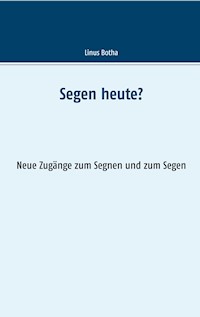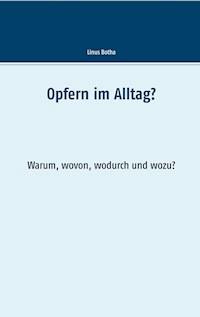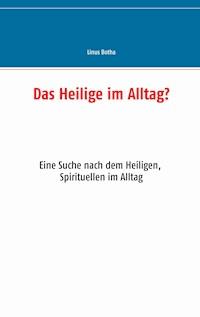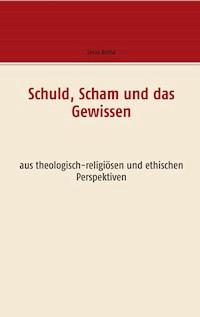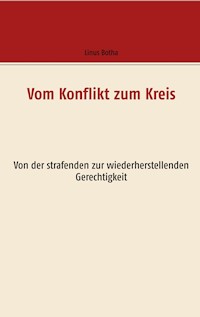
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch sollen konkrete Wege im Umgang mit Schuld, Scham, Strafe und Vergebung aufgezeigt werden. Wege - weg von einer strafenden, vergeltenden - hin zu einer wiederherstellenden, wiedergutmachenden, versöhnenden Gerechtigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1.0 Ich schäme mich!
1.2 „Reintegrative Shaming“
1.3 „Reintegrative Shaming“ & Gefängnisseelsorge
1.4 Adam und Eva
1.5 Umgang mit Scham
2.0 Restorative Justice - ein Definitionsversuch
2.1 „Restorative Justice“ - „to make things right“
2.2 „Restorative Justice“ - ein Beziehungsparadigma
2.3 „Restorative Justice“ - ein spiritueller Weg
2.4 Täter-Opfer-Mediation - ein Definitionsversuch
2.5 „Restorative Justice“ und Täter-Opfer-Ausgleich
3.0 Versöhnungskommission in Südafrika
3.1 Unsere Sprache verrät unser Denken
3.2 Strafen hat seinen Preis
3.3 Indigene Traditionen von Gerechtigkeit
3.4 Christliche Traditionen von Gerechtigkeit
3.5 „Restorative Justice“ in Norwegen
3.6 Neues Paradigma „Restorative Justice“
3.7 Das „Säulen“-Modell
4.0 Methoden des „Restorative Justice“
4.1 „Conferences“
4.2 Der Mediationsprozess
4.3 Prinzipien für Mediationsprozesse
4.4 „Gewaltfreie Kommunikation“
4.5 Dialektisch-Behaviorale-Therapie (DBT)
4.6 Das Problem „Dritte Säule“ – „Community“
4.7 Anknüpfungspunkte
5.0 Vom Konflikt zum Kreis
5.1 Der Kreis – ein Urphänomen
5.2 Der Status Quo
5.3 Ein neuer – alter Weg
5.4 Kreisverfahren im Strafvollzug
5.5. Ein Ausblick
5.6 Quellen
5.7 Schlusshinweis
Vorwort
Zu der Entstehung dieses kleinen Büchleins ist es gekommen, weil ich auf der Suche nach Alternativen im Umgang mit Gewalt, Schuld, Strafe und Gerechtigkeit bin. Aufgrund mehrerer persönlicher und familiärer Anknüpfungspunkte gehe ich seit meiner Jugend mit dem Thema Gewalt, Schuld und Gerechtigkeit, bzw.
Wiedergutmachung um. Während meines Studiums zum Diakon, im Rahmen von ethischen Vorlesungen und Diskussionen bekam ich weitere Impulse zum Themenkomplex. Ich war und bin seit längerem auf der Suche nach praktischen Modellen einer neuen Gerechtigkeit, nicht im Sinne einem allein auf Rache, Vergeltung und Bestrafung basierenden Umgang mit Schuld und Vergebung.
Auf meiner Suche bin ich auf verschiedene angewandte Modelle gestoßen, die auf dem Ansatz der wiederherstellenden, versöhnenden Gerechtigkeit basieren.
Einige dieser Modelle möchte ich im Folgenden versuchen, darstellen mit ihren Möglichkeiten und Grenzen.In der täglichen Auseinandersetzung mit Moral und Ethik in meiner Tätigkeit im Sozialen Bereich, wurde ich immer wieder durch Dialoge angeregt und begann zu Schreiben.
1.0 Ich schäme mich!
Walter Wink beschreibt eine interessante Rechtspraxis eines Naturvolk, den Negrito: Wenn jemand dort einem anderen Schaden zufügt, seine Hühner stiehlt oder das Haus des Nachbarn anzündet oder was auch immer, dann wird die Person, die das getan hat, in der Mitte eines Kreises gestellt, umringt von den Menschen, die diese Person kennen. Und sie verbringen einen ganzen Tag damit, dass jeder Einzelne aus der Gruppe dieser Person erzählt, durch welche wundervollen Dinge, die sie getan hat, sein Leben bereichert wurde. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Es geht hier um einen Verbrecher, und die erzählen ihm, was er an Schönheit in das Leben eines Mitmenschen gebracht hat. Diese Rechtspraxis hat ein Menschenbild vor Augen, das aus der Vorstellung entstanden ist, dass es unserer menschlichen Natur entspricht, dass wir, wenn wir mit uns verbunden sind, nichts lieber tun als zum Wohlergehen anderer beizutragen.Zitiert nach Marshall B. Rosenberg, Konflikte lösen durch Gewaltfreie Kommunikation. Kann ein Mensch das aushalten? Ich kann mir nur vorstellen, dass dem Deliquenten die Schamesröte ins Gesicht steigt.
„Ich schäme mich!“ – Ich habe etwas Unrechtes getan und es war irgendwie nicht (ganz) richtig. Ich habe eine Grenze überschritten – die Grenze des Normalen, der Werte. Ich habe anderen geschadet – andere weisen mir Schuld zu: Ich schäme mich! Jeder Mensch wird sich ein Gefühl vergegenwärtigen können, bei dem er am liebsten im Boden versunken wäre – Sorge und Angst, den Blicken anderer ausgesetzt zu sein. Er sieht sich in eine Situation versetzt, aus der er sich befreien möchte – untermalt durch körperliche Reaktionen (Erröten, Herzklopfen usw.).
Ich habe das Beispiel der Negrito in ein Rollenspiel für den Religions-unterricht an einer Gemeinschaftsschule im Rahmen eines Projekttages zum Thema „Antigewalt“ umgewandelt. Hier bildeten wir kleine Gruppen. Ein Gruppenmitglied setzte sich in die Mitte; die anderen sagen 10 Minuten nur Gutes über diese Person. In der Auswertung wurde deutlich, wie schwer es dem/der in der Mitte war, diese 10 Minuten auszuhalten. Es geht um Scham, die so geweckt wurde. Erstaunlich: Wir schämen uns, Gutes zu hören! Lieber Kritik - lieber das, was wir gefehlt haben! Erstaunlich: Aber im Grunde glaube ich, dass wir das Gute über uns deswegen nicht hören wollen und können, weil wir uns letztlich unserer Fehler, unseres Herkommens, unseres sozialen Status oder unserer Erfahrungen schämen - Scham der Opfer! Aber auch: Scham der Täter! Soziale Scham: Soziale Scham ist das Gefühl, das an Konfliktpunkten zwischen Individuum und Gesellschaft entsteht, also zwischen den eigenen Wünschen und den Erwartungen der Gesellschaft.
„Wenn wir uns schämen, fühlen wir uns ‚wie überfallen’ oder überrascht. Wir empfinden uns als unfähig, unzulänglich, minderwertig, hilflos, schwach, machtlos, wertlos, lächerlich, gedemütigt oder gekränkt. Die Beziehung zu Mitmenschen wird schlagartig abgebrochen; unsere Aufmerksamkeit und Wahrnehmung richtet sich stark auf uns selbst.“ S. Marks, Scham - die tabuisierte Emotion, Düsseldorf 2009, S. 37 Ich schäme mich vor Verriß, Geringschätzigkeit, Kritik, Gesten der Überlegenheit, Spott, Schuldzuweisungen, soziale Stigmatisierung. Ich habe Angst, lächerlich gemacht und bloßgestellt zu werden oder einen Korb zu erhalten – erniedrigt, gedemütigt oder verachtet zu werden. Der strafende Blick, das verächtliche Stirnrunzeln, das demütigende Wort, der spöttische Ton, das hämische Kichern - ich habe Angst vor Demütigung - “an den Pranger gestellt“ zu werden und viele Menschen ergötzen. Früher war der Pranger eine integrative Strafform: am Pranger stand man ein paar Tage, dem Spott anderer preisgegeben, aber um dann doch wieder in das Gemeinwesen eingegliedert zu werden. Das zeugt von einer hohen Integrationskraft damaliger Dörfer und Städte - heute ist da anders: der Pranger ist das Internet bzw. die Medien, die den Deliquenten vernichten wollen - alles andere als Integration! Vor allem in totalitären Machtkonstellationen, in denen die Opfer den Tätern ausgeliefert sind, kommt es zu solchen Situationen. Die Peiniger bestimmen über die Art und Dauer der Demütigungen.
Fast jeder kennt die Bilder aus Abu Ghraib. Erlebnisse, die sich bei den Opfern ins Gedächtnis einbrennen und ein Trauma auslösen.Traumatische Ereignisse sind zum einen geprägt von körperlicher Gewalt und Lebensgefahr, zum anderen sind es Ereignisse, in denen jemand existentiell seiner Daseinsberechtigung und seiner Würde beraubt wird. Insofern kann man eindeutig sagen, dass Beschämungssituationen als Folter eingesetzt werden.. Das kommt einer psychischen Vernichtung gleich und hat Trauma-Qualitäten. So etwas kann sich für den Rest des Lebens einbrennen. Das ist die Scham der Opfer, aber auch die Scham der Täter – er wird es heimzahlen durch seine Rache – durch sein Delikt. „Scham“ ist ein starkes, aber auch ein destruktives Gefühl. Ein starkes Gefühl in der Funktion als Schutz, als Zugehörigkeit oder als Integrität. In dieser Funktion sensibilisiert Scham „das soziale Individuum für die Meinungen und Empfindungen anderer und wirkt somit als eine Kraft für soziale Kohäsion.“ aus Dr. Jens Léon Tiedemann, Die intersubjektive Natur der Scham, Dissertation : Freie Universität Berlin, Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie, 2007, S. 48 Scham hilft zu einer Haltung des Respekts anderen und sich selbst gegenüber. In der deutschen Sprache gibt e zwei Bezeichnungen für Scham (‚Schande’ und ‚Scham’). Das eine bezeichnet das „Beschämt-Sein“, das andere bezeichnet eine Sensibilität für Scham, eine Art ‚Diskretion’, ‚Ehrfurcht’ oder ‚Takt’. Als starkes Gefühl ist Scham auch Schutz der Intimgrenze und hat eine identitätsfördernde Funktion. Scham schützt bestimmte Ideale und Werte und bewahrt unser Identitätskonzept, Indem sie die Diskrepanz zwischen Ist- und Sollzustand anzeigt. Aus JLTiedemann, aaO, S. 50f: „Antworten auf die Fragen ‚Wer bin ich?’ und ‚Wo gehöre ich hin?’ werden im Schmelztiegel der Scham geschmiedet.“
Scham schützt die Selbstintegrität. Scham soll verdecken und verhüllen oder aber verhüllt werden. In der Scham geht es um Grenzen. Scham schützt den Bereich, der verletzlich ist. Niemand soll diesen Bereich antasten.
Scham verletzt – Scham verhüllt die Schuld. Schamgefühle sind Schutzmechanismen für tiefer liegende Empfindungen. Die unkontrollierbaren Affekte reichen von der Peinlichkeit über den Selbstwertzweifel bis hin zum Trauma („Scham und Schuld sind die Schwestern von Trauma“ von Dami Charf).
Wer gegen das Schamgefühl angeht und die Scham verletzt, ist taktlos. Er unterdrückt und erniedrigt den anderen, indem er ihm mit Macht und Gewalt eine andere Form, eine andere Ordnung, eine andere Seinsweise aufzwängt. Scham ist eine Gefaht, aber auch eine Chance! Scham reguliert unser Verhalten zu dem anderen und unser eigenes Verhalten und hilft dem anderen, sich zu mir in eine Beziehung zu setzen. Scham motiviert, neue Konzepte auszuprobieren (kreativ).
Scham hat etwas Ernüchterndes (reißt aus unserer Traumwandelei). Scham reguliert Abstand zum Anderen und schützt uns vor entwürdigendem Verhalten und Situationen (Angst vor Scham). Scham gibt Selbsterkenntnis. Im sozialen Umfeld wirkt die Scham zweifach: exklusiv (als stigmatisierendes Beschämen) und inklusiv (als reintegrierendes Beschämen). Die folgenden Gedanken sind inspiriert von: Prof. Dr. Dieter Rössner (Institut für Kriminalwissenschaften Philipps - Universität Marburg), Täter-Opfer-Ausgleich im allgemeinen Strafrecht - Rechtsgrundlagen, Praxis und faktische Wirkung (Internet-Recherchen).
Als Stigmatisierter bleibt der Täter verurteilt; wird ihm die Rückkehr in die Gesellschaft verwehrt (Exklusion) – der Zugang zu Arbeit, Ausbildung und gesellschaftlicher Anerkennung wird wegen seiner Verurteilung eher blockiert. Dadurch wird die Attraktivität delinquenter Subkulturen sowie eine Rückfallgefährdung erhöht. Stigmata sind u.a. Geistesverwirrung, Gefängnishaft, Sucht, Homosexualität, Arbeitslosigkeit oder Suizidversuche. Aus Erving Goffman, Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität, Frankfurt/Main 1970, S.10ff.
Inklusiv oder integrativ regelt Scham als Hüterin der Werte und als Hüterin sozialer Prozesse Nähe und Distanz, Grenzziehungen, Verantwortung, Schuldempfinden und Versöhnung. „Antworten auf die Fragen ‚ Wer bin ich?’ und ‚Wo gehöre ich hin?’ werden im Schmelztiegel der Scham geschmiedet.“ (J.L. Tiedemann) „Scham ist die Hüterin der menschlichen Würde“ (Leon Wurmser). Wie kann ich mir und meinem Gegenübder helfend zur Seite stehen, mit der Frage: Wie lernen wir, uns selbst als wertvollen Menschen zu sehen, wir, die wir für das Zusammenleben in der Gemeinschaft einen wichtigen Beitrag leisten können? Wie äußert sich Scham? Und worin liegt der Unterschied zwischen ganz normalen, konstruktiven und übertriebenen, destruktiven Schamgefühlen? Warum bekommen tief beschämte Menschen ihr Leben nicht in den Griff, solange sie nicht verstanden haben, was Scham eigentlich ist und wie sie sich auswirkt.
Anhand von vier kleinen Beispielen will ich unterschiedliche Dimensionen der Scham aus Alltagssituationen vorstellen, mit möglichen Reaktionen. Die ganze Persönlichkeit ist betroffen Ein zweijähriges Kind erkundet die Welt. Im Garten ent deckt es ein schönes Plätzchen, wo es glücklich im weichen Sand spielt. Es ist stolz auf seine Leistung. »Schau her«, scheint es sagen zu wollen, „seht mal, was ich schon alles kann! Ich bin gut.“ Da schreit die Mutter: „Schau dich bloß mal an! Wie siehst du nur aus! Alles dreckig und deine Kleider sind hin! Du hast mich sehr enttäuscht, du solltest dich schämen!“ Sofort fühlt sich das Kind klein und häßlich. Es läßt den Kopf sinken und starrt zu Boden. Es sieht die schmutzigen Hände und Kleider und beginnt sich auch innerlich unrein zu fühlen. „Irgend etwas an mir muss sehr schlecht sein“, denkt es, „so schlecht, daß ich nie wirklich sauber sein werde.“ Das Kind bekommt die Verachtung der Mutter zu spüren und fühlt sich unzulänglich.
Ein sechzehnjähriges Mädchen hat seit kurzem einen Freund. Er scheint sehr rücksichtsvoll zu sein;niemalsversucht er, sie zu etwas zunötigen, das sie nicht mag. So wächst von Tag zu Tag ihr Vertrauen zu ihm. In der Schule schicken sie sich kleine romantische Botschaften zu. Dar in nennt er sie liebevoll „Sexy Girl“. Eines Tages, als sie in der Schule an einem Kameraden ihres Freundes vorübergeht, ruft dieser ihr zu: „Hey, Sexy Girl, wie geht’s denn?“ Schlagartig geht ihr auf, daß ihr Freund die Briefchen offenbar auch anderen gezeigt hat, und sofort fühlt sie sich gedemütigt. Ihr Gesicht glüht vor Verlegenheit, und sie würde am liebsten fortrennen. Sie hat das Gefühl, jeder könne in sie hinein - und durch sie hindurchsehen. Als ihr Freund später anruft, um sich zu entschuldigen, ist sie bereits wütend. »Verschwinde!« schreit sie ihn an. „Das kann ich dir nie verzeihen. Ich werde nie mehr mit dir sprechen!“
Ein Mann in mittlerem Alter hat in einer kleinen Firma einen sicheren Arbeitsplatz. Die Aussichten für sein berufliches Fortkommen scheinen sehr gut zu sein, und seine Vorgesetzten schreiben ständig hervorragende Beurteilungen. Er weiß, daß er auch unter seinen Kollegen einen guten Ruf hat. Eines Tages hat dieser Mann einen kleinen Fehler gemacht, worauf sein Chef ihn kritisiert. Vielleicht ist er zu einer Sitzung zu spät erschienen, vielleicht hat er vergessen, einer Sendung die Rechnung beizulegen. Jedenfalls ist kein nennenswerter Schaden entstanden. Der Vorgesetzte weist den Mann lediglich auf das Problem hin, ohne aggressiv zu werden. Trotzdem fühlt sich der Mann völlig am Boden zerstört. Er „weiß“, daß etwas Grundlegendes bei ihm nicht in Ordnung ist. Er glaubt, nunmehr sei er als Betrüger bloßgestellt, und ist sich sicher, die anderen würden denken, er sollte hier nicht länger arbeiten. Er ist nicht perfekt - also muß er wertlos sein. Er verbringt Stunden damit, sich an jeden einzelnen Fehler zu erinnern, den er je an seinen verschiedenen Arbeitsplätzen gemacht hat, und fühlt sich dabei nur noch schlechter. Er zieht sich in sein Büro zurück, schließt die Tür und versteckt sich dort für den Rest des Tages. Er weiß, daß er nie gut genug sein wird.
Ein älterer Mann verbringt die meiste Zeit damit, alle anderen zu kritisieren: Seine Frau ist dumm, sein Sohn faul, seine Tochter albern; seine Freunde sind ungehobelt, die Welt ist schlecht. Er zögert nicht, die anderen wissen zulassen, daß er selbst tüchtiger, vernünftiger und überhaupt besser sei als sie. Deutlich gibt er seine Überlegenheit kund und erwartet, daß man ihn respektiert. Vielleicht nehmen ihm einige Menschen dieses Image ab; andere hingegen merken, daß dieser Mann nur eine Maske trägt. Sie können seine großtuerische und arrogante Haltung durchschauen und erkennen, daß er innerlich unsicher und alles andere als vollkommen ist. Ihnen entgeht nicht, daß der Mann zwar versucht, die Welt davon zu überzeugen, daß er besser sei als die anderen, daß er sich in Wirklichkeit aber unterlegen fühlt. Mit einem solchen Menschen zusammenzuleben ist allerdings recht schwierig, empfindet er doch für seine Mitmenschen nichts als Verachtung. Und diese ziehen sich deshalb, anstatt den Mann zu achten oder gar zu verehren, von ihm zurück, gehen ihm aus dem Weg und hüten sich, ihm irgendetwas über sich selbst mitzuteilen.