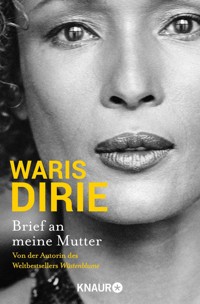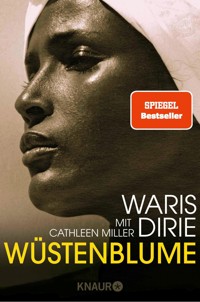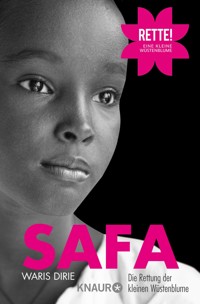9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Waris Dirie wurde in der afrikanischen Wüste geboren – und sie ist ihr Leben lang eine Nomadin geblieben. Ihre Arbeit als Topmodel und ihr Engagement für Menschenrechte machten sie in der ganzen Welt berühmt, doch sie ist eine Getriebene, die zwischen den Kulturen steht. Ihr neues Buch handelt von ihrem Doppelleben in ihrer neuen »weißen Heimat« – wo sie einerseits gefeiert wird, andererseits aber eine Fremde ist, die im Alltag allein wegen ihrer Hautfarbe von Taxifahrern abgewiesen und von Männern als Freiwild betrachtet wird. Als ihr Sohn Leon auf die Welt kommt, wird Waris Dirie ihre Zerrissenheit und Heimatlosigkeit schmerzlich bewusst. Und sie beschließt, ihrem Kind das zu geben, was sie selbst schon lange nicht mehr kennt: eine wirkliche Heimat. Schwarze Frau, weißes Land von Waris Dirie: im eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Waris Diri
Schwarze Frau, weißes Land
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Ich widme dieses Buch [...]
Die Arbeit, die man [...]
Prolog
Die kleinen Sterne leuchten [...]
1 Einmal Nomadin, immer Nomadin
Der Leopard leckt alle [...]
2 Schwarze Frau, weißes Land
Wende dein Gesicht der [...]
3 Liebe und Respekt
Schöne Dinge wachsen inmitten [...]
4 Wüstenblume – der Film
Glück widerfährt dir nicht, [...]
5 Dschibuti – zurück in Ostafrika
Die Schildkröte sagt: Arbeit, [...]
6 Ein Kontinent ohne Zukunft?
Eine Wunde, die ein [...]
7 Trügerische Träume
Es gibt vierzig Arten [...]
8 Piraten und Politiker
Nur im Vorwärtsgehen gelangt [...]
9 Zerrissen zwischen zwei Welten
Siehst du Unrecht und [...]
10 Das Schicksal der Frauen Afrikas
Armut ist wie ein [...]
11 Armut im Paradies
Wenn du nicht gewinnen [...]
12 Ein Sommer in Polen
Es ist besser, mit [...]
13 Berlin
Sorge ist wie ein [...]
14 Veruschka
Jedes Kind ist ein [...]
15 Schwanger
Ehre dein Kind, und [...]
16 Leons Geburt und neue Pläne
»Werde unabhängig!«, ist keine [...]
17 Mama Africa
Ein Boot kommt nicht [...]
18 Venedig – Start in ein neues Leben
Zwar hat der Mensch [...]
Epilog
Anhang
Meine Forderungen für die Zukunft Afrikas:
Bitte unterstützen Sie mich [...]
Bildteil
Ich widme dieses Buch den Frauen Afrikas
Die Arbeit, die man sich selbst vorgenommen hat, ist nie unmöglich.
Aus Kenia
Prolog
Der Traum der Wüstenblume
Leon, ich werde dich nie verlassen.«
Zärtlich betrachte ich meinen kleinen Sohn, während ich ihm diesen Satz ins Ohr flüstere. Leon liegt mit geschlossenen Augen friedlich auf meinem Bauch und schmiegt sich an mich. Ich genieße den Moment der Ruhe und Stille, und die Hängematte, in der wir beide liegen, schaukelt ihn sanft in den Schlaf.
Nach einer Weile drehe ich den Kopf und blicke über den Rand der Hängematte, die ich auf der Terrasse meiner kleinen Lodge aufgehängt habe. Ich kann es kaum fassen, dass dies hier unser neues Zuhause ist. Die ehemals alte, heruntergekommene Farm, die seit Jahren leer stand, liegt etwas abseits von einem Dorf an einer kleinen Straße. In Eigenregie haben meine Brüder und ich mit unseren Helfern das halb abgedeckte Dach erneuert und die von Pflanzen überwucherte, baufällige Ruine Stück für Stück renoviert und instand gesetzt, bis das Haus bewohnbar war.
Hinter der Terrasse erstreckt sich die wunderschöne Natur Tansanias. Alles ist grün, die Pflanzen stehen in voller Blüte, und an dem ovalen See am Ende des großen Grundstücks nisten zahlreiche Wasservögel. Tief atme ich den Duft der Rosen ein, die ich selbst gepflanzt habe und die nun langsam am Geländer der Veranda emporranken. Ich beobachte einige Ziegen, die im Garten herumlaufen und grasen, und halte Ausschau nach meiner Mutter, die ganz in der Nähe sein muss. Auf der anderen Seite der Lodge sind meine beiden Brüder gerade dabei, einen neuen Holzzaun aufzustellen. Ich höre sie reden und lachen.
Als ich die heruntergekommene Farm zum ersten Mal sah, wusste ich sofort, dass dies hier der Ort war, an dem ich meinen großen Traum verwirklichen könnte. Ich war mit dem Vorhaben hierher nach Ostafrika gekommen, für die Frauen aus der Region Arbeitsplätze zu schaffen. Sie sollten nicht nur fair bezahlt werden, sondern auch etwas über Landwirtschaft und die Führung einer kleinen Farm lernen. Wertvolles Wissen, das ihnen einen Weg in eine neue, unabhängige Zukunft weisen sollte.
Ich versuche, mich so wenig wie möglich zu bewegen, um Leon nicht aufzuwecken, und schaue in die andere Richtung. Der Ausblick von meinem Platz ist einfach unglaublich. In der Ferne zeichnen sich die Umrisse des gewaltigen Kilimandscharo, des höchsten Bergmassivs Afrikas, mit seiner schneebedeckten Spitze vor dem Horizont ab. Der Himmel ist strahlend blau, trotzdem ist die Lufttemperatur selbst jetzt, am späten Nachmittag, noch immer sehr erträglich. Es weht ein leichter Wind, der ein angenehmes Gefühl auf der Haut hinterlässt.
Leon bewegt sich, und ich merke, wie sehr mich dieser Moment mit meinem schlafenden Baby auf dem Bauch erfüllt. Hier, in meiner Hängematte, mit meinem kleinen Leon, mit meiner ganzen Familie in meiner Nähe, bin ich endlich am Ziel angekommen.
Dann höre ich ein Geräusch, und als ich aufblicke, entdecke ich durch die geöffnete Tür meinen älteren Sohn Aleeke, der am Küchentisch sitzt und seine Hausaufgaben macht. Er ist sehr gut in der Schule, hat schon viele Freunde gefunden und fühlt sich, genau wie ich, sehr wohl hier in Tansania, diesem im Gegensatz zu meiner Heimat Somalia friedlichen Land.
Es ist der perfekte Moment. Endlich habe ich mein Zuhause gefunden. Ich kann afrikanischen Frauen dabei helfen, ihre eigene Zukunft und damit die ihres Kontinents zu verbessern. Meine ganze Familie, die ich schon verloren geglaubt hatte, habe ich hier vereint. Meine Eltern, alle meine Geschwister, meine Söhne. Alle Menschen, die ich liebe, leben nun hier mit mir, inmitten der wunderschönen Natur Ostafrikas.
Noch ist es nur ein Traum …
Die kleinen Sterne leuchten immer, während die große Sonne untergeht.
Aus dem Senegal
1Einmal Nomadin, immer Nomadin
Ich hatte Wien, das schon beinahe zu meiner neuen Heimat geworden war, nach langen Überlegungen im Jahr 2006 verlassen, um nach Südafrika zu ziehen. Ich wollte so gerne zurück nach Afrika und hatte gehofft, in Kapstadt eine neue Heimat finden zu können. Allerdings war dieses Vorhaben nicht ganz so verlaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich ärgerte mich zwar häufig über die Bürokratie und die pingeligen Behörden in Europa und behauptete gerne, in Afrika sehe man das alles entspannter, aber bei meiner Einreise nach Südafrika erfuhr ich das Gegenteil. Hier hatte ich nicht nur mit Bürokraten, sondern zusätzlich auch noch mit der überall herrschenden Korruption zu kämpfen.
So ist das nun mal: Wenn man in Afrika etwas will, und zwar egal was, dann muss man irgendjemanden bestechen.
Als ich vor Jahren zum ersten Mal nach Somalia zurückkehrte, um mich auf die Suche nach meiner Mutter zu machen, wurde mir dies mit aller Deutlichkeit bewusst. Von dem Moment an, als ich aus dem Flugzeug stieg, musste ich Menschen schmieren und bestechen, egal ob ich Informationen brauchte oder einfach nur unversehrt den Flughafen verlassen wollte. Ich reiste damals mit meinem Bruder Mohammed nach Somalia. Die Maschine, mit der wir nach Mogadischu flogen, hatte die Bezeichnung Flugzeug eigentlich gar nicht verdient, denn wir teilten uns den Laderaum mit Ziegen und Schafen. Am Flughafen in Somalia stand dann plötzlich ein großer Mann mit einem Maschinengewehr vor uns.
»Wir müssen ihm Geld geben«, flüsterte mein Bruder.
Ich sah mich um. Überall standen Bewaffnete herum und verbreiteten mit ihren großen Gewehren Angst und Schrecken unter den ankommenden Passagieren. Zwar trugen sie die Phantasieuniform irgendeiner Rebellengruppe, sahen aber aus, als würden sie ihre »Aufgabe« durchaus ernst nehmen.
»Geld? Wofür denn? Ist der Typ vielleicht die Einreisebehörde?«, fragte ich trotzig.
»Sie werden uns die Pässe wegnehmen«, prophezeite mein Bruder besorgt.
»Das wollen wir doch mal sehen«, sagte ich kampflustig und wandte mich an den Hünen vor uns. »Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht ein Taxi besorgen?«
Daraufhin packte mich der Mann unsanft am Arm und zerrte mich in das Flughafengebäude, während ein anderer sich meinen Bruder schnappte. Gemeinsam brachten sie uns in einen winzigen Raum, in dem noch mehr Bewaffnete herumsaßen. Am Ende zahlten wir dann.
So ist das in Afrika, und es sieht nicht danach aus, als würde sich in absehbarer Zeit etwas daran ändern. Bis heute können Familien ihre Kinder nicht zur Schule schicken, da sie nur dann einen »freien Platz« bekommen, wenn sie Schmiergeld an den Verantwortlichen zahlen. Ladenbesitzer müssen einen Teil ihrer Einnahmen an völlig sinnlose, eigens dafür geschaffene Institutionen abgeben, damit sie ihr Geschäft führen dürfen. Wer jemals mit guten Absichten versucht hat, in Afrika ein noch so kleines Projekt anzustoßen, wird festgestellt haben, dass er einen guten Teil des Budgets für Schmiergeldzahlungen einplanen muss, vielleicht sogar mehr als für das eigentliche Vorhaben.
In Afrika ist alles möglich, aber nur, solange dafür Geld fließt. In einem Land wie Somalia, in dem es nicht mal mehr einen funktionierenden Staat gibt, braucht man keine Uniform, sondern lediglich eine furchterregend aussehende Waffe nach Wahl, um Autorität auszustrahlen.
In Ländern wie Südafrika hat der höhere Entwicklungsstandard des Landes eine schöne Mischung aus westlicher Uniformverliebtheit und afrikanischer Korruption hervorgebracht. Ergänzt wird das Ganze durch eine unglaublich hohe Kriminalitätsrate. Als ich nach Südafrika zog, konnte ich all diese Phänomene hautnah erleben.
Bei meiner Ankunft stand ich mit meiner PR-Managerin und Freundin Joanna in der Schlange der Zollstelle. Sie kam problemlos durch die Kontrolle, dann war ich an der Reihe und reichte der Frau am Schalter meinen Reisepass.
»Bitte warten Sie hier auf der Seite, Frau … Dirie«, sagte sie.
»Meine Freundin ist schon durch«, erwiderte ich und hielt nach Joanna Ausschau.
»Bitte warten Sie hier«, wiederholte die Frau nur.
Also stand ich eine Weile neben dem Schalter herum und wartete, bis eine Frau in Uniform auf mich zukam.
»Bitte folgen Sie mir«, sagte sie nur ohne ein weiteres Wort.
Ich ging mit ihr in einen kahlen, ungemütlichen Flughafenraum, wo sie auf einen Stuhl an einem kleinen Tisch deutete. Nachdem ich Platz genommen hatte, setzte sie sich mir gegenüber und blätterte eine Weile schweigend in meinem Reisepass. Dann schloss sie das Dokument, legte es vor sich auf den Tisch, stützte ihre Hände darauf und sah mich an. »Warum sind Sie hier, Frau Dirie?«, fragte sie gedehnt.
»Weil ich hier sein möchte«, erwiderte ich und war etwas erstaunt. Was für eine Frage war das denn?
»Ja, aber aus welchem Grund? Arbeiten Sie hier? Machen Sie Urlaub? Was ist der Grund Ihres Aufenthalts?«
»Ich bin nur zum Vergnügen hier«, antwortete ich. »Ich bin hier, um meinen Kontinent zu besuchen. Immerhin bin ich Afrikanerin.«
Die Frau zog eine Augenbraue hoch. »Es interessiert mich nicht, wo Sie herkommen«, sagte sie schroff. »Wie ist Ihre Adresse hier in Südafrika? Wo werden Sie wohnen?«
»Das weiß ich nicht auswendig, meine Freundin hat die Unterlagen«, entgegnete ich und wurde allmählich nervös. Ich blickte mich in dem winzigen Raum um, in dem nicht mal ein Bild an der Wand hing, und versuchte ruhig zu bleiben.
Die Frau schickte jemanden los, um Joanna zu suchen. Seit sieben Jahren begleitete sie mich jetzt schon auf meinen Reisen und zu meinen zahlreichen Terminen und war seit langem nicht mehr bloß PR-Managerin, sondern auch unverzichtbare Freundin für mich.
Als die Beamtin mit der Adresse zurückkam, stand die Frau auf und verschwand mitsamt dem Zettel und meinem Reisepass, ohne ein Wort zu mir zu sagen. Ich blieb in dem Zimmer sitzen, und meine Nervosität wich einer unbändigen Wut, denn ich wusste genau, was jetzt kommen würde.
»Sie können einreisen, allerdings wird wegen der besonderen Umstände eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von …«, setzte die Frau an, nachdem sie zurückgekehrt war.
Ich musste zahlen, um in meinen eigenen Heimatkontinent einreisen zu dürfen. So wurde ich also in Afrika begrüßt.
Als international tätiges Topmodel habe ich in den letzten Jahren sehr viel Zeit auf Flughäfen verbracht, und ich muss zugeben, in einer Schlange zu stehen gehört nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Schlimmer noch als Warten finde ich allerdings völlig sinnloses und willkürliches Warten, das nur dazu dient, den normalen, einfachen Passagieren sein kleines bisschen Autorität unter die Nase zu reiben.
Flughäfen zählten nun mal zu den Orten, an denen ich schon häufiger schlimme Erfahrungen mit missbrauchter Autorität hatte machen müssen. Einmal – ich war auf dem Weg aus den USA nach England, hatte bereits eingecheckt und war sogar schon durch die Sicherheitskontrolle gegangen – schlenderte ich durch den Duty-free-Bereich. Da sprach mich unvermittelt eine uniformierte Frau von hinten an.
»Ma’am, kommen Sie bitte mit mir«, sagte sie und wollte mich in ihre Richtung dirigieren.
»Gibt es ein Problem?«, fragte ich und bewegte mich keinen Zentimeter von der Stelle.
»Nein, es geht um eine Sicherheitsmaßnahme. Kommen Sie jetzt bitte mit.«
»Ich werde ganz bestimmt nicht mit Ihnen kommen«, entgegnete ich schon etwas lauter. »Ich bin bereits durch die Sicherheitskontrolle gegangen und muss meinen Flug erwischen.«
»Lady«, sagte die Frau und sah mich eindringlich an. »Kommen Sie bitte sofort mit mir, oder Sie können Ihren Flug komplett vergessen.«
Ich hatte keine Chance, denn sie war diejenige von uns beiden, die in einer Uniform steckte, und so folgte ich ihr zähneknirschend. Sie brachte mich in einen kleinen Raum ohne Fenster, in dem ein Tisch und zwei Stühle standen, nahm mir meinen Boarding Pass ab und ließ mich erst mal eine Weile warten.
Nach einer halben Ewigkeit kam sie zurück und forderte mich im Kommandoton auf, mich auszuziehen. »Ich muss Sie nach Drogen absuchen«, erklärte sie mir.
»Ich bitte Sie«, flehte ich fast schon. »Ich habe nichts bei mir, ich möchte einfach nur meinen Flug bekommen.«
Die Frau trat ganz dicht an mich heran, so dass ich den Schweiß unter ihren Armen deutlich riechen konnte. »Ma’am, machen Sie es sich nicht unnötig schwer. Ziehen Sie sich aus.«
Also zog ich mich aus.
»Und jetzt vorbeugen.« Sie begann sich Plastikhandschuhe anzuziehen. »Ich muss deine Pussy und deinen Hintern inspizieren.«
Ich stand nur regungslos da, starr vor Wut und Hilflosigkeit, und sah sie an. Sie war eine schwarze Frau, genau wie ich, wahrscheinlich sogar in meinem Alter. Das Einzige, was uns beide unterschied, war die Tatsache, dass ich nackt war und sie eine Uniform trug. Dabei war sie darunter genauso nackt wie ich. Ich richtete mich langsam auf.
»Sie werden mich nicht anfassen, Lady«, sagte ich dann. »Ihr Finger geht hier nirgends hin, schon gar nicht in die Nähe irgendeiner meiner Körperöffnungen. In mir ist nichts, das Sie zu interessieren hätte. Sie werden mir Ihren Finger ganz sicher nicht in den Hintern stecken, das garantiere ich Ihnen.« Damit begann ich mich wieder anzuziehen.
Die Frau sah mir schweigend zu. Dann verließ sie den Raum und kam kurz danach mit einem männlichen Polizisten zurück.
Er machte einen unerwartet freundlichen Eindruck. »Kann ich bitte Ihre Papiere sehen?«, fragte er.
»Die hat sie«, sagte ich und deutete auf die Polizistin.
Der Polizist ließ sich meinen Ausweis aushändigen, warf einen kurzen Blick hinein und gab ihn mir zusammen mit dem Boarding Pass zurück. Dann durfte ich gehen.
Uniformen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Uniformen, egal welcher Art, haben einen seltsamen Effekt auf die Menschen, die sie tragen. Egal wie irrelevant die Autorität ist, die eine Uniform ihrem Träger verleiht, sie scheint ihn zu verändern und sofort dazu zu verführen, diese Autorität zu missbrauchen. Man muss dazu nicht mal eine Polizeiuniform tragen, die eines simplen Flugbegleiters oder Fahrkartenkontrolleurs ist für diesen Effekt offenbar schon ausreichend.
Autorität verführt Menschen regelrecht dazu, sie zu missbrauchen. Man stecke eine ganz normale Person in eine Uniform, und schon macht dieses Kleidungsstück einen anderen Menschen aus ihr. Beim Stanford-Prison-Experiment hat eine Gruppe von Psychologen genau das mit jungen Männern gemacht. Nach dem Zufallsprinzip wurden die Teilnehmer an der Studie in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Hälfte bekam Uniformen, denn sie waren nun Gefängniswärter und hatten für Ruhe und Ordnung unter den »Gefangenen«, der anderen Hälfte der Gruppe, zu sorgen. Innerhalb weniger Tage eskalierte die Situation, und es kam zu gewalttätigen Ausschreitungen seitens der Wärter. Sobald Menschen in Uniformen stecken und eine imaginäre Sonderstellung gegenüber allen nicht Uniformierten verspüren, beginnen sie, diese auszunutzen.
Ich könnte unzählige Geschichten von Menschen erzählen, die ihre Autorität missbrauchten. Als ich mal an einem deutschen Flughafen auf meinen Flug in die USA wartete, sprachen mich zwei Polizisten an, ein Mann und eine Frau. Sie hatten mich wohl beobachtet, während ich auf den großen Informationstafeln nach meinem Flug suchte, und nun kamen sie langsam, die Hände am Gürtel, in der ganzen Pracht zweier Uniformträger auf mich zu.
Der Mann fragte mich, wohin ich reisen würde, und setzte noch schnell hinterher: »Sprechen Sie Deutsch?«
»Nein«, erwiderte ich auf Englisch.
»Wohin reisen Sie?«, wiederholte er. Er hatte sich inzwischen angepasst und redete ebenfalls englisch.
»In die USA«, gab ich widerwillig Auskunft.
»Könnte ich bitte mal Ihre Papiere sehen?«, fragte er dann.
Wortlos reichte ich dem Mann meinen Reisepass, der das Dokument erstaunt musterte. »Sie sind Österreicherin?«, fragte er dann und zog die Augenbrauen hoch. »Und Sie sprechen kein Deutsch?«
Wieder mal musste ich mitgehen, in einen weiteren kleinen fensterlosen Raum auf einem weiteren Flughafen, und wieder saß ich dort allein herum und wartete. Nach einer Weile kam der Mann zurück.
»Wie heißen Sie?«, fragte er.
Wollte der Mann sich über mich lustig machen? Er hatte doch gerade meinen Pass mitgenommen. »Waris Dirie«, antwortete ich, ohne eine Miene zu verziehen.
Plötzlich lachte er mich freundlich an. »Sie sind es wirklich, meine Frau hat erst kürzlich Ihr Buch gelesen. Bitte entschuldigen Sie, hier ist Ihr Pass.«
Ich stand einfach auf und ging, denn ich hatte nicht die geringste Lust, mich mit diesem Mann zu unterhalten, immerhin hätte ich wegen dieser unschönen Angelegenheit fast meinen Flug verpasst. Auf dem Weg zum Gate konnte ich nicht anders, als mir vorzustellen, wie lange ich wohl dort gesessen hätte, wenn ich einfach nur irgendeine schwarze Frau ohne einen bekannten Namen gewesen wäre oder wenn die Frau des Polizisten nicht zufällig mein Buch gelesen hätte.
Gib einem Menschen auch nur ein kleines bisschen Macht, und er wird sie missbrauchen. Das Beängstigende ist, dass so gut wie jeder irgendwann beginnt, sich so zu verhalten, wenn er nur lange genug eine Uniform trägt. In die Schule zu gehen und zu studieren macht Menschen vielleicht gebildeter, aber es macht sie nicht zu besseren Menschen. Es hält sie auch nicht davon ab, ihre Macht zu missbrauchen.
Was in Europa und den USA die Uniformen sind, das sind in Afrika die Waffen. Wer bewaffnet ist, kann tun, was er will. In Europa mag man einem Zollbeamten oder einem Polizisten ausgeliefert sein, in Afrika ist man nicht nur der »Staatsgewalt« ausgeliefert, sondern obendrein auch noch jedem, der sich ihr widersetzt.
Die hohe Kriminalitätsrate in Südafrika war mir vor meinem Umzug dorthin durchaus bekannt, und leider machte ich schon bald die Erfahrung, dass sie aus gutem Grund so hoch war.
In Südafrika angekommen, ging ich sofort zusammen mit Joanna auf die Suche nach einer geeigneten Bleibe. Eine Immobilienagentur führte mir mehrere Häuser vor, von denen manche am Meer lagen, einige andere in den Weinbergen bei Stellenbosch. So viel Armut es in Südafrika gab, so viel Luxus gab es auch, und ich war immer wieder perplex bei dem Anblick der weitläufigen Anwesen reicher Südafrikaner, aber auch vieler Europäer und Amerikaner, die das Klima und die wunderschöne Landschaft des südlichsten Landes auf dem afrikanischen Kontinent schätzten. Kein Wunder, dass dieser Luxus die ärmere Bevölkerung zu kriminellen Übergriffen verführte.
Trotz intensiver Suche war mein Traumanwesen lange nicht unter den Objekten, die mir die eifrigen Vermittler präsentierten, bis mir eines Tages ein etwas ungewöhnliches Angebot ins Hotel flatterte: Der Geschäftsführer der Immobilienagentur hatte sich scheiden lassen und wollte nun sein eigenes Haus verkaufen, das er für sich und seine kleine Familie in der Nähe von Kapstadt gebaut hatte. Das Gebäude, das auf einem Hügel mit freiem Blick auf den Atlantischen Ozean lag, und die Atmosphäre gefielen mir auf Anhieb. In weniger als zehn Minuten war man von hier aus am Meer, und auf der Rückseite des Hauses begann das größte Vogelschutzgebiet Südafrikas. Am Meer gab es eine bekannte Seelöwenkolonie, weshalb man auch regelmäßig einen weißen Hai zu sehen bekam, der von ihr angezogen wurde.
Als ich das Objekt besichtigte, zögerte ich nicht lange und sagte sofort zu. Da das Haus vor meinem Einzug komplett renoviert werden musste, nahm ich mir in Kapstadt erst mal eine kleine Wohnung, in der ich die Zeit bis zur Fertigstellung verbringen wollte.
Eines Abends holte mich ein südafrikanischer Freund, John, zum Essen ab. Nach einem romantischen Dinner lud er mich noch ein, mit ihm in einen Club zu gehen. Wir tanzten den ganzen Abend, und ich amüsierte mich prächtig.
Plötzlich unterbrach der DJ die Musik und ergriff das Mikrofon. »Leute, hört mal her«, rief er, »wir haben heute einen echten Star bei uns zu Gast! Waris Dirie, Afrikas berühmte Bestsellerautorin, Supermodel und Bond Girl! Applaus! Applaus!«
Ich war völlig überrascht, als die Leute mir zujubelten, und winkte freundlich zurück. Wir blieben noch eine Weile und tanzten, und John begleitete mich anschließend bis vor meine Wohnungstür. Als ich die Haustür aufsperrte, bemerkte ich aus dem Augenwinkel, dass uns zwei junge Männer gefolgt waren. Ich war etwas besorgt, aber die beiden drehten schließlich ab und verschwanden, daher machte ich mir nicht weiter Gedanken über den Vorfall.
Am nächsten Morgen setzte ich mich in meinem kleinen Apartment im Wohnzimmer auf den Fußboden und hörte Bob Marley, während ich mit meinem Manager Walter telefonierte. Meine kleine Wohnung war recht schlicht, aber dennoch sehr schön und hatte sogar einen kleinen Balkon.
Als es an der Tür klopfte, lief ich mit dem Telefon am Ohr zur Tür und öffnete, ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken. Im nächsten Moment hielt mir jemand eine Pumpgun ins Gesicht, und die zwei jungen Männer vom Vorabend stießen mich rückwärts in meine Wohnung. Während der eine mir die Waffe an den Kopf hielt, rannte der andere gleich weiter ins Wohnzimmer. Ich stand nur reglos da, das Telefon immer noch in der Hand, und war wie in Schockstarre.
»Ist sonst noch irgendjemand in der Wohnung?«, fuhr einer der Männer mich an.
»Nein.« Ich war auf einmal völlig ruhig. Langsam ließ ich die Hand mit dem Telefon sinken und versuchte das Gerät hinter meinem Rücken zu verbergen. Komischerweise geriet ich überhaupt nicht in Panik, aus irgendeinem Grund blieb ich völlig ruhig. Ich hatte nicht einmal Angst, vermutlich weil alles so unecht und surreal auf mich wirkte.
»Hi«, sagte ich zu den Männern, die Kapuzenpullis trugen, ohne aber ihre Gesichter zu vermummen. Sie waren beide schwarz und ziemlich jung, dennoch war der eine eindeutig der Anführer, da er seinen Kameraden ständig herumkommandierte. Der Zweite schien vor allem auf der Jagd nach Geld für die Drogen zu sein, die er augenscheinlich nahm.
»Bring sie hier raus!«, bellte der Anführer auf einmal.
Der andere brachte mich daraufhin tatsächlich ins Schlafzimmer und drückte mich aufs Bett, während ich immer noch versuchte, das Telefon zu verstecken, diesmal unter meinem Hintern. Der Anführer hatte in der Zwischenzeit bereits das halbe Apartment verwüstet. Er ging mit einem unglaublichen Tempo vor, und die Sachen flogen nur so durch die Wohnung.
»Ganz ruhig«, sagte ich.
»Halt den Mund, du Schlampe!«, erwiderte mein Bewacher.
»Nehmt ruhig alles, was ihr wollt, nur bitte nicht meine Musik.«
Daraufhin betrachtete er meine Stereoanlage und warf sie achtlos um. Sein Komplize sah die ganze Zeit nur zu.
Plötzlich klingelte das Telefon unter meinem Hintern, und ich fuhr entsetzt herum. Offenbar hatte ich es aus Versehen ausgeschaltet. Mein Bewacher sprang hektisch auf, wobei er mich unsanft zur Seite stieß, nahm das Telefon und pfefferte es einfach in eine Ecke. Dann setzte er sich wieder hin und starrte seinen Boss an, der immer noch dabei war, meine Wohnung in ihre Einzelteile zu zerlegen. Inzwischen hatte er jedoch anscheinend etwas gefunden. Es war meine Kreditkarte.
»Wie ist deine Geheimzahl?«, fragte er mich.
Ohne zu zögern nannte ich ihm einfach irgendeine Zahlenkombination.
»Bist du sicher?«, vergewisserte er sich.
»Ja, ja, meinst du etwa, ich bin so blöd, dich anzulügen? Ich kann gerne mit dir zum Geldautomat gehen, wenn du willst, er ist gleich hier um die Ecke.«
Der Mann beäugte mich misstrauisch, und ich konnte ihn fast nachdenken sehen. Alles hätte in diesem Moment passieren können, die Einbrecher hätten mich vergewaltigen oder umbringen können, oder beides. Aber es war Freitag, und Freitage haben etwas Magisches. Ich war mir sicher, dass mir nichts geschehen würde, und so verhielt ich mich auch. Die beiden Kleinkriminellen brachte das offensichtlich ganz schön aus dem Konzept.
Der Anführer sprang auf. »Wenn die Geheimzahl nicht stimmt, rufe ich dich an, und du legst sie um«, sagte er zu seinem Komplizen und rannte aus der Wohnung.
Da saß ich nun mit diesem dummen Kerl, der anscheinend überhaupt nicht wusste, was er gerade tat. Nach ein paar Minuten sagte ich beiläufig zu ihm. »Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dein Kollege zurückkommt, um das Geld mit dir zu teilen, oder?«
Daraufhin sprang er auf und rannte einfach aus meiner Wohnung. Ich verharrte noch einen Moment völlig still, bis ich mir sicher war, dass er tatsächlich weggelaufen war, dann rannte ich in den Hausflur und schrie um Hilfe.
Die Zeit, bis die Polizei endlich eintraf, kam mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Den ganzen Überfall über war ich völlig ruhig geblieben, dafür traf es mich jetzt wie ein Schlag, als mir klarwurde, in welcher Gefahr ich geschwebt hatte, und auf einmal fing ich am ganzen Körper an zu zittern. Endlich hörte ich die Polizeisirenen, und Sekunden später sah ich vom Fenster aus bestimmt zehn Polizeiautos vor meinem Haus anhalten. Die Polizisten verteilten sich auf die verschiedenen Straßen, während einige weitere Uniformierte zu mir in die Wohnung kamen. Sie trugen Helme, schusssichere Westen und waren schwer bewaffnet.
»Können Sie die Einbrecher beschreiben?«, fragte einer der Beamten, während sich seine Kollegen eine Weile in meiner Wohnung umsahen.
Ich nickte und schilderte ihm, was mir alles aufgefallen war.
»Leider stehen die Chancen, die Täter zu finden, nicht besonders gut«, sagte er, nachdem er meine Aussage protokolliert hatte. »Sie sind noch glimpflich davongekommen, Frau Dirie. Hier werden jeden Tag Frauen vergewaltigt und Menschen umgebracht, und zwar für weit weniger als eine Kreditkarte.«
Die Polizisten rieten mir, die Nacht nicht in der Wohnung zu verbringen, aber dazu hätte mich sowieso niemand überreden können. Ich war sehr froh, dass ich am nächsten Morgen für eine schon seit längerem geplante Vortragsreise nach Europa reisen musste, deren Höhepunkt ein Vortrag vor dem Ministerrat in Brüssel werden sollte. Sosehr ich mich auch auf Afrika gefreut hatte, in diesem Moment wollte ich nichts wie weg. Du bist eben doch eine Nomadin, dachte ich wehmütig, als mir klarwurde, dass damit wieder einmal mein Traum, endlich irgendwo sesshaft zu werden und ein Zuhause zu haben, geplatzt war. Ich fragte mich, an welche Flecken der Erde es mich wohl noch verschlagen würde, und versuchte, zuversichtlich nach vorne zu blicken.
Schließlich checkte ich in einem Hotel am Flughafen ein und flog früh am nächsten Morgen los. Ich hoffte, durch die bevorstehende Reise die Erlebnisse des Vortages einfach hinter mir lassen zu können. Wenn ich damals allerdings auch nur geahnt hätte, was mich nach diesem schrecklichen Erlebnis in Südafrika auch noch in Europa erwartete, hätte ich diese Hoffnung wohl schnell verworfen.
Der Leopard leckt alle seine Flecken – schwarze wie weiße.
Aus Simbabwe
2Schwarze Frau, weißes Land
Vierzehn Tage lang tourte ich mit Joanna für meine Stiftung die Waris Dirie Foundation, mit der ich mich seit nunmehr fünfeinhalb Jahren gegen weibliche Genitalverstümmelung einsetzte, durch ganz Europa. Ich hielt Vorträge, gab Interviews, sprach vor Journalisten, Politikern und Studenten, traf mich mit Organisationen und betroffenen Frauen. Abschließend stand mein Vortrag in Brüssel auf dem Programm.
Als wir am Vorabend der Veranstaltung in der belgischen Hauptstadt ankamen, stand eine Limousine für uns bereit, die uns vom Flughafen in unser Hotel brachte, das zur Sofitel-Gruppe gehörte. Nachdem wir eingecheckt hatten, besprach ich mit Joanna, die mich auch auf dieser Reise begleitete, noch einmal meine Rede, die für den späten Nachmittag des nächsten Tages angesetzt war. Dann ging ich in mein Zimmer und machte mich fertig, um ins Bett zu gehen. Ich war einerseits sehr müde von den Anstrengungen der vergangenen Tage und andererseits extrem nervös wegen der bevorstehenden Veranstaltung. Ich hatte zwar schon viele Reden gehalten, aber diese hier war wirklich eine große Sache. Ich sollte im Rahmen der Veranstaltung unter anderem die amerikanische Außenministerin Condoleeza Rice treffen, um mit ihr über Maßnahmen gegen weibliche Genitalverstümmelung zu sprechen. Je länger ich über den nächsten Tag nachdachte, desto nervöser wurde ich. Schließlich stand ich wieder auf und beschloss, einen Abendspaziergang zu machen.
In der Hotellobby unterhielt ich mich kurz mit einem der Portiers, der mir davon abriet, abends allein hier in der Gegend spazieren zu gehen.
»Vielleicht sollten Sie lieber in einen ruhigen Club fahren, wenn Sie sich noch ein wenig entspannen wollen. Das ist allemal sicherer, als alleine durch die Straßen zu laufen«, sagte er und empfahl mir einen Club ganz in der Nähe. Dort stand an jenem Abend nur ruhige Chill-out-Musik auf dem Programm.
Ich bedankte mich und wandte mich zum Gehen.
»Nehmen Sie aber besser ein Taxi, sonst verlaufen Sie sich noch«, riet er mir.
Ich folgte seinem Rat und ließ mich zu der besagten Adresse fahren, was wirklich nur einmal um den Block war. In dem Laden setzte ich mich an einen kleinen Tisch und lauschte der Musik, die sehr schön war. Dabei versuchte ich mich ein wenig zu entspannen und nicht an den nächsten Tag zu denken. Lange blieb ich aber nicht. Als ich den Club etwa anderthalb Stunden später verließ, stieg ich einfach in das nächstbeste Taxi.
»Zum Sofitel, bitte«, sagte ich, und der Taxifahrer startete den Motor.
Die Fahrt kam mir diesmal länger vor als auf dem Hinweg, aber ich vermutete, dass der Taxifahrer ein paar Extrakilometer auf seinen Zähler bringen wollte, und hatte keine Lust, eine Diskussion mit ihm anzufangen. Als der Wagen in der reservierten Spur vorfuhr, zahlte ich, stieg aus und ging in die Hotellobby.
Schon an der Tür und erst recht an der Inneneinrichtung erkannte ich, dass dies gar nicht mein Hotel war. Also trat ich wieder auf die Straße und blickte an dem Gebäude hinauf. »Sofitel« stand dort in Großbuchstaben.
Also ging ich ein zweites Mal hinein und meldete mich an der Rezeption. »Entschuldigen Sie«, sagte ich zu dem älteren Herrn mit Lesebrille, der seine Zeitschrift zur Seite legte, »gibt es in Brüssel noch ein anderes Sofitel? Ich glaube nämlich, ich bin im falschen Hotel gelandet …«
»Es gibt mehr als nur ein anderes«, sagte der Rezeptionist zu meinem Entsetzen und fragte dann: »Wissen Sie denn die Adresse?«
»Nein, keine Ahnung«, entgegnete ich und redete mir ein, dass es keinen Grund gab, nervös zu werden. »Ich weiß nur, dass ich in einem Sofitel wohne, irgendwo in der Nähe des EU-Gebäudes.«
»Davon gibt es hier leider auch eine Menge«, erwiderte der ältere Herr und rückte seine Brille zurecht. »Aber ich will mal im Computer nachsehen. Wie ist denn Ihr Name?«
»Waris Dirie«, sagte ich und trommelte mit den Fingern auf dem Holztresen herum.
Nach einiger Zeit blickte der Rezeptionist wieder von seinem Computer auf. »Ich kann Sie nicht finden, Frau Dirie, für Sie ist in keinem unserer Hotels ein Zimmer gebucht. Sind Sie sicher, dass Sie in einem Sofitel reserviert haben?«
»Ja«, gab ich lauter als gewollt zurück. »Ich war ja schon dort und bin seit heute Vormittag eingecheckt!«
Der Mann musterte mich zunehmend misstrauisch. »Bei Sofitel sind sie jedenfalls nicht im System, so viel steht fest. Tut mir leid«, sagte er abschließend, »ich kann Ihnen da leider nicht weiterhelfen.« Damit wandte er sich ab und begann zu telefonieren.
Empört drehte ich mich um und ging zurück auf die Straße. Dann musste ich eben Joanna anrufen und sie um Hilfe bitten. Wahrscheinlich hatte man das Zimmer wie schon so oft aus Sicherheitsgründen auf einen anderen Namen gebucht. Ich kramte in meiner Tasche auf der Suche nach meinem Handy. Wo ist das verdammte Teil nur?, dachte ich, doch dann fiel es mir wieder ein. Ich hatte mein Mobiltelefon zum Aufladen im Hotel gelassen. Da ich ursprünglich nur ein bisschen spazieren gehen wollte, hatte ich auch meine Wertsachen und Kreditkarten im Hotel gelassen und nur etwas Bargeld mitgenommen, das ich nun fast komplett für die beiden Taxifahrten und mein Getränk in dem Club ausgegeben hatte.
Langsam kroch die Sorge meinen Rücken hinauf. Wie sollte ich in dieser fremden Stadt ein Hotel wiederfinden, in dem ich unter falschem Namen logierte, den ich zu allem Übel nicht kannte. Mittlerweile war ich so verunsichert, dass ich nicht mal mehr auf den Namen der Hotelkette hätte schwören wollen. Vor dem Hotel stand eine ganze Reihe mit Taxis, und ich sprach einfach einen der Fahrer an.
»Entschuldigen Sie, ich kann mein Hotel nicht mehr finden und habe nur noch zehn Euro dabei«, versuchte ich ihm meine missliche Lage zu erklären. »Können Sie mir vielleicht helfen? Ich glaube, es ist ein Sofitel irgendwo in der Nähe eines EU-Gebäudes.«
Der Fahrer lachte. »Noch ungenauer geht es wohl kaum, was? Tut mir leid, aber umsonst kann ich nicht mit Ihnen alle Hotels in Brüssel abklappern. Ich schlage vor, ich fahre Sie zur nächsten Polizeistation.«
»Na gut«, willigte ich ein. Eigentlich war das wirklich keine schlechte Idee. Bei der Polizei war ich zumindest sicher, und die Beamten würden mir auf jeden Fall helfen. Notfalls musste ich eben die Nacht dort verbringen.
Der Taxifahrer brachte mich bis vor eine Polizeidienststelle und bot mir sogar an, mit hineinzugehen, da die meisten Polizisten in Brüssel seines Wissens nur sehr schlecht Englisch sprachen.
Ich war ihm sehr dankbar, und so redete der Mann, der aus Algerien stammte, wie er mir auf der Fahrt erzählt hatte, auf Französisch mit den flämischen Polizisten. Die schienen allerdings nicht besonders interessiert an meinem Fall, und so dauerte es eine ganze Weile, bis endlich mal einer von ihnen auf mich zukam.
»Ihre Papiere! Passport!«, bellte er mich an.
Ich hatte nichts bei mir, um mich auszuweisen, also versuchte ich ihm meine Situation klarzumachen. »Ich heiße Waris Dirie und bin auf Einladung der EU hier. Ich soll morgen vor dem Ministerrat sprechen, aber meine Papiere habe ich im Hotel gelassen …«
»… das sie jetzt nicht mehr wiederfinden, na klar.« Der Polizist sah mich an, als hätte ich gerade behauptet, ich sei der Papst und wisse nicht mehr, wo ich mein Papamobil geparkt hatte.
»Besser, Sie gehen jetzt und machen keinen Ärger, sonst muss ich die Ausländerbehörde informieren«, sagte er in unfreundlichem Ton, anstatt mir wie erwartet zu helfen.
Ich war völlig perplex. »Aber hören Sie doch, ich bin eine bekannte Autorin und Menschenrechtsaktivistin!«, rief ich.
»Jetzt reicht’s. Raus hier, aber sofort!«
»Lassen Sie uns besser gehen«, sagte der Taxifahrer. »Sonst bekommen Sie hier noch richtig Ärger. Ich möchte ehrlich gesagt auch lieber keinen Streit mit der Polizei haben.«
Auf der Straße stieg der drahtige schwarzhaarige Mann wieder in seinen Wagen.
»Tut mir leid, aber ich habe eine Familie zu ernähren, ich muss jetzt wirklich weiterarbeiten und heute Nacht noch ein bisschen Geld verdienen«, sagte er und zog die Schultern hoch. Dann verschwand er mit seinem Taxi in der Brüsseler Nacht.
Ich war komplett fassungslos. Da stand ich nun, mitten in der sogenannten Hauptstadt Europas, eingeladen von der Europäischen Union, und musste mich behandeln lassen wie eine illegale Einwanderin. Aber so war das eben. Ohne Reisepass war ich trotz meines Namens und meiner Erfolge hier nichts anderes als eine schwarze Frau, die nachts auf der Straße fremde Menschen um Hilfe bat. Alles Geld, das ich bisher in meinem Leben verdient hatte, änderte nichts daran, dass ich hier, in diesem Moment, genauso wenig hatte wie als obdachlose, illegale Afrikanerin in den Straßen Londons vor über fünfundzwanzig Jahren, als ich gerade erst nach Europa gekommen war.
Meine Wut über den unverschämten Polizisten wich der nackten Angst, die in mir aufstieg. Was sollte ich denn jetzt bloß tun? Ich erinnerte mich wieder an die unglaublich schweren ersten Jahre in London, an all die Demütigungen und vor allem an die Teilnahmslosigkeit der Menschen, die dort jeden Tag zu Tausenden an einem vorbeiliefen. Als Obdachlose war man auch in einer Millionenstadt genauso einsam wie ein einzelner Mensch in einer riesigen Wüste. Aber dort hätte ich mich wenigstens auf meinen Orientierungssinn verlassen können und früher oder später zurück nach Hause gefunden. Hier war ich mir da nicht so sicher. Es blieb mir nichts anderes übrig, als einfach in irgendeine Richtung loszumarschieren. Ich weiß im Nachhinein nicht mehr, wie lange ich schon umhergeirrt war, als ich einen Streifenwagen bemerkte, der an einer Straßenecke geparkt war. Ich beschloss, einen neuen Versuch zu wagen, und klopfte an das Seitenfenster.
»Ja?«, fragte der Polizist auf dem Beifahrersitz, ohne aufzublicken.
»Ich habe mich verlaufen und kann mein Hotel nicht mehr finden. Es ist ein Sofitel. Mein Geld, meine Papiere und mein Handy habe ich leider in meinem Zimmer liegen gelassen, und nun weiß ich wirklich nicht weiter. Ich bin Waris Dirie und soll morgen vor dem Ministerrat der EU sprechen«, erklärte ich ihm atemlos.
Der Polizist schaute mich nun einigermaßen freundlich an und begann sich mit seinem Kollegen zu unterhalten. »Okay, steigen Sie ein«, sagte er schließlich zu mir.
Erleichtert ließ ich mich auf der Rückbank des Wagens in die Polster sinken, und wir fuhren los. Einer der Polizisten gab über Funk etwas in einer Sprache durch, die ich nicht verstand.
»Wohin bringen Sie mich?«, fragte ich.
»In ein Hotel in der Nähe. Wir kennen da jemanden, der Ihnen vielleicht helfen kann.«
Ich blickte aus dem Fenster. Links und rechts standen überall Prostituierte am Straßenrand.
»Hier ist mein Hotel ganz sicher nicht!«, protestierte ich entnervt. »Ich habe Ihnen doch schon gesagt, es war gleich bei diesem EU-Gebäude.«
»Jetzt sind Sie mal schön still da hinten«, herrschte der Fahrer mich urplötzlich an. »Woher sollen wir denn wissen, dass Sie nicht eine von denen da sind und uns hier nur ein bisschen auf den Arm nehmen?« Er deutete auf die Frauen draußen auf der Straße.
Kurz darauf hielt der Wagen vor einem Hotel.
»Wir kommen gleich wieder«, sagte der Beifahrer, und die beiden Polizisten gingen hinein, während ich im Auto saß und wartete. Je länger die beiden Männer in dem Hotel blieben, desto unwohler fühlte ich mich. Wahrscheinlich hielten sie mich tatsächlich für eine Prostituierte. Ich stieg aus dem Wagen aus und betrat das Hotel. In der Lobby entdeckte ich die beiden Polizisten sofort, die gerade mit dem Rezeptionisten sprachen.
»Warten Sie draußen«, sagte der Portier zu mir. »Sie können nicht hier drinnen bleiben.«
»Wie bitte? Ich bin auf der Suche nach meinem Hotel.«
»Ich sagte, Sie sollen bitte draußen warten«, wiederholte er.
Da ich keinen zusätzlichen Ärger gebrauchen konnte, ging ich zurück zum Streifenwagen. Just in dem Moment hielt ein Taxi vor mir. Vielleicht war das ja mein Taxifahrer? Als ich versuchte, durch die Scheibe zu spähen, glitt das Fenster mit einem leisen Surren herunter.
»Brauchen Sie ein Taxi?«, fragte der Fahrer.
Es war ein anderer. Schade, dachte ich, der Zufall wäre auch zu groß gewesen.
»Ja, schon …« Ich zögerte. »Aber ich habe kein Geld dabei. Ich wohne in einem Sofitel gleich bei der EU. Wenn Sie mir weiterhelfen, gebe ich Ihnen das Geld selbstverständlich dann im Hotel.«
Der Taxifahrer, der eine Mütze auf dem Kopf trug, die er tief ins Gesicht gezogen hatte, musterte mich von oben bis unten. »Okay, steigen Sie ein, wir werden uns schon einig werden«, sagte er dann.
Erleichtert stieg ich in das Taxi ein, ohne zu ahnen, dass ich mich gerade in die Hände eines gewalttätigen Verbrechers begeben hatte. Drei Tage und Nächte dauerte die Hölle an, die dieser Mann mir bereitete, und ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Ich weiß nur eines: Ich möchte nie wieder in meinem Leben über das Erlebte reden müssen.
Als ich Joanna und Walter auf einer Polizeistation wieder in die Arme schloss, war ich unendlich froh. Ich hatte zwischendurch nicht mehr damit gerechnet, dass ich die beiden je wiedersehen würde, und ihre Anwesenheit verlieh mir neue Kraft. Diesen beiden Menschen vertraute ich, bei ihnen wusste ich, dass ich sicher war. Die belgische Polizei dagegen hatte auf ganzer Linie versagt. Sie hatte mich behandelt, wie man eine Schwarze ohne Papiere in Europa eben behandelt: barbarisch und respektlos.
Ich dachte an ein Gespräch mit der Kommunikationswissenschaftlerin Ishraga Hamid zurück, die ich in Wien getroffen hatte, da sie sich wie auch ich gegen weibliche Genitalverstümmelung engagiert. Wir hatten unter anderem über die Situation von Afrikanerinnen in Europa geredet. Die Frauen, von denen sogar knapp vierzig Prozent einen Hochschulabschluss haben, arbeiten so gut wie nie in Jobs, die ihrer Qualifikation entsprechen und fühlen sich zudem wegen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts und ihrer Hautfarbe diskriminiert.
Wie soll man sich da als schwarze Frau in einem weißen Land zu Hause fühlen?
Solange europäische Männer afrikanische Frauen als Sexobjekte betrachten und die Gesellschaft sie diskriminiert, werden sich die Lebensbedingungen dieser Frauen nicht zum Guten wenden. Ich weiß, was das heißt, denn ich habe Herablassung, Verachtung, körperliche und seelische Gewalt oft genug am eigenen Leib gespürt.
So, wie jetzt in Brüssel.
Aber ich bin zäh, und ich lasse mich nicht kleinkriegen. Von niemandem!
Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich.
Aus Südafrika
3Liebe und Respekt
Nach den schrecklichen Ereignissen, erst in Südafrika und danach in Brüssel, kehrte ich erst mal nach Wien zurück, wo ich immer noch eine kleine Wohnung hatte und wo meine Stiftung ihren Sitz hat. Um mich von den traumatischen Erlebnissen abzulenken, stürzte ich mich mit voller Kraft in die Arbeit meiner Foundation, um die Projekte sowie die wichtige Aufklärungsarbeit gegen weibliche Genitalverstümmelung – auf Englisch Female Genital Mutilation (FGM) – weiter voranzutreiben.
Bei der Gründung der Foundation im Jahr 2002 hatten wir sofort auch eine Homepage und eine E-Mail-Adresse eingerichtet, um den vielen Frauen und Mädchen, die sich seither aus der ganzen Welt an mich gewandt hatten, eine Anlaufstelle zu bieten. Über diese E-Mail-Adresse meldeten sich jedes Jahr Tausende Betroffene sowie Menschen, die mehr über das Thema erfahren oder unsere Arbeit unterstützen wollten.
Immer wieder waren auch Frauen aus Europa darunter, die Opfer von sexueller Gewalt geworden waren und sich deshalb besonders stark mit meinen Büchern identifizierten. Die Erkenntnis, dass Gewalt gegen Frauen ein universelles Problem ist und sich nicht auf Afrika beschränkt, bestärkte mich trotz der schrecklichen Erfahrungen in Brüssel, meinen Kampf für die Frauenrechte von Europa aus fortzusetzen.
Meine Erfahrungen in der täglichen Arbeit zeigten jedoch schnell, dass es vor allem der Islam war, der eine wichtige Rechtfertigung für die Eltern lieferte, ihre Töchter hier in Europa beschneiden zu lassen.
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als eine junge sudanesische Mutter mit ihrer zweijährigen Tochter vor der Tür meines Büros im Millennium Tower in Wien stand. Eine große Hilfsorganisation, die mit Asylanten arbeitete und unter anderem diese Frau betreute, hatte sie an uns verwiesen. Erst wenige Wochen zuvor war sie mit ihrem Ehemann und dessen Eltern aus Darfur als Kriegsflüchtling nach Wien gekommen. Nach ihrer Flucht und der Ankunft im sicheren Europa, so berichtete die junge Frau mir, hatte es plötzlich bei der Familie ihres Mannes nur noch ein Thema gegeben: Wie und wo konnte die kleine Tochter hier in Österreich beschnitten werden?