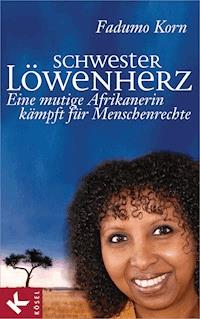
6,99 €
6,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Fadumo Korn: Eine Aktivistin mit Kopf, Hand und Herz
Fadumo Korn ist eine Kämpferin mit großem Herzen. Die in München sesshaft gewordene Nomadin hilft, wo sie kann, um die Lebensumstände von afrikanischen Asylsuchenden zu verbessern, v.a. von Frauen und Kindern, die zuallererst Opfer von Kriegen, Vertreibung, Tradition und Patriarchat werden. Engagiert klärt sie auf über die Beschneidung von Mädchen – und kämpft gegen das grausame Ritual. Denn dieses Thema betrifft uns auch hier, mitten in Europa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2010
4,3 (18 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
IMMER SCHÖN MUT MACHEN UND BRÜCKEN BAUEN
»MEINE SEELE ZERBRICHT, FADUMO!«
RECHT AUF ASYL
Copyright
IMMER SCHÖN MUT MACHEN UND BRÜCKEN BAUEN
»Gott, lass sie nicht sterben!«, dachte ich und betrat die Bühne. »Reiß dich jetzt zusammen, Fadumo!«, fuhr meine innere Stimme fort, »die Leute sind gekommen, um dich zu hören. Stoß sie jetzt nicht vor den Kopf und vermassel alles - nur weil irgendwo auf der Welt gerade ein Mädchen stirbt …«
Ich straffte meine Schultern und schaute ins Publikum: Rund 100 erwartungsvolle Gesichter blickten zu mir hoch - Männer und Frauen, Alte und Junge waren hierher in einen Münchner Saal gekommen, um meinen Vortrag zu hören; meinen Vortrag, den ich eigentlich jetzt absagen wollte. Denn irgendwo auf der Welt lag gerade meine Nichte im Sterben.
Der Anruf aus Somalia war erst gestern gekommen. Ibrahim, einer meiner Cousins, den der Bürgerkrieg in Somalia noch nicht in die Flucht geschlagen hatte, war verzweifelt: Seine 17-jährige Tochter Amina habe schon seit einigen Tagen Bauchweh, erzählte er aufgeregt, aber jetzt sei es viel schlimmer geworden. Sie bräuchte dringend Hilfe. »Fadumo, was soll ich tun? Wir haben doch keine Ärzte hier!« Ich wollte mit Amina sprechen. Ich kannte meine Nichte nicht persönlich, nur von Fotos und vom Telefon. 1987 war ich zum letzten Mal nach Somalia gereist, ab 1991 machte es der Bürgerkrieg unmöglich einzureisen, um meine Familie wiederzusehen.
Und Amina war erst später geboren worden, sie kannte ihr Leben lang nur den Krieg. Unsere Familienbande waren vor allem Telefonkabel. Ibrahim reichte das Telefon seiner Tochter. Amina klang schwach und sprach mit gequälter Stimme: »Tante Fadumo, es ist nicht mein Bauch, es ist mein Unterleib. Er ist so geschwollen und ich kann nicht aufs Klo, ich kann nicht Pipi machen. Was ist das nur?!«
Die Antwort auf diese verzweifelte Frage kannte ich nur zu gut. Ich stand hier vor meinem Münchner Publikum, um genau darüber zu referieren: über Mädchenbeschneidung und die fatalen Folgen dieses patriarchalischen Brauchs.
Amina war beschnitten, und was immer sich in ihrem Unterleib zusammengebraut hatte, es konnte nicht raus: Denn Amina war nach der Beschneidung zugenäht worden bis auf ein winziges Löchlein.
Als ich die Stimme meiner Nichte hörte, spürte ich sofort hilflose Wut in mir hochsteigen: »Verdammt!«, dachte ich mir, »das habt ihr nun davon, dass ihr eure Mädchen beschneidet! Und dann soll die Familie im Ausland helfen!« Ich sagte aber mit fester, ruhiger Stimme: »Amina, mein Mädchen, das tut bestimmt sehr weh, ich kenne das gut. Aber weißt du was? Du bist ein starkes Mädchen, du hältst das doch noch ein bisschen aus, nicht? Denk nur an Opa, wie er damals in seiner Verzweiflung einen Löwen in die Nase gebissen hatte. So konnte er sich dann aus seiner tödlichen Umarmung lösen, als der Löwe ihn fressen wollte. Ich spreche sofort mit deinem Onkel Jama in Amerika und wir schicken euch gleich Geld, damit du in ein Krankenhaus fahren kannst. Dort machen sie dich wieder gesund, du wirst schon sehen …« Sie lächelte schwach durchs Telefon und sagte: »Ach, Tante Fadumo, du machst einem immer so schön Mut!« Dann verabschiedeten wir uns mit zuversichtlichem Geplänkel. Als ich aufgelegt hatte, tippte ich mit zitternder Hand die Nummer meines großen Bruders Jama. Er ist nach dem Tod unseres Vaters und unseres ältesten Bruders das Oberhaupt unseres somalischen Familienclans, der heute in alle Winde verstreut ist. Jama hatte der Bürgerkrieg in die USA verschlagen. Ohne die Zustimmung und den Beschluss unseres Clan-Oberhaupts kann keine unserer vielfältigen weltweiten »Familien-Rettungsaktionen« gestartet werden, wie jetzt zum Beispiel die Nothilfe für Amina. Jama erfasste sofort, was los war und wie ernst es war. Ohne viele Worte zu verlieren, beschlossen wir, Geld nach Somalia zu schicken; das sollte genügen, um Amina so schnell wie möglich in das nächstgelegene Krankenhaus transportieren zu können und die Ärzte zu bezahlen. Das Land ist zwar durch den jahrzehntelangen Bürgerkrieg zerstört, aber der Geldtransfer aus dem Westen funktioniert reibungslos - Internet macht’s möglich. Erstaunlicherweise ist das in jedem Dritte-Welt-Land so. Binnen Stunden würde das Geld bei Ibrahim im hintersten Winkel Somalias sein.
Auch das muss ich immer wieder in meinen Vorträgen erklären. Dass die Menschen in Afrika, die ihre Mädchen beschneiden, keine hinterwäldlerischen Wilden sind, sondern normale Menschen, die durchaus mit moderner Technik vertraut sind. Technologischer Fortschritt und Tradition schließen sich nicht aus. Und Beschneidung ist pure patriarchalische Tradition.
Das Geld war also nicht das Problem. Ibrahim fand einen Laster, der Amina von Afgooye ins ungefähr 30 Kilometer entfernte Krankenhaus nach Mogadischu bringen würde, doch er zögerte, denn Amina delirierte schon. Ibrahim berichtete mir verzweifelt am Telefon, dass der Bauch seiner Tochter mittlerweile aufgeblasen sei wie ein Ballon und dass sie bei jeder Bewegung vor Schmerzen schreie. Es zerriss mir das Herz. Mit Jama entschieden wir: transportieren - und zwar sofort; alles Mögliche versuchen, um das Mädchen zu retten.
Während ich in München mit der S-Bahn zum Vortragssaal fuhr, holperte gleichzeitig Tausende Kilometer weiter südöstlich meine Nichte Amina mit dem Tode ringend auf der Ladefläche eines LKW über staubige Pisten dem Krankenhaus entgegen. Ich betete zu Gott, dass sie es schaffen würde.
Ich hatte das Podium mit der festen Absicht betreten, den Vortrag abzusagen. Jetzt stand ich vor dem Mikrofon und plötzlich schossen mir Aminas Worte durch den Kopf: »Tante Fadumo, du machst einem immer so schön Mut!« Und ich wusste in diesem Moment: Ich würde den Vortrag halten, ich würde diese Menschen, die gekommen waren, weil sie sich für andere Menschen interessieren, aufrütteln, ich würde sie aufklären über Mädchenbeschneidung - und ich würde ihnen »immer schön Mut machen«, dass sie etwas verändern können in dieser Welt - durch ihr Bewusstsein oder durch ihren Einsatz. Ich würde aber kein Wort über Amina sagen, denn das hieße für mich, das Schicksal herauszufordern. Ich würde ihnen einfach meine Geschichte erzählen, die Geschichte eines beschnittenen Mädchens aus Somalia, das es heute als Frau als ihre Mission ansieht, Brücken zu bauen - zwischen Menschen, Traditionen und Kulturen.
Ich bin Fadumo Abdi Hersi Farah Husen Korn. Ich wurde geboren im Großen Regen, im Jahr 1964. In der unendlichen Weite Somalias verbrachte ich die ersten sieben Jahre meines Lebens. Es waren glückliche und geborgene Jahre - trotz des arbeitsreichen und kargen Alltags unserer Nomadenfamilie. Meine Mutter Mayran und mein von mir vergötterter Vater Abdi Hersi führten mich und unsere Familienmitglieder mit unserem Vieh von Wasserstelle zu Wasserstelle. Ich war ein fröhliches, lebenslustiges und eigensinniges Kind - bis zu meinem siebten Lebensjahr. Dann wurde ich, wie alle kleinen Mädchen in Somalia, der rituellen Beschneidung unterzogen.
Meine Mutter hatte mich seit Jahren auf »meinen großen Tag« vorbereitet. Ich wusste, danach würde unser Stamm ein Fest zu meinen Ehren feiern; ich durfte auch schon vorher meine Geschenke sehen, die dann wieder versteckt wurden. Aber was da eigentlich gefeiert werden sollte, das wusste ich nicht - niemand sprach darüber. Und so fieberte ich diesem großen mysteriösen Ereignis erwartungsvoll entgegen. Wie naiv von mir! Ich hatte sogar kindlich-romantische Gedanken: Ich würde nun bald zur Frau werden, könnte heiraten und Kinder bekommen. Zum Glück wusste ich nicht, was mich erwartete: Die alte Beschneiderin schnitt mir mit ihrer Rasierklinge nicht nur die Schamlippen ab, nein, sie schnitt mir auch alle Lebensfreude und alle Kraft aus meinem kleinen Körper.
Meine Nichte Amina würde ich nie mehr sehen oder hören. Sie war noch während meines Vortrags gestorben, auf dem langen Weg ins Krankenhaus. Als ich nach Hause kam, rief mich gleich mein Bruder Jama an, der mir die traurige Botschaft überbrachte. Ich dachte nur: »Zum Glück habe ich ihr niemals direkt in die Augen sehen können. Ich kenne den lebendigen Ausdruck ihrer Augen nicht.« Das wäre noch schmerzhafter für mich gewesen. Dann sagte ich mir: »Verzeih, kleine Amina, dass ich dir nicht helfen konnte.« Und dann betete ich dafür, dass sie in eine bessere Welt kommen möge.
Wie sich später herausstellen sollte, hatte sie eine große Zyste in der Gebärmutter gehabt: Sie war geplatzt, doch die Sekrete konnten nicht abfließen, weil die Öffnung verstopft war - zugenäht eben -, und Amina bekam eine Blutvergiftung, die tödlich endete. Amina musste die Hölle auf Erden erlitten haben. Sie starb innerhalb von 48 Stunden unter qualvollen Schmerzen. Wir konnten ihr einfach nicht helfen.
Ich überlebte damals die schwere Infektion, die der Beschneidung folgte. Doch aus der lebenslustigen, quirligen kleinen Fadumo wurde ein stilles, scheues, verletzliches und trauriges Mädchen. Ich wurde krank. Ein schwaches, krankes Kind ist für Nomaden, die oft von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf den Beinen sein müssen, eine große Belastung. Also entschlossen sich meine Eltern schweren Herzens, mich zu einem wohlhabenden Halbbruder meines Vaters in die Hauptstadt Mogadischu zu bringen. Mit heißen Tränen verabschiedete ich mich von meiner Mutter, wie wir alle damals dachten, nur für wenige Wochen. Doch ich sollte sie nie mehr wiedersehen.
Ich lebte nun im Haushalt meines privilegierten Onkels und genoss eine unbeschwerte Kindheit mit meiner neuen Familie: mit Onkel Abdulqadir, Tante Madeleine - einer sehr eleganten Erscheinung - und ihren Kindern und Pflegekindern. Dieses neue Leben faszinierte mich, und die Schule, in die ich nun erstmals kam, machte mir so viel Spaß, dass ich oft kichernd erwachte, weil ich mich so darüber freute, dass das alles kein Traum war, sondern Wirklichkeit. Jeden Tag erlebte ich neue Abenteuer, sodass ich meine Krankheit darüber völlig vergessen hatte. Der Schmerz war zwar ständig da, aber er war uninteressant. Ich dachte, na ja, das tut halt alles weh, aber das ist egal, ich will zur Schule!
Doch irgendwann konnten wir die Fakten nicht mehr ignorieren: Meine Gelenke schwollen an, meine Finger und Zehen begannen sich zu verformen, und ich hatte immer stärkere Schmerzen. Onkel Abdulqadir schickte mich mit zwölf Jahren zur weiteren Behandlung nach Europa. Über ein Jahr lang wurde ich in Deutschland und Italien therapiert, durchlief eine Odyssee von Arzt zu Arzt, von Gastfamilie zu Gastfamilie. Wobei viele meiner »Gasteltern« diese Bezeichnung bei Gott nicht verdienten. Ich kehrte nach Mogadischu zurück, machte dort meinen Schulabschluss. Die Krankheit wurde nicht besser, also wurde ich 1979 mit 16 wieder nach Deutschland geschickt, nach München; wieder in eine Gastfamilie, die nicht sehr hilfreich für meine Entwicklung war. 1980 kam ich dann zu Waris und Detlef, die mir ein echtes Glücksleben schenkten, Zuversicht und Selbstbewusstsein. Endlich wieder eine Familie, die mich liebte und mir täglich ihre Zuneigung zeigte.
Ich genoss die neue Freiheit, die mir diese Familie zugestand. Eines Abends durfte ich mit Freunden zu einem Studentenfasching gehen - obwohl sich mir der Sinn von Fasching nicht so ganz erschließen wollte. Schüchtern und etwas irritiert sah ich dem bunten Treiben auf der Tanzfläche zu. Plötzlich sprach mich ein langhaariger Frankenstein an. Er fragte, was ich denn hier so machte und ob ich denn nicht tanzen wolle. Diese Begegnung mit Frankenstein war mein großes Glück, denn schon ein Jahr später gaben wir uns in München das Jawort. Ich war zu diesem Zeitpunkt gerade 19 Jahre alt und Walter - so hieß der Frankenstein mit bürgerlichem Namen - war 24. Das alles liegt nun schon über 20 Jahre zurück, und wir sind - allen Anfeindungen zum Trotz - zusammengeblieben und haben unser Leben gemeinsam aufgebaut.
1990 wurde unser Wunschkind Jama Philip geboren - unser Glück schien perfekt. Doch immer noch funkten die Spätfolgen meiner Beschneidung dazwischen, auch wenn ich mittlerweile operiert worden war. Während der Schwangerschaft hatte ich Phantomschmerzen und nach der Geburt produzierte ich so viel Muttermilch, dass sie für drei gereicht hätte. Das tat meinen vom Rheuma zerfressenen Knochen und Gelenken gar nicht gut. Diese Rheuma-Attacken sind mögliche Spätfolgen der Beschneidung. Einfach vergessen konnte ich die Schatten meiner Vergangenheit also nicht - trotz allen häuslichen Glücks. Und deshalb schwor ich mir: Irgendwann würde ich gegen diesen schädlichen und schändlichen Brauch kämpfen. Auch wenn ich damals noch nicht so recht wusste, wie …
Heute weiß ich es. Heute halte ich Vorträge über Beschneidung und gebe Seminare. Ich gehe in Schulen, um das Thema jungen Menschen nahezubringen. Denn Beschneidung geht uns alle an - ja, auch hier in Deutschland. Ich engagiere mich stark in einer Hilfsorganisation, die Mädchen in Afrika fördert, und fahre dorthin, um die Projekte zu betreuen. Ich bin als Aktivistin unterwegs und setze mich ehrenamtlich ein: gegen Beschneidung - und immer auch für Menschen aus Somalia, die der Bürgerkrieg, die Gewalt und das Morden hierher nach Deutschland verschlagen haben - auf der Flucht vor unerträglichem Leid, auf der Suche nach Asyl.
Immer schön Mut machen und Brücken bauen, das ist heute meine Aufgabe.
»MEINE SEELE ZERBRICHT, FADUMO!«
Irgendwann im Juli 2008 war es wieder mal so weit: Ich hatte meinen somalischen Romantik-Anfall. Den ganzen Tag schon hatte ich somalische Musik gehört und dann angefangen, selbst Lieder zu trällern. Unsere Sprache ist sehr romantisch; und in Somalia geht die Liebe nicht durch den Magen, wie hier in Deutschland, sondern durch die Leber. Ich schmachtete also ständig Lieder vor mich hin mit solchen Texten wie »Die Pfeile, die du abgeschossen hast, gingen mitten durch meine Leber« - was ja schon sehr kitschig klingt, aber es machte einen Riesenspaß! Ich fühlte mich herrlich beschwingt. Wie so oft an diesen Tagen meiner somalischen Romantik-Anfälle hatte mich auch heute der damit einhergehende Kochwahn überkommen, und ich war zum Türken um die Ecke gelaufen, um ein schönes Stück Lammfleisch zu kaufen. Meine Männer, Walter und Philip, sind immer glücklich, wenn sie abends heimkommen, und es riecht gut. Wenn sie mich dann auch noch trällern hören, wissen sie: »Aha, Heimweh. Fadumo hat wieder ihr Heimweh.« Aber sie wissen auch: Dann lebe ich wieder richtig.
Das Essen war fertig, ich stellte den dampfenden und duftenden Topf auf den Tisch und trällerte nach meinen Männern. Da klingelte das Telefon. Flughafen München. Bundesgrenzschutz. Ein minderjähriger somalischer Flüchtling war aufgegriffen worden. »Frau Korn, wir brauchen Sie hier. Können Sie kommen?« Mein Blick ging Richtung Küche und ich sog den aromatischen Duft meines somalischen Lammfleisch-Eintopfs ein. »Klar komme ich. Geben Sie mir eine Stunde« - so lange würde es dauern, bis ich mit der S-Bahn zum Münchener Flughafen käme.
Natürlich hatten wir uns den Abend anders vorgestellt, aber Walter und Philip zogen wie immer mit mir an einem Strang und machten mir den Abschied nicht schwer. Philip fütterte mich noch im Hinausgehen mit einer Gabel Lammfleisch und Walter wünschte mir aufmunternd alles Gute für den Einsatz.
Mein somalischer Romantik-Anfall hatte sich für heute erledigt, eingeholt wurde ich von der somalischen Realität. Am Flughafen angekommen, führte mich der Beamte vom Bundesgrenzschutz in eine Art Wartesaal. Ein kahler Raum, zwei Holzbänke standen darin. Hier warten normalerweise die Flüchtlinge, die aufgegriffen werden, schicksalsergeben darauf, dass weiter mit ihnen verfahren wird: dass Dolmetscher wie ich kommen, dass Polizisten sie befragen und dass sie danach mutterseelenalleine losgeschickt werden in das ihnen zugewiesene Flüchtlingsheim; nur mit einer Fahrkarte und einem Stadtplan ausgestattet, sollen sie sich damit in einer wildfremden Stadt zurechtfinden.
Als ich ankam, war es spät und der Raum war leer. Ich schaute nach rechts - kein Mensch; nach links - nichts; noch mal nach rechts - da bewegte sich etwas. Ich erblickte eine völlig in sich versunkene, zusammengekauerte Gestalt, einen kleinen Jungen. Kein Wunder, dass er für mich erst unsichtbar war. Doch welche Verwandlung ging dann mit ihm vor! Er sah mich, sah mein schokoladenfarbenes Gesicht mit dem breitesten Lächeln, das ich in mir finden konnte, und ein Ruck ging durch seinen Körper. Er fing an zu strahlen vor Freude und neugewonnener Energie. Seine Augen schienen zu sagen: Jetzt werde ich endlich verstanden.
Er sagte »Tante« zu mir - eine Respektsbezeugung. Auch ich spreche ältere Somalis mit Tante oder Onkel an, denn es gilt als unhöflich, sie beim Namen zu nennen. »Tante, nimmst du mich mit?« »Nein«, sagte ich, »ich nehme dich nicht mit, aber ich kann dir helfen, dass du eine gute Unterkunft bekommst.« Und meine Arbeit als vereidigte Dolmetscherin begann. Eine Gratwanderung ist das - immer wieder. Denn ich muss natürlich immer für die Beamten korrekt in der Übersetzung bleiben, aber ich möchte den Menschen, die hier vor mir gestrandet sind, auch das Gefühl geben: Hier ist jemand, der etwas für dich tut. Außerdem hilft das auch, das Misstrauen gegenüber den Behörden abzubauen. Flüchtlinge, die hier in Deutschland ankommen und nur Gewalt und Krieg kennen, zucken zusammen, wenn die Polizisten, die den Raum bewachen oder die sie befragen, sich an ihre rechte Seite fassen, um zu ihren Handys zu greifen. Sie denken, die haben Pistolen, die werden schießen - und ich muss sie dann beruhigen: Keine Sorge, keiner schießt hier willkürlich herum. Das ist nicht Somalia.
Auch Ali zuckte zusammen, als der Beamte in Richtung Hosentasche griff. Doch Ali legte sein anfängliches Misstrauen und seine Schüchternheit schnell ab und fasste Vertrauen zu mir - er verlor auch etwas die Scheu vor dem korrekten, aber freundlichen Beamten. 16 Jahre alt sei er, erzählte er uns, er sah aber viel jünger aus, so klein und schmächtig, wie er war. Hier am Flughafen gibt es noch keine ausführlichen Befragungen der Flüchtlinge, die kommen immer erst später. Hier stellen die Polizeibeamten zunächst einmal fest, dass es sich um einen Flüchtling handelt. Wichtig ist, wie er heißt, woher er kommt und wie und warum er geflohen ist. Also warum er hier in Deutschland um politisches Asyl bittet. Für diese erste Befragung, den Erstkontakt, braucht man Dolmetscher wie mich. Danach werden die Asylsuchenden auf Unterkünfte verteilt - meist auf Sammelunterkünfte, große Wohnheime, in denen Menschen aller Herren Länder bunt zusammengewürfelt auf engstem Raum untergebracht werden. Minderjährige Flüchtlinge wie Ali, die ohne Begleitung von Erwachsenen kommen, haben es weitaus besser: Für sie gibt es eine besondere Unterbringung - eben in einem Heim nur für Kinder und Jugendliche. Ich erklärte Ali, dass er nun in so ein Wohnheim mit anderen Kindern gebracht würde. Dort müsse er erst einmal bleiben, bis man seinen Antrag auf Asyl bearbeiten könne. Er verstand und hielt sich tapfer, als wir uns verabschiedeten. Ich versprach, mich bei ihm zu melden. Dann nahm ich die S-Bahn zurück in die Münchner Innenstadt.
Auf der Fahrt durch die Dunkelheit stiegen schreckliche Bilder in mir hoch. Ali hatte erzählt, dass er hatte mit ansehen müssen, wie man seinen ältesten Bruder und seine Schwester umgebracht hatte. Es geschah mitten in der Nacht, die Meuchelmörder überfielen die Familie im Schlaf. »Das ist dieser verdammte Bürgerkrieg«, dachte ich bitter. »Kindern werden die Familien genommen und den Familien die Kinder.« Mich erinnerte Alis Geschichte so sehr an meine eigene Familie in Somalia, die in ständiger Gefahr lebt. Ich dachte zurück an die Hiobsbotschaften einige Monate zuvor, als am ersten Tag des Ramadan, des muslimischen Fastenmonats, zehn Männer aus unserem Clan gemeuchelt wurden. Die Meuchelmörder - in Somalia werden sie Mooryaan genannt - sagten zu ihnen: Entweder ihr kämpft mit uns oder wir bringen euch um. Mein jüngster Bruder hatte sich dann wieder einmal vor diesen Banditen verstecken müssen. Tagelang wusste niemand von unserer Familie, wo er war und ob er überhaupt noch lebte. Immer, wenn das Telefon klingelte und ich eine somalische Nummer auf dem Display sah, erschrak ich - es hätte ja wie so oft eine schlechte Nachricht sein können. Aber mein Bruder blieb am Leben und meldete sich ein paar Tage später am Telefon, als ob nichts gewesen wäre.
Eine ähnliche Situation erlebte mein Bruder Mohamed kurz darauf. Mohamed ist das jüngste unserer Geschwister, das letzte Kind unserer Mutter, deshalb hängen wir alle so an ihm - er ist die letzte Erinnerung an sie; sie starb, als ich zwölf Jahre alt war. Auch Mohamed musste sich plötzlich verstecken, auf ihn ist - seit vielen Jahren schon - ein Kopfgeld ausgesetzt. Es ist eine absurde, uralte Stammesfehde, die nur mit Blut gesühnt werden kann, und so wird er von den Mitgliedern des verfeindeten Stammes gesucht. Außerdem vermuten sie immer Geld bei ihm, denn er arbeitet oft mit ausländischen Hilfsorganisationen zusammen. Er war also wieder einmal untergetaucht. Besorgt rief ich in Somalia an und bei einem der Gespräche mit meiner Nichte, der Tochter meiner Halbschwester Halimo, hörte ich im Hintergrund Schüsse. Ich erstarrte, doch meine Nichte lachte nur: »Ja ja, es wird geschossen, aber die Kugeln kommen nicht durch, unser Haus ist aus Stein. Außerdem ist es nichts im Vergleich zu heute Früh. Mach dir keine Sorgen, Tante Fadumo!« Am nächsten Tag rief mich dann mein Bruder Mohamed an und sagte wieder: »Mach dir keine Sorgen, Fadumo, ich musste mich zwar verstecken, aber es geht uns gut hier. Sie haben nur drei Männer umgebracht.« Und dann fragte er allen Ernstes mich, wie es mir denn so ginge! Da musste ich innerlich lachen, denn mir geht es doch wirklich prächtig - ich habe hier an jeder Ecke einen Arzt und vor allem keinen Bürgerkrieg. Immer wieder stelle ich mir die Frage, wie ich meinen Bruder Mohamed da bloß rauskriegen kann. Die Sache mit dem Kopfgeld ist schon schlimm genug, doch die Willkür des Bürgerkrieges kommt noch dazu - und so ist die tägliche Angst um das eigene Leben bittere Realität in meiner Heimat Somalia.
Ich hatte dann wieder einmal eine Aktion gestartet - wie ich es bis heute tue -, um hier in Deutschland Geld zu sammeln für die ärztliche Notversorgung in Somalia. Dabei muss ich immer wieder meinen Ärger hinunterschlucken über das so oft gehörte Argument: »Wir haben doch hier auch Armut, uns geht’s doch auch in Deutschland nicht gut, wir sollten lieber Geld sammeln für die Kinder hier…« Ja - bei allem Respekt -, doch die Kinder hier sind keine Kinder des Krieges.
Den Kindern in Somalia wird der Krieg in die Wiege gelegt. Auch der 16-jährige Ali kennt nichts anderes, schoss es mir durch den Kopf. Länger als sein ganzes bewusstes Leben lang - seit 1991 - herrscht Bürgerkrieg. Mord, Willkür, Angst, Elend. Und trotz allem - Hoffnung. Wieder stiegen Bilder in mir hoch, die Erinnerung an einen fröhlichen Anruf meines jüngsten Bruders Mohamed. Kurz nachdem er aus seinem Versteck wieder auftauchte, wurde er Vater. »Meine Frau hat mir einen Sohn geboren. Ich habe ihn nach unserem Vater benannt!«, rief er ins Telefon. Und ich weinte mit ihm Tränen der Freude, denn es war das erste Kind meiner Schwägerin, das nicht abgegangen oder eine Totgeburt war. Es war ein großer Tag für unsere Familie und auch für den kleinen Neuankömmling, denn an seinem Geburtstag wurde nicht geschossen. Ich schickte rasch ein bisschen Geld nach Somalia, damit die Familie diesen Tag der Freude feiern konnte: Sie sollten sich etwas kaufen, was sie eben finden konnten in diesen Kriegszeiten; sie würden damit - so will es unser Brauch - den Ahnen für das Neugeborene danken. Wenn das Kind überleben sollte, würde man dann später alle Ahnen zum Dank an Festtagen ehren. Es war ein guter Tag, ein Tag, an dem nicht geschossen wurde. Das wird man sich noch Jahrzehnte später erzählen. Der Kleine überlebte. Er bekam den Spitznamen »der Kämpfer«.
Als ich wieder zu Hause ankam, war es schon spät in der Nacht und meine Männer schliefen. Der Rest meines romantischen somalischen Abendessens stand auf dem Herd. Ich hätte es mir aufwärmen können, aber ich hatte keinen Hunger mehr. Die Gewissheit, Ali an seinem ersten Tag in Deutschland ein Stück Vertrauen und Heimat gegeben zu haben, machte mich satt.
Eine Woche später fuhr ich wieder mit der S-Bahn hinaus in Richtung Flughafen. Ich wollte Ali in seinem Wohnheim weit draußen vor der Stadt besuchen. Diesmal kam ich nicht als Dolmetscherin, sondern als ehrenamtliche Sozialarbeiterin. »Gut, dass Sie da sind, Frau Korn!«, begrüßten mich die Betreuer. »Wir kommen nicht an Ali heran, er verschließt sich und wir können nicht zu ihm durchdringen, obwohl er da ist …!« Wie oft hatte ich das schon miterlebt! Flüchtlinge brechen oft zusammen, sobald sie in der Unterkunft sind, sobald sie echte Ruhe und Frieden spüren und die Anspannung der Vergangenheit von ihnen abfällt. Andererseits ist so vieles fremd und neu für sie, Somalia ist weit weg und Deutschland so völlig anders. Und sie können sich nur schwer damit abfinden, dass sie als Asylsuchende nicht einfach so hinausgehen und sich frei in Stadt und Land bewegen dürfen wie alle anderen Menschen auch. All das - und noch dazu das ungewohnte Essen, die Kälte und die ständigen Erklärungen, was sie tun und lassen sollen - ist so erschreckend für viele Flüchtlinge, dass sie krank werden. Sie bekommen Magen- und Kopfschmerzen und ziehen sich in sich selbst zurück. Auch Ali. Als ich in sein Zimmer trat, erschrak ich innerlich: wie grau er aussah, so ohne Lebensmut! Aber wieder überspielte ich meinen Schreck und strahlte ihn mit einem großen Lächeln an. Er strahlte mich ebenfalls an, kam auf mich zu und strahlte einfach weiter. Dann brach er in Tränen aus. »Meine Seele zerbricht, Fadumo!«
Sofort war mir klar: Ali hatte hier im Wohnheim zum ersten Mal in seinem Leben wirklich Frieden und Ruhe um sich herum. Er hatte ein Einzelzimmer und hätte sich eigentlich erholen können von den Gräueln des Bürgerkriegs und den Strapazen seiner Flucht. Aber wie immer, wenn die Ruhe kommt, kommt auch das Trauma. Ali schlief bei Licht, ständig hatte er Angst, im Schlaf überfallen und wie seine Geschwister getötet zu werden. Und er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er selbst in Sicherheit war; weil er seiner Familie nun nicht mehr helfen konnte; weil er nicht für seinen kleinen Bruder sorgen kann, der einen Schlag mit einem Gewehrkolben auf den Kopf versetzt bekommen hatte, sodass er seither nicht mehr sprechen kann und immer wieder in Ohnmacht fällt; weil er nicht bei seiner Mutter sein kann, die ihm das Leben geschenkt hat; weil er Essen hat, Frieden und Hilfe - und die anderen nicht. Alis Seele drohte tatsächlich zu zerbrechen - an den Schreckensbildern des Kriegs, die jetzt, in der Geborgenheit des Jugendheims, in ihm hochstiegen. Und seine gefühlte Isolation entkräftete ihn weiter: Eine Woche lang hatte er keinen Somali zu Gesicht bekommen oder in seiner Sprache gesprochen. »Aber jeder Mensch braucht doch einmal am Tag seine Sprache und seine Menschen«, sagte er mit flehenden Augen. Ali glaubte sogar, er sei taub: »Aber ich bin nicht taub«, sagte er dann tapfer lächelnd, »denn wenn ich meine Zimmertür zumache, kann ich mit mir selbst somalisch sprechen.« Da wusste ich, ich musste dringend Gesellschaft für den kleinen Ali organisieren.
Nicht, dass die Betreuung in dem Heim für minderjährige Flüchtlinge nicht gut gewesen wäre! Ganz im Gegenteil: Für Kinder, die unbegleitet kommen und um Asyl bitten, sind die Zustände ungleich besser als für Erwachsene. Es wird vorbildlich für sie gesorgt, ich bin immer ganz begeistert darüber, wie rührend und aufopfernd sich die Sozialarbeiter um die Kinder kümmern, wie sie sie trösten und vor allem: motivieren. Ich freue mich an den schönen Wohngemeinschaften, in denen zwei bis drei Kinder in einem Zimmer leben. Es gefällt mir, dass die Kinder sofort einen Deutschkurs bekommen und auch Taschengeld, damit sie wirtschaften lernen - von einer Woche zur nächsten. Sie haben gute, sensible und hochprofessionelle Sozialarbeiter, an die sie sich jederzeit wenden können. Sie lehren die Kinder auch, dass sie lernen müssen, ihre Wünsche zu äußern und dass sie das dürfen. Ich wäre damals, als ich nach Deutschland kam, um Heilung für meine Krankheit zu suchen, sehr gerne in ein solches Wohnheim gegangen. Ich hätte gerne eine Ausbildung bekommen, um mir Deutsch nicht mühsam selbst beibringen zu müssen. Es wäre mir bestimmt besser gegangen als in der Familie, in die mich mein reicher Onkel schickte; eine Familie, die mich täglich spüren ließ, dass ich nicht willkommen sei und dass sie damit nur meinem damals noch mächtigen Onkel einen Gefallen erwiesen. Aber wer weiß? Vielleicht wäre mein Leben nicht so verlaufen, wie es jetzt ist. Und es ist gut jetzt. Vielleicht hätte ich nicht gelernt, so zu kämpfen…
Jetzt würde ich für Ali kämpfen und gegen seine Isolation. Ich nahm mir vor, in meinem somalischen Bekanntenkreis ein paar Jungs und Männer zu mobilisieren, die ihn besuchen würden oder die Ali besuchen könnte, wenn er die Erlaubnis bekäme, nach München zu fahren. Bis dahin würde ich öfter bei Ali anrufen, damit er regelmäßig »seine Sprache und seine Menschen« bekäme. Gesagt - getan. Wir telefonierten oft miteinander, und auch meine somalischen Landsleute kümmerten sich um den Jungen. Wenn er mit ihnen zusammen war, war das wie Heimat für ihn.
Einmal sagte er mir am Telefon: »Hey, Fadumo, mir geht’s gut! Du bist ein Engel« - und ich sah sein Lachen durch den Hörer. Dann gab er mir den typischen somalischen Wunsch mit auf den Weg, einen Wunsch, den ich schon unzählige Male gehört hatte:
»Mögest du viele Söhne haben!«
Auch wenn Alis Einsamkeit nun vorerst gelindert war, seine seelischen Verletzungen konnte ich ihm nicht nehmen. Immer wieder kamen nachts die Albträume hoch, die Angst vor den Meuchelmördern, vor denen er geflohen war, die Angst um seine Geschwister, die diesen Mooryaan nun ohne ihn ausgeliefert sind. Tagsüber versuchte Ali, tapfer zu sein.
Dann kam Alis große Befragung - die Anhörung im Asylverfahren. Dabei geht es den Beamten vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge um die Details und Hintergründe der Flucht und des Asylantrags. Also darum, ob tatsächlich Gründe für ein politisches Asyl vorliegen. Die Aussagen der Asylbewerber werden auf Herz und Nieren geprüft, ihre Glaubwürdigkeit wird auf eine harte Probe gestellt.
RECHT AUF ASYL
Das Recht auf Asyl ist auf dem Papier eine wunderbare und gut durchdachte Sache. Ein Flüchtling, der nach Deutschland kommt, weil er in seinem Heimatland von staatlichen Stellen oder auch nichtstaatlichen Institutionen verfolgt wird, hat hier ein Recht auf Flüchtlingsschutz - auf Asyl. Dieses Recht zum Schutz vor Verfolgung hat die Genfer Flüchtlingskonvention 1954 nach den bitteren Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs festgeschrieben. Die im Dritten Reich staatlicherseits betriebene Verfolgung und Vernichtung von Juden (wegen ihrer Religion oder »Rasse«), von Sinti und Roma (wegen ihrer vermeintlichen Minderwertigkeit), von Homosexuellen (wegen ihrer vermeintlichen »Abartigkeit«), von Kommunisten (wegen ihrer anderen politischen Überzeugung) und von Behinderten (wegen ihrer vermeintlichen Lebensunfähigkeit) - all das waren die schrecklichen Fakten, aus denen man Lehren zog: Für derart staatlich Verfolgte sollte es zukünftig immer die Möglichkeit der Zuflucht im sicheren Ausland geben, die Möglichkeit des politischen Asyls - das war das vorrangige Ziel der Genfer Flüchtlingskonvention. Das Recht auf politisches Asyl, also den Schutz vor staatlicher Verfolgung im Heimatland, ist fest im deutschen Grundgesetz verankert und hat Verfassungsrang.
Im Laufe der nächsten Jahrzehnte und bis heute sah und sieht sich die Welt zunehmend konfrontiert mit auseinanderbrechenden Staaten oder gewaltsamen Umstürzen, also quasi-staatlichen oder sogar nicht-staatlichen Gebilden, in denen plötzlich gar kein echter Staat mehr existent ist, in denen Anarchie herrscht, Rebellen, Splittergruppen, Warlords und Clans blutig um die Macht rangeln oder Bruderkriege und Völkermorde ein Land zerfleischen. Vor allem in Afrika und im Nahen Osten ist das der Fall. Die Zivilbevölkerung leidet dabei am meisten - weil Menschen vielleicht zufällig dem »falschen« Stamm oder Clan, der »falschen« Religion oder dem »falschen« Geschlecht angehören; doch eigentlich sind ihre Verfolger keine staatlichen Akteure und ihre Verfolgung also kein Grund für politisches Asyl.
Dennoch trägt Deutschland prinzipiell auch für diese Flüchtlinge Sorge, wenn ihr Leben, ihre körperliche Unversehrtheit oder ihre Freiheit im Heimatland bedroht sind. Gesetzlich begründet wird dieses Recht auf Schutz vor Verfolgung mit dem Verweis auf die Genfer Flüchtlingskonvention; das Recht heißt aber eben nicht politisches Asyl, sondern Abschiebungsschutz - oder landläufig »kleines Asyl« - und ist auch nicht im Grundgesetz, sondern im Aufenthaltsgesetz verankert.
Übrigens ist die geschlechtsspezifische Verfolgung als Asylgrund (für das »kleine Asyl«) erst im neuen Zuwanderungsgesetz 2005 gesetzlich verankert worden. Erst jetzt hat eine Frau das Recht, vor Verfolgung geschützt zu werden, weil sie eine Frau ist und deshalb frauenspezifischer Gewalt ausgesetzt ist. Davor waren es einfach keine schutzwürdigen Gründe, dass eine Frau von sexualisierter Gewalt im Heimatland bedroht war, weil sie zufällig einem anderen Stamm angehörte als dem, der gerade die Oberhand hatte, und sie somit ein Objekt der sexuellen Gewalt als Mittel der Kriegsführung war. Es war kein Asylgrund, dass sie als Mädchen zwangsverheiratet werden sollte, weil es die muslimischen Regeln vermeintlich so wollten. Oder dass ein Mädchen beschnitten werden sollte, weil es die patriarchalische Tradition so wollte. All das sind mittlerweile zum Glück anerkannte Asylgründe. Erst seit 2005, aber immerhin. Heute kann ein Mädchen, das von Beschneidung bedroht ist, hier Asyl finden - und auch ihre Mutter. Ich bin gerne Zeitzeugin solch wunderbarer politischer und gesetzlicher Entwicklungen. Asyl zu gewähren ist eine hehre Errungenschaft humanistischer Gesinnung.
Auf dem Papier. In der Praxis, die ich alltäglich erlebe, sieht das deutlich nüchterner aus. Asyl ist hier ein bürokratischer Prozess, und wie alles, was menschliche Vielfalt mit einem administrativen Raster zu erfassen versucht, reicht die Bandbreite der Bürokratie im deutschen Asylverfahren von leidenschaftslosem Dienst nach Vorschrift bis hin zum verständigen und sensiblen Anwenden der Verwaltungsvorschriften mit menschlichem Antlitz.
Grundsätzlich wird im Asylverfahren der jeweilige Einzelfall geprüft. Die Menschen werden nicht über einen Kamm geschoren, jedes Flüchtlingsschicksal ist individuell und wird entsprechend ernst genommen und begutachtet. Das geschieht in der sogenannten »Anhörung« beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das in ganz Deutschland Anlaufstellen hat. Jeder Flüchtling muss sie absolvieren und auch Ali war nun dran. Die Anhörung ist eine ausführliche und auch lange Befragung. Der Beamte oder die Beamtin - sie heißen hier im BAMF »Einzel-Entscheider« - arbeitet sich dabei an einem Fragebogen entlang. Die 25 Fragen sind für alle Asylsuchenden gleich und müssen beantwortet werden - ohne Rücksicht auf das Individuum. Und dabei kommt es oft zu peinlichen Situationen.
Wie oft habe ich erlebt, dass ein somalisches Mädchen, eine Muslimin, nach ihrem Familienstand gefragt, antwortet: »Ledig« - und gleich darauf kommt die Routinefrage: »Haben Sie Kinder?« Das ist für viele eine solche Ehrverletzung, dass sie in Tränen ausbrechen und mich empört fragen: »Warum will der Beamte mich beleidigen? Ich hab doch gesagt, ich bin ledig, ich kann doch gar kein Kind haben!« Diese gleich zu Anfang gestellte Frage ist für die junge Frau oft eine solche Brüskierung, dass auch die ganze folgende Anhörung von Vorsicht und Misstrauen gegenüber dem Einzel-Entscheider geprägt bleibt. Doch das
Dieses Buch widme ich meinem Mann Walter und meinem Sohn Jama Philip. Sie machen mir in jeder Lebenslage Mut, beschützen mich und stärken mir den Rücken.
Copyright © 2009 Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Foto der Autorin und Fotos im Innenteil: Walter Korn
eISBN 978-3-641-05110-5
Weitere Informationen zu diesem Buch und unserem gesamten lieferbaren Programm finden Sie unter
www.koesel.de
Leseprobe
www.randomhouse.de





























