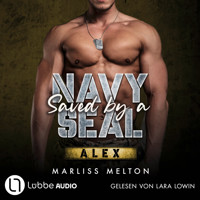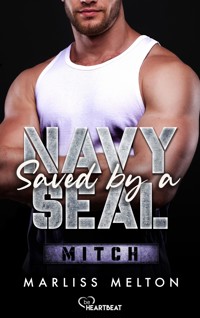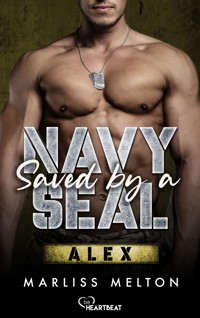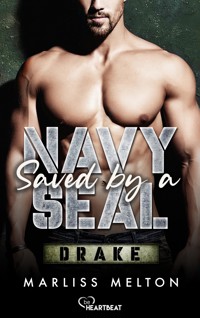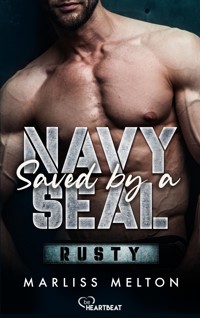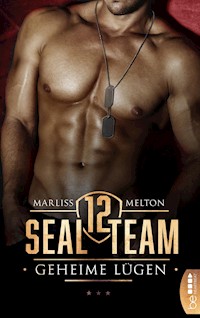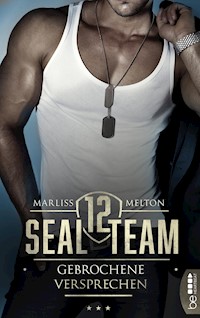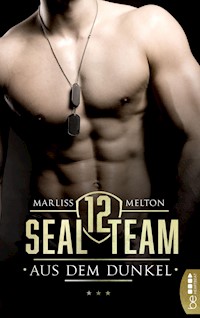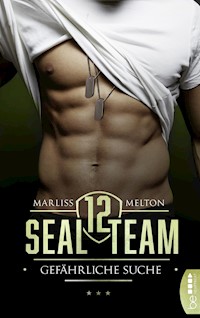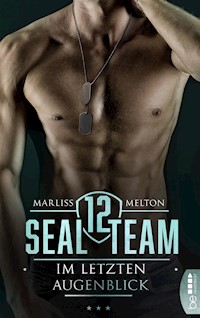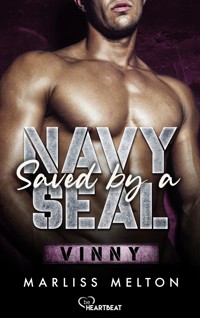6,99 €
2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: SEAL-Team-12-Reihe
- Sprache: Deutsch
Kann er seine Vergangenheit hinter sich lassen, um sie zu retten?
Die junge Penny Price wird von einem unbekannten Anrufer bedroht. Sie ist überzeugt, dass es sich um den Mörder ihres Vaters handelt, und fürchtet, dass sie sein nächstes Opfer sein wird. Hilfe erhält sie von ihrem Nachbarn, dem attraktiven Ex-Navy-SEAL Joe Montgomery - der kämpft jedoch mit den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit. Wird er sie trotzdem retten können?
"Knisternde Romantik." Publishers Weekly
Starke Helden und ganz viel Gefühl - die packende und wunderbar romantische Navy-SEALs-Reihe von Marliss Melton:
SEAL Team 12 - Aus dem Dunkel
SEAL Team 12 - Gebrochene Versprechen
SEAL Team 12 - Geheime Lügen
SEAL Team 12 - Bittere Vergangenheit
SEAL Team 12 - Gefährliche Suche
SEAL Team 12 - Im letzten Augenblick
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Epilog
Danksagung
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
SEAL Team 12 – Aus dem Dunkel
SEAL Team 12 – Gebrochene Versprechen
SEAL Team 12 – Geheime Lügen
SEAL Team 12 – Bittere Vergangenheit
SEAL Team 12 – Gefährliche Suche
SEAL Team 12 – Im letzten Augenblick
Über dieses Buch
Kann er seine Vergangenheit hinter sich lassen, um sie zu retten?
Die junge Penny Price wird von einem unbekannten Anrufer bedroht. Sie ist überzeugt, dass es sich um den Mörder ihres Vaters handelt, und fürchtet, dass sie sein nächstes Opfer sein wird. Hilfe erhält sie von ihrem Nachbarn, dem attraktiven Ex-Navy-SEAL Joe Montgomery – der kämpft jedoch mit den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit. Wird er sie trotzdem retten können?
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Marliss Melton hat fast überall in der Welt gelebt, da ihr Vater Diplomat war. Ihr Mann ist aus der Marine ausgeschieden. Sie nutzt ihre Weltkenntnis und ihre Militärkontakte, um realistische und aufrichtige Romane zu schreiben.
MARLISS MELTON
SEAL Team 12
BITTERE VERGANGENHEIT
Aus dem amerikanischen Englisch von Ralf Schmitz
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Marliss Arruda
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Next to Die«
Originalverlag: Forever
Forever is an imprint of Grand Central Publishing/Hachette Book Group, USA.
This edition published by arrangement with Grand Central Publishing, New York, NY, USA. All rights reserved.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30 161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2013/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Die Medienakteure, Hamburg
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © GettyImages|Nikolas_jkd; © GettyImages|triocean
eBook-Erstellung: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7517-2050-2
be-ebooks.de
lesejury.de
In Erinnerung an die drei Navy-SEALs, die am 28. Juni 2005 während eines Aufklärungseinsatzes im Rahmen der Operation Redwing in Afghanistan starben.
Michael Murphy
Danny Dietz
Mathrew G. Axelson
Und an die sechzehn Special Operators, die bei dem Versuch, sie zu retten, ums Leben kamen.
Und schließlich an den einzigen Überlebenden.
Dies ist nicht ihre Geschichte, aber sie ist
von ihrem Heldenmut inspiriert.
Möge Gott mit ihnen sein.
Bleiben sie auch weiterhin auf dem Pfad der Tugend.
»Über ihnen leuchtet ein Licht, und ein Engel steigt zu ihnen herab – er winkt ihnen, ihm zu folgen. Der Engel trägt eine Infanterieuniform aus dem Ersten Weltkrieg. Er sagt ihnen wortlos, sie sollten sich nicht fürchten. Soldaten sorgen im Himmel füreinander, sagt er, und dass man sie erwarte und ein großer Empfang für sie geplant sei.«
Zu Ehren der Gefallenen, CMDR Mark Divine
Prolog
Nordafghanistan
»Kontakt abbrechen«, flüsterte Joe in den Teamfunk, dann verließen er und die drei SEALs seines Kommandos den Trampelpfad und stiegen so leise wie möglich in die bewaldete Schlucht hinab. Auf dem Weg durch die Zypressen, die er durch sein Nachtsichtgerät grün leuchten sah, zählte Joe, wie viele Sekunden verstrichen, bis ihre Hinterlassenschaft – eine auf dem Trampelpfad deponierte Landmine – explodierte.
»… neunzehn, zwanzig.«
Rums! Auf die Detonation folgte das Geschrei aufständischer Taliban, derselben Männer, von denen sie vier Meilen weiter oben auf dem Pfad überrascht worden waren, als sie aus einer unterirdischen Höhle ausschwärmten. Unter schwerem Beschuss hatten sich die SEALs zurückgezogen und das Feuer erwidert. Es war ein langer Weg bis zur Landezone, und im Visier von vierzig oder mehr Männern mit Nachtsichtgeräten, deren Schüsse von den Bergen ringsum widerhallten, wurde er noch länger.
Um den Rückzug zu beschleunigen, hatten die SEALs ihre Rucksäcke auf dem Pfad abgeworfen. Da jeder von ihnen nur noch sechs Magazine hatte, mangelte es ihnen gleichermaßen an Munition und Kraft, als die Landezone, kurz LZ genannt, in Sicht kam.
Doch da lag sie vor ihnen, ein Plateau auf dem nächstgelegenen Berg, dessen Flanke vom Geschützfeuer der Luftwaffe durchlöchert worden war, rundherum befand sich verbranntes Gestrüpp und der Boden glich einer Mondlandschaft. Nun konnte man nur noch durch eine steil abfallende, bewaldete Schlucht und den Wiederaufstieg auf der anderen Seite dorthin gelangen.
Als sie den Grund der Schlucht erreicht hatten, blieben die SEALs in Deckung und befanden sich damit fürs Erste in Sicherheit. Nach der Zerstörung durch die Landmine war nun anstelle von Schüssen nur noch Geschrei und Gestöhne zu hören. Der Wind pfiff unheimlich durch die Zweige verkümmerten Immergrüns.
Wenn sie Glück hatten, würden die Explosion und die Tatsache, dass sie danach verschwunden waren, die Aufständischen in ihre Höhle und damit weg von der LZ treiben.
Dieser Aufklärungseinsatz hatte von dem Moment an, als Chief Harlan an hohem Fieber erkrankt war und Joe entschieden hatte, dessen Platz einzunehmen, unter keinem guten Stern gestanden, dachte Joe düster. Eine Stunde vor ihrer Landung hatte ein Spectre-Kanonenboot diesen Berg passiert, die feindlichen Kräfte auf dem Trampelpfad jedoch völlig übersehen. Schlimmer noch, das Kanonenboot befand sich nun außerhalb der Reichweite der vier SEALs. Sonst hätte ein Funkspruch genügt, und der AC-130-Kampfhubschrauber wäre ihnen zu Hilfe geeilt wie eine Adlermutter ihren Jungen. Mit dem kleinkalibrigen Geschütz des Helis ließen sich die ungefähr vierzig Aufständischen so präzise wie mit einem Skalpell ausschalten.
Zum Rückzug gezwungen, hatte Joes Einheit nur noch eine Option: die Bitte um Abzug. Wenn die Aufständischen nicht vor der Ankunft des Hubschraubers verschwanden und wenn sie – Gott bewahre – Raketenwerfer in ihrem Arsenal hatten, würde man diesen verfluchten Einsatz offiziell als Reinfall verbuchen müssen.
Joe blickte auf die Uhr. Das Zeitfenster war offen, der Satellit in Position, sodass Curry über SATCOM um Abzug der Einheit bitten konnte.
»Bravo, Bericht«, sprach Joe in sein Mikro.
»Curry hier«, flüsterte der Sanitäter.
»Smiley«, bestätigte ihr Scharfschütze.
»Nikko«, sagte der MG-Schütze. »Scheiße.«
Der Fluch ließ Joe aufhorchen. »Was ist los?«
»Wollte nur wissen, was mir da am Bein runterläuft. Oh, Scheiße!«
Das hörte sich nicht gut an. »Sammeln«, befahl Joe, um die Einheit enger um sich zu scharen.
Vier Schatten glitten aufeinander zu. Nikko atmete schwer. Dann klappte er neben Curry, dem Sanitäter, zusammen, der in die Knie ging, um sich die Wunde anzusehen. Joe tat es ihm gleich. Im Licht von Currys Taschenlampe erkannte er, wie schlimm es war. Allerdings war »Scheiße« nicht der Kraftausdruck, der Joe in den Sinn kam. Nikko steckte eine Kugel im Bein, ganz in der Nähe der Oberschenkelarterie. So blass, wie der MG-Schütze war, musste er bereits jede Menge Blut verloren haben. Was denn auch sonst – jetzt, da sie mit der Geschicklichkeit von Bergziegen zur LZ hinaufklettern mussten.
Sie mussten dringend um Abzug bitten. Sonst war es aus mit Nikko.
Während Curry verzweifelt versuchte, die Wunde abzubinden, nahm Joe ihm das Funkgerät ab. Ein paar Schritte entfernt setzte er es zusammen und kontaktierte ihren Einsatzleiter, Captain Lucas.
»Heli gestartet«, versicherte Lucas ihm.
»Blackhawk?«, fragte Joe in der Hoffnung auf ein schnittiges, unauffälliges Fluggerät.
»Kann ich keinen in die Luft bringen«, erklärte Lucas grimmig. »Wir schicken einen Chinook.«
Joe zerlegte mit einigem Bauchgrimmen das SATCOM. Das Getöse des anfliegenden Chinook würden die übrigen Aufständischen auf dem Pfad bestimmt nicht überhören, und so, wie der Einsatz bisher gelaufen war, verfügten die ganz sicher über Raketen.
»Los«, sagte Joe betont zuversichtlich. Als Einsatzleiter war es seine Hauptaufgabe, seine Einheit bei Laune zu halten und einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen.
Die Männer beeilten sich, seinem Befehl Folge zu leisten. Curry half Nikko auf die Beine und stütze ihn mit einem Arm. Smiley trat vor und nahm dem Verletzten sein M60 ab, um Curry zu entlasten. Trotzdem stand der Sanitäter vor der entmutigenden Aufgabe, sich selbst und Nikko zur LZ hinaufzuschleppen.
Als Erster befolgte Smiley den Befehl. Der schlanke, wendige Zwanzigjährige flitzte hinter den Bäumen hervor, um den fast senkrechten Anstieg in Angriff zu nehmen. Nach fünfzig Metern duckte er sich hinter einen Felsbrocken und brachte sein Gewehr in Anschlag, um Nikko und Curry Deckung zu geben. Die humpelten vorsichtig hinter ihm her, passierten seine Stellung und legten dann weiter oben auf dem Bergrücken eine Pause ein.
Nun war Joe an der Reihe. Körperlich war er so fit und kräftig wie die Jüngeren, doch er glitt mit seinem Stiefel auf dem unebenen Boden aus. Er gab alles, um mit mit seinem hageren Körper schnell voranzukommen, drückte sich vom Untergrund ab und kletterte, eine Hand über die andere setzend, auf sein Ziel zu: eine Felsnase, die fast die Form eines Tyrannosaurus Rex aufwies. Die Rotoren des anfliegenden Hubschraubers übertönten jetzt seinen Herzschlag.
Zweifellos hörten auch die Aufständischen das Geräusch. Los, los, drängte er sowohl den Heli als auch seine Männer. Es würde nicht lange dauern, bis der Feind die vier den gegenüberliegenden Berg erklimmenden SEALs entdeckte. Jedenfalls nicht, wenn auf dem Gipfel ein vier Tonnen schwerer Hubschrauber landete. Zu allem Übel begann am Horizont auch schon das Morgengrauen.
Wieder war es an Smiley, den anderen vorauszueilen. Er rappelte sich auf und nahm die Steigung, Nikkos M60 schien ihn nicht daran zu hindern. Gleichzeitig näherte sich der Chinook, seine Rotoren zerschnitten die Luft wie tausend Engelsflügel. Jeden Augenblick würden seine Umrisse am dunklen Himmel zu sehen sein.
Nun machten sich auch Nikko und Curry an den Aufstieg. Joe wollte gerade seine Stellung aufgeben, um Curry zu helfen, als die beiden Männer ausrutschten und strauchelten, sodass Joe nur noch bestürzt hinter ihnen herkraxeln konnte.
Da kam donnernd der Chinook in Sicht, allerdings befanden sie sich noch nicht einmal in der Nähe der LZ.
»Curry, Nikko!«, brüllte Joe, als er sie endlich erreichte.
»Konnte ihn nicht halten, Sir«, erklärte Curry. Nikko hatte das Bewusstsein verloren.
»Nehmen Sie seine Füße«, drängte Joe. Gemeinsam wuchteten und schleppten sie den Verletzten hinauf.
Doch im nächsten Augenblick zischten ein halbes Dutzend Raketen über sie hinweg. »Heilige Scheiße!« Die beiden Männer warfen sich schützend über Nikko. Ringsum schlugen Granaten in die Erde ein, wie Gischt spritzte Geröll auf und prasselte, der Schwerkraft gehorchend, auf ihre Rücken.
Als er sicher war, nichts abbekommen zu haben, spähte Joe zu dem Hubschrauber hinauf. Er wartete noch auf sie, die Rotoren schwirrten ungeduldig. »Los jetzt, weg hier!«, brüllte er, bereit, Nikko ohne einen weiteren Zwischenhalt bis hoch zum Bergkamm zu schleppen.
Doch weder Nikko noch Curry antworteten. Joe nahm sein Nachtsichtgerät ab. »Curry!«, schrie er ungläubig. Currys Schädel war zerschmettert, vermutlich durch Steinschlag.
Er schaltete sein Mikro ein. »Smiley, hierher. Beide sind tot!«
Wieder sah er hinauf und betete, dass der Chinook nicht abdrehte. Smileys Schatten glitt prompt zu ihm herunter, während vier weitere Raketen über die Schlucht auf sie zusausten.
Joe biss die Zähne zusammen, zog den Kopf ein und machte sich auf alles gefasst. Bumm, Bumm, Bumm, Bumm! Der Berghang bebte, spie Geröll und Erdklumpen, die gnadenlos auf Joes Rücken herabregneten. Als er aufblickte, war Smiley verschwunden. Joe tastete nach seinem Nachtsichtgerät, konnte aber auch das nicht mehr finden.
Jetzt war der Chinook seine letzte Hoffnung. Die Rampe war bereits ausgefahren, Verstärkung rückte mit Granatwerfern aus. Joe kam auf die Knie und winkte. Er brauchte Hilfe, um seine Männer zu bergen, sie in den Bauch des Hubschraubers zu schaffen und nach Hause zu bringen. Tot oder lebendig.
Aber es sollte nicht sein.
Wie eine Sternschnuppe flog eine weitere Rakete über die Schlucht. Für ein Stoßgebet blieb ihm gar keine Zeit.
Im nächsten Moment ging der Hubschrauber schon in einem riesigen, pilzförmigen Feuerball auf, Hitze schlug Joe entgegen und er wurde von brennenden Trümmern überschüttet. Die Wucht der Explosion warf ihn zurück, weit weg von Nikko und Curry.
Er fühlte, dass er hinabstürzte.
Dann schlug er auf, rollte, die Erde unter ihm fiel steil ab. Er versuchte sich abzustoppen, fiel aber zu schnell, schrammte über Felsen und Sträucher. Er krümmte sich, rollte, schützte Kopf und Extremitäten. Er brach durch die Zweige eines Immergrüns, krachte gegen eine Baumwurzel, prallte ab, rollte weiter.
Er stürzte, schlug auf, wirbelte herum, schlitterte über einen Laubteppich.
Rutschend kam er endlich zum Halt.
Als er ein Augenlid aufbekam, erspähte er durch Zedernzweige hindurch Flammen, die aus den Überresten des Helikopters schlugen. Rauchsäulen verdunkelten den heller werdenden Himmel. Joe atmete langsam ein, spürte schmerzhaft, wie sich seine Lungen mit Luft füllten. Und er krümmte sich, als er den Gestank von verbranntem Fleisch wahrnahm.
Aus der Schlucht waren Freudenschreie zu hören, danach Gewehrsalven. Die Guerillakämpfer feierten lautstark ihren Sieg.
Oh Jesus. Großer Gott.
Keine Seele an Bord des Chinook oder in seiner Nähe konnte diese Explosion überlebt haben. Seine Männer waren entweder tot oder lagen im Sterben.
So also fühlt sich eine Niederlage an, dachte Joe, während er das Bewusstsein verlor. Es war viel schlimmer, als er es sich vorgestellt hatte.
1
Auf das Läuten der Türglocke reagierte Lieutenant Penelope Price mit einem Stöhnen. Sie hatte sich eben erst auf ihr viel zu weiches Sofa sinken lassen, um sich die Sechs-Uhr-Nachrichten anzuschauen und sich dabei ein Stück Käsekuchen zu gönnen. Penny taten die Hände und Füße weh. Nach den Überstunden im Marinekrankenhaus, wo sie neben den eigenen Patienten auch die der Physiotherapeutin im Mutterschaftsurlaub betreute, hatte sie eine Auszeit verdient.
»Hoffentlich kein Vertreter«, murmelte sie, wobei sie den Käsekuchen auf dem Couchtisch abstellte. Während sie durch den zum Obergeschoss hin offenen Eingangsbereich zur Tür ging, zog sie den Gürtel ihres Veloursbademantels enger. Vielleicht war ihr Nachbar, der Navy-SEAL, von seinem Einsatz zurück und suchte nach seiner Katze.
Aber durch die Glasscheibe erblickte sie nicht das Gesicht des brandheißen Commanders Joe Montgomery, sondern das ihrer vierundzwanzigjährigen, anstrengenden kleinen Schwester Ophelia.
»Hi«, sagte Penny, auf Ärger gefasst. »Was gibt’s?« Mit der frischen Oktoberluft wehte der Geruch trockenen Laubs herein.
»Äh, ich muss eine Zeit lang hierbleiben«, antwortete Ophelia und warf dabei nervös einen Blick über die Schulter. »Kann ich mein Auto in deiner Garage parken?«
Penny schob sich nachdenklich eine kupferrote Haarsträhne hinters Ohr. »Du kannst nicht jedes Mal bei mir ankommen, wenn mal wieder eins deiner Beziehungsdramen zu Ende ist, Lia«, tadelte sie ihre Schwester.
»Tu ich auch nicht«, beruhigte Ophelia sie. »Aber ich muss mein Auto in deine Garage fahren. Bitte«, fügte sie noch hinzu.
Es war der Mangel an Theatralik, der Penny zum Einlenken bewegte. »Na gut«, meinte sie mit einem Nicken und warf einen Blick auf Lias Rostlaube. »Moment noch, ja, ich muss erst ein paar Sachen wegräumen.«
Kurz darauf hatte der 91er Oldsmobile bequem in der Einzelgarage Platz gefunden. Ophelia stieg aus dem Wagen und lud einen Koffer aus.
Penny beäugte das Gepäck, ein sicheres Zeichen dafür, dass ihre Schwester wieder einmal die Miete nicht hatte bezahlen können. »Und wie lange willst du bleiben?«, fragte sie, als sich das Garagentor ratternd schloss und die beiden in Dunkelheit hüllte.
»Weiß nicht«, gestand Lia. »Lass mich erst mal erzählen, was passiert ist, dann kannst du dir selbst ein Bild machen.«
Oh Mann, das klang nicht gerade vielversprechend. Besorgt und mit einem unguten Gefühl in der Magengegend ging Penny durch die Waschküche in ihr hart erarbeitetes Fünf-Zimmer-Einfamilienhaus vor. Eigentlich hatte sie dort mit einem Mann und Kindern leben wollen, aber sie war inzwischen neunundzwanzig und noch nicht verheiratet. Wenn ihre Schwester weiterhin regelmäßig bei ihr auf der Türschwelle stehen sollte, würde sie wohl nie ein normales Leben führen.
Ophelia setzte ihren Koffer im Hausflur ab und lief dann händeringend in die Küche.
»Es sind noch Reste da, falls du Hunger hast«, bot Penny ihr an und bemerkte jetzt erst, dass Lias Locken länger waren. Ihre Schwester trug ihr Haar fast wie sie selbst, nur stufiger, mit ein paar störrischen Ponyfransen. Während Penny sich bequem und zurückhaltend kleidete, ging Ophelia gern an die Grenzen des modisch Möglichen, trug Pailletten, Batik, Spitze und Perlen.
»Schon gut, ich hab keinen Hunger.« Doch als Lia die offene Schachtel Käsekuchen entdeckte, stürzte sie sich sofort darauf und schnitt sich ein großes Stück ab.
»Also, was war los?«, hakte Penny nach.
Ophelia ignorierte die Frage. »Hey, ich wusste gar nicht, dass du eine Katze hast«, sagte sie und deutete mit der Gabel in Richtung Wohnzimmer.
Commander Montgomerys Kater hockte über Pennys Nachtisch. »Felix!«, schimpfte sie, lief zu ihm und hob ihn hoch. »Der gehört nicht mir, sondern meinem Nachbarn.«
»Dem Navy-SEAL?« Lia zog die schmalen Brauen hoch, während sie sich den nächsten Riesenbissen in den Mund stopfte. »Schläfst du mit ihm?«
»Natürlich nicht«, antwortete Penny, die das Ablenkungsmanöver ihrer Schwester durchschaute. »Er ist irgendwo im Einsatz. Eigentlich sollte eine Freundin von ihm das Tier versorgen, aber die ist wohl unzuverlässig, und Felix frisst nun mal gern. Nicht wahr, Großer?« Sie kraulte den breiten Katzenkopf. »Können wir jetzt zum Grund deines Besuchs kommen?«
Ophelia ließ die Schultern hängen. Abrupt stellte sie ihren Teller auf den Küchentresen und schob ihn von sich. »Na ja, erst mal sind die Touristen wieder nach Hause gefahren, da verdiene ich als Kellnerin nicht mehr so viel Geld.«
»Stimmt«, sagte Penny. Im letzten Jahr war dasselbe passiert, damals hatte sie Lia zu einem richtigen Job geraten.
»Aber das ist noch nicht alles«, fügte ihre kleine Schwester mit einem kläglichen Seufzen hinzu.
Penny malte sich aus, was das Schlimmste wäre. »Ich hoffe, es hat nichts mit Daddys Notizbuch zu tun«, sagte sie flehentlich.
»Ich fürchte doch«, erklärte Ophelia kleinlaut.
»Oh, nein, was hast du angestellt?«
»Ich habe Eric angerufen«, gab Lia zurück und blickte Penny mit ihren hübschen, türkisblauen Augen um Verständnis heischend an. »Ich war sauer und wollte Antworten.«
»Was hast du ihm gesagt?«, fragte Penny und umfasste aus Wut darüber, dass ihre Schwester womöglich ihrer beider einzige Chance, sich Gerechtigkeit zu verschaffen, vermasselt hatte, die Katze fester.
»Ich wollte von ihm wissen, ob er nachts noch gut schläft, okay? Ich habe ihn nicht beschuldigt, das Rizin gestohlen oder Dad ermordet zu haben.«
»Und was hat er geantwortet?«
»Nichts. Er konnte nichts sagen. Du weißt ja, wie er redet. Er fing an zu stottern und zu stammeln. Ob du’s glaubst oder nicht, wenn er nervös ist, stottert er noch viel schlimmer – so nervös war er bestimmt nur, weil er Schiss hatte.«
Penny schaute ihre Schwester über Felix’ zuckende Ohren hinweg an. »Hat er dich bedroht?« Sie war sich nicht sicher, ob sie ihrer Schwester eine scheuern oder sie trösten sollte. »Wolltest du deshalb dein Auto in der Garage verstecken?«
»Ich hab’s doch gesagt, er kann nicht mal sprechen, sondern atmet nur so ins Telefon.«
»Atmet? Das hört sich an, als hättest du mehr als nur ein Mal mit ihm geredet.«
Lia schluckte. »Er hat seitdem ein paar Mal angerufen. Aber wie ich schon meinte, gesagt hat er eigentlich nichts.«
Penny fröstelte, als ihr klar wurde, wie besorgt ihre Schwester war. »Oh, Mann«, brummte sie. Ihre Entdeckung hatte Ophelia dazu gebracht, sich weit vorzuwagen, und nun zahlte sie einen hohen Preis dafür.
»Es tut mir leid«, gestand Lia ungewohnt demütig. »Ich weiß auch nicht, wieso ich ihn angerufen habe. Aber ich war so wütend.«
Pennys Verärgerung schlug in Mitleid um. »Ich weiß, Süße. Ich auch.« Sie überlegte, was nun zu tun war. »Nun, ich schätze, zu wissen, dass wir ihm auf der Spur sind, wird für Eric nichts ändern. Solange er nicht zwischenzeitlich untertaucht, kann das FBI ihn immer noch festnehmen.«
»Hast du denen Daddys Notizbuch schon gezeigt?«
»Nein, aber ich habe am Donnerstag einen Termin.«
»Oh, gut«, meinte Lia und rieb sich die Arme, als wäre ihr kalt.
»Ich bin froh, dass du für eine Weile bei mir wohnst«, fand Penny mit einem Mal. »Wenn wir zusammenhalten, stehen wir das alles bestimmt besser durch.« Der Gedanke, dass Ophelia Angst haben könnte, gefiel ihr nicht.
Ihre Schwester schenkte ihr ein dankbares Lächeln.
Felix schnurrte so laut, dass Penny zuerst nicht mitbekam, wie die Nachrichtensprecherin irgendetwas über die Navy-SEALs mitteilte. Doch dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit dem Fernseher zu und bedeutete Lia, still zu sein.
»… im Nordosten Afghanistans der schlimmste Vorfall in der Geschichte der Special Forces«, sagte die Sprecherin gerade. »Wie bestätigt wurde, gehören sechzehn Männer an Bord eines Chinook-Hubschraubers sowie drei in der Nähe aufgefundene SEALs zu den Opfern. Die Taliban geben an, einen vierten SEAL geköpft zu haben. Trotz dieser Behauptung ist eine beispiellose Suchaktion im Gang. Um wen es sich bei dem vermissten SEAL handelt, wurde indes noch nicht bekannt gegeben.«
Während die Sprecherin mit der Nachricht über einen Bombenanschlag im Irak fortfuhr, sah Penny durch das Fenster hinüber zu dem dunklen, verwaisten Haus ihres Nachbarn, und vor Mitgefühl wurde ihr schwer ums Herz. Sie fragte sich, ob Commander Montgomery die Opfer womöglich persönlich kannte. Schließlich gab es unter den Special Forces einen besonders starken Zusammenhalt.
»Meinst du, dein Nachbar hat was damit zu tun?«, fragte Ophelia, als sie bemerkte, wohin ihre Schwester schaute.
»Nein«, gab Penny entschieden zurück. »Er ist ein hochrangiger Offizier und war mit Sicherheit nicht direkt im Kampfeinsatz. Aber vermutlich kannte er viele dieser Männer«, fügte sie in dem Bewusstsein hinzu, dass dieser tragische Vorfall ihn tief getroffen haben musste. Als im vergangenen Jahr einer ihrer Nachbarn halbseitig gelähmt aus dem Irak zurückgekehrt war, hatte der SEAL eine Rollstuhlrampe gebaut und die Transporte ins Krankenhaus organisiert. Diese aufmerksame Art zeichnete ihn aus.
Außerdem hatte er einen ein Meter neunzig großen, gestählten Körper, von der Sonne gebleichtes Haar und graugrüne Augen zu bieten. Penny stand schon seit Jahren auf ihn, aber da ständig neue fantastische Frauen mit ihm im Whirlpool planschten, würde sie niemals beim ihm landen, so viel wusste sie. Außerdem tauschte er außer einem höflichen Gruß kaum je ein Wort mit ihr.
Er hatte keine Ahnung davon, dass sie sich um seinen Kater kümmerte und seinen Vorgarten pflegte, während er in der Weltgeschichte herumturnte und Soldat spielte.
Mit einem unterdrückten Seufzen griff sie nach ihrem halb verspeisten Stück Käsekuchen und trug ihn in die Küche. »Ich geh jetzt besser schlafen«, verkündete sie, hielt den Teller unter fließendes Wasser und schob ihn in die Spülmaschine. »Ich muss morgen früh zur Arbeit. Ich nehme an, du findest oben alles, was du brauchst.«
»Danke«, sagte Lia, ließ sich in den Sessel plumpsen und zappte durch die Fernsehkanäle.
Als Penny kurz darauf ins Bett schlüpfte, dachte sie an die neunzehn Männer, die ihr Leben verloren hatten. Sie trauerte ehrlich um sie und fühlte mit ihren Angehörigen, schließlich war sie Lieutenant der US-Marine und außerdem stolz auf ihr Land. Ihr fiel der Vermisste ein. Mach, dass er noch lebt, betete sie.
Bevor sie einschlief, kam ihr einmal mehr ihr anbetungswürdiger Nachbar in den Sinn. Sein Vorname war Joseph; wie sie mitbekommen hatte, nannten seine Freunde ihn Monty. Für sie war er jedoch eher Mighty Joe. Da er sich im Vorjahr so rührend um den Verwundeten gekümmert hatte, stand für sie einfach fest, dass Mighty Joe die jüngste Tragödie sehr nahegehen musste, und sie wünschte sich von ganzem Herzen, sie könnte ihn trösten.
Ich werde hier draufgehen, dachte Joe, als er in dem spärlichen Schatten eines Felsvorsprungs zusammenklappte.
Er keuchte, rang nach Atem, um seine schmerzenden Lungen mit Sauerstoff zu füllen. Wenig unterhalb des Gebirgskamms, mehr als viertausend Meter über dem Meeresspiegel, war die Luft entsetzlich dünn. Tagsüber wurde es warm, aber bei Nacht fiel die Temperatur extrem ab, sodass er in seiner staubigen Uniform fror.
Der beständige Wind stach ihn in seine verbrannten Wangen und er bekam rissige Lippen. Sein Mund war so trocken, dass seine Zunge schon ganz angeschwollen war. Wenn er nicht bald Wasser fände, würde er es von den Soldaten stehlen müssen, die ihm auf den Fersen waren. Was für ein Spaß.
Das für solche Fälle vorgesehene Evakuierungsmanöver war erbärmlich, ein weiterer Mangel bei diesem stümperhaften Einsatz. Joe wäre vermutlich besser dran, wenn er versuchte, durch die feindlichen Linien hindurch zu den Koalitionstruppen zu gelangen, statt auf der Suche nach dem vorgesehenen Evakuierungspunkt tiefer in den Hindukusch vorzudringen. Seit vier endlos langen Tagen wurde er nun bereits von Untergrundkämpfern verfolgt, die sich in diesem Gelände bestens auskannten. Und alles, was er in dieser Zeit gegessen hatte, war eine Eidechse, die sich auf einem Felsen gesonnt hatte.
Mehrere Male wäre er um ein Haar gefangen genommen worden. Doch die Todesangst – vor allem die Angst davor, enthauptet zu werden, eine Exekutierungsart, für die die Taliban berüchtigt waren – trieb ihn weiter an. Doch vergeblich, der Evakuierungspunkt blieb unerreichbar.
Er saß in einer tödlichen Falle, nichts erschien ihm mehr sinnvoll. Wie hatte alles so schnell den Bach hinuntergehen können? Warum fand er keinen Ausweg aus diesem Terrorlabyrinth?
Ein in der Ferne stattfindender Bombenangriff war sein einziger Bezug zur Realität. Die Amerikaner schlugen zurück.
Dann schoss eine ferngesteuerte Drohne über ihn hinweg und tauchte ins Tal hinab. Sie suchte nach ihm, ging ihm auf, und vor lauter Frust stiegen ihm Tränen in die Augen.
Er konnte seine Position nicht anzeigen. Mit seinem Schlapphut hatte er auch das Leuchtband verloren, das im Klettverschluss unter der Krempe versteckt war. Den Infrarotimpulsgeber hatte er zurückgelassen, als er seinen Leuten befahl, ihre Rucksäcke abzulegen. Seine Evakuierungsausrüstung samt Signalspiegel war bei dem tiefen Sturz vor vier Tagen verloren gegangen. Eine andere Möglichkeit, von diesem kargen Berghang aus SOS zu funken, gab es nicht.
Er konnte nur in Bewegung bleiben oder die Gefangennahme riskieren, doch er hatte sich bereits bis zur völligen Erschöpfung vorangeschleppt. Nun lag er in dem spärlichen Schatten des vorspringenden Felsens und machte keuchend seine womöglich letzten Atemzüge.
Verlor er den Verstand? Obwohl er eben noch nur das Heulen des Windes vernommen hatte, glaubte er nun Stimmen zu hören.
Er wollte sich aufrappeln, bekam aber gerade mal ein Auge auf. Als er sein Messer zog, entglitt es seinen steifen Fingern, fiel klirrend herunter und landete außerhalb seiner Reichweite.
Scheiße, damit war er am Ende.
Die Stimmen verstummten. Vorsichtigen Schrittes näherte man sich ihm.
Gott sei mir gnädig.
Mühsam stützte er sich auf die Ellbogen.
Mit verschwommenem Blick erkannte er blinzelnd zwei Männer. Sie trugen cremefarbene Gewänder und Turbane. Waren das Engel?, fragte er sich und blinzelte nochmals, um sie besser erkennen zu können. Doch dann hörte er Schafe blöken. Also mussten die beiden Hirten sein.
Sie kamen vorsichtig näher, berieten sich, blickten vorsichtig umher. Das einzige Wort, das Joe verstand, lautete »Amerki«. Amerikaner.
Als einer der beiden eine Klinge zog, zuckte er in Erwartung des Schlimmsten zusammen. Doch es war sein Messer, sie hatten es aufgehoben. Der Ältere legte es Joe auf den Bauch. Dann holte er eine Feldflasche aus Ziegenleder unter seinem Hirtenmantel hervor und hielt sie ihm mit wachsamem, bekümmertem Blick hin.
»Danke«, brachte Joe krächzend heraus. Er hob eine Hand, um die Feldflasche zum Mund zu führen, zitterte jedoch viel zu sehr.
Der Fremde half ihm. Als Joe die belebende Flüssigkeit schlürfte, musste er gegen den Drang ankämpfen, sie einfach hinunterzustürzen. Währenddessen sagte der Mann etwas zu seinem jüngeren Begleiter. »Komm«, wandte er sich dann an Joe und drängte ihn, sich aufzusetzen.
Der zögerte. Wer konnte wissen, ob diese Fremden ihn nicht den Taliban auslieferten? Als spürte er das Misstrauen, wiederholte der Mann: »Amerki.«
Durch die plötzlich aufkeimende Hoffnung kam wieder Leben in Joes Glieder. Vielleicht, nur vielleicht, würden sie ihm ja helfen.
Eric Tomlinsons Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Als er Ophelia Prices Apartment zum dritten Mal einen Besuch abstattete, steckte eine Deutsche mit Lockenwicklern in den Haaren den Kopf aus der gegenüberliegenden Wohnungstür und fragte: »Wieso klopfen Sie jeden Tag bei Lia, wenn Sie doch sehen, dass sie nicht zu Hause ist?«
Während ihm kalter Schweiß von der Schläfe zum Kinn hinabrann, setzte Eric ein unbehagliches Lächeln für sie auf. »Wissen Sie … w-w-w-wo sie ist?«, fragte er dann.
»Warum sollte ich Ihnen das erzählen?«, wollte die Frau wissen und beäugte seine hagere Gestalt misstrauisch.
»Ich muss … m-m-m-mit ihr re-re-re-reden.« Unter der Anstrengung, einen einwandfreien Satz herauszubekommen, erzitterte sein ganzer Körper.
»Nein, ich weiß nicht, wo sie ist«, antwortete die Nachbarin nachdrücklich und wollte die Wohnungstür schließen.
»Warten Sie!« Eric hechtete zu ihr hinüber und warf sich mit der Schulter gegen die Tür, bevor die Frau sie ganz zumachen konnte. »Doch, das wissen Sie!«, rief er vorwurfsvoll. Es stand ihr in ihr dickliches Gesicht geschrieben, als sie die Tür zuzustemmen versuchte.
»Gehen Sie. Sie wollte zu ihrer Schwester, okay? Hier sollen Freunde von ihr einziehen. Mehr weiß ich nicht!«
Ruckartig wich er zurück, die Wohnungstür fiel zu. Ihre Schwester? Ah, ja, Danny Prices ältere Tochter. Sie hatte Eric besser gefallen als die würdelose Ophelia. Aber Sonja, seine Frau, hatte die Jüngere lieber gemocht. Ist sie nicht schön?, hatte sie von deren rotblonden Haaren und türkisblauen Augen geschwärmt.
Ja, war er zumindest nach außen hin ihrer Meinung gewesen, aber die Ältere ist klug, wie ihr Vater.
Dessen Entdeckung hatte Eric vor nunmehr fünf Jahren fast in den Ruin getrieben. Danny war schließlich daran gestorben und hatte das Geheimnis mit ins Grab genommen.
Jedenfalls war Eric bisher davon ausgegangen.
Doch Ophelia Price schien die Wahrheit zu kennen. Können Sie nachts noch gut schlafen?, hatte sie von ihm wissen wollen.
Seit ihrem Anruf bekam er kein Auge mehr zu.
Wie war sie bloß darauf gekommen?, zermarterte er sich das Hirn. Hatte Danny irgendetwas Schriftliches hinterlassen? Einen Hinweis? Eine Botschaft aus dem Grab? Die ältere Schwester würde nicht lange brauchen, um das FBI einzuschalten.
Er musste alle beide zum Schweigen bringen, sonst würde es ihnen allen noch leidtun.
2
Afghanistan
Das Krankenhaus der Bagram Air Base bestand aus vorgefertigten Bauteilen und wurde mit Generatoren betrieben. Heißes Wasser gab es nicht.
Anstelle einer Katzenwäsche hatte Joe eine Dusche gewollt und stand nun zitternd im Waschraum unter dem Rinnsal, das aus dem Duschkopf drang. Mit einem Stück Seife machte er sich daran, den Dreck einer Woche von seinem Körper zu schrubben, wobei er auf die behandelte Verbrennung an der rechten Wange achtete, die er, wie man ihm gesagt hatte, trocken halten sollte.
Der Schaum brannte in den Schrammen und Blasen an seinen Händen. Sein eingefallener Bauch, die vorstehenden Hüftknochen, die aufgeplatzte Haut, all das zeugte davon, in welcher extremen Notlage er gewesen war.
Seine Rettung verdankte er einem Stammesältesten und dessen Sohn. Die beiden hatten die Koalitionstruppen verständigt, woraufhin sechs Männer der Joint Special Operations Task Force, kurz JSOTF genannt, zu dem abgelegenen Bergdorf geflogen waren, um ihren Einsatzleiter zu holen und nach Bagram zu bringen. Hier wuselten alle um ihn herum, kümmerten sich um ihn und ließen ihn keinen Augenblick lang genug Ruhe, um über seinen Anteil an der Katastrophe nachzudenken.
Joes Commander, Captain Lucas, gab den Taliban die Schuld. Großer Gott, gut, dass einer von euch zurück ist, Sohn, hatte er mit Tränen in den Augen gesagt. Wer hätte gedacht, dass die mit einer dreißig Jahre alten SA-16 Gimlet so einen Treffer landen? Aber das Scheißding hat denen die Arbeit abgenommen. Zur Hölle mit denen!
Er schickte ihn zur Genesung nach Hause. Sie brauchen Zeit, um das zu verarbeiten, Monty, bei diesen Worten hatte er seine Hände schwer auf Joes Schultern gelegt.
Weshalb war es bloß dazu gekommen?, fragte sich der SEAL, während er zusah, wie das Wasser in einem Wirbel abfloss. Er hatte alles befolgt, was ihm in der Ausbildung beigebracht worden war. Diese Männer hätten nicht sterben dürfen.
Mit einer Hand stützte er sich an der Duschkabine ab und schnappte krampfhaft nach Luft. Am liebsten wäre er unter der tonnenschweren Last auf seiner Brust zusammengesunken.
Bis zu diesem Desaster hatte er nur das Gefühl des Triumphs gekannt und nicht gewusst, wie schmerzhaft eine Niederlage sein konnte.
Sicher, er war ins Zweifeln geraten, als er es während des Unterwassertrainings der SEALs zum ersten Mal mit Männern zu tun bekommen hatte, die nicht so fit und konzentriert gewesen waren wie er. Aber selbst da hatte er bald gezeigt, was in ihm steckte, und sich von den anderen abgehoben.
Das Geräusch einer zufallenden Tür riss Joe aus seinen elenden Gedanken. Er drehte das Wasser ab und griff nach dem Handtuch, das er sich um die Hüften schlang. Als er den Duschvorhang zur Seite zog und mitten zwischen den Spinden Chief Harlan – »Harley« – stehen sah, erstarrte er.
Offenbar wollte der Mann mit ihm reden.
Sean Harlan war nicht groß. Joe überragte ihn nicht nur, er stellte ihn buchstäblich in den Schatten. Doch bei den Special Operations hieß das nicht viel. Harley gab mit seinem athletischen Körper, der in einem frisch gestärkten Wüstentarnanzug steckte, dem glatt wie ein Babypopo rasierten Schädel, den blauen Augen und dem etwas schiefen und gewandten Mund, wenn er sprach, eine beeindruckende Erscheinung ab. Der Ausdruck in seinen Augen und der Zug um seinen Mund schlugen mitunter im Bruchteil einer Sekunde von herzlicher Belustigung in kalte Gleichgültigkeit um.
Im Moment jedoch war seine Miene unergründlich, seine Gedanken ließen sich nicht erahnen.
Seit Harleys Eintritt in die JSOTF besaß Joe größten Respekt vor ihm. Nach sechzehn Jahren Kampferfahrung wusste der Mann mehr über die Taktik, Technik, Vorgehensweise, Bewaffnung und Einsatzplanung der SEALs als jeder andere Angehörige der Spezialeinheit, den Joe kannte – sich selbst nicht ausgenommen.
Joe grüßte ihn mit einem Nicken. »Chief.« Eigentlich hatte Harley den Einsatz leiten sollen, doch als dieser hohes Fieber bekam, hatte sich Joe in letzter Minute dazu entschieden, dessen Aufgabe zu übernehmen, statt die Aufklärungsmission zu verschieben, für die ihnen ohnehin nur ein enges Zeitfenster zur Verfügung stand.
Harley blickte auf Joes Verband. »Sir.« Dann musterte er Joes Gestalt mit seinen blauen Augen, so als suchte er nach sichtbaren Beweisen für seine Mühen.
Joe hatte fünfzehn Pfund Gewicht verloren, seine Wangen waren eingefallen und sonnenverbrannt, die Lippen warfen Blasen und er hatte geschwollene Hände und Füße.
Als Harley ihm schließlich in die Augen sah, ließ der grimmige Zug um seinen Mund durchaus auf Mitgefühl schließen. »Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben, Sir«, sagte er schroff.
Joe fühlte eine unsichtbare Schlinge um den Hals. »Danke«, brachte er heraus.
»Berichten Sie mir, was passiert ist«, verlangte Harley mit vor Emotionen rauer Stimme, in der zu Joes Entsetzen etwas Vorwurfsvolles mitschwang. Die hellblauen Augen des Chiefs glänzten feucht, die Hände ballte er an seinen Seiten zu Fäusten. »Das waren meine Jungs«, fügte er hinzu. »Ich bin für sie verantwortlich gewesen.«
Angesichts der Möglichkeit, dass Harley ihm die Schuld an dem Vorfall geben könnte, trat Joe der kalte Schweiß aus den Poren. »Auf einmal ging alles schief«, versuchte er sich zu verteidigen. »Wir wurden entdeckt und gerieten in ein Feuergefecht mit ungefähr hundert von denen. Das Kanonenboot war nirgends in Sicht. Nikko wurde getroffen und stürzte, wir mussten ihn schnell da rausschaffen. Die Tangos hatten Granatwerfer, uns ging die Munition aus.« Er konnte unmöglich aufzählen, was alles zu ihrem Nachteil gelaufen war.
Doch Harley schüttelte den Kopf. Offenbar genügten ihm alle diese Gründe nicht. »Ich hätte bei ihnen sein müssen«, beharrte er.
»Sie waren krank«, rief Joe ihm ins Gedächtnis. Gleichzeitig fragte er sich, ob es ein Fehler gewesen war, Harleys Position zu übernehmen. Wäre alles anders gekommen, wenn er noch ein, zwei Tage zugewartet oder Harlan mit Fieber in den Einsatz geschickt hätte?
»Ich wollte nicht, dass Sie meine Aufgabe übernehmen«, erinnerte Harley ihn. »Ich hätte den Einsatz selbst leiten können. Fieber hin oder her.«
Joe fühlte sich benommen und stellte sich für einen festeren Stand breitbeiniger hin. Er war sicher gewesen, dass er das Richtige tat. Es befanden sich Truppen im Kampf, die auf die Ergebnisse der Mission warteten. Aber was, wenn er unbewusst auf einen letzten Einsatz aus gewesen war? »Unter Ihrem Kommando wäre es auch nicht anders gekommen.«
»Kann sein«, räumte Harley ein, »aber das waren meine Männer.«
Joes Knie zitterten. Vielleicht gab Harley ihm ja gar nicht die Schuld. Vielleicht versuchte er nur genauso wie Joe, die unbegreifliche Tatsache zu verarbeiten, dass die Soldaten, mit denen sie Trainings absolviert, mit denen sie gegessen, ihre Geschichten geteilt und brenzlige Situation überstanden hatten, nun tot waren.
»Sie waren auch meine Männer«, konterte Joe und hielt dem stechenden Blick des anderen nur mit Mühe stand. »Und es tut mir leid, Sean«, ergänzte er, woraufhin das Kinn des Chiefs leicht zu beben begann. »Es tut mir so verdammt leid, dass es so ausgegangen ist.«
Resigniert nahm Harley einen entspannteren Gesichtsausdruck an. Schweigen stellte sich ein, wirkte tief und verheerend wie eine tödliche Wunde. »Ich hoffe, Ihre Verbrennungen heilen gut, Sir«, sagte der Chief, wobei er nickend auf Joes Verletzung deutete.
»Danke.«
Dann straffte der Mann sich und salutierte zackig.
Trotz seines bleischweren Arms schaffte Joe es, den Gruß zu erwidern.
Harley machte auf dem Absatz kehrt und verließ ohne ein weiteres Wort die Waschräume.
Drei Sekunden verstrichen, dann ließ Joe sich auf eine der Bänke vor den Spinden sinken.
Himmel, was, wenn es wirklich sein Fehler war?
Er vergrub das Gesicht in den Händen und erschauerte.
Es vergingen weitere drei Tage, während der er an Einsatzbesprechungen teilnahm, Papierkram erledigte, packte und die Rückreise antrat, bis er endlich wieder zu Hause ankam. Joe lenkte seinen schwarzen Jeep mit Verdeck in die Auffahrt seines Sechszimmerhauses in einem Vorort von Virginia Beach, stellte den Motor ab und starrte vor sich hin.
Früher hatte er Urlaub als ein notwendiges, ärgerliches Übel zwischen seinen Einsätzen betrachtet. Doch diesmal gab es keinen neuen Auftrag, auf den er sich freuen konnte. Er würde nicht in sein Team zurückkehren.
Sie sind zu lange dabei, um Operations Officer zu bleiben, hatte Captain Lucas erklärt. Es wird Zeit, dass Sie das Kommando über eine Einheit übernehmen. Fahren Sie heim und warten Sie auf den Anruf der Einsatzleitung.
Doch sein Zuhause kam ihm seltsam fremd vor. Als er im Mai aus Virginia aufgebrochen war, hatte noch der Hartriegel geblüht. Jetzt war Ende Oktober, und der zehn Jahre alte Ahorn in seinem Vorgarten trug bereits orange verfärbte Blätter. Das leuchtende Laub des Baums und die Blumenbeete unterschieden sein Haus von den anderen. Er hatte einen Jungen dafür bezahlt, den Sommer über seinen Rasen zu mähen. Und von irgendjemandem war offenbar Laub geharkt worden, denn sein Vorgarten sah tadellos aus.
Zu teilnahmslos, um dafür dankbar zu sein, stieg Joe aus seinem Wagen aus und verzog angesichts der Schmerzen das Gesicht. Inzwischen war herausgekommen, dass er sich bei dem Sturz nach der Explosion eine Rückenverletzung zugezogen hatte. Doch er verzichtete auf die verschriebenen Medikamente. Die Schmerzen lenkten ihn von der Tragödie ab.
Er hatte gerade die Autotür zugeworfen, da nahm er das Geräusch schneller, vom Gras gedämpfter Schritte wahr und blickte auf. Seine Nachbarin – wie hieß sie noch gleich? – kam mit seinem schwarz-weißen Kater auf dem Arm über den Rasen auf ihn zugeeilt.
»Sir!«, rief sie mit freundlicher Stimme. Ihr schüchternes Lächeln gefror auf ihren Lippen, als sie die scheußlichen Verbrennungen bemerkte, im nächsten Moment fasste sie sich jedoch wieder. »Sie sind wieder da«, bemerkte sie und blieb auf Höhe des Vorderrads seines Wagens stehen.
»Ja«, gab er schroff zurück. Er freute sich, seinen Kater zu sehen, hatte aber keine Lust auf einen Plausch.
Ihre wasserblauen Augen zogen ihn in ihren Bann. »Ich war in Sorge«, erklärte sie, dann schienen ihre nächsten Worte regelrecht über ihn hereinzubrechen. »Ich habe in den Nachrichten von dem schrecklichen Vorfall gehört. Es tut mir furchtbar leid. Sie haben bestimmt einige sehr gute Freunde verloren.«
Ihre Aufrichtigkeit war zu viel für ihn. »Danke.« Joe musste den Blick auf seinen Kater senken. »Na, Felix, mein Dicker. Wie kannst du der Dame bloß ihre Zeit stehlen?« Er trat näher und tätschelte dem Tier den Kopf.
»Oh, das ist kein Problem«, versicherte ihm die Nachbarin. »Felix hat bloß gemerkt, dass er regelmäßig gefüttert wird, wenn er zu mir kommt. Ihre, äh, Katzensitterin ist nicht besonders zuverlässig.«
Joe sah auf, als sie in so kühlem Tonfall über seine Freundin Barbara sprach. Er bemerkte, dass die Frau den Schorf und die Schrammen an seiner Hand musterte, und zog den Arm zurück. Dann wandte er sich ab, um seinen Seesack von der Rückbank des Jeeps zu nehmen. Unter dem Gewicht stöhnte er auf. Er drehte sich wieder um und griff mit seiner freien Hand nach dem Kater. »Danke fürs Aufpassen«, murmelte er.
Die Nachbarin gab Felix mit vor Sorge gerunzelter Stirn her. »Falls ich irgendetwas für Sie tun kann …«, bot sie an.
»Danke«, sagte er erneut, diesmal cooler. In ihm sah es jedoch ganz anders aus. Er kam sich entblößt und verwundbar vor, war vollkommen aus der Fassung.
»Ich bin froh, dass Sie wieder zu Hause sind«, sagte sie und trat zurück. Dann drehte sie sich mit einem weiteren schüchternen Lächeln und zittrigen Fingern um und marschierte entschlossen über den Rasen davon. Ohne Hüftschwung – jedenfalls nicht mit einem absichtlichen.
Verwirrt von ihrer Freundlichkeit, beschloss Joe, sich keine Gedanken über sie zu machen. Er hob den Kater hoch und sah ihn vorwurfsvoll an. »Du bist herumgestromert, wie?«
Felix guckte selbstzufrieden, antwortete mit einem Schnurren und gab Joes Kinn mit dem Kopf einen Stups.
»Lügner«, brummte Joe auf dem Weg zu seiner Haustür. Bei jedem Schritt verspürte er Schmerzen in der rechten Rückenhälfte.
Penny machte langsam die Tür zu und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Du meine Güte! So hatte ihr Nachbar bei seiner Abreise aber noch nicht ausgesehen. Er war hager, sonnenverbrannt und hatte mehr Kratzer und Schrammen als ein agiler Dreijähriger. Dann erst diese Wunde unter dem Auge! Wie außer durch eine absichtliche Verbrennung oder einen schrecklichen Unfall konnte man sich eine derart schlimme Brandwunde zuziehen?
Armer Kerl. Ihr fiel ein, wie er beim Ausladen der Tasche aus dem Jeep aufgestöhnt hatte, und sie begriff, dass er unter Schmerzen litt. Was ihm wohl wehtat? Der Rücken?
Als Physiotherapeutin im Portsmouth Naval Medical Center kümmerte sich Penny um Patienten mit allen möglichen Verletzungen. Der Anblick von Joe Montgomerys qualvoll verzerrtem Gesicht hatte ihr genügt, um zu wissen, dass dieser Mann durch die Hölle gegangen war.
Aber warum? Ein Commander saß in seinem Büro und delegierte. Die gefährliche Arbeit erledigten rangniedere Offiziere und Mannschaftsgrade. Vermutlich hatte er einen Autounfall gehabt. Das würde jedenfalls seinen Zustand, die Blessuren im Gesicht und die Rückenverletzung erklären.
Ja, so musste es gewesen sein. Betroffen, aber zufrieden mit ihren Schlussfolgerungen, stieß sie sich von der Tür ab.
Um zehn Uhr am selben Abend war sie sich da jedoch nicht mehr so sicher.
»Hey, wie’s aussieht, ist dein SEAL wieder da«, verkündete Ophelia, als sie vom Hafenviertel zurückkehrte. »Im Haus brennt überall Licht.«
»Ich weiß«, sagte Penny, die auf dem Sofa saß und auf einem Niednagel herumkaute. So eine Stromverschwendung passte nicht zu ihrem Nachbarn. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm. »Wie war die Arbeit?«
»Zäh«, erklärte Ophelia, ließ sich aufs Sofa fallen und langte nach der Fernbedienung.
»Warum suchst du dir keine richtige Arbeit?«, schlug Penny mit einem Blick auf Lias Hooters-T-Shirt vor.
»Richtige Arbeit ist öde«, gab ihre Schwester zurück, während sie durch sämtliche Kanäle zappte.
Penny war versucht, verzweifelt die Arme in die Luft zu werfen. Würde Lia jemals den Ernst des Lebens begreifen? »Ich muss dich um einen Gefallen bitten«, sagte sie entschlossen.
»Was?«, fragte Lia mit bangem Blick.
»Ich habe heute erfahren, dass ich morgen arbeiten muss. Meine Kollegin ist im Mutterschaftsurlaub, und bis ihre Vertretung kommt, sind wir unterbesetzt. Ich kann also nicht zu dem Termin beim FBI um zwei.«
»Kannst du keinen neuen ausmachen?«
»Klar, kann ich, wenn wir noch zwei Wochen warten wollen. Wenn man bedenkt, dass Eric von unserem Verdacht weiß, halte ich das aber nicht für besonders klug. Oder was meinst du?«
Ophelia sah sie verständnislos an. »Und was soll ich da machen?«
»Ich möchte, dass du an meiner Stelle hingehst. Nimm das Beweismaterial mit und erklär einem FBI-Beamten, was wir vermuten.«
Ophelia ließ sich stöhnend gegen die Sofalehne sinken. »Ich habe befürchtet, dass du das sagst.«
»Ach, komm schon, Süße, du kannst das«, versicherte Penny ihr. »Das FBI ist in Norfolk, direkt an der Kreuzung 264 und Military Highway. Du verfährst dich schon nicht. Ich geb dir sogar zwanzig Dollar Spritgeld«, versuchte sie, ihre Schwester zu locken.
Ophelia verzog das Gesicht. »Na schön, ich mach’s«, lenkte sie ein.
»Super«, sagte Penny und sprang auf. »Das Notizbuch liegt schon auf dem Küchentresen und das Benzingeld auch. Vergiss nicht, denen den Ausdruck der E-Mail vorzulegen.«
In dem Moment klingelte das Telefon neben dem Sofa. Beide schraken auf.
»Für mich kann das nicht sein«, meinte Penny. Alle ihre Freundinnen waren verheiratet, die kuschelten jetzt mit ihren Ehemännern oder brachten ihre lieben Kleinen ins Bett.
Also griff Ophelia nach dem Telefon und hob vorsichtig ab. »Hallo?«
Penny spitzte die Ohren, um mitzubekommen, wer sich meldete.
»Hallo«, wiederholte Lia, und die angespannten Züge ihrer Schwester verrieten Penny, dass es sich um einen anonymen Anruf handelte – einen wie jene, die Ophelia aus ihrer Wohnung vertrieben hatten.
»Fahr zur Hölle«, schimpfte diese und knallte den Hörer auf. »Das war wieder Eric«, verkündete sie dann händeringend.
Penny zog sich vor Sorge der Magen zusammen. »Leg einfach den Hörer daneben«, riet sie. »Wenn wir nicht abnehmen, kann er uns nicht auf die Nerven gehen.«
»Stimmt.« Damit rammte Ophelia den Hörer zwischen die Sofakissen.
Doch ihre Angst, Eric könnte etwas unternehmen, bevor sie dem FBI ihr Beweisstück übergeben hatten, konnten sie nicht so leicht wegstecken. »Sei morgen vorsichtig«, sagte Penny. Sie wollte Lia nicht weiter beunruhigen, aber auf der Hut zu sein zahlte sich meistens aus. »Und ruf mich im Krankenhaus an, sobald du zurück bist«, fügte sie hinzu. »Ich will wissen, was das FBI für uns tun wird.«
Dass Eric ein tödliches Gift gestohlen und verkauft hatte, würde sicher das Interesse der Behörden wecken.
»Mach ich«, versprach Ophelia. »Gute Nacht, Pen.«
»Nacht.« Bevor sie nach oben ging, überprüfte Penny noch, ob alle Türen verschlossen waren. Schließlich kroch sie in ihr breites, gemütliches Bett, doch das Gefühl, in Gefahr zu schweben, ließ sie nicht los und hinderte sie am Einschlafen. Als ihre Schwester in das gegenüberliegende Gästezimmer ging, lag sie immer noch wach.
Vom kaum sechs Meter entfernten Nachbarhaus fiel Licht in ihr Bad, aber sie konnte sich nicht dazu aufraffen, die Tür zu dem Zimmer zu schließen.
Mighty Joe war daheim. In Sicherheit. Er bereicherte diese Welt noch mit seiner Gegenwart. Ihm war jedoch irgendetwas Schreckliches zugestoßen. Das spürte sie.
Was, wenn sie ihn einfach danach fragte? Vermutlich wusste er sowieso, dass sie auf ihn stand. Welche Frau, die von ihrem Haus aus auf seinen Whirlpool schauen konnte, täte das nicht? Er war vom Scheitel seiner goldbraunen Haare bis zu den Waden auf markante Weise schön. Die Narbe im Gesicht würde daran nichts ändern. Er besaß ein dermaßen selbstsicheres Auftreten, dass es kaum vorstellbar war, ihm könnte irgendetwas misslingen. Ein Mann wie er wäre von ihrer überfürsorglichen Art bestimmt nicht gerade angetan.
Trotzdem hatten sie heute mehr ausgetauscht als einen höflichen Gruß. Oder war das lediglich Wunschdenken? Er hatte sie aus seinen tief liegenden, graugrünen Augen angesehen, und ihr war bewusst geworden, dass er sie da zum ersten Mal wirklich wahrnahm.
Es war nicht gerade der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, aber immerhin mal ein Anfang. Penny schloss seufzend die Augen und träumte davon, ihren Nachbarn besser kennenzulernen.
3
Lia fand die dunkle Backsteinfassade der FBI-Niederlassung in Norfolk genauso einschüchternd wie erwartet – was auch an den Betonabsperrungen ringsum und den unzähligen Sicherheitsvorkehrungen liegen mochte. Die Wachen gaben sich nicht damit zufrieden, ihre riesige Handtasche zu durchleuchten, sie durchsuchten sie sogar und beschlagnahmten sowohl das Handy ihrer Schwester als auch ihre Dose Pfefferspray. Für ihre bestickte Jeans und den korallenroten Stricksweater erntete sie missbilligendes Stirnrunzeln.
In dieser Umgebung, die für alle Regeln stand, über die sie sich normalerweise hinwegsetzte, fühlte Lia sich wie ein Fisch auf dem Trockenen.
Aus Protest und vor lauter Entsetzen wäre sie fast aus dem Gebäude geflohen, doch dann wurde sie von einer Mitarbeiterin im Wartebereich abgeholt, die kaum älter als sie selbst war, feuerrote Haare hatte und lächelte, als wäre sie zu jeder Schandtat bereit. Obendrein war ihr honigfarbener Hosenanzug ganz nach Lias Geschmack.
»Hi, ich bin Special Agent Lindstrom«, stellte sich die Frau vor und hielt ihr die Hand hin. »Nennen Sie mich Hannah.«
»Ophelia Price«, sagte Lia und stand auf. Die FBI-Mitarbeiterin musste über einen Meter achtzig groß sein, Lia kam sich ihr gegenüber winzig vor. »Ich bin anstelle meiner Schwester Penelope hier«, erklärte sie. Als die Frau die Augenbrauen hochzog, fügte sie hinzu: »Wir wurden nach unseren Großmüttern benannt.«
»Aha«, erwiderte Hannah Lindstrom mit einem Nicken. »Tja, dann kommen Sie mal mit.«
Sie verließ den Empfangsbereich und ging mit Lia durch einen Korridor zu einem Zimmer, das ungefähr die Größe eines Kleiderschranks besaß. »Hier führen wir unsere Befragungen durch«, erklärte sie, setzte sich hinter einen Schreibtisch und bedeutete Ophelia, auf einem der beiden Stühle ihr gegenüber Platz zu nehmen. »Kann ich Sie für Kaffee begeistern?«, fragte sie und zeigte auf die auf einem Serviertisch thronende Kaffeemaschine.
»Oh, nein danke. Ich bin schon nervös genug.«
»Es gibt keinen Grund, nervös zu sein«, versicherte Hannah ihr und verschränkte ihre langen Finger ineinander. An ihrer linken Hand funkelte ein ansehnlicher Diamant. »Was kann ich für Sie tun?«
Lia durchwühlte ihre Handtasche und nahm das Notizbuch heraus, das mitzunehmen Penny sie gebeten hatte. Dann zog sie ein Blatt Papier aus dem Rücken der Kladde und faltete es auseinander. »Unser Vater ist vor fünf Jahren bei einem Autounfall gestorben. Sein Wagen kam von der Straße ab. Damals bestand der Verdacht, dass er abgedrängt wurde, aber es ließ sich nichts nachweisen. Jetzt hat Penny das hier in Daddys Notizbuch gefunden.« Damit reichte sie die ausgedruckte E-Mail über den Schreibtisch.
Die FBI-Agentin überflog das Blatt Papier mit ihren apfelgrünen Augen. »Wer ist Eric Tomlinson?«, fragte sie dann.
»Ein Kollege meines Vaters. Sie haben bei BioTech zusammengearbeitet, einem Biochemielabor in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Langley.«
Die Agentin deutete mit einem Nicken an, dass sie schon von dem Unternehmen gehört hatte.
»Kurz bevor mein Vater ums Leben kam, verschwand ein giftiges Abfallprodukt namens Rizin aus dem Labor. Die Presse hat darum einen Riesenwirbel gemacht.«
»Rizin«, wiederholte die Agentin mit erwachendem Interesse. Als sie den Text der E-Mail studierte, zog sie ihre rotbraunen Brauen zusammen.
»Heute Morgen wurden vierundsechzigtausend Dollar auf das angegebene Konto überwiesen«, las sie laut vor. »Warum hat Ihr Vater das aufgehoben?«