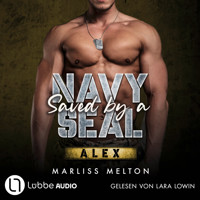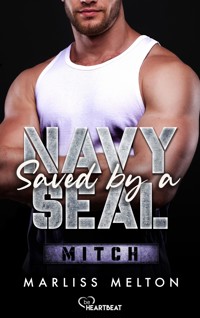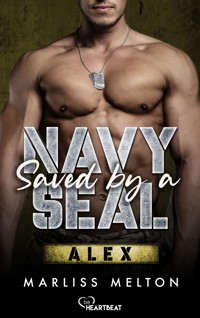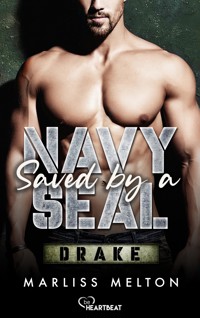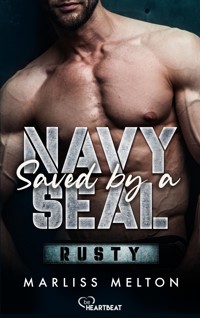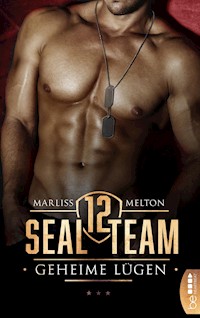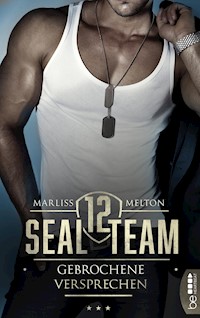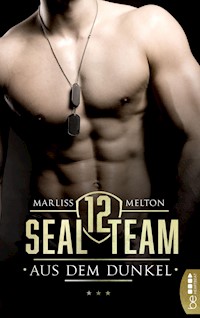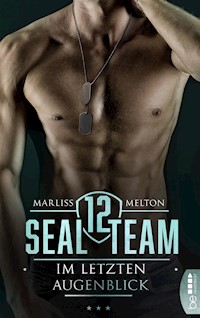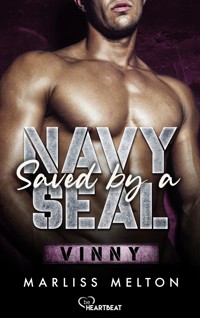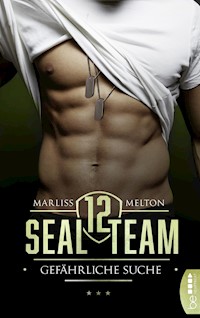
6,99 €
2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: SEAL-Team-12-Reihe
- Sprache: Deutsch
Er hat ihr alles genommen. Wird sie ihm das je verzeihen können?
Jordan Bliss arbeitet als Lehrerin in Venezuela und möchte den vierjährigen Miguel adoptieren. Doch dann kommt es zu einem Aufstand, und Jordan muss Venezuela verlassen. Der kleine Miguel wird ihr von dem attraktiven Navy SEAL Solomon McGuire aus den Armen gerissen. Es zerreißt sie fast vor Trauer, doch Jordan gibt nicht auf. Ihr ist klar, was sie tun muss: nach Venezuela zurückkehren und ihren Sohn holen - und Solomon wird ihr dabei helfen.
"Ich kann diese talentierte Autorin nur wärmstens empfehlen. Fesselnd und ereignisreich!" New-York-Times-Bestsellerautorin Heather Graham
Starke Helden und ganz viel Gefühl - die packende und wunderbar romantische Navy-SEALs-Reihe von Marliss Melton:
SEAL Team 12 - Aus dem Dunkel
SEAL Team 12 - Gebrochene Versprechen
SEAL Team 12 - Geheime Lügen
SEAL Team 12 - Bittere Vergangenheit
SEAL Team 12 - Gefährliche Suche
SEAL Team 12 - Im letzten Augenblick
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Epilog
Danksagung
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
SEAL Team 12 – Aus dem Dunkel
SEAL Team 12 – Gebrochene Versprechen
SEAL Team 12 – Geheime Lügen
SEAL Team 12 – Bittere Vergangenheit
SEAL Team 12 – Gefährliche Suche
SEAL Team 12 – Im letzten Augenblick
Über dieses Buch
Er hat ihr alles genommen. Wird sie ihm das je verzeihen können?
Jordan Bliss arbeitet als Lehrerin in Venezuela und möchte den vierjährigen Miguel adoptieren. Doch dann kommt es zu einem Aufstand, und Jordan muss Venezuela verlassen. Der kleine Miguel wird ihr von dem attraktiven Navy SEAL Solomon McGuire aus den Armen gerissen. Es zerreißt sie fast vor Trauer, doch Jordan gibt nicht auf. Ihr ist klar, was sie tun muss: nach Venezuela zurückkehren und ihren Sohn holen – und Solomon wird ihr dabei helfen.
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Marliss Melton hat fast überall in der Welt gelebt, da ihr Vater Diplomat war. Ihr Mann ist aus der Marine ausgeschieden. Sie nutzt ihre Weltkenntnis und ihre Militärkontakte, um realistische und aufrichtige Romane zu schreiben.
MARLISS MELTON
SEAL Team 12
GEFÄHRLICHE SUCHE
Aus dem amerikanischen Englisch von Ralf Schmitz
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2008 by Marliss Arruda
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Don’t let Go«
Originalverlag: Forever
Forever is an imprint of Grand Central Publishing/Hachette Book Group, USA.
This edition published by arrangement with Grand Central Publishing, New York, NY, USA. All rights reserved.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30 161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2013/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Die Medienakteure, Hamburg
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © GettyImages|Pinkypills; © GettyImages|triocean
eBook-Erstellung: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7517-2051-9
be-ebooks.de
lesejury.de
Du bist bereits das Vorbild für viele meiner Figuren gewesen, aber noch nie war es so offensichtlich wie dieses Mal. Es mag Frauen geben, die neidisch sind, weil ich mit der Quelle meiner Inspiration verheiratet bin. Andere sind vielleicht froh, dass du zu mir gehörst und nicht zu ihnen. Wir haben gute und schlechte Zeiten erlebt, und noch immer bist du die Liebe meines Lebens. Es macht mich froh, dass du nicht losgelassen hast, als du es hättest tun können.
Prolog
Vor fünf Jahren
Trotz der Hitze, die aus den Lüftungsschlitzen im Fußraum des alten Volkswagens zu ihm heraufwaberte, fröstelte Chief Petty Officer Solomon McGuire in seiner wollenen Cabanjacke. Aus seiner Kindheit in Camden, Maine, war er harte Winter gewöhnt, weshalb ihm das mildere Klima von Virginia Beach nur selten zusetzte. Doch die Erinnerung an den Einsatz, den er gerade hinter sich hatte, lastete auf seiner Brust wie ein Eisblock und ließ ihn bis auf die Knochen frieren.
Petty Officer Blaine Koontz aus Kentucky hatte zu den Jungspunden gehört, in deren Gegenwart sich ältere SEALs müde und verbraucht fühlten. Der Mann war ein einen Meter achtundsechzig großes Energiebündel gewesen. Mit seinen Sommersprossen und dem ewigen Grinsen hatte er jedem tödlichen Unternehmen den Anschein gegeben, als handelte es sich um ein Spiel unter Kindern.
Hooyah!Wir springen aus niedriger Höhe mit dem Fallschirm über feindlichem Gebiet ab, laufen mit sechzig Pfund Marschgepäck auf dem Rücken vier Meilen über die Dünen, umzingeln die von der Irakischen Nationalgarde gehaltene Ölquelle und nehmen sie ein. Kein Problem! Das kriegen wir hin!
Und das hatten sie auch. Als sie sich der Ölquelle über die ungeschützte Fläche hinweg näherten, hatte Koontz allerdings eine Kugel in die Schläfe abbekommen. Er war nicht sofort tot gewesen, sondern hatte noch gelebt und wirres Zeug gestammelt, während er von Solomon festgehalten wurde, damit der Sanitäter ihm den zertrümmerten Schädel bandagieren konnte.
Nach sechzehn Jahren als SEAL war Solomon in dem Glauben gewesen, bereits alles gehört und gesehen zu haben. Falsch. Bei den Worten, die aus Koontz’ Mund hervorgesprudelt waren, hatten sich ihm die Nackenhaare gesträubt. Wie es schien, war der Petty Officer doch nicht so unbekümmert gewesen. Der Zweiundzwanzigjährige hatte aus gutem Grund so unverfroren mit dem Sensenmann geflirtet: Der Tod stellte für ihn keine schlimmere Heimsuchung dar als sein sadistischer Erzeuger.
Koontz war erst gestorben, als ein Night Stalker unter dem Beschuss durch Granatwerfer im feindlichen Luftraum zur Landung angesetzt hatte, um den Verletzten in Sicherheit zu bringen. Der Tod des Mannes hatte Solomon erschüttert, doch Trauer war ein Luxus, den er und seine Männer sich nicht leisten konnten, also hatten sie sich beeilt, ihren Einsatz zu beenden – einen Einsatz, der insgesamt zweiundsiebzig schlaflose Stunden dauern sollte. Die SEALs hatten nicht nur die Ölquelle eingenommen, sondern sie auch noch bei einem Gegenangriff verteidigen müssen, bis das Siebte Infanteriebataillon der Army aufgetaucht war und sie unterstützt hatte.
Solomon, der dafür bekannt war, jedes Ziel hartnäckig zu verfolgen, fühlte sich seitdem mehr als erschöpft. Das Wissen um Koontz’ schreckliche Kindheit zerrte an seinen Nerven, als er im Mondschein einer kalten Januarnacht in der ruhig daliegenden Vorstadt aufs Gaspedal trat.
Die Zufahrt zu seinem Wohnviertel kam in Sicht, woraufhin er herunterschaltete und dann um die Ecke bog, ohne die Bremse auch nur zu berühren. Er sehnte sich nach der Erleichterung, die er in dem Augenblick empfinden würde, wenn er seinen kleinen Sohn in die Arme nähme und in sein unschuldiges, engelsgleiches Gesicht schaute. Ein Gefühl der Erleichterung, das vollkommen sein würde, sobald er sich in die sanften Arme seiner Frau sinken ließe.
Sein Sohn hieß Silas. Und er war Solomons ganzer Stolz.
Früher hatten sich alle seine Gedanken nur um seine Frau Candace gedreht, sie war der Mittelpunkt seiner Welt gewesen. Doch dann hatte er erkennen müssen, dass ihre Schönheit ebenso oberflächlich war wie ihre Gedanken. Trotzdem, sie war die Mutter seines Sohnes. Er hatte beschlossen, sie zu heiraten, und zu dieser Entscheidung stand er.
Sein zweistöckiges Backsteinhaus befand sich am Ende einer Sackgasse. Jeden Monat verschlang die Hypothek die Hälfte seines Solds, doch es war Candaces Wunsch gewesen, also hatte er es für sie gekauft. Spät wie es war, brannte hinter den Fenstern kein Licht mehr, seine kleine Familie schlief. Solomon drosselte den Motor und rollte in die Auffahrt.
Er griff nach seinem Rucksack, stieg aus und folgte den Granitplatten, die quer über den frostbedeckten Rasen verliefen. Mit steifen Fingern schloss er die Haustür auf. Beim Gedanken an den oben in seinem Bettchen schlummernden, zwölf Monate alten Silas schlug sein Herz schneller. Fast spürte er schon die Wärme seines kräftigen kleinen Körpers an seiner Brust und roch seinen süßen Babyduft.
Doch als er eintrat, schlug ihm nicht wie erwartet Wärme entgegen. Vielmehr war es kalt ihm Haus, es herrschte eine Grabesstille und die gewohnten Gerüche hatten sich verzogen.
Mit einem Anflug von Angst schaltete Solomon das Licht an. Im dem blendenden Schein der Lampe bestätigte sich, was ihm seine übrigen Sinne signalisiert hatten. »Candace!« Seine besorgte Stimmte hallte von den leeren Wänden und der hohen Decke wider. »Nein!«, ächzte er und ließ den Rucksack fallen.
Drei Stufen auf einmal nehmend rannte er die Treppe hinauf, stürmte den breiten Flur entlang und stieß die Tür zum Kinderzimmer auf. Der unerbittliche Mond beleuchtete ein Zimmer, das ebenso verwaist war wie der Rest des Hauses. Das Licht musste er gar nicht erst einschalten. Nur die Teddybärbordüre an der Wand war noch da.
»Oh Gott«, stöhnte er, taumelte zurück in den Flur und stakste zum Elternschlafzimmer. Er rauschte durch die Doppeltür und starrte in den Raum vor ihm. Weg. Alles weg.
Schaudernd drehte er sich um und kehrte ins Kinderzimmer zurück. »Silas«, jammerte er und fühlte sich, als habe man ihm sämtliche Eingeweide herausgerissen. An der Stelle, an der das Kinderbett gestanden hatte, sank er auf die Knie, vergrub das Gesicht in den Händen und weinte.
1
Amazonas, Venezuela
Die Flügeltüren der Kapelle von La Misión de la Paz flogen auf, woraufhin die dort Versammelten erstarrten. Der Eindringling kam aus dem gleißenden Sonnenlicht hineingehastet, seine braunen Glieder glänzten vor Schweiß, sein Atem ging stoßweise, sodass er seine Mitteilung nur unterbrochen hervorbrachte: »Guerillas se acercan. ¡Hay por lo menos cincuenta y llevan armas!«
Guerillas kommen. Mindestens fünfzig, und sie sind bewaffnet. Während ihr die Übersetzung der Botschaft durch den Kopf ging, richtete sich Jordan Bliss, die gerade einen Schüler unterwiesen hatte, auf und blickte Pater Benedict an, um zu sehen, wie er reagierte.
Auf dem gütigen Gesicht des Priesters spiegelte sich Sorge wider. »Sie hätten schon vor zwei Wochen abreisen sollen«, sagte er zu ihr. »Jetzt müssen Sie sich mit uns verstecken.«
»Es war meine freie Entscheidung, Pater«, rief sie ihm freundlich ins Gedächtnis, während sie zu dem Grund für ihr Bleiben herübersah, dem vier Jahre alten Miguel, der hinter ihr kauerte und seine Schiefertafel umklammerte. Sie hatte ihn trotz der politischen Wirren in Venezuela und der zunehmenden Gefahr für Amerikaner unmöglich im Stich lassen können.
»Los«, drängte Pater Benedict, der sich als Brite in einer kaum weniger bedrohlichen Lage befand. »Holen Sie die Kinder. Wir verstecken uns alle im Weinkeller. Pedro, lauf und bring Schwester Madeline her«, fügte er auf Spanisch hinzu. »Schnell.«
Jordan rief die Kinder zusammen und wies sie an, ihre Tafeln unter den Kirchenbänken liegen zu lassen. Miguel nahm sie auf den Arm. Er schlang seine Ärmchen um ihren Hals, doch er war so dünn, dass sie sein Gewicht kaum spürte.
»Hier entlang«, gab der Priester den Weg vor und lief zur Sakristei, die durch einen Vorhang vom Altarraum abgetrennt war. Dort angelangt, schob er mit dem Fuß den abgetretenen Teppich beiseite. Eine in den Steinfußboden eingelassene hölzerne Klappe führte in den Keller. Als er sie anhob, war darunter eine Treppe zu sehen, deren Stufen in der Dunkelheit verschwanden. Modergeruch stieg auf.
Jordans Angst vor geschlossenen Räumen ließ sie zurückschrecken. Hinter ihr drängten sich, instinktiv schweigend, die Kinder.
»Nehmen Sie die Kerzen«, instruierte der Priester sie und hielt ihr eine Handvoll hin. »Streichhölzer«, ergänzte er mit bemerkenswert ruhiger Stimme. Sie verstaute sie in den tiefen Taschen ihrer kurzen Cargohose, während Pater Benedict ein Tuch von einem Korb hob und den Brotlaib für die Abendmesse herausnahm. »Den werden wir brauchen.«
Nur Gott wusste, wie lange sie dort unten ausharren müssen würden. Und ob die Guerillas, die auf dem Weg zu ihnen waren, ihnen mit Eifer nachspüren oder einfach weiterziehen würden.
»Los«, sagte der Priester und wies mit einem Nicken auf die Stufen.
Obwohl es ihr vor Panik fast die Kehle zuschnürte, befahl Jordan ihrem kleinen Trupp, sich an dem wackeligen Geländer festzuhalten und ihr zu folgen. Dann wagte sie den ersten Schritt in die Untiefen der Erde und machte gleich darauf den zweiten.
Kaum umgab sie die feuchte Kühle, fühlte sie, wie sie mit der Wange gegen ein Spinnennetz kam. Sie erschauerte, drückte Miguel fester an sich und überwand für ihn und die übrigen Kinder ihre Furcht. Tiefer, immer tiefer stiegen sie in die Dunkelheit hinab, bis sie das Ende der Stufen erreichten und festgetretenen Erdboden unter den Füßen hatten.
Ein Frösteln überkam sie, als sie zurück nach oben zum Licht schaute. Was, wenn sie nie wieder die Sonne sehen würde? Eiligen Schrittes näherte sich nun auch Schwester Madeline.
»Ich habe sie gesehen«, erklärte die Nonne auf ihre nüchterne Art. »Eine ganze Horde«, fügte sie mit typisch britischem Understatement hinzu.
Eine wilde Horde, dachte Jordan, vor lauter kaltem Schweiß klebte ihr bereits das Hemd am Rücken.
Schwester Madeline kam rasch die Treppe herunter. »Wer ist alles bei uns?«, wollte sie wissen.
»Die Waisen«, murmelte Jordan.
»Wir sollten sie gehen lassen«, schlug Schwester Madeline mit einem Blick nach oben zum Priester vor.
»Nein«, zischte Jordan und drückte Miguel noch entschlossener an sich.
»Ihr Weinen könnte uns verraten«, erklärte die Nonne.
»Es ist zu spät, um sie wieder nach oben zu schicken«, stellte Pater Benedict fest, der nun ebenfalls zu ihnen herunterkam. »Außerdem, wer sollte sich dann um sie kümmern? Sie würden bloß wieder auf der Straße landen. Pedro«, wandte er sich an den Jungen über ihm, der hoffte, Priester werden zu können, »mach die Tür zu und schließ ab. Zieh den Teppich über die Bodenklappe und lass den Schlüssel verschwinden. Sag keinem, wo wir sind. Sobald die Guerillas fort sind, lässt du uns wieder raus.«
»Si, padre«, antwortete der Junge. Widerstrebend und mit bedauernder Miene schloss er die Luke. Da das Sonnenlicht durch die Ritzen fiel, wurde es zunächst nicht vollkommen finster. Doch als der Teppich über die Luke geschoben wurde, hüllte sie alle eine dermaßen tiefe, undurchdringliche Schwärze ein, dass jeder Muskel in ihrem Körper Jordan den Dienst versagte.
»Entzünden wir eine Kerze und beten wir«, drang Pater Benedicts Stimme aus der Dunkelheit zu ihr und löste sie aus ihrer Erstarrung.
Ungelenk setzte sie Miguel ab, um der Finsternis ein Ende zu bereiten, was in Anbetracht ihrer zitternden Hände jedoch praktisch unmöglich war. Im flackernden Licht des Zündholzes waren die blassen Gesichter ihrer erwachsenen Begleiter und vier Paar glänzender Kinderaugen zu erkennen. Sie starrten auf den Docht und blickten sich um, als die Kerze endlich brannte.
Ihr Versteck maß etwa zehn mal sieben Schritte, war von Spinnweben überzogen und überall befanden sich Nischen, in denen flaschenweise Messwein lagerte. Zu trinken haben wir jedenfalls genug, dachte Jordan und verkniff sich ein hysterisches Glucksen.
Der Priester setzte sich und zog seine langen Beine an, um den anderen Platz zu machen. Jordan suchte nach einer Abstellmöglichkeit für die Kerze, die außerhalb der Reichweite der Kinder war. Als sie einen Spalt in der Wand entdeckte, klemmte sie die Kerze wie eine Fackel hinein. »Setzt euch«, wies sie die Kleinen an und machte es ihnen vor.
Miguel kroch auf seinen Lieblingsplatz – ihren Schoß – und seine Haare kitzelten sie in der Nase. Vor Bedauern darüber, dass sie ihn nicht besser beschützen konnte, brannten Jordan Tränen in den Augen.
»Lieber Gott«, begann der Priester in einem leisen, grimmigen, aber erstaunlich ruhigen Tonfall, »wir beten zu dir, sieh auf uns herab und halte deine schützende Hand über uns …«
Beim Klang seiner tiefen Stimme schweifte Jordan in Gedanken ab. Sie bedeutete Fatima, die sich ängstlich wimmernd an sie schmiegte, leise zu sein. Gebete konnten nicht schaden, fand Jordan, aber helfen würden sie auch nicht unbedingt. Gott wusste, wie häufig sie als werdende Mutter darum gebetet hatte, ihr Kind nicht zu verlieren und ihre Ehe retten zu können.
Anders als der Priester und die Nonne war Jordan nicht in Venezuela, um Seelen zu retten. Vielmehr wollte sie einen Heilungsprozess beenden, der im letzten Sommer begonnen hatte, dann jedoch unterbrochen worden war, weil sie wegen ihrer Anstellung als Lehrerin hatte zurück nach Hause reisen müssen.
Diesen Sommer war sie zurückgekommen – nicht, um sich weiter zu erholen, sondern um die Adoption abzuschließen, die sie vor neun Monaten beantragt hatte. Die Warnungen ihrer Regierung vor der unsicheren politischen Lage waren bei ihr auf taube Ohren gestoßen. Und nun würde ihre Weigerung, sich das Risiko einzugestehen, womöglich zu ihrem Tod führen.
Eine Gewehrsalve unterbrach Pater Benedicts Gebet. Alle lauschten und hielten gemeinsam die Luft an. Hatten die Guerillas einen der Dorfbewohner getötet, die La Misión besuchten? Oder kündigten sie bloß auf Furcht einflößende Weise ihr Erscheinen an?
Obwohl die Zeitungen seit Wochen vor einem Aufstand der Populisten gewarnt hatten und alle Amerikaner dazu aufgefordert worden waren, das Land zu verlassen, hatten sie in dieser abgelegenen Mission im Urwald nicht mit einem Zwischenfall gerechnet.
Jordan interessierte sich nicht für Politik. Und die Kinder von Amazonas brauchten sie noch dringender als ihre Schüler zu Hause.
Sie berührte alle Kinder und strich ihnen tröstend über die schmalen Schultern. Falls nötig, würde sie ihr Leben für sie geben, vor allem für Miguel, der genau in dem Alter war, das ihr Kind jetzt gehabt hätte. Klein und schutzlos, wie er war, hatte er einen besonderen Platz in Jordans Herz erobert. Sie stand so kurz davor, ihn endlich mit nach Hause nehmen zu können. Komme, was wolle, sie würde ihn nicht im Stich lassen.
Suffolk, Virginia
Special Agent Rafael Valentino las das frisch gemalte Schild an der von Bäumen gesäumten Zufahrt.
SECOND CHANCE – PFERDETHERAPEUTISCHE RANCH
Mit einem Knopfdruck hielt er die schwermütige Arie aus der Oper Carmen an und fuhr, auf eine Enttäuschung gefasst, die Schotterstraße hinunter.
Die Jillian Sanders, die er kannte, arbeitete als Krankenschwester in Fairfax und nicht auf einer Pferderanch in Suffolk, Virginia. Trotzdem, als er auf einer Liste eingegangener Anrufe über den Namen gestolpert war, hatte er beschlossen, diesen Hausbesuch zu machen, um es selbst zu überprüfen.
Ausgewachsene Eichen gaben den Blick auf ein buttergelbes Farmhaus frei, das einen frischen Anstrich nötig hatte. Die Veranda fiel zu einer Seite hin ab, der Fußweg war von Sträuchern und Gestrüpp überwuchert. Fünfzig Meter weiter stand eine neue Scheune, rötlich gebeizt und mit einem frisch errichteten Zaun, dessen Holz noch grün wirkte.
Rafe hielt an und griff nach der Akte. Jillian Sanders hatte einunddreißig Mal beim FBI angerufen und um Hilfe gebeten.
Als er sich der Haustür näherte, spitzte er die Ohren, hörte aber nur den Wind und Vogelgezwitscher. Das Klappern der Absätze seiner Ferragamo-Schuhe auf der schiefen Veranda klang deplatziert.
Bevor er anklopfen konnte, wurde die Tür aufgerissen. »Ja?«, fragte ein vielleicht vierzehnjähriger Junge, in dessen grauen Augen Feindseligkeit lag.
»Special Agent Valentino vom FBI«, stellte Rafe sich vor, wobei er versuchte, das Krächzen in seiner Stimme, das durch seine verletzten Stimmbänder verursacht wurde, abzumildern. »Ich bin auf der Suche nach Jillian Sanders.«
»Sie ist in der Scheune«, antwortete der Junge und beäugte die Narbe an Rafes Hals.
»Wer sind Sie?«, fragte ein kleines Mädchen, das seinen Kopf unter dem Arm des Jungen hindurchsteckte.
»Der Butzemann«, meinte der Bruder.
»Nee, nee.«
»Tja, der könnte er aber sein. Geh wieder in deinem Zimmer spielen. Wir reden nicht mit Fremden.«
»Du hast mir gar nichts zu sagen.«
Rafe verzog das Gesicht und wich zurück. Wie lange war es her, dass er Geschwister zanken gehört hatte? Acht Jahre. Lange genug, um sich nicht mehr genau daran zu erinnern.
Er ging zu der offen stehenden Scheune und spähte in das Zwielicht im Inneren. Ein schwacher Geruch nach Pferdemist, vermischt mit dem Duft von frischem Stroh, schlug ihm entgegen. »Hallo?«, rief er und ging vorbei an leeren Stallboxen in die Richtung, aus der ein schlurfendes Geräusch kam. Ein Pferd reckte den Kopf über die Trennwand und wieherte. Dann glitt die Tür der Box auf und eine Frau schaute heraus.
»Rafael!«, stieß sie hervor. Das lange, goldblonde Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, ihre Shorts und das T-Shirt spannten über ihrem Schwangerschaftsbauch, doch er hätte sie trotzdem überall erkannt.
»Jillian.« Ihn überkam ein Gefühl absoluter Zufriedenheit.
»Du liebe Güte«, keuchte sie und legte sich eine ihrer in Handschuhen steckenden Hände aufs Herz. »Ich hatte nicht damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen.«
»Ich auch nicht«, erklärte er. Er mochte das weiche Timbre ihrer Stimme und ihre grünblauen Augen.
»Was führt dich nach Suffolk?«, fragte sie erfreut.
»Ich wurde vor acht Monaten von Washington herversetzt«, antwortete er.
»Du bist wegen meiner Anrufe hier«, vermutete sie.
Er deutete auf die Akte. »Ich habe mich gefragt, ob du es bist.« Sie hatte ihn nicht nur beruhigt, als er in der Notaufnahme fast an seinem eigenen Blut erstickt war, sondern ihn in den Wochen bis zu seiner Genesung auch jeden Tag besucht.
»Ich bin so froh, dich wiederzusehen«, sagte sie, zog einen Handschuh aus und streckte ihm ihre Hand entgegen.
Während Rafe es genoss, wie warm und weich sich ihre Finger anfühlten, ging ihm auf, dass dies ihr erster Körperkontakt überhaupt war.
»Lebst du hier in Suffolk?«, erkundigte er sich und ließ sie widerstrebend los. »Ich dachte, dein Mann wäre Polizist in Fairfax.«
Sie wandte sich ab und legte die Handschuhe weg. »Ich bin hergezogen, um diese Therapieranch für Veteranen, die im Krieg Arme oder Beine verloren haben, aufzuziehen. Reiten fördert den Muskelaufbau und trainiert den Gleichgewichtssinn.«
»Ich hatte ja keine Ahnung«, gestand er verblüfft. Dann schaute er fragend auf ihren Bauch.
»Du hast mich beim Stallausmisten überrascht«, entschuldigte sie sich, seinen Blick ignorierend. »Komm mit ins Büro. Ich habe dir so viel zu erzählen.«
Zehn Minuten später, nachdem er ihr versichert hatte, dass das FBI alles in seiner Macht Stehende tun würde, um ihre Schwester zu finden, beobachtete Jillian, wie Rafael sich wieder auf den Weg machte.
Geschmeidig stieg er in seinen Oldsmobile Cutlass und legte den Sicherheitsgurt an. Sie hatte ihn noch nie in anderer Kleidung als einem Pyjama gesehen, trotzdem überraschte es sie nicht, dass er einen stahlgrauen Designeranzug aus Seide und ein schneeweißes Hemd ohne Krawatte trug. Schließlich hatte er selbst im Pyjama irgendwie elegant gewirkt.
Als er ihr zulächelte, wurde ihr leichter ums Herz und der Kummer, der sie sonst permanent bedrückte, schien gelindert. Es war schön, diesem Freund wiederbegegnet zu sein, den sie lieb gewonnen, aber dann aus den Augen verloren hatte – besonders, weil sie in jüngster Zeit so vieles verloren hatte.
Dann setzte er zurück, eine Hand fest am Lenkrad, und fuhr los, woraufhin ihre Sorgen auf der Stelle zurückkehrten.
Sie hatte ihm noch nicht einmal vom Tod ihres Mannes erzählt. Jeden Morgen wachte sie panisch mit der Erkenntnis auf, dass das Wohlergehen ihrer Familie nun allein auf ihren schmalen Schultern lastete. Ihr Baby, Garys überraschendes Vermächtnis, würde schon in zwei Monaten zur Welt kommen, und bis dahin musste sie noch jede Menge erledigen, damit sie ihrem Kind die Aufmerksamkeit zukommen lassen konnte, die es verdiente.
Mit einem tiefen Seufzer wandte sich Jillian der Scheune zu. Sie musste verrückt gewesen sein, zu glauben, sie könnte ihren und Garys Traum allein verwirklichen. Doch da sie nun einmal begonnen hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als die Sache durchzuziehen.
Amazonas, Venezuela
»Wie gehen wir vor, Senior Chief?«, flüsterte Petty Officer Vinny DeInnocentis und schlug nach dem Moskito, der sich durch die in seinem Nacken verteilte Tarnfarbe arbeitete. Nach Einbruch der Dunkelheit schwärmten die Insekten in noch dichteren Wolken aus.
Solomon McGuire, alias Mako, wandte sich lange genug von der Misión de la Paz ab, die sich in der Hand von Rebellen befand, um Vinny einen eisigen Blick zuzuwerfen. Angesichts seiner hellgrauen, fast schon farblosen Augen musste er sich dafür aber auch nicht allzu sehr anstrengen.
»Was denn?«, fragte der junge SEAL mit der Großschnäuzigkeit eines Kinds aus der Großstadt. »Wir liegen hier jetzt seit ungefähr sechs Stunden und sehen zu, wie diese Arschgeigen die Einheimischen schikanieren. Wann schlagen wir endlich los?«
»Wir haben nicht hier gelegen«, verbesserte Solomon ihn. »Wir haben beobachtet.«
»Stimmt.« Vinny nickte, woraufhin Solomon kurz die Hoffnung schöpfte, der Petty Officer könnte es eines Tages zum Chief bringen, doch dann fügte dieser hinzu: »Ich habe beobachtet, dass so ein Riesenkäfer an meinem rechten Bein hoch und genau auf meine Klöten zukrabbelt, fünf Meter über uns baumelt eine giftige Schlange, und die Wurzeln, hinter denen wir uns verstecken, sehen mir ziemlich nach einer Gifteiche aus.«
»Das ist eine Trompetenblume«, widersprach Solomon, der sich immerhin an Vinnys Rastlosigkeit gewöhnt hatte. »Wir gehen um null einhundert rein. Sie, Teddy und Gus nehmen die Anlage ein, während ich die Leute lokalisiere, die wir mitnehmen wollen. Wir machen sie ausfindig, fesseln sie und bringen sie raus, dann stoßen wir am vereinbarten Treffpunkt zu Harley und Haiku.«
Vinnys weiße Zähne blitzten im Dämmerlicht auf. »Hooyah, Senior Chief. Ich muss bloß noch den Käfer aus meiner Hose kriegen«, gab er zurück und schüttelte, während er aus dem Unterholz hochkam, sein Bein, als wäre er Rumpelstilzchen.
Solomon aktivierte den Teamfunk, um Kontakt mit den Scharfschützen aufzunehmen. »Vier Stunden bis zur Operation Extraction«, informierte er Aufklärer und Schützen.
»Verstanden«, gab Harley leise zurück. Nun, da die Nacht anbrach, begaben Haiku und er sich über die Außenmauer der Mission und das mit Tonschindeln gedeckte Dach der Küche in den Glockenturm der aus dem siebzehnten Jahrhundert stammenden Kapelle. Von dort aus würden sie optimale Sicht auf die Erstürmung der Misión durch ihr Team sowie die anschließende Suchaktion haben.
Solomon stellte auf seiner Uhr den Countdown ein.
2
Drei Stunden und fünfzig Minuten später beobachtete Solomon, wie der Sekundenzeiger seiner MTM-Extreme-Ops-Navy-Black-SEAL-Taucheruhr vorrückte. Er und seine Männer lagen nun hinter den duftenden Wurzeln einer Bougainvillea und waren voller Adrenalin. Neun, acht, sieben … Sie führten schwere Ausrüstung mit sich und trugen Gasmasken. Drei, zwei, eins.
Auf sein Nicken hin ließ Teddy die Sprengladung hochgehen, und das uralte schmiedeeiserne Tor flog auf. Von ihrer Position unter den Bäumen aus schleuderten Vinny, Teddy und Gus Rauchgranaten auf den Hof. Sofort tauchten die vom Tumult und den zischenden Granaten alarmierten Rebellen auf und traten desorientiert und verwirrt den Rückzug an.
Harley ließ darauf vom Glockenturm aus die erste Garbe niederprasseln, während das Befreiungskommando wie maskierte Gespenster zur Mission vorrückte und dabei Schüsse aus den Maschinenpistolen abgab.
Unter ihrem Feuerschutz begann Solomon mit der Suche.
Ein kurzer Blick in die mittelalterlich anmutende Küche zeigte ihm, dass sich dort niemand aufhielt. Seine Männer schossen sich den Weg zur Kapelle frei, wobei sie ein halbes Dutzend Rebellen ausschalteten, die keine fünf Sekunden lang Widerstand leisteten.
Vinny und Teddy drückten sich flach gegen die Stuckmauer der Kirche, während Gus, ein Lieutenant, die Türflügel eintrat und eine Schockgranate hineinwarf. Wie bei einer Blendgranate sollte sie die Menschen im Gebäude verwirren und deren Evakuierung erleichtern. Gerade als Solomon hineinspähte, sah er durch sein Nachtsichtgerät die orangerote Silhouette eines Mannes, der sich hinter eine Balustrade warf.
Wird Zeit, einen Rebellen zu verhören, dachte er, da gab Gus ihm auch das Zeichen, hineinzugehen. Vinny und Teddy ließen sie zurück, um die Tür zu bewachen, während sie selbst an einer Außenwand entlang auf den Mann in seinem Versteck zuhielten. »Kommen Sie mit erhobenen Händen raus, dann passiert Ihnen nichts«, rief Solomon im Vorrücken auf Spanisch.
Als er seine Maske hochschob, bemerkte er, dass es sich bei der Gestalt, die da auftauchte, nur um einen Heranwachsenden handelte und vermutlich nicht um einen Rebellen, denn er trug das Gewand eines Geistlichen. Vom Kopf bis zu den Füßen schlotternd, streckte er die Arme in die Luft.
»Wir suchen Gringos«, sagte Solomon und beobachtete, wie der Junge reagierte.
Der sah panisch kurz nach rechts.
»Wo sind sie?«, hakte Solomon nach, der den Blick registriert hatte, und Gus hob drohend sein Gewehr.
»Abajo«, quiekte der Jugendliche.
»Unten?«, gab Solomon zurück.
»Ein Keller«, vermutete Gus.
»Aqui«, bestätigte der Junge, schlurfte zurück in den Alkoven und deutete auf den Fußboden.
»Zeig es uns«, befahl Solomon. »Schnell!«
Mit unsicheren Bewegungen, die vermuten ließen, dass dies nicht zu seinen üblichen Aufgaben gehörte, zog der Junge einen Schlüssel aus seinem Gewand, schob einen Teppich beiseite, schloss eine Falltür darunter auf und öffnete sie. »Soy yo«, gab er sich rufend zu erkennen und fügte dann hinzu, dass er in Begleitung amerikanischer Soldaten komme.
Nach dem von dort unten aufsteigenden Gestank zu schließen, harrten die Menschen seit Tagen in ihrem Versteck aus. Solomon kniete sich hin und zog seine Taschenlampe hervor. Gus blickte ihm über die Schulter, während sie den Kellerraum absuchten.
Am Fuß einiger wacklig aussehender Stufen entdeckten sie drei hellhäutige Erwachsene und vier einheimische Kinder. Alle blinzelten sie scheu ins Licht.
»Jordan Bliss?«, fragte Solomon, indem er den Lichtstrahl auf den einzigen Mann unter ihnen richtete.
»Nein, tut mir leid«, antwortete dieser, offenbar war er Engländer. »Ich bin Pater Benedict. Miss Bliss, unsere Lehrerin, sitzt da drüben.« Ein Nicken.
Miss? Das hätte er sich ja denken können.
Im Schein seiner Taschenlampe sah Solomon eine Frau Anfang dreißig mit rotbraunen Haaren und einem hübschen Gesicht, die dem blendenden Licht standhielt, um ihn misstrauisch zu beäugen. »Wer sind Sie?«, fragte sie mit durch mangelnden Gebrauch heiserer Stimme, während sie einen kleinen Jungen an ihre Brust drückte.
»Navy-SEALs«, erklärte er knapp. »Ich bin Senior Chief McGuire. Das ist Lieutenant Atwater. Wir sind hier, um Sie und die britischen Staatsbürger rauszuholen.«
»Gott sei Dank«, rief die ältere Frau neben ihr aus.
»Habt ihr das gehört, niños?«, flüsterte Jordan Bliss den Kleinen zu. »Diese Männer werden uns helfen.«
»Nur die Erwachsenen, Ma’am«, korrigierte Solomon sie barsch in einem Tonfall, der klarmachte, dass er keinen Widerspruch duldete. »Keine Kinder. Los jetzt!«
Sie sah ihn an, als hätte er sie mitten ins Herz getroffen. »Nein«, protestierte sie ebenso bestimmt wie er. »Wir können die Kinder unmöglich hier zurücklassen.«
Während er nach den Plastikfesseln in seiner Westentasche griff, warf Solomon Gus einen Blick über die Schulter zu. Es gehörte zu ihrer üblichen Vorgehensweise, Gefangene, zu deren Befreiung sie eingesetzt wurden, im Notfall zu fesseln und sogar zu knebeln, um zu verhindern, dass diese den Einsatz gefährdeten.
»Wir haben Befehl, Sie und die beiden britischen Staatsbürger mitzunehmen, Ma’am. Sonst niemanden«, nahm Gus Solomon den Ärger ab, das klarzustellen.
»Dann nehmen Sie die beiden mit«, erwiderte die Frau und ihre Knöchel traten weiß hervor, als sie zurückwich und die Kinder mit sich zog. »Ich muss sowieso nach Ayacucho.«
»Sie sind Waisen«, erklärte der Priester mit einem eindringlichen Blick zu Solomon. »Sie haben niemanden, der sich um sie kümmert. Und die Rebellen sind laut Pedro ein gemeiner Haufen.«
Solomon schaute auf seine Uhr, dann schaltete er sein Mikrofon ein. »Lagebericht.« Für so etwas hatte er keine Zeit.
»Auf dem Hof ist alles ruhig«, antwortete Haiku, »aber so, wie sich’s anhört, ist Verstärkung auf dem Weg. Entfernung ein Kilometer. Verstanden.«
»Wir haben die Leute gefunden«, berichtete Solomon und überlegte, wie sie weiter vorgehen sollten. Gus war zwar Offizier, doch was Befreiungsaktionen anging, mangelte es ihm an Erfahrung. Also kam es auf Solomon an.
»Ohne die Kinder gehe ich nicht«, sagte Jordan Bliss noch einmal.
Er hätte am liebsten zurückgeblafft, dass er sie einfach mitschleppen würde, ob es ihr nun passte oder nicht, doch stattdessen hörte er sich unter dem erwartungsvollen Blick des Priesters sagen: »Wir nehmen die Kinder bis zur Landezone mit. Keinen Schritt weiter. Und jetzt alle raus hier!«
Nachdem er ihnen die Treppe hinaufgeholfen hatte, fesselte Gus die größeren Kinder aneinander, um das Risiko zu verringern, eins oder zwei von ihnen im Regenwald zu verlieren. Den Kleinen überließ er Jordan.
»Hören Sie mir zu«, brummelte Solomon, während er die Waisen rasch einer Musterung unterzog, »und sorgen Sie dafür, dass die Kinder alles mitbekommen. Wir haben sechs Meilen Eilmarsch zur Landezone vor uns und unter keinen Umständen Zeit für Ruhepausen. Sie dürfen nicht sprechen, Weinen oder Gejammer sind nicht drin. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
»Sehr klar«, bestätigte Jordan nicht weniger hitzig.
Er starrte sie finster an. »Dann los«, sagte er.
»Vayan con Dios«, murmelte der Jugendliche, als sie durch das Mittelschiff der Kapelle auf die Tür zugingen.
Jordan taten die Arme weh, und die ganze Zeit schon plagte sie ihr Rücken. Trotzdem würde sie Miguel nicht in das dichte Laubwerk von Amazonas absetzen. Schon die älteren, aneinandergefesselten Kinder hatten Mühe, das Tempo mitzuhalten.
Senior Chief McGuire, Lieutenant Atwater und zwei schwer bewaffnete SEALs führten sie fast im Laufschritt aus La Misión in den unwegsamen Regenwald. Zwei weitere SEALs entlockten Jordan vor Schreck ein Keuchen, als sie wie aus dem Nichts auftauchten und sich ihnen anschlossen.
Auf ihr Ächzen hin gab Miguel ein verwirrtes Wimmern von sich.
»Psst, Baby, psst«, beruhigte sie ihn, da sie Angst hatte, der Chief könnte von ihr verlangen, die Kinder zurückzulassen. Selbst im Zwielicht des Urwalds bemerkte sie, wie er ihr einen finsteren Blick über die Schulter zuwarf.
Herzloser Kerl. Kümmerte es ihn denn gar nicht, dass sie dreißig Pfund zusätzlich trug? Der Schlamm saugte regelrecht an ihren Stiefeln und fühlte sich an wie Klebstoff. Die Luft war dermaßen feucht, dass sie kaum genug Sauerstoff in ihre schmerzenden Lungen bekam.
»Wie geht es Ihnen, Ma’am?«, erkundigte sich einer der neben ihr laufenden SEALs. Obwohl er schwer bewaffnet und mit Marschgepäck beladen war, schien er nicht außer Atem zu geraten. Im Unterschied zu den übrigen vier SEALs trug er kein Nachtsichtgerät, sondern spähte stattdessen durch das Infrarotzielfernrohr seines Gewehrs.
»Soll ich ihn für Sie tragen?«, bot er ihr freundlich an.
»Nein, danke«, antwortete sie und quälte sich weiter. »Miguel hat Angst vor Fremden.«
Und er tat gut daran. Seine Geschichte war anfangs vollkommen unklar gewesen und hatte sich erst gegen Ende des vergangenen Sommers geklärt – sechs Monate nachdem er von Pater Benedict in der Obhut älterer Straßenkinder entdeckt worden war. Für sein Alter klein, mit großen braunen Augen, aus denen unschuldige Verwirrung sprach, redete Miguel nur im Flüsterton mit seinen Kameraden. Durch ihre unermüdliche Hingabe hatte Jordan es inzwischen geschafft, ihm wenigstens ein Kichern zu entlocken. Das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnte, war ein dahergelaufener Fremder, der ihn unsanft herumschubste und ihn damit in sein Schneckenhaus zurücktrieb.
Den Kleinen im vergangenen Sommer in der Mission zurückzulassen hatte ihr fast das Herz gebrochen. Miguel war zu ihrer zweiten Chance geworden, Liebe zu geben und geliebt zu werden. Dank Venezuelas neuer Regierung hatte sie die Adoption sofort in die Wege leiten können. Doch nun, da die Gemäßigten sich mühsam zu halten versuchten, fürchtete sie, dass die Gesetze revidiert werden würden. Damit hätte der schmerzliche Prozess der Recherchen zu Hause und das Zusammentragen aller erforderlichen Dokumente für Miguels Unterlagen vorzeitig ein Ende.
Sie musste diese SEALs glauben lassen, sie hätte Miguel längst adoptiert, auch wenn sie in Wahrheit noch darauf wartete, dass das Gericht in Ayacucho es bestätigte. Jordan betete, der Priester und die Nonne würden ihr die Notlüge nachsehen, und eilte an die Spitze des Trupps. Ein Farnwedel klatschte ihr ins Gesicht, dann stolperte sie über eine Wurzel. »Verzeihung«, rief sie, damit der Senior Chief sein Marschtempo drosselte.
Als er ihr sein maskiertes Gesicht zuwandte, musste sie an Darth Vader denken – samt böser Aura und allem. »Was ist jetzt wieder?«, erkundigte er sich barsch.
»Ich muss Ihnen etwas sagen«, keuchte sie. »Ich habe dieses Kind hier, Miguel, adoptiert«, log sie. »Er ist mein Sohn, und ich werde ihn nicht an der Landezone zurücklassen. Er fliegt mit mir nach Hause.«
»Zeigen Sie mir die Adoptionspapiere«, verlangte er.
»Die liegen bei der zuständigen Behörde in Ayacucho. Ich muss sie dort abholen«, teilte sie ihm die halbe Wahrheit mit.
Der SEAL schenkte ihr keine Beachtung. Stattdessen schaute er auf den Kompass seiner Uhr, passte ihre Marschrichtung an und lief weiter.
Jordan überliefen vor Angst kalte Schauer. »Ich lasse ihn nicht im Stich«, rief sie, während sie hinter dem Mann herhetzte. »Und hier geht es nicht nach Ayacucho. Ich muss Richtung Osten.«
»Wir besprechen Ihre Optionen, wenn wir die LZ erreicht haben.«
Er war unerbittlich. »Was stimmt eigentlich nicht mit Ihnen?«, warf sie sich wie eine Löwin für ihr Kind ins Zeug. »Sind Sie unter Wölfen aufgewachsen? Hatten Sie keine Mutter?«
Er drehte sich so plötzlich zu ihr um, dass die anderen gegen ihn prallten.
»Muss ich Sie erst fesseln und knebeln?«, drohte er und riss Miguel damit aus dem Schlaf. Der Junge gab ein ängstliches Wimmern von sich.
»Ruhig, Baby«, versuchte Jordan sofort, ihn zu beruhigen. »Alles ist gut.«
Doch vier Tage lang eingesperrt gewesen zu sein und nun mitten im Urwald so grob geweckt und von einem Wildfremden mit einer Maschinenpistole in Angst und Schrecken versetzt zu werden, war zu viel für Miguel. Sein Weinen wurde lauter, übertönte die Geräusche aus dem Dickicht des Dschungels und hallte unter dem Laubdach der Bäume wider.
Senior Chief McGuire erstarrte. »Bringen Sie ihn zum Schweigen!«, befahl er mit heiserer Stimme.
»Sie haben ihm mit Ihren Drohungen doch erst Angst gemacht!«, gab Jordan zurück. »Können Sie denn keinen höflichen Ton anschlagen?«
»Jordan.« Pater Benedict stellte sich zwischen sie beide. »Streiten Sie sich bitte nicht mit dem Senior Chief«, bat er eindringlich. »Ich habe vor, alle Kinder nach Puerto Ayacucho zu bringen. Dort kann ich Ihre Unterlagen bei der Behörde abholen und für Miguel sorgen, bis es Ihnen möglich ist, wieder bei ihm zu sein.«
Sie weigerte sich, sein Angebot zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn, ernsthaft darüber nachzudenken. Nein. Diesen Sommer würde sie ihr Kind mit nach Hause nehmen.
Als sie sich abwandte, folgten ihr die Kinder auf dem Fuße. Während sie weiterging, redete sie beruhigend auf Miguel ein. »Ruhig, Baby, ganz ruhig, du bist jetzt in Sicherheit. Niemand wird dir etwas tun.« Sie betete, dass sie recht hatte. Wenn sie ohne ihn fortginge, lief sie Gefahr, ihn in einem Land zu verlieren, das von den Rändern her zerfiel. Undenkbar. Erneut von ihm getrennt zu sein würde sie nicht überleben.
Urplötzlich erreichten sie die LZ, eine dem Urwald abgetrotzte Lichtung, auf der einmal wöchentlich ein Feuer gelegt wurde, damit Mutter Natur sich nicht zurückholte, was ihr rechtmäßig zustand. Vor dem inzwischen zinngrauen Himmel erkannte Solomon die Umrisse eines Chinook-Transporthubschraubers. Als sie näher kamen, begannen sich die Rotoren zu drehen und erzeugten Wind, der den Geruch von Morast und verfaulendem Obst zu ihnen trug.
Solomon sah auf die Uhr und schaltete sein Mikrofon ein. »Die Frauen in den Hubschrauber«, wandte er sich an seine Männer. »Die Kinder bleiben beim Priester.« Er sprach so laut, dass Jordan Bliss ihn hören konnte, die wie angewurzelt stehen blieb, woraufhin sich die Waisen hinter ihr versammelten.
»Nehmen Sie’s nicht persönlich«, rief er und wandte sich ab, um ihrem entsetzten Blick zu entgehen. »Meine Befehle lassen mir keinen Spielraum, zusätzliche Passagiere mitzunehmen.« Durch sein wärmeempfindliches Nachtsichtgerät sah er die Frau mehr grün als rot leuchten, so als sei das Blut in ihren Adern zum Stillstand gekommen und ihre Körpertemperatur gegen null abgesunken.
»Ich lasse Miguel nicht allein«, beharrte sie mit bebender Stimme und drückte den Kleinen fest an sich. »Ich gehe mit Pater Benedict nach Ayacucho.«
Der Priester kam zu ihr und bemühte sich zu vermitteln. »Lassen Sie ihn bei mir, Jordan«, versuchte er sie zu überreden und streckte die Hände aus. »Sie müssen weg von hier. Sie hätten erst gar nicht so lange bleiben dürfen.«
Doch Jordan zog den Jungen nur noch fester an sich und schüttelte vehement den Kopf.
Solomon gab Vinny und Teddy unauffällig ein Zeichen, woraufhin die beiden auf Jordan zustürmten und ihr den Jungen entrissen.
»Nein!«, kreischte sie, trat um sich und wehrte sich gegen Teddy, der sie hochhob und unter die Rotoren des Hubschraubers trug. Vinny übergab das weinende Kind dem Priester, bevor er ihnen zum Helikopter folgte.
Mit einem bitteren Geschmack im Mund nickte Solomon Pater Benedict zu und drehte sich dann zum Gehen um. Verblüfft sah er, dass Jordan sich wie eine Katze in Teddys Armen wand und sich befreite. Im nächsten Augenblick rannte sie mit ausgestreckten Armen und seinen Namen rufend zu Miguel.
Der Junge erwiderte ihre Schreie mit tränennassem Gesicht, den Mund vor Verwirrung und Entsetzen weit aufgerissen, während er sich aus dem Griff des Priesters zu winden versuchte.
Solomon zischte einen Fluch und schnitt Jordan den Weg ab. Mit einem Satz war er bei ihr, schlang von hinten die Arme um sie und hielt sie so fest, dass sie sich weder durch Verbiegen noch durch Fußtritte befreien konnte. »Nein!« Ihre gequälten Schreie hallten in seinem Schädel wider und weckten Erinnerungen an das, was er selbst verloren hatte.
Sie kämpfte wie eine Löwin mit ihm, ließ die Fäuste seitlich auf seinen Helm niederprasseln, fuhr ihm mit den Fingernägeln durchs Gesicht und rammte immer wieder die Absätze ihrer Stiefel gegen seine Schienbeine, während sie sich in seinem Griff wand. Trotzdem gelang es ihm, sie zu dem dröhnenden Chinook zu schleppen, aus dem Vinny und Gus ihm helfend die Hände entgegenstreckten, um Jordan, die weiterhin schrie, hineinzuhieven.
Kaum waren sie drin, da startete der Helikopter auch schon, stieg höher und höher zum heller werdenden Himmel auf, an dem bereits die Sonne aufging. Das üppig bewachsene Gelände erstreckte sich bereits wie ein düsteres Meer unter ihnen, doch noch immer wehrte sich Jordan Bliss mit aller Kraft und versuchte, sich zur offenen Tür durchzuschlagen.
»Haltet sie fest!«, brüllte Solomon und schloss die Luke.
Unter dem nun gedämpften Knattern der Rotoren war es, als kämen die qualvollen Schreie der Frau aus seinem eigenen Kopf.
»Sie Scheißkerl!«, kreischte sie. Ihre Wut richtete sich gegen Solomon, obwohl sowohl Vinny als auch Gus sich abmühten, um zu verhindern, dass sie sich auf ihn stürzte. »Lassen Sie sie zurückfliegen!«, befahl sie mit vor Verzweiflung rauer Stimme. »Sie sollen zurückfliegen!«
Solomon legte Ausrüstung und Helm ab. »Lasst sie los«, sagte er, denn er hatte es satt, ihren sinnlosen Kampf mit anzusehen.
Als die beiden Männer sie losließen, fiel Jordan erschöpft auf Hände und Knie. Mit Tränen in den Augen starrte sie Solomon an. »Bitte, bringen Sie mich zurück«, flehte sie, nun unterwürfig.
»Das geht nicht«, sagte er und hasste jedes Wort, das aus seinem Mund kam. »Es steht nicht in meiner Macht.«
Unter einem verzweifelten Stöhnen ließ sie den Kopf auf den geriffelten Metallboden sinken, zog die Knie dicht an den Körper und schluchzte – es waren raue Schluchzer, die aus tiefster Seele kamen und Solomon ins Cockpit trieben, wo er sich mit der Besatzung besprach.
Als er zu seinen Männern zurückkam, lag Jordan an eine Bank gefesselt da, den Kopf zur Seite gerollt, Arme und Beine steif von sich gestreckt. Durch das Kanzelfenster schien die Sonne herein, sodass die Haarsträhnen, die ihr in das blasse, erschöpfte Gesicht hingen, rötlich schimmerten.
»Ich habe ihr Lorazepam gegeben«, beichtete Vinny, als er Solomons bestürzten Blick sah. »Ich konnt’s nicht mehr ertragen, Senior Chief.«
Solomon nickte. Er machte Vinny nicht den leisesten Vorwurf.
Dann setzte er sich zwischen Jordan und die betende Nonne auf die Bank. Auf dem Platz rechts außen blätterte Gus in einem Handbuch. Haiku und Teddy überprüften ihre Waffen. Harley, der für das Bordgeschütz, ein M15-Maschinengewehr, zuständig war, schaute von seiner Position am Boden zu ihm hoch.
»Was?«, wollte Solomon wissen, als er den missbilligenden Gesichtsausdruck des glatzköpfigen Chiefs bemerkte. »Hätten Sie anders gehandelt?«
»Ja, hätte ich«, antwortete der Scharfschütze. Seine Miene und Stimme verrieten Geringschätzung.
»Dann hätten Sie auf der Stelle umkehren und den Kleinen wieder aussetzen müssen«, prophezeite Solomon.
»Vielleicht nicht«, meinte Harley mit einem herausfordernden Funkeln in den Augen. »Was meinen Sie, Sir?«, fragte er Gus, der daraufhin von dem Handbuch aufsah.
»Das liegt im Ermessen des Senior Chiefs«, erwiderte dieser neutral. »Im Leben ist nicht immer alles schwarz oder weiß.«
Solomon starrte düster aus dem Fenster. Er brauchte weder Harleys Missfallen noch Gus’ Weisheiten. Bei seiner Entscheidung hatte er sowohl die Vorschriften und die zu erwartenden Entwicklungen berücksichtigt als auch die Disziplin gewahrt. Doch er wusste auch, wie es sich anfühlte, wenn einem ein Kind und die Zukunft genommen wurden. Deshalb hasste er, was er getan hatte.
3
Jordan zog sich innerlich noch tiefer in den behaglichen Kokon zurück, in dem sie dahintrieb, und versuchte, sich dem Sog des Bewusstseins zu entziehen. Sie hatte gute Gründe, nicht aufwachen zu wollen; das Vergessen war so viel süßer als die Wirklichkeit.
Ihr Kopf ruhte auf einer muskulösen Schulter, das Gesicht hatte sie an eine männlich riechende Halsbeuge geschmiegt. Hielt Doug sie so behutsam in den Armen? Ihr Exmann war ein großer, starker Footballtrainer einer Highschool. Während sie mit der Hand über seine feste Brust fuhr, fielen ihr seine Seitensprünge wieder ein, woraufhin sie protestierend aufschrie, den schweren Kopf hob und verlangte, er solle sie loslassen.
Der Anblick des mit Farbe beschmierten Gesichts über ihr holte sie in die Wirklichkeit zurück. Navy-SEAL Senior Chief McGuire trug sie über ein heißes, windiges Rollfeld auf ein Flughafenterminal zu. Zwei SEALs gingen vorneweg, hinter ihm liefen drei neben Schwester Madeline her.
»Lassen Sie mich runter!«, krächzte Jordan. Das Letzte, woran sie sich erinnerte, war, dass einer der SEALs ihr eine Nadel in den Oberschenkel gestochen hatte. Und dieser Mann hier – dieser Mistkerl – war es gewesen, der sie daran gehindert hatte, Miguel mitzunehmen. Sie begann zu strampeln.
»Sie werden nicht stehen können«, warnte er sie vor.
»Lassen Sie mich los!«, tobte sie. Der Gedanke, dass sie Miguel nun, genau wie ihr Baby, womöglich für immer verloren hatte, entfachte ihre Wut.
McGuire blieb abrupt stehen. »Sie wollen, dass ich Sie absetze?«, fragte er mit eisigem Blick.
»Ja.«
»Na schön.« Er ließ eine Hand sinken und gab damit ihre Beine frei. Ihre Stiefel trafen auf den von der Sonne aufgewärmten Zement. Sofort entwand sie sich ganz aus seinem Griff und sank – zu ihrer Verblüffung – einfach in sich zusammen. Blitzschnell schlang er einen Arm um sie, fing sie ab und stellte sie wieder auf die Füße.
»Fassen Sie mich nicht an«, fauchte sie und löste sich aus seiner Umklammerung, fest entschlossen, auf eigenen Beinen zu stehen.
Um ihr zu signalisieren, dass er es aufgab, hob er beide Hände und sah dabei zu, wie sie auf der Stelle umkippte. Diesmal machte er keine Anstalten, sie aufzufangen.
»Uff.« Jordan landete auf der Hüfte, Schmerz durchzuckte vom Becken ausgehend ihren ganzen Körper.
Der Senior Chief wandte sich kopfschüttelnd ab und ging weiter.
Zwei der anderen SEALs beeilten sich, ihr aufzuhelfen. »Alles klar, Ma’am?«, fragte der Dunkelhaarige mit den braunen Augen, der ihr eine Spritze mit wer weiß was darin verpasst hatte. Auf einmal gab er sich ganz besorgt.
Jordan konnte nicht antworten. Ob alles klar war? Für sie würde nie wieder alles klar sein.
Aus seinen blauen Augen funkelte der glatzköpfige SEAL den sich zurückziehenden Senior Chief missbilligend an. Die behutsame Art, wie er sie berührte, verriet Anteilnahme.
»Hoch mit Ihnen«, sagte der erste SEAL, und die beiden Männer halfen Jordan auf, sie in der Mitte. Automatisch bewegte sie die Beine, bemerkte jedoch verwundert, dass sie den Asphalt unter ihren Füßen nicht spürte. Seltsam.
Ein afroamerikanischer SEAL hielt ihnen die Tür auf und führte das Trio sowie Schwester Madeline aus Hitze und Wind hinein ins Gebäude.
Klimaanlage, registrierte der eigenständig arbeitende Teil von Jordans Verstand. Es war Monate her, dass ihr dieser Luxus zuteil geworden war. Von einer weiter hinten gelegenen Essensausgabe wehte der Duft von Kaffee und Ahornsirup zu ihr herüber.
Ihre beiden Begleiter setzten sie auf eins der sechs Sofas in einem Bereich, der offenbar ein Gate des Flughafens darstellte. Während der kahle SEAL umgehend davonstakste, ging der jüngere vor Jordan in die Hocke, um ihre Vitalwerte und Pupillen zu checken. »In ein paar Stunden werden Sie sich besser fühlen«, versicherte er ihr. »Wie wär’s mit einem Becher Orangensaft?«, fragte er dann, als würde er ihr einen Jungbrunnen anbieten.
Sie schaute ihn nur stumm an. Wie sollte sie irgendetwas zu sich nehmen, wenn sie doch wusste, dass Miguel ohne sie vermutlich Hunger und Durst litt und schreckliche Angst hatte?
Der Mann verzog mitleidig das Gesicht, erhob sich und ging zu den anderen.
Jordan kippte auf dem mit einem Überwurf abgedeckten Sofa zur Seite und schloss die Augen. Sonnenlicht fiel warm auf ihr Gesicht.
Miguel. Sie hatte mit ihm gespielt, ihn gehalten und ihn zwei Sommer nacheinander aufblühen sehen. Er war ebenso Teil ihres Lebens geworden wie das Baby, das sie unter dem Herzen getragen hatte. Nun, da er fort war, fühlte sie sich genauso unvollständig wie nach ihrer Fehlgeburt.
Unter den geschlossenen Lidern stiegen ihr heiße Tränen in die Augen, traten zwischen ihren Wimpern hervor und benetzten das Kissen unter ihrem Kopf. Da fiel ein Schatten über sie und entzog ihrem Gesicht die Wärme.
Als sie blinzelnd hochschaute, sah sie Senior Chief McGuire über sich aufragen, in einer Hand hielt er einen Becher und in der anderen ein halb eingewickeltes Brötchen. Sie machte die Augen wieder zu. »Verschwinden Sie.«
»Hinsetzen«, sagte er, ohne auf sie einzugehen.
»Lassen Sie mich in Ruhe.«
Doch statt sie allein zu lassen, fasste er sie bei den Schultern und zerrte sie in eine aufrechte Sitzposition. »Sie müssen essen«, meinte er und ließ sich auf dem sonnenbeschienenen Teil des Sofas nieder, dort, wo sie mit dem Kopf gelegen hatte. Dann hob er ihr Frühstück vom Boden auf.
»Sagt wer?«
»Sage ich.« Damit drückte er ihr den Becher in die Hand.
Plötzlich fiel ihr auf, dass ihr Mund wie ausgedörrt war. Mit zitternden Fingern nahm sie den Becher entgegen. Das Gefühl, wie der Saft über ihre Zunge und kühl ihre Kehle hinabrann, veranlasste sie, erneut die Augen zu schließen.
Vorsichtig biss sie von dem Brötchen ab, das ihr in die Hand gedrückt wurde. Der Geruch von Essen hatte ihren Appetit geweckt, und nun bekam sie richtigen Heißhunger. »Wo sind wir?«, erkundigte sie sich mit vollem Mund. Der verkümmerte Kaktus draußen vor dem Fenster ließ keine großen Schlussfolgerungen zu.
»Auf den Niederländischen Antillen«, antwortete er schroff.
Also lag ein ganzer Ozean zwischen ihr und dem geliebten Kind. Bei dieser Erkenntnis verging ihr der Appetit, und sie begann, den Rest des Brötchens einzuwickeln.
»Aufessen«, sagte der SEAL.
Sie funkelte ihn mit brennenden Augen an. »Ich gehöre nicht zu Ihren Soldaten«, gab sie scharf zurück. Als ihre Blicke sich trafen und sie einander anstarrten, ging ihr schlagartig auf, wie unendlich männlich er war. Seine breiten Schultern und die kräftigen Oberarme machten ihr auf unangenehme Weise bewusst, dass sie eine Frau war – eine, die verdreckt neben ihm saß und dringend eine Dusche brauchte, während er es irgendwann in den letzten Minuten geschafft hatte, sich die Tarnfarbe aus dem Gesicht zu wischen.
»Jemand vom FBI wird Sie abholen«, erklärte er mit barscher, hallender Stimme, »und nach Hause bringen.«
»Egal.« Ihr Zuhause war da, wo Miguel sich befand.
»Sie müssen sich waschen«, fügte er hinzu.
Sein sauber gewaschenes Gesicht war seltsam faszinierend. Er besaß aristokratische Züge, trug einen dunklen Schnurrbart und hatte gepflegte schwarze Augenbrauen. All das zusammen ließ ihn gnadenlos gut aussehen. Seine silbrigen Augen wirkten beinahe hypnotisch. Sie betrachtete die Partie grauer Haare über seiner Stirn, die wie eine Flosse in seinen ansonsten dunklen Schopf überging.
Mako, fiel ihr der Name wieder ein. Kein Wunder, dass die anderen ihn so nannten. Er sah aus wie ein Hai.
»Wo ist der Waschraum?« Sie hatte Mühe, aufzustehen.
»Da drüben.« Auch er erhob sich und behielt sie im Auge, fasste sie jedoch nicht an, sondern wies mit einem Nicken auf eine Tür. »Ich habe Ihnen da drin eine Fliegermontur hingelegt, damit Sie sich umziehen können.« Die Art, wie er die Worte da drin