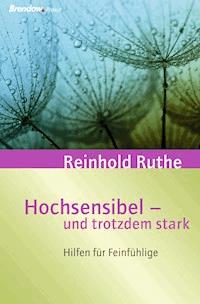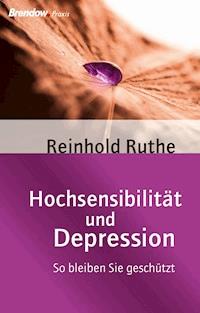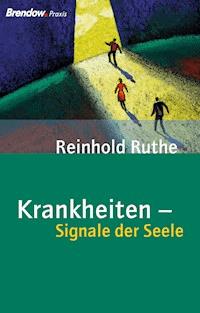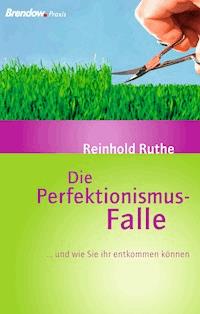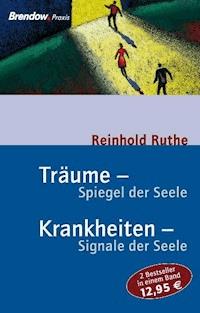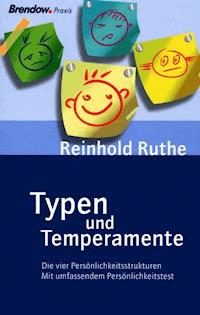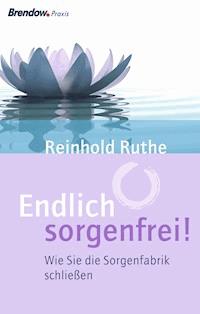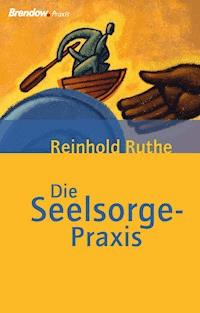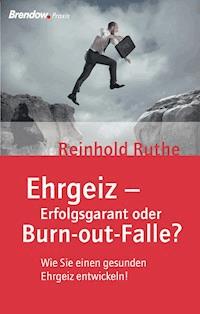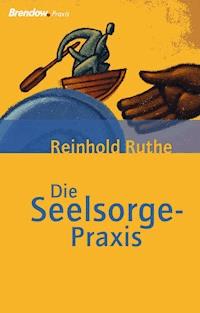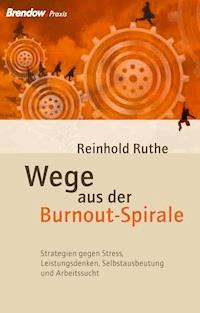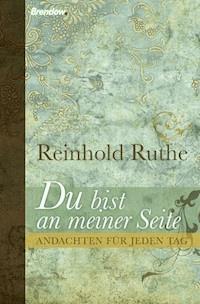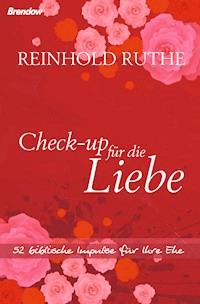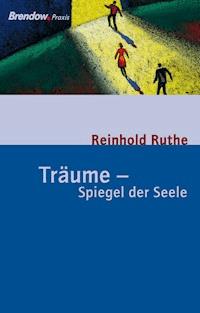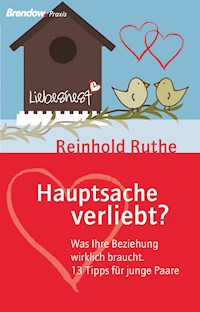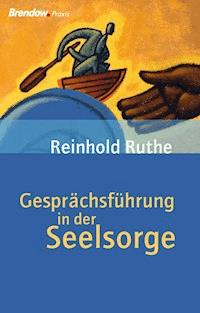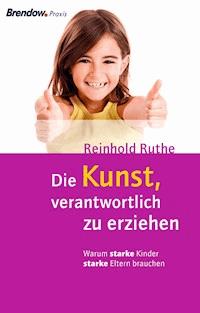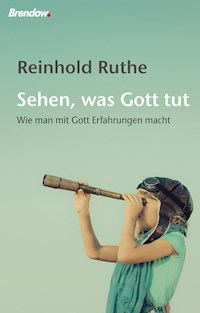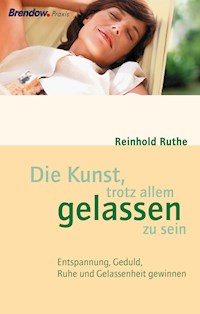6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ICL - Institut für Christliche Lebens- und Eheberatung
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wie führt man ein beratendes Gespräch? Was macht gute Seelsorge aus? Wo liegen die Grenzen für die beratende Seelsorge? Wie geht man in der Beratung mit suizidalen Ratsuchenden um?Auf all diese Fragen und mehr bietet Seelsorge wie macht man das? eine Antwort, geschrieben aus der Praxis für die Praxis.In dieser neuen, durchgesehenen Ausgabe wurden veraltete Begriffe angepasst, Angaben zur wissenschaftlichen Forschung auf den neuesten Stand gebracht und Material aus weiteren Büchern Ruthes ergänzt, mit Fokus auf die Gesprächsführung.Ein wertvolles und vielfach erprobtes Handwerkszeug für Menschen, die haupt- oder ehrenamtlich in Seelsorge und Beratung arbeiten möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Reinhold Ruthe
Seelsorge – wie macht man das?
Grundlagen für das beratende Gespräch
Der vorliegende Text darf nicht gescannt, kopiert, übersetzt, vervielfältigt, verbreitet oder in anderer Weise ohne Zustimmung des Instituts verwendet werden, auch nicht auszugsweise: weder in gedruckter noch elektronischer Form. Die einzige Ausnahme stellen die Kopiervorlagen in diesem Buch dar. Jeder Verstoß verletzt das Urheberrecht und kann strafrechtlich verfolgt werden. Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind die im Text enthaltenen Bibelzitate aus: Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen
Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft
Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.
Weitere Bibelzitate:
Bibeltext der Schlachter (SLT) Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.
Hoffnung für alleTM (Hfa) Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.
Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers Fontis.
© 2025 ICL-Institut für Christliche Lebens- und Eheberatung
Herausgeberin: Katharina Schmidt
Im Helbling 8, D-79400 Kandern-Tannenkirch
www.icl-institut.org
Umschlaggestaltung: Helene Bergen, Dieter Betz
Lektorat: Esther Middeler – www.middeler.com
Korrektorat & Satz: Thilo Niepel – www.textdienstleister.com
Ehrenamtliche Mitarbeit: Christiane Gestrich, Melanie Wittenburg,
Katharina Goncalves
E-Book-Herstellung: Joh.-Christian Hanke – www.jchanke.de
ISBN: 978-3-692284-996
Zum Inhaltsverzeichnis
INHALT
Vorwort zur erweiterten Neuauflage
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie halten die überarbeitete Neuauflage eines Klassikers in den Händen.
Auf der Arbeit von Reinhold Ruthe gründen sich heute viele Ausbildungen für Seelsorger und Lebensberater. Ihm ist es gelungen, die individualpsychologischen Ansätze von Alfred Adler, Rudolf Dreikurs, Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, und weiteren mit der christlichen Seelsorge zu verbinden. Er war ein Vorreiter auf seinem Gebiet, ein Pionier und für viele eine Inspiration. Im April 2023 ist er heimgegangen zu seinem Herrn und hat die Rechte seiner Bücher an Katharina Schmidt (ICL) übertragen. Sie war seine Studentin, für einige Jahre Dozentin an seinem Institut und schon damals in der Seminarentwicklung tätig. Später entwarf sie während ihrer Beratungsarbeit ein schulisches Gesamtkonzept für Seelsorge und individualpsychologische Beratung und bildet seit 1992 mit ihrem Lehrerkollegium über ICL (Institut für Christliche Lebens- und Eheberatung) Seelsorger, Coaches und psychosoziale Berater aus. Viele engagierte Absolventen haben diese Ausbildung in verschiedene Länder und Sprachen von Asien bis Lateinamerika gebracht und dort eigenständige Institute aufgebaut. Die Bücher von Reinhold Ruthe waren den Studierenden Inspiration und Ermutigung und begleiteten sie in ihrer Seelsorgearbeit.
An dieser Neuauflage von »Seelsorge – wie macht man das?« hat ein ganzes Team von Leuten mitgearbeitet, die alle mindestens die Grundausbildung bei ICL abgeschlossen haben. Dabei haben wir uns bemüht, den Ruthe-eigenen Charakter beizubehalten. Manche sprachlichen Formulierungen wurden geglättet, veraltete Begriffe angepasst und Angaben zur wissenschaftlichen Forschung auf den neuesten Stand gebracht. Die ursprünglich enthaltenen Kapitel zur Paarberatung wurden herausgekürzt, da es sich hierbei um eine spezielle Art der Beratung handelt, zu der Ruthe separate Bücher publiziert hat.
Da »Seelsorge – wie macht man das?« als Standardliteratur für die ICL-Grundstufe gilt, haben wir an etlichen Stellen Inhalte ergänzt, die auch als Seminarinhalte auftauchen. Manches konnten wir dafür aus anderen Publikationen von Ruthe entnehmen, anderes stammt von ICL-Absolventen.
Für diese Neuauflage haben wir uns entschieden, der Lesbarkeit halber die ursprüngliche (männliche) Leseranrede beizubehalten. Selbstverständlich sind heute viele Frauen als kompetente und fachlich versierte Seelsorgerinnen, Lebensberaterinnen, Coachinnen und Psychotherapeutinnen tätig und in diesem Buch angesprochen, wenn z. B. von »dem Seelsorger« die Rede ist.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine gewinnbringende Lektüre, die persönlich, aber auch fachlich zu mehr Sicherheit und Freiheit in der Umsetzung verhilft.
Ihre Katharina Schmidt
Herausgeberin
ICL – Institut für Christliche Lebens- und Eheberatung
Aus- und Weiterbildungen
für Seelsorge, Coaching und Beratung
www.icl-institut.org
Einführung von Reinhold Ruthe
Es ist unübersehbar, dass immer mehr jüngere und ältere Menschen in unseren Kirchen, in Gemeinden und Gemeinschaften Seelsorge benötigen.
Viele bewusste Christen suchen seelsorgerlichen Rat, weil sie
psychische Störungen aufweisen,
seelisch leiden und krank sind,
durch Erziehung und Sozialisation Fehlverhaltensweisen aufweisen,
mit Psychosomatischen Beschwerden reagieren,
ausweglose Beziehungskonflikte vorbringen
und/oder mit geistlichen Problemen belastet sind, die sich seelisch und körperlich auswirken.
Therapeutische Seelsorge meint die dienende Seelsorge (griechisch therapeuo = dienen). Seelsorger sind Diener, Werkzeuge, und Mitarbeiter unseres Herrn. Christus ist der eigentliche Seelsorger. Von ihm lernen wir: »Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch« (1. Petr. 5,7 SLT).
Seelsorge ist ein lebendiger Prozess und mehr als Beratungstechnik. Es geht in ihr um biblische Maßstäbe und nicht in erster Linie um Techniken und Methoden der Psychologie.
Psychotherapeutische Techniken und Methoden, die der biblischen Botschaft nicht widersprechen, werden benutzt, um sich in Menschen einzufühlen, um zu ermutigen, Hoffnung zu vermitteln, zu trösten, zu ermahnen, den Menschen mit Sünde zu konfrontieren und ihm im Namen Jesu Vergebung zuzusprechen.1 Sie stehen aber nicht im Mittelpunkt. Beratende Seelsorge ist helfendes und heilendes Gespräch, das im Bekenntnis des Glaubens geschieht und sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt.
Die Schwerpunkte der beratenden Seelsorge möchten wir so charakterisieren: Es geht darum, zu beraten und zu ermutigen.
Diese beiden Aspekte sollen in diesem Buch konkret und in Beispielen zu Wort kommen.
Das Buch wendet sich an Christen, die als haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter eine vertiefte Seelsorge-Ausrüstung anstreben. Pastoren und Prediger, Leiter von Hauskreisen und kirchlichen Einrichtungen sowie Studenten in der theologischen und seelsorgerlichen Ausbildung werden Anregungen für ihre Gespräche mit Ratsuchenden finden. Einige Fragebögen und Selbsterforschungsaufgaben können den Ratsuchenden als Hausaufgaben und dem Seelsorger als Gesprächsgrundlage dienen.
Viele Beispiele, die das Gesagte veranschaulichen, sind aus verständlichen Gründen für den Leser verfremdet worden.
Seelsorge allgemein
Biblische Leitsätze für die beratende Seelsorge
Beratende Seelsorge will kein selbstgestricktes Programm entwerfen, sondern sich an biblischen Leitlinien orientieren. Seelsorge geschieht im Namen Jesu und nicht im eigenen Namen. Der eigentliche Seelsorger ist Jesus selbst. »Legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch«, lädt uns der 1. Petrusbrief ein (1. Petr. 5,7). Im selben Brief findet sich ein Text, der uns präzise den Auftrag der Seelsorge definiert:
»Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen« — 1. Petrus 4,10–11
Das ist der biblische Leitgedanke für unsere beratende Seelsorge. Das ist die biblische Dienstanweisung, durch die unser Aufgabengebiet abgesteckt ist.
Auf dem Hintergrund des Textes sind folgende Gesichtspunkte bedeutsam:
1. Beratende Seelsorger sind Diener am Nächsten.
Sie sind keine Macher oder selbsternannte Therapeuten.
Sie verstehen sich nicht als anmaßende Könner.
Der Auftrag lautet: »Dient einander …«
2. Therapeutische Seelsorge erinnert an den griechischen Begriff therapeuo – helfen, dienen.
Sie beinhaltet aber auch, dass Hilfsmittel und Techniken aus den Humanwissenschaften eingesetzt werden, um biblische Maßstäbe zu realisieren.
Humanwissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen können dabei niemals die Kraft des Heiligen Geistes ersetzen, der Menschen verändert und erneuert.
3. Beratende Seelsorge ist ein Charisma, eine Gabe, die Gott schenkt.
Wie ein Prediger und Verkündiger die Gabe des Redens von Gott geschenkt bekommt und sie durchs Studium der Theologie und/oder eine entsprechende Ausbildung fördert und vertieft, so kann beratende Seelsorge durch Kurse und Seminare bereichert und praxisnäher ausgebaut werden.
Ständiges Gebet darum, die Gaben zu reinigen, zu heiligen und zu erneuern, geht mit der Bereitschaft einher, diese Gaben auch zu schulen.
4. Beratende Seelsorger sind Verwalter der Gaben Gottes.
Gaben sind kein selbsterrungener Besitz. Es sind anvertraute Geschenke, die wir verwalten.
Verwalter praktizieren nicht auf eigene Faust; sie reagieren als Mitarbeiter Gottes.
5. Der Dienst am Nächsten kennt kein Patentrezept.
»Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat« (V. 10).
Beratende Seelsorge ist eine Möglichkeit, mit Hilfe bewährter Methoden dem Ratsuchenden die Zusammenhänge von tiefliegenden Destabilisierungen, von unverstandenen Konflikten, von Lebenslügen und Krankheiten bewusstzumachen.
6. Beratende Seelsorger verstehen sich so, »dass es Gottes Worte sind«, die sie weitergeben (V. 11).
Nicht unsere Vorstellungen und Maßstäbe bestimmen die Gespräche, sondern Gottes Wort, das für innerseelisches und zwischenmenschliches Verhalten Gebote bereithält.
Darum beginnt alle beratende Seelsorge mit dem Hören auf Gott, dem wir unsere Sorgen und Probleme und die des Ratsuchenden anvertrauen.
7. Beratende Seelsorge stellt Gottes Ehre in den Mittelpunkt (V. 11)
Beratende Seelsorger sind Werkzeuge, Mitarbeiter und Verwalter Gottes.
Je mehr sie selbst in den Mittelpunkt rücken, desto offensichtlicher fordern sie ihre eigene Ehre.
Heilungen und Heilwerden in Christus sind nicht unser Verdienst, sondern Gnade.
8. Beratende Seelsorger verlassen sich auf die Kraft und Macht Gottes (V. 11).
Ein Begabter ist ein Beschenkter. Ein Vollmächtiger ist ein Bevollmächtigter.
Darum rechnet ein beratender Seelsorger in jedem Gespräch mit Gottes Macht und Kraft und verlässt sich nicht auf seine Kompetenz.
Worum geht es in Seelsorge und Beratung?
Der Begriff »Seelsorge« birgt viele Missverständnisse in sich. So begegnet man häufig der Vorstellung, in der Seelsorge habe man es nur mit dem Spirituellen zu tun. In dieser Auffassung hat sich ein spätantiker hellenistischer Geist in die kirchliche Verkündigung und Seelsorge eingeschlichen. Die Folge war, dass in Verkündigung und Seelsorge die biblischen Aussagen über den Menschen verkürzt wurden. Man sah das Zentrum des Menschen nur in seinem göttlichen Funken, der Seele, die ihren Ursprung in der oberen Gotteswelt habe. Der Körper gehöre der unteren Welt an, der dunklen, materiellen, der dämonischen Welt. Verkündigung und Seelsorge kümmerten sich dementsprechend um das »Wesentliche«, um das »Eigentliche«, um die Seele, und hatten damit nur einen Teilaspekt des Menschen im Blick. So wurde die Sünde als geistliches Problem zum zentralen, alle leiblichen und psychischen Nöte dagegen zum peripheren Thema.
1. Die herkömmliche Seelsorge
Der Hauptakzent der herkömmlich verstandenen Seelsorge liegt nicht im Psychologischen, sondern im Theologischen. Herkömmliche Seelsorge zielt auf den Bruch, die Umkehr, die Bekehrung, die Hinwendung zu Jesus Christus.
Diesem Verständnis entspricht dann auch die Art der Aussprache, des seelsorgerlichen Gesprächs mit dem Seelsorgesuchenden. Hier geht es um Vergebung, mit der mehr gemeint ist als Annahme, Tolerieren und Solidarisieren. Der Seelsorger nimmt den Ratsuchenden an, wie Jesus den Sünder angenommen hat – er, der zur Sünde ein radikales Nein, aber zum Sünder ein bedingungsloses Ja gesagt hat. Wer seine Sünde bekennt, dem kann der Seelsorger die Verheißungen Gottes zusprechen.
Das bedeutet: Seelsorger im herkömmlichen Sinn kann nur sein, wer sich von Jesus Christus berufen und gesandt weiß, wer Gemeinschaft mit und durch ihn hat, wer aus seiner Kraft helfen und bezeugen will. Denn in der so verstandenen Seelsorge geht es erst in zweiter Linie um menschliche Ratschläge, um psychologische Hilfen oder Entscheidungshilfen zur Lebensbewältigung.
Dieser Tenor darf nicht überhört, das Ziel solcher Seelsorge darf nicht diskriminiert werden. Die Betonung liegt hier jedoch einseitig auf der Frage nach dem Heil, während alle anderen Probleme des Menschen beiseitegelassen werden.
Diese Einseitigkeit kann mit der überspitzten Formulierung seines Seelsorgers gekennzeichnet werden: »Hast du Jesus, lösen sich alle Probleme der Welt.« Dieser Satz ist hinsichtlich der Simplifizierung falsch. Wer Jesus gefunden hat, ist nicht frei von Problemen, Fehlhaltungen, Neurosen, Konflikten und psychischen Störungen. Auch ein Mensch, der glaubt und betet, hat noch Probleme, Schwierigkeiten und Konflikte. Gott hat uns zwar seinen Beistand verheißen, nicht jedoch die Beseitigung aller Probleme. Jesus sagt: »Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit« (Mt. 28,20 SLT).
Rudolf Affemann schreibt:
»Es kann leider nicht bestritten werden, dass nicht wenige ernste Christen in ihrem Unterbewussten unmoralischer, bösartiger, liebloser sind als viele moderne Heiden. Die bei ihnen vorhandenen psychoneurotischen Symptome und funktionellen körperlichen Krankheiten weisen nicht selten darauf hin, dass der christliche Glaube hier zu einem großartigen Verdrängungsmanöver geführt hat.«2
Neurose
Neurose beschreibt eine seelische Störung, bei der keine körperlichen Ursachen erkennbar sind. Sie wird als Reaktion auf innerseelische Konflikte verstanden. Die Betroffenen erleben einen erheblichen Leidensdruck, der ihre Lebensqualität mindert z. B. durch Angststörungen, Zwangsstörungen, Belastungsstörungen.
Für Alfred Adler stand die Einheit der Persönlichkeit inkl. des Unbewussten im Mittelpunkt des Verständnisses eines Menschen. Er unterteilte menschliches Verhalten in »allgemein nützliches und wertvolles« Verhalten, bei dem die Interessen des Einzelnen auf die Menschheit im Allgemeinen gerichtet sind, und »allgemein unnützliches und wertloses« Verhalten, das sich an der persönlichen Überlegenheit des Einzelnen über die anderen orientiert.
Neurotische Symptome und Arrangements entwickelt derjenige, der glaubt, seine Probleme wären zu schwierig, um damit »glorreich« fertig zu werden. Er will sein unbewusstes Persönlichkeitsideal beschützen und seinen Wert durch das Streben nach Überlegenheit sichern. So löst er den Konflikt zwischen »Sollen« und »Wollen« mit »Ausreden«, deren Symptome ihn scheinbar hindern, seinen Beitrag für das Leben leisten zu können.
2. Das Leib-Seele-Geist-Problem
Die Wirklichkeit der Seele kann man nicht beweisen. Man kann die Seele auch nicht irgendwo im Körper lokalisieren. Wir lächeln heute über den Philosophen Descartes, der die Seele in der Zirbeldrüse ansiedeln wollte. Wir lächeln heute auch über die Feststellung des Anatomen Virchow, der nach zahllosen Operationen nicht die Spur einer Seele im menschlichen Leib entdecken konnte. Die Seele ist kein Organ, sondern eine Dimension. Leib und Seele hängen eng miteinander zusammen. Man könnte sagen, dass die Seele die Innenseite des Körpers, der Körper wiederum die Außenseite der Seele ist. Man kann den Menschen nicht in einen inneren und äußeren Menschen aufspalten. Vielmehr besteht zwischen Leib und Seele die innigste Verbindung. Die Seele formt sich in Gesicht und Händen, in Gang und Schrift des Menschen aus. Mit unserer gesamten Erscheinung, mit jeder Geste und mit dem Klang unserer Stimme verraten wir unsere Seele.
Falsch ist es zu formulieren: Der Mensch hat eine Seele. Vielmehr ist er eine Seele, die eines Körpers bedarf, um sich in der irdischen Welt auswirken zu können.
Wie Leib und Seele zusammenhängen, machen einige Beispiele deutlich:
Meine Seele hat Angst. Die Folge: Der Körper zeigt plötzlich kalten Schweiß bis hin in die Handflächen.
Meine Seele gruselt sich. Die Folge: Der Körper bekommt eine Gänsehaut.
Die Seele freut sich sehr. Die Folge: Der Puls schlägt höher, schneller.
Viele seelische Leiden können sich in körperlichen Erkrankungen niederschlagen. Es kann zu Lähmungen kommen, zu Magengeschwüren, zu Atembeschwerden, zu Verstopfung, zu Herzattacken und Kreislaufbeschwerden. Anfang des letzten Jahrhunderts war man der Meinung, dass sich Neurosen3 – also psychische Destabilisierungen – nur auf das Herz legen und Herzleiden verursachen würden. Heute weiß man, dass alle Organe von psychischen Störungen beeinflusst werden. Es gibt neurotische Leber-, Gallen- und Blasenleiden.
Der Organismus wird durch Gedanken, Gefühle und Vorstellungen beeinflusst. Analog kann man vermuten, dass das vegetative Nervensystem durch seelische Probleme, durch Konflikte und Spannungen beeinflusst und beeinträchtigt wird. Eine erkrankte Seele hat also das autonome Nervensystem aus dem Gleichgewicht gebracht. Eine gestörte Erlebnisverarbeitung hat also Krisen, Depressionen, Verzweiflung, berufliches Versagen, Selbstmordgedanken, sozialen Rückzug, Misstrauen, Selbstentfremdung, Resignation und psychogene Organerkrankungen hervorgebracht. Die Nerven sind gesund, aber die Seele ist krank.
Und der menschliche Geist?
Er ist eine eigene Größe im menschlichen Leben. Seine Definition und Einordnung ist schwierig. Wir unterscheiden aber seelisches und geistiges Sein. Der Mensch ist Träger des Geistes. Er ist gekennzeichnet durch Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung, bewusste Verantwortlichkeit und Freiheit, durch Unterscheiden von Sein und Sollen. Die Sonderstellung des Geistes gegenüber Leib und Seele entspricht in jeder Beziehung dem Neuen Testament. Paulus schreibt: »Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes [Wesen], der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus!« (1. Thess. 5,23 SLT).
Es bedarf keiner Frage, dass neben der psychischen Behandlung und Beratung die geistige Betreuung des Ratsuchenden heute eine große Rolle spielt. Der Geist des Menschen ist nicht von sich aus göttlich, ist nichts Übermenschliches, aber er steht mit dem Seelisch-Körperlichen und mit dem Geist Gottes in Verbindung. Alle drei Bereiche stehen in lebendiger Wechselbeziehung. »Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind« (Röm. 8,16 SLT).
Der Mensch als »dreidimensionales« Wesen ist in seiner dreifachen Beziehung eine Einheit. Alle drei Dimensionen sind eng miteinander verbunden, und man sollte deshalb von Körper, Seele und Geist als von drei verschiedenen Seiten des einen Wesens reden. Denn jede Erkrankung, die in einer der drei Dimensionen auftritt, erfasst immer den ganzen Menschen.
Seele und Geist sind eine unlösbare schöpfungsmäßige Einheit, und wie der Mensch für den Leib sorgt, muss er auch für die Seele sorgen. Leibsorge und Seelsorge sind also aufeinander angewiesen und eng miteinander verknüpft.
3. Seelsorge und Heilung
Seelsorge ist eine Lebenshilfe, die den ganzen Menschen betrifft. Sie gründet sich in der Nachfolge Christi. Diese Lebenshilfe ist aber mehr als Hilfe zum ewigen Leben, sie umfasst seelische und körperliche Nöte, umfasst den Menschen in seinem Glaubensalltag, in seinen Zweifeln, in seinen Schwächen, in seinen Leiden und Ängsten, in seinen Sorgen und seiner Verzweiflung, in seinen Verspannungen und Belastungen, in seinen Anfechtungen und Hemmungen.
Im Alten Testament wird Krankheit in engem Zusammenhang mit Sünde gesehen. Ungehorsam gegen Gott hat Krankheit verschiedenster Art zur Folge. Selbst Hiob, der seine Unschuld vor Gott beteuert, spricht sich im Verlauf seiner Schicksalsschläge schuldig und tut Buße in Sack und Asche, weil er sich als Geschöpf Gottes gegen den Schöpfer und sein unbegreifliches Gericht aufgelehnt hat. Auch im Neuen Testament findet man eine enge Verbindung zwischen Krankheit, Tod und Sünde. Krankheit wird als Zeichen der Gottentfremdung gesehen und von Jesus mit Sünde in Verbindung gebracht.
Wir sollten uns allerdings hüten, jede Krankheit als Folge einer konkreten Sünde zu verstehen. Jesus hat seinen Jüngern sogar untersagt, in schweren Schicksalsschlägen, die ihre Mitmenschen betrafen, die direkte Folge besonders schwerer Sünden zu sehen. Den allgemeinen Zusammenhang von Sünde und Krankheit hat er jedoch nie bestritten. Aber auch Heilung von Krankheit spielt in der Bibel eine entscheidende Rolle. Wenn Krankheit als Strafe und Züchtigung von Gott ausgeht, dann ist Gott auch in der Lage, den Menschen von Gebrechen und Schwächen zu heilen. »Ich bin der Herr, dein Arzt« (2. Mose 15,26c SLT).
Der Begriff »Heilung« ist umfassend. Er bezieht sich nicht nur auf körperliche Krankheiten, sondern auch auf geistliche und psychische Leiden, auf die Gesamtsituation des unerlösten Menschen. Der Abschnitt über die Heilung eines Gelähmten (Mk. 2,1–12) macht deutlich, wie eng Sünde und Krankheit zusammengehören. Selbst in Fällen, wo Willkürakte und Unfälle die Menschen heimsuchten, bestätigt Jesus den Strafcharakter der Krankheit und des Todes. Ob Christen oder Nichtchristen, Kranke oder Nichtkranke, sie stehen unter der allgemeinen Sündhaftigkeit und haben den Tod als der Sünde Sold verdient.
Krankheit wird im Neuen Testament an vielen Stellen auf Einwirkung des Satans zurückgeführt. Taubheit, Stummheit, Besessenheit, der »Pfahl im Fleisch« bei Paulus, immer wieder ist davon die Rede, dass Satan seine Hand im Spiel gehabt habe, der die Menschen mit Fäusten schlägt, sie gebunden hat und übel plagt: »Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit achtzehn Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten … Und diese Frau hier, die der Satan volle achtzehn Jahre lang gebunden hielt …« (Luk. 13,11.17).
An anderer Stelle schreibt Paulus über sich: »Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe« (2. Kor. 12,7 SLT).
Heilung erfährt der Mensch durch den Heiland Christus. Im Wirken Jesu waren Verkündigung und Heilen gleichwertig miteinander verbunden. Wie ein roter Faden zieht sich das Heilen Jesu durch das Neue Testament. Und auf die Frage Johannes des Täufers, ob er der verheißene Messias sei, antwortete Jesus: »Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt, und Armen wird das Evangelium verkündigt« (Mt. 11,5 SLT). Die Verwirklichung der Gottesherrschaft steht mit auffälligen Heilungen in engster Beziehung. Diese Heilungswunder waren Siege über den Satan und Zeichen der anbrechenden Königsherrschaft Gottes.
Vor diesem Hintergrund ist die Seelsorge im Namen Jesu eine umfassende Glaubens- und Lebenshilfe. Denn alle Menschen sind nach dem Neuen Testament in ihrer Ganzheit an Leib, Geist und Seele krank; sie sind Sünder und dem Tod verfallen. Der Seelsorger hat dementsprechend die Aufgabe, diesen Menschen in ihrer Ganzheit eine heilende Lebenshilfe zu gewähren. Genau genommen soll der Mensch im Zusammenwirken von Arzt, Berater oder Psychotherapeut und Seelsorger seelisch, körperlich und geistig heil werden. Seelsorge gilt dem Einzelnen, bleibt aber nicht bei dem isolierten Vertrauensverhältnis zwischen Ratsuchendem und Seelsorger stehen, sondern zielt auf die Gemeinschaft innerhalb der Kirche, in der der Ratsuchende sich als angenommen und aufgehoben erfährt.
4. Seelsorge als Glaubens- und Lebenshilfe
In den letzten Jahrzehnten hat sich ein Wandel in der Beurteilung der Seelsorge vollzogen. Stärker als früher wird der ganze Mensch in seiner Existenz vor Gott angesprochen. Die Seelsorge hat sich zur Glaubens- und Lebenshilfe gewandelt. Seelsorge hat ihren Mittelpunkt in Gott, und Jesus Christus ist ihr Auftraggeber. Das Seelsorgegespräch wendet sich an den ganzen Menschen als
einer Gott ebenbildlichen Person,
einer gefallenen,
heilsfähigen
und heilsbedürftigen Person.
Ziel der Seelsorge mit Blick auf den Ratsuchenden ist:
»Lügen, die wir glauben«, in Frage zu stellen und durch neue befreiende Überzeugungen zu ersetzen;
Hilfe zur Selbsthilfe, d. h. Aktivierung des Ratsuchenden in der Suche nach Lösungen;
Begleitung im Prozess der Selbstexploration und Hilfe beim Finden einer bewussten und eigenverantworteten Haltung und daraus verantwortlichem Handeln;
unerkannte Motive und lebensgeschichtliche Hintergründe von Schwierigkeiten gemeinsam entdecken;
Hilfe beim Entdecken und Leben seiner neuen Identität in Christus geben;
Stärkung und Ermutigung des Ratsuchenden durch gemeinsames Entdecken seiner Ressourcen;
diese Ressourcen im Dienste eines gemeinschaftlichen Zieles, einer auf die Zusammenarbeit gerichteten Motivation für eine Lösungsfindung nutzbar machen;
zu innerem Frieden verhelfen: mit sich, den Mitmenschen, mit Gott und dem Leben;
sich versöhnen mit seiner Vergangenheit (Eltern, Bezugspersonen, Lebensgeschichte);
bewusstes Stehen in der Gegenwart und vertrauensvoller Ausblick in die Zukunft.
Wo die Aufmerksamkeit nur auf das Seelenheil gerichtet bleibt, werden materielles, geistiges und seelisches Wohl vernachlässigt. Der Mensch, der heute zum Seelsorger geht, hat nicht nur Glaubensfragen auf dem Herzen; er möchte nicht nur theologische Probleme klären. Er kommt mit allen möglichen Fragen, die das Leben aufwirft, mit allen möglichen Schwierigkeiten, die der Alltag bietet.
5. Was will die Psychologie in der Seelsorge?
Es gibt nicht wenige Christen, die in der psychologisch orientierten Seelsorge eine Verwässerung des eigentlichen Auftrags erblicken. Sie befürchten, dass die Seelsorge im Vordergründigen und Vorläufigen steckenbleibt. Das kann geschehen – und das ist geschehen. Wesentlich ist die Einstellung des Beraters und Seelsorgers. Zweifellos hat es in der Vergangenheit und Gegenwart Richtungen gegeben, die sich für eine rein säkulare Seelsorge ausgesprochen haben, welche die Störungen, Probleme, Konflikte und Nöte der Seele oder des Menschen allein im innerseelischen und zwischenmenschlichen Bereich sucht. Davon soll in diesem Buch nicht die Rede sein. Hier geht es um das fruchtbare Zusammenwirken von Psychologie und Seelsorge.
Methoden und wissenschaftliche Hilfen aus Humanwissenschaften – soweit sie biblischen Aussagen und Maßstäben nicht widersprechen – werden in den Beratungs- und Seelsorgeprozess eingebaut, um den Menschen in ihren konkreten Sorgen, Leiden, psychischen Abhängigkeiten und Krankheiten gerecht zu werden.
Weltweit nehmen bewusste Christen Ärzte für alle Krankheiten des Leibes und der Seele in Anspruch. Sie nutzen die wissenschaftlichen Erkenntnisse für sich, die mit dem biblischen Hintergrund nichts zu tun haben. Alle technischen Errungenschaften und Erfindungen des Atomzeitalters, Flugzeuge, Medien, das Internet usw. werden kommentarlos von Christen in ihr Leben integriert. Nur Psychologie, Psychotherapie und andere Zweige der Humanwissenschaften sollen außen vor bleiben?
Darum ist es unvorstellbar, dass nicht auch wissenschaftliche Ergebnisse aus den Fachgebieten Psychotherapie, Psychologie, Psychiatrie, Pädagogik und Medizin, wenn sie bestimmten biblischen Lehrmeinungen nicht zuwiderlaufen, in der beratenden Seelsorge Verwendung finden. Christen, die sich als Seelsorger berufen fühlen, sollen zugerüstet werden, im Namen Jesu Menschen ganzheitlich fachlich und sachlich zu helfen.4
a) Womit beschäftigt sich die Psychologie nicht?
Als Wissenschaft von der Seele oder vom menschlichen Verhalten beschäftigt sie sich nicht
mit der Seele in ihrer Beziehung zu Gott,
mit ihrem Ursprung und ihrer Herkunft,
mit ihrer Unsterblichkeit.
Die Entwicklung des Seelenbegriffs dürfte auf die unheimliche Beobachtung zurückgehen, dass der Tote ohne Leben, ohne Bewegung – ohne Seele – ist. In den griechischen, lateinischen und hebräischen Begriffen für Seele schwingt stets die Bedeutung von »Hauch« und fühlbarer Bewegung mit. Theologische und philosophische Fragen, die sich daraus ergeben, gehören nicht zum Forschungs- und Anwendungsgebiet der Psychologie. Sie ist nicht imstande, etwas über die Substanz der Seele und ihre mögliche Beschaffenheit in einer zukünftigen Welt auszusagen.
b) Was kann die Psychologie leisten?
Psychologie untersucht wissenschaftlich das Verhalten und die mentalen Prozesse des Menschen. Die Hauptfragen sind: Wie denkt, fühlt und verhält sich der Mensch in sozialen Beziehungen und deren Kontext? Welche Auswirkungen haben äußere Umstände auf sein inneres Erleben und wie interagiert er mit seiner Umwelt?
Psychologen nutzen verschiedene Methoden und Theorien, um Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen und Handlungen von Individuen und Gruppen zu studieren. Sie beobachten, leiten Experimente an, sammeln Informationen aus der therapeutischen Arbeit mit Patienten und entwickeln theoretische Modelle aus dem erworbenen Wissen. Auch werden Erkenntnisse aus Bereichen wie der Soziologie und der Biologie hinzugezogen.
Die Erkenntnisse aus der Psychologie werden in zahlreichen Bereichen wie der Therapie und Beratung, in Bildung und Organisationsmanagement, der Arbeitswelt, dem Gesundheitswesen und der Forschung angewendet.
c) Das Zusammenwirken von Psychologie und Seelsorge
Psychotherapie und Seelsorge sind verschiedene Dinge. Es handelt sich um grundverschiedene Richtungen mit grundverschiedenen Zielen. Dem Seelsorger geht es um geistliches Leben, dem Therapeuten geht es in erster Linie um seelisches Leben. Während in der Psychotherapie im Allgemeinen zwei Partner zu Wort kommen, wirken in der Seelsorge drei Partner mit. Der lebendige Gott ist als Dritter gegenwärtig.
Die Seelsorge bedarf der Psychologie. Der Seelsorger braucht psychologische Erkenntnisse, wenn er das Wort Gottes zielsicher anbringen will. Seelsorge ist ohne klare Diagnostik verschwommen und oft wenig fruchtbar. Psychologie untersucht und beschreibt das Verhalten, Erleben und Handeln des Menschen. Der Seelsorger braucht Menschenkenntnis, wenn er die Botschaft des Evangeliums vollmächtig ausrichten will. Denn jeder Hörer ist anders. Jeder Mensch beurteilt, interpretiert und empfindet die Botschaft in seiner eigenen Weise.
Darum bedeutet Psychologie in der Seelsorge:
Schwierigkeiten, die der Ratsuchende nicht aus eigener Kraft beiseite räumen kann, mit Hilfe eines geschulten Seelsorgers zu erkennen und zu überwinden;
Ängste, deren Hintergründe der Ratsuchende nicht kennt, offenzulegen;
echte und falsche Schuldgefühle zu unterscheiden;
unangemessene Schuldgefühle nicht überzubewerten;
Unlust, deren Motive er nicht versteht,
Hoffnungslosigkeit, deren Quelle ihm verborgen ist,
Fanatismus, den er nicht ablegen kann,
Rechthaberei, die er nicht durchschaut,
ungeistliche Gesetzlichkeit, die er für biblisch hält,
Jähzorn, der ihn überkommt, zu hinterfragen;
auch verborgene Absichten und Ziele auf Hintergrundgedanken abzuleuchten und – wenn es gelingt – aus dem Weg zu räumen.