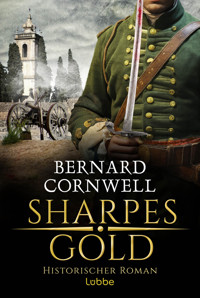9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Spanien, 1813. Major Richard Sharpe wartet begierig darauf, dass Wellington die Franzosen zu einer entscheidenden Schlacht stellt. Ohne die Spanier wäre ein englischer Sieg allerdings unmöglich, weshalb die Allianz mit ihnen unter allen Umständen bewahrt werden muss. Das weiß auch der französische Spion Dierre Ducos, ein Todfeind Sharpes. Mit Hilfe der schönen Marquesa Hélène hat der Franzose einen teuflischen Plan ausgeklügelt, der die spanisch-englische Allianz zerbrechen und den verhassten Sharpe vernichten wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
EPILOG
ANMERKUNGEN DES AUTORS
HISTORISCHE ANMERKUNG
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 80er Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
Bernard Cornwell
SHARPESEHRE
Richard Sharpe und der Victoria-FeldzugFebruar bis Juni 1813
Aus dem Englischen vonJoachim Honnef
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Überarbeitete Fassung des 1991 bei Bastei Lübbe erschienenen Romans »Sharps Ehre«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1985 by Bernard Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Honour«
Published by arrangement with Marco Vigevani & Associati
Agenzia Letteraria, on behalf of Toby Eady Associates Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Rainer Delfs
Titelillustration: © Bao Pham
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1465-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
»Sharpes Ehre« ist Jasper Partingtonund Shona Crawford Poole gewidmet,
PROLOG
Es gab ein Geheimnis, durch das der Krieg für Frankreich gewonnen werden konnte. Keine Geheimwaffe und ebenso wenig irgendeine überraschende Strategie, durch die alle Feinde Frankreichs besiegt werden würden, sondern eine politische Finte, die die Briten aus Spanien vertreiben würde, ohne dass eine Muskete abgefeuert werden musste. Es war ein Geheimnis, das bewahrt und für das bezahlt werden musste.
Deshalb ritten an einem eisigkalten Wintertag im Jahre 1813 zwei Männer in die nördlichen Hügel Spaniens. Immer wenn sich die Straße gabelte, wählten sie den schmaleren Pfad. Sie stiegen über gefrorene Wege immer höher zu einem Platz der Felsen, der Adler, des Windes und der Grausamkeit, bis sie schließlich unter der Februarsonne das ferne Meer glitzern sahen und in ein verstecktes Hochtal gelangten, in dem es nach Blut roch.
Am Zugang zum Tal gab es Wachtposten, in Lumpen und Felle gehüllte Männer, die mit Musketen bewaffnet waren. Die Posten stoppten die beiden Reiter, riefen sie an, und dann knieten sie sich vor einem der Reiter hin, der ihnen mit behandschuhter Hand den Segen erteilte. Die beiden Männer ritten weiter.
Der Kleinere der beiden, der Bewahrer dieses größten aller Geheimnisse, hatte ein schmales, bleiches Gesicht mit Pockennarben. Er zügelte sein Pferd oberhalb einer felsigen Arena, die entstanden war, als in diesem Tal in einem Bergwerk Erz gefördert worden war. Der kleine Mann blickte kalt auf die Szene, die sich unter ihm abspielte. »Ich dachte, ihr veranstaltet keine Stierkämpfe im Winter.«
Es war ein primitiver Stierkampf, kein prächtiges Schauspiel, wie es auf den mit Barrikaden abgesperrten Plazas der großen Städte im Süden geboten wurde. Vielleicht hundert Männer jubelten von den Seiten der Felsarena, während zwei Männer einen schwarzen, gereizten Stier quälten, aus dessen Nacken das Blut rann. Das Tier war ohnehin geschwächt, weil es im Lauf des Winters schlecht gefüttert worden war, seine Angriffe waren Mitleid erregend, und der Tod kam schnell. Der Stier wurde nicht mit dem traditionellen Degen getötet und auch nicht mit dem kleinen Messer zwischen den Nackenwirbeln, sondern mit dem Schlachtbeil.
Ein riesiger Mann in Lederbekleidung unter einem Wolfsfell schwang das Schlachtbeil, das in der schwachen Sonne glänzte. Der Stier versuchte dem Hieb auszuweichen, schaffte es jedoch nicht. Er sandte einen letzten, nutzlosen Schrei zum Himmel, dann schlug das Schlachtbeil durch Knochen, Sehnen und Muskeln, und die Zuschauer jubelten.
Der kleine Mann, dessen Miene bei dem Anblick Abscheu widerspiegelte, wies auf den Mann mit dem Schlachtbeil. »Ist er das?«
»Das ist er, Comandante.« Der große Priester musterte den kleinen bebrillten Mann, als genieße er dessen Reaktion. »Das ist El Matarife – der Schlächter.«
El Matarife bot einen Furcht erregenden Anblick. Er war groß und kraftstrotzend, doch es war vor allem sein Gesicht, das Furcht einflößte. Mit seinem dichten Bart wirkte er wie eine Mischung aus Mensch und Tier. Der Bart wucherte bis zu den Wangenknochen, sodass seine kleinen, verschlagen blickenden Augen wie Schlitze zwischen Bart und Haupthaar aussahen. Es war das Gesicht einer Bestie, das jetzt über dem toten Stier zu beiden Reitern aufblickte. El Matarife verneigte sich spöttisch. Der Priester hob grüßend eine Hand.
Die Männer in der Felsarena, Partisanen des Schlächters, riefen nach einem Gefangenen. Der Kadaver des Stiers wurde am Felshang hochgezogen zu den anderen drei toten Tieren, deren Blut das weiße, kalte Gestein gefärbt hatte.
Der kleine Mann runzelte die Stirn. »Ein Gefangener?«
»Sie erwarten doch wohl nicht, dass El Matarife auf einen Willkommensgruß für Sie verzichtet, Comandante? Schließlich kommt nicht jeden Tag ein Franzose her.« Der Priester freute sich über das Unbehagen des kleinen Franzosen. »Und es wäre klug, zuzuschauen, Comandante. Eine Weigerung würde als Beleidigung seiner Gastfreundschaft betrachtet werden.«
»Gott verdamme seine Gastfreundschaft«, sagte der kleine Mann, aber er blieb.
Dieser kleine Franzose mit der Brille bot keinen beeindruckenden Anblick, doch das Äußere war trügerisch. Pierre Ducos wurde Commandant genannt, obwohl Major nicht sein wahrer Rang war und er überhaupt keinen Rang in der französischen Armee hatte, was jedoch keiner wusste. Er sprach außer dem Kaiser niemanden mit »Sire« an. Er war teils Spion, teils Polizist und ganz Politiker. Es war Pierre Ducos, der seinem Kaiser das Geheimnis vorgeschlagen hatte, und Pierre Ducos musste es in die Tat umsetzen und so den Krieg für Frankreich gewinnen.
Ein blonder Mann, nur mit Hemd und Hose bekleidet, wurde an den Kadavern der Stiere vorbeigeschoben. Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Er blinzelte, als wäre er von einer finsteren Stätte plötzlich ins Tageslicht gebracht worden.
»Wer ist das?«, fragte Ducos.
»Einer der Männer, die er in Salinas gefangen nahm.«
Ducos stieß einen Grunzlaut aus. El Matarife war ein Partisanenführer, einer der vielen, die das nördliche Hügelland heimsuchten, und er hatte vor Kurzem einen französischen Konvoi überrascht und ein Dutzend Gefangene gemacht. Ducos rückte seine Brille zurecht. »Er nahm zwei Frauen gefangen.«
»Stimmt«, sagte der Priester.
»Was geschah mit ihnen?«
»Interessiert Sie das sehr, Comandante?«
»Nein.« Ducos’ Tonfall klang mürrisch. »Sie waren Huren.«
»Französische Huren.«
»Trotzdem Huren.« Er sagte es angewidert. »Was geschah mit ihnen?«
»Sie gehen ihrem Gewerbe nach, Major, aber ihr Lohn ist das Leben statt Bargeld.«
Der blonde Gefangene war zum Fuß der Felsarena gebracht worden. Jetzt wurden seine Handfesseln durchgeschnitten. Er krümmte die Hände in der Eiseskälte und fragte sich offenbar, was ihm an dieser Stätte, die nach Blut stank, widerfahren würde. Bei den Zuschauern herrschte erwartungsvolle Vorfreude. Sie waren still, doch sie grinsten, weil sie wussten, was geschehen würde.
Eine Kette wurde in die Arena geworfen.
Die rostige Eisenkette fiel in das Blut des Stiers, das in der Kälte dampfte. Der Gefangene schauderte. Er wich einen Schritt zurück, als ein Mann ein Ende der Eisenkette anhob, doch dann ließ er sich stumm und ohne Widerstand die Kette um seinen linken Unterarm binden.
Der Schlächter, dessen gewaltiger Bart vom Blut des Stiers bespritzt war, nahm das andere Ende der Eisenkette. Er schlang es um seinen linken Arm und lachte den Gefangenen an. »Ich werde zählen, wie lange es dauert, bis du stirbst, Franzmann.«
Der französische Gefangene verstand die spanischen Worte nicht. Er erkannte jedoch, was auf ihn zukam, als man ihm ein Messer mit langer Klinge in die Hand drückte, das identisch mit dem Messer in El Matarifes Hand war. Die Kette, die beide Männer miteinander verband, war drei Yards lang.
Der Priester lächelte. »Haben Sie schon mal solch einen Kampf gesehen?«
»Nein.«
»Er verlangt Geschicklichkeit.«
»Zweifellos«, sagte Ducos trocken.
Alle Geschicklichkeit war auf Seiten des Schlächters. Er hatte Übung in diesem Messerkampf, und er fürchtete keinen Gegner. Der Franzose war tapfer, aber verzweifelt. Seine Angriffe waren heftig, jedoch unbeholfen. Er wurde durch die Eisenkette aus dem Gleichgewicht gerissen, wurde gequält, erhielt Schnitte, und bei jedem Schnitt, den El Matarife ihm zufügte, zählten die Partisanen laut mit. »Uno!« Ein Schnitt, der dem Franzosen die Stirn aufriss. »Dos!« Ein Schnitt in die linke Hand. Die Zahl wuchs.
Ducos schaute zu. »Wie lange dauert das?«
»Vielleicht bis fünfzig.« Der Priester zuckte mit den Schultern. »Vielleicht auch länger.«
Ducos schaute den Priester an. »Gefällt Ihnen das?«
»Mir gefallen alle männlichen Zeitvertreibe, Comandante.«
Ducos lächelte. »Außer einem.«
Padre Hacha blickte wieder in die Arena hinab. Der Priester war groß, ein Hüne wie El Matarife. Er zeigte kein Mitleid mit dem Gefangenen, dem El Matarife Schnitte und Stiche zufügte. Padre Hacha war in vielerlei Hinsicht ein idealer Partner für Pierre Ducos. Wie der Franzose war er teils Spion, teils Polizist und ganz Politiker, doch seine Politik war die der Kirche, und seine Fähigkeiten waren der spanischen Inquisition gewidmet. Padre Hacha war ein Inquisitor.
»Catorce!«, schrien die Partisanen, und Ducos, erschreckt von dem lauten Aufschrei, schaute wieder hinunter in den Felsenkessel.
El Matarife, der noch nicht vom Messer des Gefangenen getroffen worden war, hatte seinem Gegner mit großem Geschick das linke Auge ausgestochen. El Matarife wischte sorgfältig die Messerspitze an seinem Lederärmel ab. »Komm, Franzmann!«
Der Gefangene hatte seine linke Hand auf die Augenhöhle gepresst. Die Eisenkette spannte sich und klirrte leise, als El Matarife die Hand des Gefangenen von der blutigen Augenhöhle fortzog. Der Gefangene schüttelte den Kopf und schluchzte. Er wusste, dass er lange und schmerzhaft sterben würde. So sah stets der Tod für die Franzosen aus, die von Partisanen gefangen genommen wurden, und auf die gleiche grausame Weise starben die Partisanen, die von den Franzosen gefangen genommen wurden.
Der Franzose zerrte an der Kette und versuchte, El Matarifes Druck standzuhalten, doch er war machtlos gegen den riesigen Mann. Plötzlich riss El Matarife an der Eisenkette, der Franzose fiel und wurde wie ein auf Land geratener Fisch über den Boden geschleift. Als der Spanier innehielt, wollte sich der Franzose aufrappeln, doch ein Tritt traf seinen linken Unterarm, brach den Knochen, und er wurde weitergeschleift. Die Zuschauer lachten über seine Schmerzensschreie.
Ducos’ Miene war ausdruckslos.
Padre Hacha lächelte. »Das regt Sie nicht auf, Comandante? Er ist ein Landsmann von Ihnen.«
»Ich hasse alle unnötige Grausamkeit.« Ducos rückte wieder seine Brille zurecht. Es war eine neue Brille, die er aus Paris hatte schicken lassen. Seine alte Brille war an Weihnachten von einem britischen Offizier namens Richard Sharpe mit dem Säbel zerschlagen worden. Diese Schmach nagte noch in Ducos, aber er glaubte an das spanische Sprichwort, dass man Rache kalt genießen soll.
Bei zwanzig hatte der Franzose sein rechtes Auge verloren.
Bei fünfundzwanzig schluchzte er um Gnade. Er war nicht mehr in der Lage zu kämpfen, und seine zerlumpte, vor Schmutz starrende Hose war mit frischem Blut besudelt.
Bei dreißig erstickte sein Schluchzen, und der Gefangene wurde getötet. El Matarife ärgerte sich, weil der Mann keine Gegenwehr mehr leistete und es langweilig wurde. Er schnitt dem Gefangenen die Kehle durch, enthauptete ihn und warf den Kopf den Hunden vor, die von den toten Stieren weggejagt worden waren. Dann band er die Kette von seinem linken Unterarm, schob das Messer in die Scheide und schaute wieder zu den beiden Reitern empor. Er lächelte den Priester an. »Willkommen, Bruder! Was hast du mir gebracht?«
»Einen Gast.« Der Priester sagte es mit Nachdruck.
El Matarife lachte. »Bring ihn zum Haus, Thomas!«
Ducos folgte dem Inquisitor zwischen Felsen hindurch zu einem Haus, das aus Steinen erbaut war. Decken hingen vor den Fenster- und Türöffnungen. Im Haus, das von einem Feuer erwärmt wurde, wartete eine Mahlzeit. Es gab Fleischeintopf, Brot, Wein und Ziegenkäse. Das Mahl wurde von einem Mädchen mit narbigem, schmalem Gesicht serviert. El Matarife gesellte sich zu ihnen und brachte den Geruch von frischem Blut in die feuchte Wärme des kleinen Raums.
Der Partisanenführer schloss den Priester in die Arme. Sie waren Brüder, aber sie ähnelten sich kein bisschen. Die Körpergröße war gleich, doch das war die einzige Übereinstimmung. Der Inquisitor war gewandt, schlau und feinfühlig, und El Matarife war grob, primitiv und wild. Der Partisanenführer war der Typ Mann, den Pierre Ducos verabscheute, denn er bewunderte Schlauheit und hasste brutale Kraft, doch der Inquisitor würde ihm nur helfen, wenn sein Bruder ins Vertrauen und in ihren Plan einbezogen wurde.
El Matarife löffelte den fetten Eintopf. Saft tropfte auf sein Bartgestrüpp. Er schaute Ducos mit den kleinen, rot geränderten Augen an. »Tapfer von Ihnen, hierher zu kommen.«
»Ich komme unter dem Schutz Ihres Bruders.« Ducos sprach perfekt Spanisch, wie er ein halbes Dutzend anderer Sprachen beherrschte.
El Matarife schüttelte den Kopf. »In diesem Tal, Franzmann, sind Sie unter meinem Schutz.«
»Dann bin ich dankbar dafür.«
»Hat es Ihnen gefallen, Ihren Landsmann sterben zu sehen?«
Ducos antwortete in sanftem Tonfall. »Wem würde Ihr kämpferisches Können nicht gefallen?«
El Matarife lachte. »Möchten Sie noch einen sterben sehen?«
»Juan!«, mahnte der Inquisitor laut. Er war der ältere Bruder, und seine Autorität schüchterte El Matarife ein. »Wir sind geschäftlich hier, Juan, nicht zum Vergnügen.« Er wies zu den anderen anwesenden Männern. »Und wir werden allein miteinander reden.«
Pierre Ducos war nicht gern hierher gekommen, doch der Krieg befand sich in einer so entscheidenden Phase, dass er den Forderungen des Inquisitors zugestimmt hatte.
Ducos hatte sich einverstanden erklärt, mit seinem Feind an diesem Tisch zu sitzen, weil der Krieg schlecht für Frankreich verlief. Der Kaiser war mit der größten Armee der Neuzeit in Russland einmarschiert, und diese Armee war in einem Winter vernichtend geschlagen worden. Jetzt bedrohte das nördliche Europa Frankreich. Die Armeen von Russland, Preußen und Österreich witterten den Sieg. Um sie zu bekämpfen, zog Napoleon Truppen aus Spanien ab, zu einem Zeitpunkt, an dem der englische General Wellington seine Streitkräfte verstärkte. Nur ein Dummkopf glaubte jetzt noch an einen militärischen Sieg der Franzosen in Spanien, und Pierre Ducos war kein Dummkopf. Wenn die Armee die Briten nicht besiegen konnte, so war vielleicht jedoch ein Sieg durch die Politik möglich.
Das dünne Mädchen, das aus Furcht vor ihrem Herrn und Meister zitterte, schenkte Wein in silberne Becher ein. In das Silber war das »N« von Napoleon ziseliert. Es war Beute, die der Schlächter bei einem seiner Angriffe auf die Franzosen gemacht hatte. Ducos wartete, bis das Mädchen fort war, und dann sprach er mit seiner ruhigen, tiefen Stimme von Politik.
In Frankreich, im Luxus des Château von Valençay, befand sich der spanische König als Gefangener. Für sein Volk war Ferdinand VII. der rechtmäßige König, den man ihnen genommen hatte, ein Symbol für ihren Stolz. Sie kämpften nicht nur, um die französischen Invasoren zu vertreiben, sondern auch, um ihren König wieder auf den Thron zu setzen. Jetzt schlug Napoleon vor, den Spaniern ihren König zurückzugeben.
El Matarife schnitt Ziegenkäse mit dem Messer ab, mit dem er den Gefangenen gequält und getötet hatte. »Die Franzosen wollen den Spaniern den König zurückgeben?«, fragte er ungläubig.
»Er wird wieder auf den Thron kommen«, bekräftigte Ducos.
Ferdinand VII., erklärte der Franzose, würde nach Spanien zurückgeschickt werden. Er würde in allen Ehren zurückkehren dürfen, aber nur, wenn er den Vertrag von Valençay unterzeichnete. Das war das Geheimnis – der Vertrag, den Ducos für eine geniale Idee hielt. In dem Vertrag hieß es, dass der Krieg, der unglücklicherweise zwischen Spanien und Frankreich ausgebrochen war, jetzt vorüber sei. Es würde Frieden sein. Die französischen Armeen würden sich aus Spanien zurückziehen, und der Vertrag enthielt das Versprechen, dass die Feindseligkeiten nicht fortgesetzt werden würden. Spanien würde ein freies, souveränes Land mit seinem geliebten König sein. Spanische Gefangene würden aus französischen Lagern heimgeschickt werden, spanische Trophäen würden ihren Regimentern zurückgegeben und der verletzte Stolz würde durch französische Schmeicheleien aufpoliert werden.
Als Gegenleistung musste Ferdinand nur eines versprechen: dass er die Allianz mit Britannien beenden würde. Die britische Armee sollte den Befehl erhalten, Spanien zu verlassen, und wenn sie das nicht sofort tat, durfte sie kein Futter für ihre Pferde, keinen Proviant für ihre Männer erhalten und keinen Hafen mit ihren Versorgungsschiffen anlaufen. Eine hungernde Armee war keine. Ohne dass ein Schuss fiel, würde Wellington gezwungen sein, Spanien zu verlassen, und Napoleon konnte jeden von der Viertelmillion französischer Soldaten in Spanien gegen die nördlichen Feinde marschieren lassen. Es war ein Geniestreich.
Natürlich musste das ein Geheimnis bleiben. Wenn die britische Regierung auch nur im Traum dachte, dass solch ein Vertrag vorbereitet wurde, dann würde britisches Gold fließen, Bestechungsgelder würden angeboten werden, und die Bevölkerung Spaniens würde aufgehetzt und gegen einen Frieden mit Frankreich aufgewiegelt werden.
Ducos räumte ein, dass der Vertrag in Spanien unpopulär sein würde. Die einfachen Leute, die Bauern, deren Frauen von den Franzosen vergewaltigt und deren Felder geplündert worden waren, würden keinen Frieden mit ihrem erbitterten Feind begrüßen. Nur ihr geliebter, abwesender König konnte sie überreden, einen Frieden mit Frankreich zu akzeptieren, und ihr König zögerte.
Ferdinand VII. wollte eine Rückversicherung. Würde ihn der spanische Adel unterstützen? Die spanischen Generäle? Und – das Wichtigste – was würde die Kirche sagen? Es war Ducos’ Aufgabe, dem König Antworten auf die Fragen zu liefern, und der Mann, der Ducos die Antworten geben würde, war der Inquisitor.
Padre Hacha war gerissen. Er war durch seine Raffinesse in der Inquisition aufgestiegen, und er wusste die geheimen Kanäle zu nutzen, die von der Inquisition zu allen wichtigen Leuten gepflegt wurden. Er konnte die anderen Inquisitoren in jedem Teil Spaniens einsetzen, um von wichtigen Persönlichkeiten Briefe zu sammeln, die dem gefangenen spanischen König übergeben wurden und die ihm versicherten, dass ein Frieden mit Frankreich von genug Adeligen, Geistlichen, Offizieren und Händlern akzeptiert werden würde, sodass der Vertrag möglich war.
All dies hörte sich El Matarife an. Als Ducos seinen Vortrag beendet hatte, zuckte der Partisanenführer mit den Schultern, wie um zu sagen, dass Politik nicht seine Sache war. »Ich bin Soldat.«
Pierre Ducos nippte an seinem Wein. Ein Windstoß hob eine der feuchten Decken vor einer Fensteröffnung an, und die Talgkerze auf dem Tisch flackerte. Ducos lächelte. »Ihre Familie war einst reich.«
El Matarife wies mit dem Messer, an dem noch Käse haftete, auf den Franzosen. »Eure Truppen zerstörten unseren Reichtum.«
»Ihr Bruder«, sagte Ducos mit einer Spur von Spott, »hat einen Preis für die Hilfe ausgehandelt, die er mir gewähren wird.«
»Einen Preis?« Der bärtige Hüne grinste bei dem Gedanken an Geld.
Ducos grinste zurück. »Der Preis ist die Rückgabe des Familienvermögens und mehr.«
»Mehr?« El Matarife schaute seinen Bruder an.
Der Priester nickte. »Dreihunderttausend Guineen, Juan.«
El Matarife lachte. Er blickte von seinem Bruder zu dem Franzosen und sah, dass keiner von beiden lächelte, dass die Summe stimmte, und sein Lachen verstummte. Er starrte Ducos streitlustig an. »Sie betrügen uns, Franzmann. Ihr Land wird niemals so viel zahlen. Niemals!«
»Das Geld kommt nicht von Frankreich«, sagte Ducos.
»Woher dann?«
»Von einer Frau«, erklärte Ducos sanft. »Aber zuerst muss jemand getötet werden, dann muss jemand inhaftiert werden, und das, El Matarife, ist Ihre Aufgabe bei diesem Plan.«
Der Partisanenführer sah seinen Bruder fragend an, und als der Priester bestätigend nickte, heftete er den Blick wieder auf den Franzosen. »Einer soll getötet werden?«
»Ja. Der Ehemann der Frau.«
»Wer soll inhaftiert werden?«
»Die Frau.«
»Wann?«
Pierre Ducos sah das Lächeln des Partisans, und Hoffnung stieg in ihm auf. Das Geheimnis würde sicher und Frankreich würde gerettet sein. Mit dreihunderttausend Guineen, die er nicht auszugeben brauchte, würde er die Zukunft von Napoleons Kaiserreich kaufen.
»Wann?«, fragte der Partisanenführer noch einmal.
»Im Frühjahr«, sagte Ducos. »In diesem Frühjahr. Werden Sie bereit sein?«
»Wenn mich Ihre Soldaten in Frieden lassen.« El Matarife lachte.
»Das verspreche ich.«
»Dann werde ich bereit sein.«
Das Übereinkommen wurde per Handschlag besiegelt. Das Geheimnis, der Vertrag, der zu Britanniens Niederlage führen sollte, würde sicher sein, und darüber hinaus würde sich Pierre Ducos an dem Engländer rächen, der seine Brillengläser mit dem Säbel in Stücke geschlagen hatte. Im Frühjahr, wenn sich die Armeen auf einen Krieg vorbereiteten, der binnen eines Jahres durch den geheimen Vertrag überflüssig werden würde, sollte ein Soldat namens Richard Sharpe sterben.
KAPITEL 1
Major Richard Sharpe stand an einem nasskalten Frühlingstag an einer alten Steinbrücke und spähte auf die Straße, die südwärts zu einem tiefen Pass in dem felsigen Hügelkamm führte. Der Wind wehte kalt in das felsige Tal hinab, und die Hügel waren dunkel vom Regen. Hinter Sharpe standen fünf Kompanien Infanterie. Die Männer hatten Lappen um die Schlösser ihrer Musketen gewickelt und die Mündungen mit Korken verstopft, damit kein Regen in die Läufe geriet.
Der Pass war fünfhundert Yards entfernt. In ein paar Minuten würde dort der Feind auftauchen, und Sharpes Aufgabe war es, zu verhindern, dass er die Brücke überquerte. Ein einfacher Job, die Arbeit eines Soldaten. Die Aufgabe wurde erleichtert, weil das Frühjahr 1813 spät kam, das Wetter in diesen Hügeln im Grenzland nur Regen gebracht hatte und der Fluss tief, reißend und unpassierbar geworden war. Der Feind musste zur Brücke kommen, wo Sharpe wartete, oder er konnte den Fluss nicht überqueren.
»Sir?« D’Alembord, Captain der Leichten Kompanie, sprach Major Sharpe zögernd und leise an, als befürchte er, Sharpes Zorn auf sich zu ziehen.
»Ja?«
»Ein Stabsoffizier kommt, Sir.«
Sharpe stieß einen Grunzlaut aus, sagte jedoch nichts. Er hörte Hufschlag nahen. Der Reiter passierte ihn, zog das Pferd um die Hand und zügelte es. Der Reiter, ein Kavallerie-Lieutenant, schaute aufgeregt auf Sharpe hinab.
»Major Sharpe?«
Ein dunkles Augenpaar, das hart und ärgerlich blickte, sah von den vergoldeten Sporen des Lieutenants auf. Der Blick schweifte über die Stiefel und den mit Schlamm bespritzten blauen Umhang und heftete sich auf die Augen des aufgeregten Stabsoffiziers. »Sie sind mir im Weg, Lieutenant.«
»Verzeihung, Sir.«
Der Lieutenant trieb sein Pferd hastig zur Seite. Er war hart geritten auf seinem Kurierritt durch schwieriges Terrain, und er war stolz darauf, es geschafft zu haben. Sein Stute war unruhig wie der aufgeregte Reiter. »General Preston lässt grüßen, Sir, und der Feind kommt in Ihre Richtung.«
»Ich habe Posten auf dem Hügelkamm«, sagte Sharpe schroff. »Ich sah den Feind seit einer halben Stunde.«
»Jawohl, Sir.«
Sharpe spähte zum Pass. Der Lieutenant überlegte, ob er stumm davonreiten sollte, als der große Major der Schützen wieder den Blick auf ihn richtete. »Sprechen Sie Französisch?«
Der Lieutenant, der nervös war, weil er Major Richard Sharpe zum ersten Mal begegnete, nickte eifrig. »Jawohl, Sir.«
»Wie gut?«
Der Kavallerist lächelte. »Très bien, Monsieur, je parle …«
»Ich habe keine verdammte Demonstration verlangt! Antworten Sie!«
Der Lieutenant war bestürzt wegen des heftigen Tadels. »Ich spreche gut Französisch, Sir.«
Sharpe starrte ihn an. Der Lieutenant dachte, dass auf diese Art ein Henker einen einst privilegierten Delinquenten anstarren würde. »Wie heißen Sie, Lieutenant?«
»Trumper-Jones, Sir.«
»Haben Sie ein weißes Taschentuch?«
Diese Unterhaltung, fand Trumper-Jones, wurde zunehmend sonderbar. »Jawohl, Sir.«
»Gut.« Sharpe spähte wieder zu den Hügeln und der Passstraße hinauf.
Das ist zu einem Scheißjob geworden, dachte er. Die britische Armee säuberte die Straßen östlich der portugiesischen Grenze. Sie trieben die französischen Vorposten zurück und räumten die französischen Garnisonen, damit die Straßen bereit für den Sommerfeldzug der Armee waren.
An diesem regnerischen, kalten und windigen Tag hatten fünf britische Bataillone eine kleine französische Garnison am Fluss namens Tormes angegriffen. Knapp fünf Meilen hinter den Franzosen, auf der Straße, die ihr Rückzugsweg war, befand sich diese Brücke. Sharpe war mit einem halben Bataillon und einer Kompanie von Schützen in einem Nachtmarsch im Bogen zu der Brücke geschickt worden, um den Rückzug der Franzosen zu blockieren. Seine Aufgabe war einfach. Er sollte die Franzosen lange genug aufhalten, bis die anderen Bataillone heran waren und sie erledigten. So einfach war das, doch nun, am späten Nachmittag, war Sharpe zornig und erbittert. Da war etwas schiefgelaufen.
»Sir?«
Sharpe blickte auf. Lieutenant Trumper-Jones hielt ihm ein gefaltetes Leinentaschentuch hin und lächelte nervös. »Sie wollten ein Taschentuch, Sir?«
»Ich will mir nicht die Nase putzen, Sie Blödmann! Es ist für eine Kapitulation!«, grollte Sharpe und ging zwei Schritte fort.
Michael Trumper-Jones starrte ihm nach. Es stimmte, dass sich tausendfünfhundert Franzosen dieser kleinen Truppe von weniger als vierhundert Mann näherten, aber nichts, was Trumper-Jones über Richard Sharpe gehört hatte, war eine Vorbereitung auf diese plötzliche Bereitschaft zur Kapitulation gewesen. Sharpes Ruhm war bis nach England gedrungen, woher Michael Trumper-Jones erst vor Kurzem gesegelt war, um in die Armee einzutreten, und je näher er an die Fronten gekommen war, desto öfter hatte er den Namen Richard Sharpe gehört. Sharpe war der Inbegriff des guten Soldaten, ein Mann, bei dem andere begierig um Anerkennung buhlten und dessen Name als Symbol für professionelle Fähigkeit galt, und offenbar ein Mann, der sich jetzt kampflos ergeben wollte.
Lieutenant Michael Trumper-Jones war entsetzt bei diesem Gedanken. Er schaute verstohlen auf Sharpes Gesicht, das von der Sonne gebräunt und vom Wind gegerbt war. Es war ein gut aussehendes Gesicht, trotz der Narbe unterhalb seines linken Auges, die ihm einen spöttischen, wissenden Ausdruck verlieh. Trumper-Jones wusste es nicht, aber dieser Ausdruck verschwand, wenn Sharpe lächelte.
Am meisten erstaunte Trumper-Jones, dass Major Richard Sharpe keine Rangabzeichen und weder Schärpe noch Epauletten trug. Nur der große, abgegriffene Kavallerie-Säbel an seiner Seite wies darauf hin, dass er Offizier war. Kaum zu glauben, dass dies der Mann war, der die erste Adler-Standarte von den Franzosen erbeutet hatte, der in die Bresche von Badajoz gestürmt war und mit den Deutschen bei Garcia Hernández gesiegt hatte. Kaum zu glauben, dass dieser selbstsichere Mann seine Karriere aus dem Mannschaftsstand begonnen hatte. Das machte es noch schwieriger, zu begreifen, dass er sich kampflos ergeben wollte.
»Was starren Sie mich so an, Lieutenant?«
»Nichts, Sir.« Trumper-Jones hatte gedacht, Sharpe beobachte die südlichen Hügel.
Das hatte er auch getan, doch er hatte das Starren des Lieutenants bemerkt, und es gefiel ihm nicht. Er hasste es, angegafft und beobachtet zu werden. In diesen Tagen fühlte er sich nur in Gesellschaft seiner Freunde wohl. Es wurde ihm ebenfalls bewusst, dass er unnötig schroff zu dem jungen Kavallerie-Offizier gewesen war. Er schaute zu ihm auf. »Wir haben drei Geschütze gezählt. Stimmen Sie da zu?«
»Jawohl, Sir.«
»Vierpfünder?«
»Ich glaube, ja, Sir.«
Sharpe grunzte. Er beobachtete den Pass. Er hoffte, dass er nach den beiden Fragen einen freundlicheren Eindruck auf den Lieutenant machte, obwohl er in Wirklichkeit keine freundlichen Gefühle für irgendeinen Fremden hegte. Seit Weihnachten war er in dieser depressiven Stimmung, hin und her gerissen von heftigen Schuldgefühlen und wilder Verzweiflung, weil seine Frau am verschneiten Tor Gottes gestorben war. Immer wieder sah er vor seinem geistigen Auge das Blut an ihrer Kehle. Er schüttelte den Kopf, wie um das Bild zu verbannen. Er fühlte sich schuldig, weil seine Frau Teresa ums Leben gekommen war, weil er sie betrogen hatte, weil er ihre Liebe nur so unzulänglich erwidert und zugelassen hatte, dass seine Tochter die Mutter verloren hatte.
Durch diese Schuld war er arm geworden. Seine Tochter, noch keine zwei Jahre alt, wuchs bei ihrem Onkel und ihrer Tante auf, und Sharpe hatte all seine Ersparnisse genommen und sie Antonia, seiner Tochter, geschenkt. Er besaß nichts mehr außer Säbel, Gewehr, Fernrohr und der Kleidung auf seinem Leib. Er ärgerte sich über diesen jungen Stabsoffizier auf seinem teuren Pferd und mit den vergoldeten Sporen an neuen Lederstiefeln.
In den Gliedern hinter ihm setzte Raunen ein. Die Männer hatten die kleinen Gestalten gesehen, die plötzlich auf dem südlichen Hügelkamm auftauchten. Sharpe wandte sich zu ihnen um. »Bataillon!« Es wurde still. »Bataillon! Stillgestanden!«
Die Stiefel der Männer knallten auf nassem Felsboden zusammen. Die Männer standen in zwei Gliedern quer vor der Mündung des kleinen Tals, in dem die Straße nordwärts führte.
Sharpe schaute sie an, und er wusste, wie nervös sie waren. Dies waren seine Männer, sein Bataillon, und er vertraute ihnen, selbst gegen den zahlenmäßig hoch überlegenen Feind. »Sergeant Huckfield!«
»Sir!«
»Fahnen hoch!«
Lieutenant Michael Trumper-Jones fand es unpassend, dass die Männer in einem solch feierlichen Augenblick grinsten. Dann sah er den Grund. Die »Fahnen« waren nicht die üblichen Flaggen eines Bataillons, sondern Stofftücher, die an zwei entlaubte Birkenstämme gebunden waren. Im Regen hingen sie schlaff herab, und aus der Ferne konnte man unmöglich erkennen, dass die Fahnen nur zwei Mäntel waren, die mit gelbem Besatz von Uniformröcken der Soldaten verziert worden waren. Oben auf den beiden »Fahnenstangen« war weiterer gelber Stoff angebracht, damit sie, zumindest aus der Ferne, den Kronen von England ähnelten.
Sharpe sah die Überraschung des jungen Stabsoffiziers. »Halbbatallione haben keine Fahnen, Mister Trumper-Jones.«
»Jawohl, Sir.«
»Und die Franzosen wissen das.«
»Jawohl, Sir.«
»Was werden sie also denken?«
»Dass Sie ein ganzes Bataillon haben, Sir?«
»Genau.« Sharpe blickte wieder nach Süden, und Michael Trumper-Jones fragte sich neugierig, warum dieses Täuschungsmanöver ein notwendiges Vorspiel für die Kapitulation war. Er hielt es für besser, nicht zu fragen. Major Sharpes Miene entmutigte ihn.
Kein Wunder, denn Major Richard Sharpe, der nach Süden spähte, dachte in diesem Augenblick, dass dieses Flusstal ein elender, unpassender und blöder Platz zum Sterben war. Er fragte sich manchmal, ob er im Tod Teresa wiedersehen würde, ihr schmales Gesicht, das ihn immer mit einem Lächeln begrüßt hatte, das jedoch immer mehr in der Erinnerung verblasste. Er hatte nicht einmal ein Bild von ihr, und seine Tochter, die in Teresas spanischer Familie aufwuchs, hatte weder von ihrer Mutter ein Bild noch von ihrem Vater.
Sharpe wusste, dass die Armee eines Tages von Spanien fortmarschieren und er mitmarschieren würde, und seine Tochter würde sich selbst überlassen sein, wie er als kleiner Junge als Waise zurückgeblieben war. Elend zeugt Elend, dachte er, und dann erinnerte er sich an den Trost, dass Antonias Onkel und Tante bessere und liebevollere Elternteile waren, als er jemals einer hätte sein können.
Eine Windbö peitschte Regen übers Tal, verdeckte die Sicht und warf prasselnden Regen auf die Steinbrücke. Sharpe sah zu dem berittenen Offizier auf. »Was sehen Sie, Lieutenant?«
»Sechs Reiter, Sir.«
»Sie haben keine Kavallerie?«
»Wir haben keine gesehen, Sir.«
»Dann sind es ihre Infanterie-Offiziere. Die Kerle werden unseren Tod planen.« Er lächelte bitter. Er wünschte, dieses Wetter würde aufhören, die Sonne würde das Land wärmen und die schrecklichen Erinnerungen an den Winter auslöschen.
Dann war der Horizont am Pass plötzlich von blauen Uniformen der Franzosen übersät. Sharpe zählte die Kompanien, die auf ihn zumarschierten. Sechs. Das war die Vorhut, die den Befehl erhalten würde, die Brücke zu stürmen, aber noch waren die französischen Geschütze nicht herangeschafft und in Stellung gebracht worden.
An diesem Morgen hatte sich Sharpe Captain Peter d’Alembords Pferd geliehen und war ein Dutzend Mal über die Route geritten, auf der sich die Franzosen näherten. Er hatte sich in die Lage des feindlichen Befehlshabers versetzt und mit sich gestritten, bis er sicher gewesen war, was der Feind tun würde. Als er jetzt beobachtete, tat der Feind genau das.
Die Franzosen wussten, dass eine große britische Streitmacht hinter ihnen war. Sie wagten nicht, die Straße zu verlassen und ihre Geschütze aufzugeben, um durch das Hügelland zu ziehen, denn dann würden sie den Partisanen ausgeliefert sein. Sie wollten diese Straßensperre schnell zerschmettern, und das Werkzeug dafür waren ihre Geschütze.
Etwa hundertfünfzig Yards unterhalb des Hügelkamms, wo die Straße eine letzte Biegung zum Tal hin beschrieb, gab es eine felsige Plattform, die eine ideale Stellung für Artillerie darstellte. Von dort aus konnten die Franzosen ihre Kartätschen in Sharpes beide Glieder feuern, und wenn sie die Briten verstreut hatten, sie verwundet waren und im Sterben lagen, würde die französische Infanterie die Brücke mit den Bajonetten stürmen. Von der bequemen Felsplattform aus konnten die französischen Geschütze über die Köpfe ihrer eigenen Infanterie hinwegfeuern. Die Plattform war dafür geschaffen, so sehr, dass Sharpe heute Morgen einen Arbeitstrupp dorthin geschickt hatte, der Felsbrocken entfernt hatte, die den Kanonieren lästig sein konnten.
Er wollte die französischen Geschütze dort haben. Er hatte die Franzosen förmlich eingeladen, sie dort in Stellung zu bringen.
Sharpe beobachtete, während die drei Teams langsam die Geschütze die steile Straße hinabmanövrierten. Infanteristen halfen, die Räder zu bremsen. Immer tiefer gelangten sie.
Es war möglich, dass die Geschütze auf die flache Fläche gegenüber der Brücke gebracht wurden, aber um das zu verhindern, hatte Sharpe seine Hand voll Schützen der Leichten Kompanie des South Essex Bataillons am Flussufer postiert. Die Franzosen würden sie dort sehen, die Treffsicherheit der Schützen fürchten und sich entscheiden, die Geschütze außerhalb der Gewehrschussweite in Stellung zu bringen.
Und so war es. Sharpe war erleichtert, dass die Teams zu der Plattform einschwenkten. Dann wurden die Kanonen abgeprotzt, und die Munition wurde nach vorn gebracht.
Sharpe wandte sich zu den Männern um. »Die Mündungen entkorken!«
Die Männer mit den roten Uniformröcken zogen die Korken aus den Läufen ihrer Musketen und wickelten die feuchten Lappen von den Schlössern ab. »Musketen – anlegen!«
Die Männer nahmen die Musketen an die Schulter. Die Franzosen würden die Bewegung natürlich sehen. Sie fürchteten die Schnelligkeit von britischem Musketenfeuer, den gut eingeübten Rhythmus des Todes, der so viele Schlachtfelder Spaniens heimgesucht hatte.
Sharpe wandte sich von seinen Männern ab. »Lieutenant?«
»Sir?« Michael Trumper-Jones sagte es mit piepsiger Stimme. Er versuchte es mit tieferer Stimme. »Sir?«
»Binden Sie Ihr Taschentuch an Ihren Säbel.«
»Aber, Sir …«
»Befolgen Sie den Befehl, Lieutenant!« Sharpe sagte es so leise, dass keiner der Männer außer Trumper-Jones es hören konnte, aber die Worte klangen hart und scharf.
»Jawohl, Sir.«
Die sechs Kompanien der Franzosen waren etwa zweihundertfünfzig Yards entfernt. Sie kamen in einer Kolonne, mit aufgepflanzten Bajonetten, und sie waren bereit, anzugreifen, wenn die Geschütze ihre Aufgabe erledigt hatten.
Sharpe nahm das Fernrohr aus der Provianttasche, zog es aus und schaute sich die Geschütze an. Er sah die Kartätschen, die Metallbehälter, die ihre Kugeln in einem Fächer des Todes ausbreiten würden.
Dies war der Augenblick, in dem er es hasste, Major zu sein. Er musste lernen, Arbeit zu delegieren, andere Männer die gefährliche, harte Arbeit erledigen zu lassen, doch in diesem Moment, in dem die französischen Kanoniere die letzten Vorbereitungen zum Feuern trafen, wünschte er, bei der Kompanie Schützen zu sein, die ihm für dieses Tagewerk zugeteilt worden war.
Die erste Kartätsche wurde in ein Rohr geschoben.
»Jetzt, Bill!«, sagte Sharpe laut. Michael Trumper-Jones fragte sich, ob er etwas darauf erwidern sollte, und sagte sich, dass er besser den Mund hielt.
Links der Straße, von den hohen Felsen, die dort aufragten, waren weiße Rauchwölkchen zu sehen. Dann folgte das Krachen von Gewehren. Drei der Kanoniere brachen getroffen zusammen.
Es war ein einfacher Hinterhalt. Eine Kompanie Schützen nahe der Stelle versteckt, an der die Geschütze gezwungenermaßen abgeprotzt werden mussten.
Die Franzosen wurden von den Schützen völlig überrascht. Weil sie selbst keine Gewehre benutzten, sondern die Muskete mit glattem Lauf vorzogen, die so viel schneller feuerte, trafen sie keine Vorsichtsmaßnahmen gegen die Grünröcke, die so geschickt in Deckung gingen und auf drei- oder vierhundert Schritt schießen konnten. Jetzt lag die Hälfte der Kanoniere am Boden, Pulverrauch wallte dicht, und immer noch krachten Gewehre, und Kugeln schlugen in die Besatzungen der Geschütze. Die Schützen wechselten die Positionen, um am Rauch der vorangegangenen Schüsse vorbei zu zielen, erschossen die Zugpferde, damit die Geschütze nicht mehr bewegt werden konnten, und töteten die Kanoniere, sodass die bewegungsunfähig gemachten Geschütze nicht mehr bedient werden konnten.
Die Nachhut des Feindes, die auf der Straße hinter den Geschützen war, wurde im Laufschritt vorwärts befohlen. Die Männer formierten sich unterhalb der Felsen und wurden hinauf befohlen, doch der Felshang war zu steil, und die Schützen waren beweglicher als ihre schwer beladenen Feinde. Der französische Angriff verhinderte immerhin, dass die britischen Schützen weiterhin auf die Kanoniere feuerten, und diejenigen Artilleristen, die überlebt hatten, krochen aus der Deckung ihrer Protzen, um die Geschütze weiter zu laden.
Sharpe lächelte.
Da war ein Mann namens William Frederickson in diesen Hügeln. Halb Deutscher, halb Engländer und Furcht erregender als jeder Soldat, den Sharpe bisher gesehen hatte. Er wurde von seinen Männern »der liebe Bill« genannt, obwohl er mit seiner Augenklappe, den falschen Schneidezähnen und mit dem narbigen Gesicht alles andere als lieb aussah. Der liebe Bill ließ die Kanoniere, die überlebt hatten, aus der Deckung kommen, und dann gab er den Schützen rechts der Straße den Feuerbefehl.
Die letzten Kanoniere fielen. Die Schützen zielten auf Fredericksons Rufe hin auf die berittenen Offiziere der Infanterie. Der Feind wurde durch wenige, gut gezielte Gewehrschüsse seiner Artillerie beraubt und plötzlich ins Chaos gestürzt. Jetzt war es für Sharpe an der Zeit, seine andere Waffe einzusetzen.
»Lieutenant?«
Michael Trumper-Jones, der versuchte, die feuchte weiße »Fahne« zu verstecken, die von seiner Säbelspitze hing, schaute Sharpe an. »Sir?«
»Reiten Sie zum Feind, grüßen Sie ihn von mir und schlagen Sie vor, dass er die Waffen niederlegt.«
Trumper-Jones starrte den großen Schützen an. »Dass sie sich ergeben, Sir?«
Sharpe sah ihn finster an. »Sie wollen doch nicht etwa vorschlagen, dass wir uns ergeben, oder?«
»Nein, Sir.« Trumper-Jones schüttelte heftig den Kopf. Er fragte sich, wie er tausendfünfhundert Franzosen überreden konnte, vor vierhundert durchnässten, erschöpften britischen Infanteristen zu kapitulieren. »Natürlich nicht, Sir.«
»Sagen Sie ihnen, dass wir hier ein Bataillon in Reserve haben, dass sechs weitere hinter ihnen sind und wir Kavallerie in den Hügeln haben und bald Geschütze eintreffen. Erzählen Sie ihnen jede gottverdammte Lüge, die Ihnen einfällt. Aber richten Sie meine Grüße aus und sagen Sie, dass meiner Meinung nach genug Männer gestorben sind. Sagen Sie den Franzosen, dass sie Zeit haben, um ihre Fahnen zu vernichten.« Sharpe schaute über die Brücke. Die Franzosen kletterten die Felsen hinauf, doch immer noch krachten Gewehre gedämpft durch den Regen, immer noch starben Männer sinnlos an diesem Nachmittag. »Reiten Sie, Lieutenant! Sagen Sie den Franzosen, dass ich ihnen fünfzehn Minuten gebe, bevor ich angreife! Hornist?«
»Sir?«
»Blasen Sie die Reveille. So lange, bis der Lieutenant beim Feind ist.«
»Jawohl, Sir.«
Die Franzosen, gewarnt durch den Hornisten, beobachteten den einzelnen Reiter, der auf sie zuritt und sein weißes Taschentuch hoch hielt. Höflich befahlen sie ihren Männern, das Feuer auf die schwer fassbaren britischen Schützen auf den Felsen einzustellen.
Der Rauch des Kampfes verwehte im Regen, der vom Wind gepeitscht wurde, als Trumper-Jones in einem Knäuel von französischen Offizieren verschwand. Sharpe wandte sich zu den Männern um. »Rührt euch!«
Die fünf Kompanien rührten sich. Sharpe blickte zum Flussufer. »Sergeant Harper!«
»Sir!« Ein riesiger Mann, noch einen Kopf größer als der große Sharpe, kam vom Ufer. Er war einer der Schützen, der mit Sharpe in diesem Bataillon von Rotröcken gelandet war. Obwohl das South Essex Bataillon rote Uniformröcke und die Musketen für kurze Distanz trug, hatte dieser Mann wie die anderen Schützen von Sharpes alter Kompanie immer noch die grüne Uniform an und war mit einem Gewehr bewaffnet.
»Glauben Sie, die Scheißer geben klein bei?«, fragte Harper, als er bei Sharpe angelangt war.
»Sie haben keine andere Wahl. Sie wissen, dass sie in der Falle sitzen. Wenn sie uns nicht binnen einer Stunde loswerden, sind sie erledigt.«
Harper lachte. Wenn jemand ein wahrer Freund Sharpes war, dann dieser Sergeant. Sie hatten zusammen auf jedem Schlachtfeld in Spanien und Portugal gekämpft, und das Einzige, was Harper mit Sharpe nicht teilen konnte, war das Schuldgefühl, das ihn seit dem Tod seiner Frau quälte.
Sharpe rieb sich die Hände gegen die für diese Jahreszeit ungewöhnliche Kälte. »Ich möchte etwas Tee, Patrick. Du hast meine Erlaubnis, welchen zu machen.«
Harper grinste. »Jawohl, Sir.« Er sprach mit dem starken Akzent von Ulster.
Der Tee war noch warm im Becher, den Sharpe in den Händen hielt, als Lieutenant Trumper-Jones mit dem französischen Colonel zurückkehrte. Sharpe hatte bereits befohlen, die falschen Fahnen zu senken, und nun ging er seinem verzweifelten Feind entgegen. Er weigerte sich, den Degen des Mannes zu nehmen. Der Colonel, der wusste, dass er diese Brücke ohne seine Geschütze nicht einnehmen konnte, akzeptierte die Kapitulationsbedingungen. Er erklärte, es sei ein Trost, dass er sich einem Soldaten von Major Sharpes Ansehen ergebe.
Major Sharpe dankte ihm. Er bot ihm Tee an.
Zwei Stunden später, als General Preston mit seinen fünf Bataillonen eintraf und verwirrt war, weil er kein Musketenfeuer vor sich gehört hatte, fand er rund tausendfünfhundert französische Gefangene, drei erbeutete Geschütze und vier Wagen mit Proviant vor. Die französischen Musketen waren am Straßenrand aufgeschichtet. Was die Franzosen aus dem Dorf bei ihrer Garnison geplündert hatten, befand sich jetzt im Gepäck von Sharpes Männern. Niemand vom South Essex Bataillon oder von Fredericksons Schützen war auch nur verwundet. Die Franzosen hatten sieben Mann verloren und einundzwanzig Verwundete zu beklagen.
»Glückwunsch, Sharpe!«, sagte der General.
»Danke, Sir.«
Offizier nach Offizier beglückwünschte ihn. Er schüttelte sie ab. Er erklärte, dass die Franzosen wirklich keine Wahl gehabt hatten, dass sie ohne Geschütze seine Stellung nicht hätten durchbrechen können, doch die Glückwünsche nahmen kein Ende, und schließlich wurde es ihm peinlich, und er ging zur Brücke zurück.
Er schritt über die Brücke und fand den Quartiermeister des South Essex Bataillons, einen korpulenten Offizier namens Collip, der das Halbbataillon auf seinem Nachtmarsch begleitet hatte.
Sharpe zog Collip in eine Felsspalte. Collip wich furchtsam zurück, denn Sharpes Miene war grimmig. »Sie sind ein glücklicher Mann, Collip.«
»Jawohl, Sir.« Collip hatte schreckliche Angst. Er war erst vor zwei Monaten zum South Essex gekommen.
»Sagen Sie mir, warum Sie sich glücklich preisen können, Mister Collip.«
Collip schluckte nervös. »Es – es wird keine Strafe geben, Sir?«
»Es hätte nie irgendeine Strafe gegeben, Mister Collip.«
»Nicht, Sir?«
»Weil es meine Schuld war. Ich glaubte Ihnen, als Sie sagten, Sie könnten mir die Verantwortung für das Gepäck aus den Händen nehmen. Das war mein Fehler. Haben Sie mir noch was zu sagen?«
»Es tut mir sehr leid, Sir.«
In der Nacht waren Sharpe und seine Captains mit Fredericksons Schützen vorausmarschiert. Sharpe hatte sie angeführt, um ihnen den Weg zu zeigen, den sie nehmen mussten, und er hatte es Collip und den Lieutenants überlassen, die Männer hinterher zu bringen. Sharpe war zurückgekehrt und hatte Collip am Rand einer tiefen Schlucht vorgefunden, die mit großen Schwierigkeiten überwunden worden war. Sharpe hatte die Schützen hinüber geführt, war eine steile Wand hinunter geklettert, war durch einen eiskalten Bach gewatet, dessen Wasser in diesem nassen Frühjahr bis zur Hüfte reichte, und mit nasser, kalter Kleidung auf der anderen Seite hochgeklettert.
Als Sharpe zu den fünf Kompanien zurückgekehrt war, hatte ihn eine Pleite erwartet.
Mister Collip, der Quartiermeister, hatte entschieden, den Rotröcken das Durchqueren der Schlucht zu erleichtern. Er hatte aus Musketenriemen ein langes Seil gemacht, eine große Schlinge, die über den Abgrund gezogen werden konnte, und auf der Leine über die Schlucht hatte er alle Waffen, Tornister, Feldflaschen und Provianttaschen der Männer befestigt. Beim letzten Einholen der Leine hatte sich ein Riemen gelöst, und die gesamte Musketenmunition des South Essex Bataillons war in den Bach gefallen.
Als sich die Franzosen der Brücke näherten, hatten nur Sharpes Schützen Munition. Die Franzosen hätten die Brücke mit einer einzigen Musketensalve einnehmen können, weil Sharpe ihnen nichts hatte entgegensetzen können.
»Trennen Sie niemals wieder einen Mann von seinen Waffen und der Munition, Mister Collip, niemals! Versprechen Sie mir das?«
Collip nickte eifrig. »Jawohl, Sir.«
»Ich finde, Sie schulden mir eine Flasche, Mister Collip.«
»Jawohl, Sir. Selbstverständlich, Sir.«
»Guten Tag, Mister Collip.«
Sharpe ging davon. Er lächelte plötzlich, vielleicht weil die Wolkendecke im Westen aufgerissen war und ein Strahl rötlicher Sonnenschein auf den Schauplatz seines Sieges fiel. Sharpe suchte Patrick Harper und trank mit seinem alten Schützen Tee. »Ein gutes Tagewerk, Jungs.«
Harper lachte. »Haben Sie den Bastarden gesagt, dass wir keine Munition hatten?«
»Man soll den Leuten immer ihren Stolz lassen, Patrick.« Sharpe lachte. Er hatte seit Weihnachten nicht mehr gelacht.
Aber jetzt, nach diesem ersten Kampf des neuen Feldzugs, hatte er den Winter überlebt, hatte seinen ersten Sieg des Frühjahrs errungen und freute sich auf einen Sommer ohne den Kummer und das Durcheinander der Vergangenheit. Er war Soldat, er marschierte in den Krieg, und die Zukunft sah glänzend aus.
KAPITEL 2
An einem Sonnentag, als die Schwalben ihre Nester im alten Gemäuer der Burg von Burgos bauten, starrte Commandant Pierre Ducos von der Mauer hinab.
Er war barhäuptig. Der leichte Westwind zupfte an seinem schwarzen Haar, während er in den Burghof schaute. Er rückte die Bügel seiner Brille zurecht und zuckte zusammen, als das Metall über seine wund gescheuerte Haut schabte.
Sechs Wagen wurden über das Kopfsteinpflaster gezogen. Es waren gewaltige Wagen, mit jeweils acht Ochsen. Planen bedeckten die Ladung, waren mit Stricken befestigt und wölbten sich über der Fracht. Die müden Ochsen wurden vom fernen Ende des Burghofs getrieben, wo die Wagen mit viel Mühe an der Mauer des Burgfrieds geparkt wurden.
Die Wagen wurden von Kavalleristen eskortiert, die Lanzen trugen, an denen rote und weiße Wimpel hingen.
Die Garnison der Burg beobachtete die Ankunft der Wagen. Über ihren Köpfen, auf der Spitze des Burgfrieds, flatterte die Trikolore im leichten Wind. Die Posten schauten über das weite Land hinaus und fragten sich, ob der Krieg von Neuem gegen diese alte spanische Festung anbranden würde, die die Große Straße von Paris nach Madrid bewachte.
Hufschlag trommelte am Torweg, und Pierre Ducos sah eine glänzende Kutsche in den Burghof fahren. Sie wurde von vier Schimmeln gezogen, die silbernes Zaumzeug hatten. Die Kutsche fuhr zu schnell, aber Ducos sagte sich, dass dies typisch für die Besitzerin war.
Sie war in Spanien bekannt als La Puta Dorada – die goldene Hure.
Neben der Kutsche, die im Burghof stoppte, zügelte ein Général der Kavallerie sein Pferd. Er war noch recht jung, das Abbild eines französischen Helden, dessen prächtige Uniform gestärkt war, damit sie das Gewicht seiner Orden und Abzeichen tragen konnte. Er sprang von seinem Pferd, winkte den Kutscher zur Seite, öffnete den Kutschenschlag und ließ schwungvoll die Treppe herunter. Dann verneigte er sich.
Ducos starrte auf die Frau, die aus der Kutsche stieg, wie ein Raubtier sein Opfer anstarrt.
Sie war schön, die goldene Hure. Männer, die sie zum ersten Mal sahen, konnten kaum glauben, dass eine Frau so schön sein konnte. Ihre Haut war weiß und rein wie die weißen Perlmuscheln am Strand der Biskaya. Ihr Haar war goldblond. Eine Laune der Natur verlieh ihrem Gesicht einen Ausdruck der Unschuld, was in Männern den Wunsch weckte, sie zu beschützen. Pierre Ducos kannte nur wenige Frauen, die so wenig Schutz brauchten wie die goldene Hure.
Sie war Französin, geborene Hélène Leroux, und sie diente Frankreich seit ihrem sechzehnten Lebensjahr. Sie hatte in den Betten der Mächtigen geschlafen und ihnen die Geheimnisse ihrer Nationen entlockt, und als Napoleon die Entscheidung getroffen hatte, Spanien zu annektieren, hatte er Hélène als seine Waffe ausgeschickt.
Sie hatte sich als Tochter von Opfern der Revolution ausgegeben. Auf Anweisung von Paris hatte sie einen Mann geheiratet, der dem spanischen König nahestand und in die Geheimnisse eingeweiht war. Sie war immer noch verheiratet, doch ihr Mann war weit fort, und sie trug den Titel, den er ihr gegeben hatte. Sie war die Marquesa de Casares el Grande y Melida Sadaba. Sie war so schön wie ein Sommertraum und so höllisch wie der Teufel. La Puta Dorada.
Ducos lächelte. Ein Falke, hoch über seinem Opfer, mochte die gleiche Befriedigung empfinden wie jetzt der französische Major, als er seinem Adjutanten befahl, der Marquesa einen Gruß von Pierre Ducos zu überbringen und sie zu bitten – was einem Befehl gleichkam, ihn unverzüglich aufzusuchen.
Die Marquesa de Casares el Grande y Melida Sadaba, duftend nach Rosenwasser und lieblich lächelnd, wurde eine Stunde später in Commandant Ducos’ spartanisch eingerichtetes Büro geführt. Er schaute vom Schreibtisch auf. »Sie kommen spät.«
Sie blies ihm eine Kusshand von ihren Spitzenhandschuhen zu und schritt an ihm vorbei zur Bastion. »Die Landschaft sieht heute sehr schön aus. Ich bat Ihren herrlich schüchternen Lieutenant, mir etwas Wein und Weintrauben zu holen. Wir könnten hier draußen essen, Pierre. Ihre Haut braucht etwas Sonne.« Sie beschattete ihr Gesicht mit einem Sonnenschirm und lächelte Ducos an. »Wie geht es Ihnen, Pierre? Tanzen Sie die Nächte durch wie immer?«
Er ignorierte ihren Spott. Er trat auf die Türschwelle und sagte schroff: »Sie haben sechs Wagen in dieser Festung.«
Sie mimte ehrfürchtige Scheu. »Hat der Kaiser Sie zu seinem Schirrmeister gemacht, Pierre? Da muss ich Ihnen gratulieren.«
Er zog ein gefaltetes Papier aus seiner Westentasche. »Die Wagen sind mit Tafelgold und Tafelsilber beladen, mit Gemälden, Münzen, Gobelins, Statuen, Skulpturen und mit dem Inhalt eines Weinkellers, verpackt in Sägemehl. Der Gesamtwert beträgt dreihunderttausend Guineen.« Er starrte sie in stummem Triumph an.
»Und einige Möbelstücke, Pierre. Hat Ihr Spion nicht die Möbel gefunden? Einige davon sind ziemlich wertvoll. Eine sehr teure maurische Couch mit Elfenbeinintarsien, ein japanischer Sekretär, der Ihnen gefallen würde, und ein Spiegelbett.«
»Und zweifellos das Bett, in dem Sie Général Verigny überredeten, Ihren gestohlenen Besitz zu schützen?« Général Verigny war der Kavallerie-Offizier, dessen Männer die Wagen auf der Fahrt von Salamanca eskortiert hatten.
»Gestohlen, Pierre? All das gehört mir und meinem lieben Mann. Ich dachte mir nur, da Wellington uns zu besiegen droht, sollte ich unsere bescheidene Habe nach Frankreich bringen. Betrachten Sie mich einfach als Flüchtling. Ah!« Sie lächelte Ducos’ Adjutanten an, der ein Tablett brachte, auf dem eine geöffnete Flasche Champagner, ein einzelnes Glas und eine Schale mit Weintrauben standen. »Stellen Sie es auf die Brüstung, Lieutenant.«
Mit finsterer Miene wartete Ducos, bis sein Adjutant fort war. »Der Besitz befindet sich auf Wagen der französischen Armee.«
»Es sind ausgemusterte Wagen, Pierre.«
»Ausgemustert von Général Verignys Quartiermeister.«
»Stimmt.« Sie lächelte. »Ein lieber Mann.«
»Und ich werde diese Ausmusterung aufheben.«
Die Marquesa starrte ihn an. Sie fürchtete Pierre Ducos, doch sie würde ihm nicht die Befriedigung geben, ihre Angst zu zeigen. Sie spürte die Bedrohung durch Ducos. Sie flüchtete aus Spanien, vor Wellingtons drohendem Sieg, und sie nahm ihr Vermögen mit, das sie unabhängig gegenüber jedweder Tragödie machen würde, die Frankreich widerfahren konnte. Jetzt bedrohte Ducos diese Unabhängigkeit. Sie zupfte eine Weinbeere von der Traube. »Wenn Sie etwas von mir wollen, Pierre, warum fragen Sie nicht einfach? Oder wollen Sie meine Habe mit mir teilen?«
Ducos sah sie böse an. Niemand konnte Pierre Ducos der Habgier bezichtigen. Er wechselte das Thema. »Ich möchte wissen, wie Sie über die Rückkehr Ihres Mannes aus Südamerika denken.«
Sie lachte. »Sie möchten, dass ich in sein Bett zurückkehre, Pierre? Glauben Sie nicht, dass ich genug für Frankreich erlitten habe?«
»Liebt er Sie noch?«
»Liebe? Welch ein sonderbares Wort aus Ihrem Munde, Pierre.« Sie schaute zur Trikolore auf. »Er ist immer noch verrückt nach mir.«
»Er weiß, dass Sie eine Spionin sind?«
»Gewiss hat es ihm jemand erzählt, meinen Sie nicht? Aber Luis nimmt Frauen nicht ernst, Pierre. Er denkt, ich wurde zur Spionin, weil ich unglücklich mit ihm war. Er sagt sich, wenn er erst zurück ist und ich wieder in seinem Palast lebe, wird alles wieder in Ordnung kommen. Er kann mich anknurren und dann bei seinem Beichtvater deswegen heulen. Männer sind so blöde.«
»Oder wählen Sie sich nur blöde Männer aus?«
»Welch eine Boudoir-Unterhaltung!« Sie lächelte ihn strahlend an. »Was wollen Sie also, Pierre?«
»Warum kommt Ihr Mann heim?«
»Er mag das Klima in Südamerika nicht, Pierre. Er bekommt davon Blähungen, sagt er. Er leidet unter den Blähungen. Einmal ließ er einen Diener auspeitschen, der lachte, als ihm ein Wind entfuhr.«
»Er ist zu Wellington gegangen.«
»Natürlich! Luis ist Spaniens neuer Held!« Sie lachte. Ihr Ehemann hatte eine spanische Armee gegen Rebellen im Banda Oriental geführt, dem Gebiet nördlich des Rio de la Plata. Die Rebellen, die sahen, dass Spanien von Frankreich gedemütigt wurde, hatten versucht, ihre Unabhängigkeit von Spanien zu erringen. Zur Überraschung der Marquesa und der vieler Leute hatte der Marqués die Rebellen besiegt. Sie schnippte einen Weintraubenkern über die Brüstung. »Er muss ihnen zahlenmäßig hundert zu eins überlegen gewesen sein. Oder vielleicht ließ er ihnen einen Furz in die Gesichter fahren? Glauben Sie, das ist die Erklärung, Pierre? Möchten Sie eine Weintraube?« Sie lächelte, als er schwieg, und schenkte sich Champagner ein. »Sagen Sie mir, warum Sie mich mit Ihrem üblichen Charme und Ihrer rücksichtsvollen Art herbestellt haben.«
»Ihr Mann will Sie wiederhaben?«
»Das wissen Sie doch. Ich bin mir sicher. Sie fangen all seine Briefe ab. Seine Geilheit ist größer als sein Patriotismus.«
»Dann möchte ich, dass Sie ihm einen Brief schreiben.«
Sie lächelte. »Ist das alles? Ein Brief? Darf ich dann meine Wagen behalten?« Sie fragte es mit einer Kleinmädchenstimme.
Er nickte.
Sie musterte ihn scharf, misstraute einem Handel, der so leicht abgeschlossen werden sollte. Ihre Stimme klang plötzlich hart. »Sie lassen mich für einen Brief meinen Besitz nach Frankreich bringen?«
»Für einen Brief.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Sie werden mir entsprechende Papiere geben?«
»Selbstverständlich.«
Sie nippte am Champagner. »Was soll ich schreiben?«
»Gehen wir hinein.«
Er hatte den Brief schon geschrieben, und sie brauchte ihn nur auf das Briefpapier abzuschreiben, das das Wappen der Familie ihres Mannes trug. Sie bewunderte Ducos’ Tüchtigkeit, das Papier stehlen zu lassen, sodass es für sie vorbereitet war. Er bot ihr den einzigen Stuhl an und gab ihr einen Federkiel und Tinte. »Verbessern Sie die Ausdrucksweise, Hélène.«
»Das wird nicht schwierig sein, Pierre.«
Der Brief erzählte eine haarsträubende Geschichte. Er war die Antwort auf einen Brief des Marqués, und darin hieß es, dass sie sich nichts sehnlicher wünsche, als bei ihm zu sein, dass die Freude über seine Rückkehr sie mit Sehnsucht und Erwartung erfülle, dass sie jedoch davor zurückschrecke, zu ihm zu kommen, solange er unter Wellingtons Kommando sei.
Sie fürchte sich, weil da ein englischer Offizier sei, der sie auf übelste Weise verfolge, der sie und ihren Mann beleidigt und ihr jede Demütigung zugefügt habe. Sie habe sich beim englischen Oberbefehlshaber beschwert, doch es könne nichts getan werden, weil der beleidigende Offizier ein Freund Wellingtons sei. Sie fürchte um ihre Tugend, und sie habe Angst, zu ihrem Mann zu kommen, bevor der üble Offizier aus Spanien entfernt werde. Der Offizier, schrieb sie, habe bereits einmal versucht, ihr Gewalt anzutun, und bei diesem Vergewaltigungsversuch habe nur seine Volltrunkenheit das Schlimmste verhindert. Sie fühle sich nicht mehr sicher, solange dieser gemeine, triebhafte Mann, Major Richard Sharpe, am Leben sei. Sie unterzeichnete den Brief und tupfte sorgfältig Champagnertropfen auf die Tinte, sodass die Schrift wie von Tränen befleckt war, und dann lächelte sie Ducos an.
»Sie wollen, dass er sich duelliert?«
»Ja.«
Sie lachte. »Richard wird ihn abschlachten!«
»Natürlich.«
Sie lächelte. »Sagen Sie mir, Pierre, warum möchten Sie, dass Richard meinen Mann tötet?«
»Das ist doch offenkundig, nicht wahr?«
Wenn ihr Ehemann, ein Grande Spaniens und ein Held, von einem Engländer getötet wurde, dann würde die labile Allianz zwischen Spanien und England gefährlich belastet werden. Das Bündnis war aus Zweckdienlichkeit entstanden. Die Spanier liebten die Engländer nicht. Es ärgerte sie, dass sie eine britische Armee brauchten, um die Franzosen aus ihrem Land zu vertreiben. Sie hatten zwar Wellington zum Oberbefehlshaber all ihrer Armeen gemacht, aber das war eine Anerkennung seiner Fähigkeiten, und die Notwendigkeit zu dem Bündnis hatte ihnen nur noch deutlicher vor Augen geführt, wie sehr sie ihn brauchten.
Hélène schaute zu, während Ducos die Tinte mit Sand trocknete. »Sie wissen, dass kein Duell stattfinden wird, nicht wahr?«
»Kein Duell?« Er schüttete den Sand auf den Boden.
»Arthur wird es nicht zulassen.« Arthur war Wellington. »Was machen Sie dann, Pierre?«
Er überging ihre Frage. »Sie wissen, dass dies Major Sharpes Todesurteil sein kann?«
»Ja.«
»Es beunruhigt Sie nicht?«
Sie lächelte süß. »Richard kann auf sich aufpassen, Pierre. Die Götter lächeln ihn an. Außerdem tue ich das für Frankreich, nicht wahr?«
»Für die Wagen samt Inhalt, teure Hélène.«
»Ah, ja. Meine Wagen. Wann bekomme ich den Passierschein dafür?«
»Für den nächsten Konvoi nach Norden.«
Sie nickte und erhob sich. »Glauben Sie wirklich, dass die beiden sich duellieren werden, Pierre?«
»Beunruhigt Sie das?«
Sie lächelte. »Ich wäre ziemlich gern Witwe. Eine reiche Witwe. La Viuda Dorada.«
»Dann müssen Sie hoffen, dass Ihnen Major Sharpe den Gefallen tut.«
»Er war in der Vergangenheit sehr gefällig, Pierre.« Ihr Parfüm erfüllte den Raum.
Ducos faltete den Brief. »Mögen Sie ihn?«
Sie neigte den Kopf und dachte anscheinend darüber nach. »Ja. Er hat die Tugenden der Geradlinigkeit und Loyalität.«
»Kaum nach Ihrem Geschmack, hätte ich gedacht.«
»Wie wenig wissen Sie über meinen Geschmack, Pierre! Bin ich entlassen? Darf ich zu meinem Vergnügen zurückkehren?«
»Ihr Siegel!«
»Ah.« Sie nahm den Ring ab, den sie über ihrem Spitzenhandschuh trug, und überreichte ihn Ducos. Er drückte den Ring in heißes Wachs und gab ihr den Siegelring zurück.
»Danke, Hélène.«
»Danken Sie mir nicht, Pierre.« Sie schaute ihn mit einem leicht spöttischen Lächeln an. »Öffnen Sie die Briefe des Kaisers für mich, Pierre?«
»Natürlich nicht.« Er furchte die Stirn bei diesem Gedanken, während er sich fragte, wie Napoleon solche Briefe schickte, ohne dass sie seinen Männern in die Hände fielen.
»Das dachte ich mir auch.« Sie befeuchtete die Lippen mit der Zungenspitze. »Sie wissen, dass er mich immer noch mag.«
»Ich glaube, er mag all seine Mätressen.«
»Sie sind so süß, Pierre.« Sie drehte den Sonnenschirm in den Händen. »Wissen Sie, dass er mich für eine Expertin in spanischen Angelegenheiten hält? Dass er mich sogar um Rat bittet?«
»So?« Ducos starrte sie an.
»Ich muss Ihnen gratulieren, Pierre. Ich sagte dem Kaiser, dass Ihre Idee mit dem Vertrag ausgezeichnet ist.« Sie lächelte, als sie seine betroffene Miene sah. »Wirklich, Pierre! Ausgezeichnet. Das war das Wort, das ich benutzte. Selbstverständlich sagte ich ihm, dass wir vielleicht Wellington zuerst besiegen, aber wenn das nicht gelingt? Ausgezeichnet!« Sie lächelte wie eine Siegerin. »Sie werden meine Wagen also über die Grenze fahren lassen, nicht wahr?«
»Das habe ich bereits versprochen.«
»Aber wem, lieber kleiner Pierre? Wem?« Sie ging zur Tür und öffnete sie. Sie lächelte abermals. »Guten Tag, Commandant. Es war mir ein so kleines Vergnügen.«
Er lauschte dem Klacken ihrer Absätze, das sich auf dem Gang entfernte, und Zorn erfüllte ihn. Napoleon, stets ein Narr, wenn es um gespreizte Beine in einem Bett ging, hatte der Goldenen Hure von dem Vertrag von Valençay erzählt? Und jetzt wagte sie es, ihm zu drohen? Anzudeuten, dass sie ihr Land verraten, das Geheimnis des Vertrags enthüllen würde, wenn ihre verdammten Wagen mit der Fracht nicht bis Frankreich gelangten?
Er ging auf die Burgmauer. Der Brief, den sie geschrieben hatte, war in seiner Hand, und er war der Schlüssel zu dem Vertrag. Heute würde er den Brief dem Inquisitor geben, und morgen würde Padre Hacha mit seinem Bruder El Matarife die Reise gen Westen antreten. Binnen drei Tagen würde die Sache nicht mehr rückgängig zu machen sein, und in zwei Wochen würde er Hélènes schönen Mund für immer zum Schweigen bringen.
Er beobachtete sie, als sie unten im Burghof Général Verigny begrüßte und er ihr beim Einsteigen in die Kutsche behilflich war, und er dachte, welche Freude es sein würde, diese Hure zu demütigen. Sie wagte es, ihm zu drohen? Das würde sie bereuen!
Ducos kehrte in sein Büro zurück. Er würde es ihr zeigen. Er würde Frankreich retten, Britannien besiegen und der Welt vor Augen führen, wie schlau und geschickt er war. Einen Moment lang stellte er sich als den neuen Richelieu vor, als neuen strahlenden Stern in Frankreichs Glorie. Er konnte nicht verlieren, davon war er überzeugt, denn er hatte die Risiken kalkuliert. Er würde siegen.
KAPITEL 3
»Zelte!« Sharpe spuckte es förmlich aus. »Gottverdammte Zelte!«
»Um darin zu schlafen, Sir.« Sergeant Patrick Harper behielt seine ausdruckslose Miene. Die zuschauenden Männer des South Essex Bataillons grinsten.
»Verdammte Zelte!«
»Saubere Zelte, Sir. Hübsch und weiß, Sir. Wir könnten Blumenbeete rings herum anlegen, falls die Jungs Heimweh bekommen.«
Sharpe trat gegen eines der dicken Segeltuchbündel. »Wer braucht schon Zelte?«