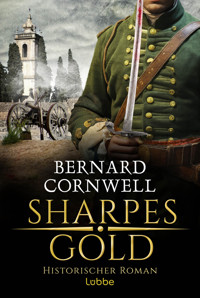9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
1814. Napoleons endgültige Niederlage steht unmittelbar bevor - vorausgesetzt, die gut befestigte Stadt Toulouse kann erobert werden. Captain Richard Sharpe nimmt noch einmal all seine Kraft zusammen und führt seine Truppen zum Sieg. Doch ehe Sharpe den Säbel für immer ablegen kann, wird er vor ein Militärgericht gestellt. Die Anklage: Raub von Napoleons persönlichem Schatz. Sharpe flüchtet und beginnt den Kampf seines Lebens. Dabei besitzt er nur eine Waffe: die unerschütterliche Entschlossenheit, Rache an dem Mann zu nehmen, der seine Ehre beschmutzte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
TEIL I
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
TEIL II
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
TEIL III
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
TEIL IV
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
EPILOG
HISTORISCHE ANMERKUNG
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 80er-Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
Bernard Cornwell
SHARPESRACHE
Richard Sharpe undder Frieden von 1814
Aus dem Englischen vonJoachim Honnef
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Überarbeitete Fassung des 1991 bei Bastei Lübbe erschienenenRomans »Sharps Rache«
Für die Originalausgabe:Copyright © 1989 by Bernard CornwellTitel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Revenge«Published by arrangement withMarco Vigevani & Associati Agenzia Letteraria,on behalf of Toby Eady Associates Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Rainer DelfsTitelillustration: © Bao PhamUmschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3968-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
TEIL I
PROLOG
Major Richard Sharpe hatte alles für seinen Tod vorbereitet. Sein Pferd Sycorax und sein schönes französisches Fernrohr würde er Captain William Frederickson vermachen, seine Waffen würden in den Besitz von Sergeant Patrick Harper übergehen, und alles andere würde seine Frau Jane erben. Alles außer der Uniform, in der Sharpe stets gekämpft hatte. Die Uniform bestand aus dem verblichenen grünen Uniformrock der 95th Rifles, einer französischen Kavalleriehose und kniehohen Reitstiefeln. Sharpe hatte darum gebeten, in dieser Uniform begraben zu werden.
»Wenn du nicht in diesen Lumpen beerdigt wirst, wird man sie ohnehin verbrennen«, bemerkte Frederickson abfällig.
Es stimmte, dass die Lederstiefel stark verschrammt von Messern, Bajonetten und Säbeln waren, dass die Hose so oft geflickt war und mehr der weggeworfenen Arbeitshose eines Farmers ähnelte als der eines Chasseur-Colonels von Napoleons Kaiserlicher Garde. Der grüne Uniformrock war so verwaschen und fadenscheinig, dass nicht mal eine Motte eine ordentliche Mahlzeit daran gehabt hätte. Es war jedoch die Uniform, in der Sharpe gekämpft hatte und die ihm deshalb viel bedeutete. Er mochte in der alten Uniform wie eine Vogelscheuche aussehen, doch eine abergläubische Ader in ihm gebot ihm, sie im Kampf zu tragen, und so hatte er sie an diesem kalten Morgen im März 1814 an, obwohl ihn viele Meilen von jedem feindlichen Soldaten trennten.
»Du wirst den Rock ausziehen müssen, Richard«, warnte Frederickson, der die abergläubische Vorliebe seines Freundes für diese Uniform verstand.
»Ich weiß.« Es gab keine Einzelheit dieses Morgens, die Sharpe nicht immer wieder im Geist durchgegangen war. Was heute Morgen geschehen würde, bezeichnete mal als »Gras vor dem Frühstück essen«. Es klang harmlos, aber es konnte den Tod bedeuten.
Die beiden Männer standen auf einer grasbewachsenen Anhöhe oberhalb des grauen und bewegten Atlantiks. Eine lange und hohe Welle brandete vom Westen gegen die Felsenklippe. Südlich der Anhöhe sahen sie den französischen Hafen St. Jean de Luz voller Handelsschiffe und Fischerboote, während in den äußeren Fahrrinnen des Hafens eine Flottille der Royal Navy vor Anker lag. Die Flottille bestand aus drei Schaluppen, zwei Fregatten und einem großen Linienschiff namens Vengeance.
Es war kalt in der Morgendämmerung, doch der Frühling nahte, und mit ihm würde ein Wiederaufleben der Schlachten kommen. Kaiser Napoleon hatte die Friedensbedingungen seiner Feinde abgelehnt, und so würden die französischen Armeen kämpfen müssen, um ihr Heimatland zu verteidigen. Ihre Feinde waren jetzt ganz Europa. Wellingtons Armee von Briten, Spaniern und Portugiesen hatte die südwestliche Ecke Frankreichs eingenommen und würde bald weiter ins Herzland vorstoßen, während sich weit im Norden die Preußen, Österreicher und Russen durch Napoleons nördliche Linien kämpften.
All dies war im Augenblick unbedeutend für Major Richard Sharpe, als er durch das gefrorene Gras über die flache Kuppe der Erhebung schritt. Der Wind wehte kalt vom Ozean, und William Frederickson suchte Schutz davor im Windschatten einiger verkrüppelter Kiefern.
Sharpe ging auf und ab, nahm den Wind nicht wahr und war besessen von den Gedanken an seinen Tod. Das Wichtigste, sagte er sich, ist die Tatsache, dass Jane gut versorgt ist. Sie hatte bereits die Verfügungsgewalt über sein Geld, das die Beute von einer Plünderung nach der Schlacht von Vitoria war. Viele Soldaten waren an diesem Tag vermögend geworden, jedoch nur wenige so reich wie Richard Sharpe und Patrick Harper.
Sharpe ging zu Frederickson. »Wie spät ist es?«
Frederickson klappte den Deckel seiner Taschenuhr auf, was ihm mit Handschuhen einige Mühe bereitete. »Zwanzig nach sechs.«
Sharpe stieß einen Grunzlaut aus und wandte sich ab. Das Licht der Morgendämmerung sickerte durch die grauen Wolken, während das Meer dunkel war wie flüssiger, aufgewühlter Schiefer. Ein kleines Fischerboot mit hohem Bug lag gefährlich nahe bei den Felsen unterhalb von Sharpe. Die Fischer hoben Hummerfangkörbe über Bord. Vielleicht wird dein Feind heute Abend einen von diesen Hummern essen, dachte Sharpe, während du bereits kalt wie Stein unter französischer Erde liegst. »Gras vor dem Frühstück …«
»Verdammt, warum können wir nicht mit Säbel und Degen kämpfen?«, stieß er plötzlich ärgerlich hervor.
»Weil Bampfylde Pistolen gewählt hat.« Frederickson paffte an einer Zigarre, und der Wind trug den Rauch schnell davon.
Sharpe fluchte und wandte sich wieder ab. Er war nervös, und es machte ihm nichts aus, das vor Frederickson zu zeigen. Der Captain war einer von Sharpes engsten Freunden geworden, der wusste, wie einem die Furcht vor einem Kampf zusetzen konnte. Frederickson, halb englischer, halb deutscher Abstammung, sah Furcht erregend aus. Auf spanischen Schlachtfeldern hatte er ein Auge und die meisten seiner Zähne verloren. Seine Männer nannten ihn in verlegener Zuneigung »lieber Bill«, doch auf Schlachtfeldern war er alles andere als lieb. Er war Soldat, so hart wie jeder in der Army, und hart genug, um zu wissen, dass selbst ein tapferer Mann von Furcht fast gelähmt sein kann.
Sharpe wusste das ebenfalls, doch er war überrascht über die Furcht, die ihn an diesem kalten Morgen erfasste. Er war Soldat, seit er als sechzehnjähriger Rekrut zum 33rd gegangen war. In den einundzwanzig Jahren seither hatte er sich durch verteidigte Breschen gekämpft, hatte in der Schützenlinie gestanden und dem Feind ins Auge gesehen, der keine vierzig Schritte entfernt gewesen war. Er hatte als Plänkler vor der Schlachtlinie gekämpft und gesehen, wie feindliches Artilleriefeuer seine Männer zerfetzt hatte, und all das hatte er öfter erlebt, als er sich erinnern konnte. Sharpe hatte in Flandern, Indien, Portugal, Spanien und Frankreich gekämpft. Er war aus den rotberockten Mannschaften zu einem der Offiziere Seiner Majestät aufgestiegen. Er hatte eine feindliche Adler-Standarte erbeutet und war gefangen genommen worden. Er war verwundet worden. Er hatte getötet. Andere Männer hatten ihre Fähigkeiten in einem Leben des Friedens genutzt und entwickelt, aber Sharpe war zu einem Meister des Krieges geworden. Wenige hatten so oft und so gut gekämpft wie er, und jetzt sagte er sich, dass die Erinnerungen an diese vielen Kämpfe an seinem Selbstvertrauen nagten. Es war ihm klar, dass das Glück dieser vielen blutigen Jahre nicht anhalten konnte, oder vielleicht kannte er jetzt besser als die meisten die Gefahr und fürchtete sie deshalb. Er konnte sich nur zu gut vorstellen, dass durch die Laune des Schicksals ein Mann, der auf den übelsten Schlachtfeldern gekämpft und überlebt hatte, hier beim »Gras vor dem Frühstück« getötet werden konnte.
»Warum nennt man es Gras vor dem Frühstück?«, fragte er Frederickson. Der liebe Bill, der wusste, dass Sharpe die Antwort bereits kannte und die Frage nur gestellt hatte, um sich von seiner Furcht abzulenken, verzichtete auf eine Antwort.
»Eine alberne Bezeichnung«, hatte Jane vor zwei Wochen gesagt.
»Gras vor dem Frühstück essen«, bedeutete einfach ein Duell, das traditionell im Morgengrauen und für gewöhnlich auf einem Stück Rasen ausgetragen wurde, wo Platz für einen Zweikampf mit Pistole oder Degen war. »Wenn du auf diesem blödsinnigen Duell bestehst, werde ich nach Hause zurückkehren«, hatte Jane hinzugefügt. »Ich werde dir nicht erlauben, dass du dein Leben wegwirfst, Richard.«
»Dann solltest du heimfahren«, hatte Sharpe gesagt, »denn ich werde nicht auf das Duell verzichten.«
Die Meinungsverschiedenheit hatte als Plänkelei begonnen und sich zu einem heftigen Streit entwickelt, der ihm die vergangenen zwei Wochen verdorben hatte. Janes Einwände gegen das Duell waren durchaus vernünftig. Erstens konnte er leicht getötet werden, woraufhin Jane Witwe sein würde, und zweitens würde er der Verlierer sein, selbst wenn er siegte. Das Duellieren war in der Armee verboten, und wenn Sharpe auf dem Duell bestand, konnte er in einem einzigen Augenblick seine Karriere ruinieren. Für Jane war die Karriere ihres Mannes wichtig, und sie wollte nicht, dass er sie aufs Spiel setzte, weder bei einem Duell noch bei den Gefechten eines endenden Krieges. Jane war der Meinung, dass Sharpe nach England zurückkehren und die Früchte seiner Taten genießen sollte. In England, sagte sie, würde er ein Held sein und die Belohnung eines solchen entgegennehmen können. Der Prinz of Wales hatte ihm eine Audienz gewährt und würde jetzt Major Sharpe zu Sir Richard machen. Jane wollte, dass Sharpe seinen Abschied von der Army nahm, das Duell vergaß und heimsegelte. Stattdessen würde er als sturer Narr Gras vor dem Frühstück essen, und aller Ruhm und die Belohnungen des Prinzen würden dahin sein, sich in Nichts auflösen wie Pistolenrauch im Wind. So hatte Jane ihm ihr Ultimatum gestellt: Wenn er auf dem Duell bestand, dann würde sie ihn öffentlich blamieren, indem sie allein nach England zurückkehren würde. Sharpe hatte das als Bluff durchschaut, doch auf Kosten einer kalten und einsamen nächsten Nacht.
Frederickson fummelte wieder an seiner Taschenuhr herum. »Halb sieben.«
»Es ist kalt«, sagte Sharpe, als bemerke er das erst jetzt.
»In einer Stunde werden wir Kotelett und Erbsenpüree zum Frühstück essen.«
»Du vielleicht.«
»Wir beide«, beharrte Frederickson geduldig, wandte sich dann ab und beobachtete eine kleine schwarze Kutsche, die am Fuß der kleinen Erhebung auftauchte. Der Kutscher peitschte die Pferde über den Pfad aus Fahrspuren hinauf und lenkte sie dann zu der Kieferngruppe, wo er sie zügelte. Sergeant Harper, der irische Hüne, stieg mit heiterer Miene aus der Kutsche und grinste Sharpe zuversichtlich an. »Guten Morgen, Sir! Ein bisschen kühl heute.«
»Guten Morgen, Patrick.«
»Ich hab den Knaben geholt, Sir.« Harper wies auf einen schwarz gekleideten Mann, der ebenfalls mit der Kutsche gekommen war.
»Guten Morgen, Doktor«, sagte Sharpe höflich.
Der Arzt ignorierte die Begrüßung. Der dünne, ältere Franzose blieb in der Kutsche sitzen. Er hatte eine schwarze Arzttasche, die zweifellos Messer, Knochensägen, Sonden und Verbandszeug enthielt. Der Doktor hatte nur widerstrebend zugesagt, für dieses morgendliche Duell zur Verfügung zu stehen, deshalb hatte Frederickson Harper beauftragt, dafür zu sorgen, dass der Mann wach und bereit war. Kein britischer Arzt, weder von Army noch Navy, war bereit gewesen, seine Dienste bei dieser illegalen Zeremonie, die jeden Beteiligten vors Kriegsgericht bringen konnte, zur Verfügung zu stellen.
»Er war letzte Nacht besoffen, Sir«, sagte Harper, dessen grüner Uniformrock so verblichen war wie der von Sharpe und Frederickson.
»Wer war besoffen? Der Doktor?«
»Nein, Sir. Bampfylde war blau. Er blieb an Land, und ich sah ihn im Gasthaus.« Harper lachte. »Voll wie ein Bischof war er. Der ist heute bestimmt nervös.«
»Ich bin auch nervös«, knurrte Sharpe. »Ich hab in der Nacht kaum geschlafen.« Auch in der Nacht davor hatte er kaum ein Auge zugetan, weil ihn die Gedanken an das, was heute Morgen geschehen würde, aufgewühlt und wach gehalten hatten.
Jetzt würde er bald feststellen, was das Schicksal bestimmte, und je näher der Augenblick rückte, desto größer wurde seine Furcht. Das bekannte er Harper, und er war froh, es sich von der Seele reden zu können, denn der große Ire war Sharpes bester Freund und hatte all die Schlachten mit ihm geteilt, seit Wellingtons Armee in Portugal gelandet war.
»Aber Sie waren nicht betrunken, Sir.« Harper bestand hartnäckig darauf, seinen Offizier zu siezen, obwohl ihm Sharpe schon des Öfteren das Du angeboten hatte. »Bampfylde wird heute Morgen das große Zittern haben. Man wird ihn mit Eiern aufpäppeln müssen.« Harper amüsierte sich anscheinend bei der Vorstellung an den Ausgang des Duells. Er hatte keinen Zweifel, dass Sharpe Bampfyldes schwarze Seele zur ewigen Verdammnis schicken würde.
Für Sharpe war klar, dass Bampfylde nichts anderes verdiente. Bampfylde war ein Navy-Offizier, Captain der mächtigen Vengeance. Vor Wochen hatte er einen Feldzug nach Norden geführt, um die französische Küstenfestung Teste de Buch einzunehmen. Sharpe war der ranghöchste Offizier an Land gewesen, und nachdem er die Festung eingenommen hatte, war er mit seinen Männern landeinwärts marschiert, um an der französischen Nachschubstraße einen Hinterhalt zu legen. Als er zur eingenommenen Festung zurückgekehrt war, hatte sich Bampfylde davongemacht. Sharpe war mit zwei Kompanien Schützen und einer Einheit aus Marineinfanteristen in der Festung abgeschnitten gewesen. Er war von einer französischen Brigade unter Général Calvet belagert worden. Durch die Gnade Gottes, das Glück der Schützen und die Hilfe des Kapitäns eines amerikanischen Kaperschiffes hatte Sharpe seine Männer gerettet – aber nicht alle. Zu viele waren in der Festung gefallen, und Bampfylde trug die Schuld daran. Sharpe hatte nach der Rückkehr von der blutigen Schlacht gegen Calvet rasend vor Empörung den Navy-Offizier zu diesem Duell herausgefordert.
»Ich wünschte, wir kämpften mit Degen«, murmelte Sharpe.
»Degen oder Pistolen, wen juckt das?«, erwiderte Harper fröhlich.
»Mich.«
»Er ist so oder so ein toter Bastard.«
»Er ist ein Verspäteter.« Frederickson schlug die Arme um seine Schultern, um sich etwas aufzuwärmen. Er spürte die wachsende Anspannung in Sharpe und fragte Harper, ob die Kompanie abmarschbereit war.
»Jawohl, Sir.«
»Gut.« Nach dem Duell würde Frederickson sofort mit seiner Schützenkompanie ostwärts marschieren, um zur Army zu stoßen. Sergeant Harper würde mit Frederickson gehen, denn genau wie Sharpe war er von seinem alten Bataillon abkommandiert worden. Dieses Bataillon, die »Eigenen Freiwilligen des Prinzen von Wales«, hatte einen neuen Colonel, der seine eigenen Majors und einen neuen Sergeant Major ernannt hatte, wodurch Sharpe und Harper praktisch wurzellos geworden waren.
Harper war nur zu gern von Frederickson übernommen worden, der seinerseits mit Freuden von Major General Nairn übernommen worden war, einem Schotten, der endlich das Kommando über eine eigene Kampfbrigade erhalten hatte und Fredericksons Männer als tödliche Verstärkung für die Schützenlinie haben wollte. Nairn wollte auch Sharpe haben, nicht für die Schützenlinie, sondern als seinen Stabschef. »Aber ich war nie Stabsoffizier«, hatte Sharpe eingewandt.
»Und ich war nie Brigadekommandeur«, hatte Nairn heiter entgegnet.
»Ich muss mit Jane reden«, hatte Sharpe gesagt. Er war zu seinem Quartier gegangen und hatte das eisige Schweigen einer Woche gebrochen, aber ihre Diskussion über Nairns Angebot war nicht erfreulicher gewesen als der tränenreiche, zornige Streit über das Duell. Jane hatte immer noch darauf bestanden, dass sie nach England heimkehren sollten, und diesmal hatte sie einen neuen Grund für Sharpes Abschied aus der Armee angeführt. Wenn erst der Frieden da sei, hatte sie argumentiert, würden die Grundstücks- und Immobilienpreise in England steigen. Deshalb sei es nur vernünftig, jetzt heimzusegeln und ein Haus in London zu suchen. Sharpe hatte heftig protestiert und erklärt, dass er niemals in London wohnen würde. Er war nicht gegen den Kauf eines Hauses, aber es sollte ein Haus auf dem Land sein, nicht in der scheußlichen, dreckigen, überfüllten und korrupten Stadt. Aus keinem besonderen Grund wollte er in Dorset wohnen. Jemand hatte einst diese Grafschaft gepriesen, und diese Begeisterung hatte sich ihm unauslöschlich eingeprägt.
Schließlich waren ihnen die Argumente ausgegangen, und sie hatten widerwillig einen Kompromiss geschlossen. Jane würde heimreisen, um die noch niedrigen Preise zu nutzen, aber sie würde ein Landhaus in Dorset kaufen. Unterdessen würde Sharpe Major General Nairn dienen – wenn er das Duell überlebte.
»Aber warum?«, hatte Jane unter Tränen gesagt. »Du hast selbst gesagt, dass du dich vor weiteren Kämpfen fürchtest. Du kannst nicht ewig kämpfen und am Leben bleiben!« Aber Sharpe konnte ihr nicht sagen, warum er sich weigerte, vor dem Ende des Krieges heimzukehren. Er wollte gewiss kein Stabsoffizier sein, und er gab seine Furcht vor weiteren Schlachten zu, aber es gab einen tieferen Grund, der an seiner Seele zerrte wie eine dunkle, reißende Strömung. Seine Freunde würden in Nairns Brigade sein, Nairn selbst, Frederickson und Harper. So viele Freunde waren ums Leben gekommen, und so wenige hatten überlebt, und Sharpe wusste, dass er sich niemals verzeihen würde, wenn er diese guten Freunde in den letzten Wochen eines langen Krieges verlassen würde. Er würde bleiben und kämpfen. Aber zuerst würde er einen Navy-Offizier töten oder selbst getötet werden.
»Da kommen die Hurensöhne«, sagte Frederickson zufrieden.
Drei Reiter näherten sich auf der Straße von der Stadt.
Alle trugen dunkelblaue Navy-Uniformen und Zweispitze. Sharpe schaute an den drei Navy-Offizieren vorbei, um zu sehen, ob irgendwelche Militärpolizisten aus der Stadt kamen, um das Duell zu stoppen und die Teilnehmer festzunehmen. Das Duell war kein Geheimnis. Die Hälfte der Offiziere in St. Jean de Luz hatten Sharpe Glück gewünscht. Er konnte nur vermuten, dass sich die Militärpolizei entschlossen hatte, sich taub und blind zu stellen.
Die Navy-Offiziere ritten den Pfad hinauf, zügelten fünfzig Yards entfernt die Pferde und saßen ab, ohne Sharpe eines Blickes zu würdigen. Einer der Offiziere hielt die Pferde an den Zügeln, einer ging nervös auf und ab und der dritte schritt zu den drei Riflemen.
Frederickson, Sharpes Sekundant, ging dem Navy-Offizier ein paar Schritte entgegen. »Guten Morgen, Lieutenant!«
»Guten Morgen, Sir.« Lieutenant Ford war Bampfyldes Sekundant. Er trug einen Holzkasten. »Ich entschuldige mich für die Verspätung.«
»Es freut uns, dass Sie endlich da sind.« Frederickson warf einen Blick zu Bampfylde. Der Captain ging immer noch nervös auf und ab. »Ist Ihr Duellant bereit zu einer Entschuldigung, Lieutenant?«
Die Frage wurde nur der Form halber gestellt und ebenso der Form halber beantwortet. »Natürlich nicht, Sir.«
»Was bedauerlich ist.« Frederickson, dessen Kompanie wegen Bampfyldes Feigheit in der Festung Teste de Buch gelitten hatte, sagte es kein bisschen bedauernd. Stattdessen verriet sein Tonfall Vorfreude in Erwartung von Bampfyldes Tod. »Sollen wir mit der Prozedur beginnen, Lieutenant?« Ohne auf eine Antwort zu warten, winkte er Sharpe zu sich wie Ford Bampfylde. Die beiden Duellanten traten sich wortlos gegenüber. Bampfylde war totenbleich, wirkte jedoch ziemlich nüchtern auf Sharpe. Er zitterte keineswegs, wie Harper prophezeit hatte. Er sah verärgert aus, aber jeder, den man der Feigheit bezichtigt hatte, sollte ärgerlich sein.
Ford öffnete den Holzkasten und nahm zwei Duellpistolen heraus. Bampfylde hatte die Waffen bestimmen können, weil er herausgefordert worden war, und er hatte ein Paar langläufiger französischer Perkussionspistolen gewählt. Frederickson wog die Waffen in den Händen, untersuchte ihre Hähne, zog den Ladestock aus einer der Waffen und prüfte beide Läufe. Er vergewisserte sich, dass keine der beiden Pistolen einen gezogenen Lauf hatte. Beide hatten glatte Läufe. Es waren identische Waffen, soweit handwerkliches Geschick sie völlig gleich herstellen konnte.
Der Arzt neigte sich aus der Kutsche, um die sorgfältigen Vorbereitungen zu beobachten. Sein Kutscher stand in einen weiten Mantel gehüllt bei den Pferden. Harper wartete bei den Kiefern.
Ford lud beide Pistolen, während Frederickson aufmerksam zuschaute. Der Lieutenant benutzte feines Schwarzpulver, das er mit einem kleinen Messbecher abmaß. Ford war nervös, seine Hand zitterte, und etwas vom Pulver wurde vom Wind verweht, aber er glich den Verlust sorgfältig mit zusätzlichem Pulver aus. Das Pulver wurde mit dem Ladestock in den Lauf gestampft, und dann wurde jede Bleikugel in geöltes Leder gehüllt. Kugeln, so sorgfältig sie auch gegossen waren, hatten nie ein perfektes Kaliber, doch durch das Leder passten sie so genau wie möglich, und das verlieh den Pistolen zusätzliche Treffgenauigkeit. Sie würden treffgenauer mit gezogenem Lauf sein, aber das hielt man für unsportlich. Die Kugeln wurden in die Läufe gerammt, dann wurde der Ladestock mit einem Hammer hinabgeschlagen, damit die Kugeln hart auf der Pulverladung saßen.
Als die Läufe geladen waren, öffnete Ford eine kleine Blechdose, die Zündhütchen enthielt. Jedes Zündhütchen bestand aus hauchdünnem Kupfer, das eine winzige Ladung Schwarzpulver einschloss. Wenn der Hammer der Pistole auf das dünne Kupfer schlug, explodierte das Pulver darin und stieß eine winzige Flamme durch das Zündloch zu der Ladung im Lauf. Solche Waffen waren sehr genau, teuer und viel zuverlässiger als die altmodischen Steinschlosswaffen, die so anfällig gegen Feuchtigkeit waren. Ford drückte die Zündhütchen sorgfältig in die winzigen Vertiefungen unter den Hähnen und senkte behutsam die Hähne, sodass die Waffen gesichert waren. Dann, mit sonderbar zaghafter Miene, hielt er beide Pistolen mit dem Griff voran Frederickson hin.
Frederickson, der somit die Wahl hatte, blickte zu Sharpe.
»Egal, welche«, sagte Sharpe knapp. Es waren die ersten Worte, die einer der beiden Duellanten seit dem Treffen gesprochen hatte. Bampfylde schaute zu Sharpe, als er sprach, und blickte dann schnell weg. Der Navy-Offizier war ein untersetzter Mann mit feistem, blassem Gesicht, während Sharpe markante Züge und sonnengebräunte Haut hatte. Eine Narbe auf der linken Wange gab seinem Gesicht etwas Spöttisches, was nur verschwand, wenn er lächelte.
Frederickson wählte die rechte der beiden Pistolen. »Rock und Kopfbedeckung bitte ablegen, Gentlemen«, sagte er in feierlichem Tonfall.
Sharpe hatte dieses Ritual erwartet, doch es erschien ihm immer noch sonderbar und überflüssig. Er nahm den Tschako ab und zog den Uniformrock aus. Auf dem Ärmel des Schützenrocks war ein Stoffabzeichen aufgenäht. Ein Kranz aus Eichenblättern, der bewies, dass er ein Himmelfahrtskommando in eine Bresche geführt hatte, die vom Feind mit Feuer und Stahl verteidigt worden war. Sharpe gab Frederickson den Uniformrock, der daraufhin Sharpe die Pistole überreichte. Der Wind zerrte an Sharpes Haar und blies es von seinen Augen.
Bampfylde zog seinen Navy-Mantel aus und knöpfte den blauweißen Uniformrock auf. Darunter trug er ein weißes Seidenhemd, das er in eine Schärpe über seiner weißen Hose gesteckt hatte. Es hieß, dass man Fetzen von Seide leichter und somit viel sicherer aus einer Kugelwunde entfernte, und deshalb bestanden viele Offiziere darauf, bei einer Schlacht Seide zu tragen. Sharpes Hemd war aus Leinen.
Lieutenant Ford nahm Bampfyldes Sachen und räusperte sich. »Sie werden zehn Schritte gehen, wenn ich zähle, Gentlemen.« Ford war nervös. Er räusperte sich von Neuem, bevor er weitersprach. »Und danach werden Sie sich umdrehen und schießen. Wenn beim ersten Schusswechsel keine Genugtuung gegeben ist, können Sie auf einem zweiten bestehen und so weiter.«
»Sind Sie zufrieden mit Ihrer Position?«, fragte Frederickson. Bampfylde zuckte zusammen, als er angesprochen wurde. Dann schaute er sich um, als suche er einen besseren Platz für das Duell.
»Ich bin zufrieden«, sagte er schließlich.
»Major?« Frederickson sah Sharpe fragend an.
»Zufrieden.«
Der Pistolengriff war aus Nussbaumholz, das mit Kreuzlagen schraffiert war. Die Waffe fühlte sich schwer und schlecht ausbalanciert in Sharpes Hand an, aber das lag daran, dass er nicht an solche Pistolen gewöhnt war. Es war zweifellos eine Waffe von großer Präzision.
»Wenn Sie sich bitte umdrehen wollen, Gentlemen.« Fords Stimme bebte.
Sharpe wandte sich um, sodass er zum Meer blickte. Der auffrischende Wind kräuselte die graue See zu weißen Schaumkronen. Der Wind blies Sharpe genau ins Gesicht, sodass er beim Zielen keinen Gegenwind zu berücksichtigen brauchte.
»Sie können die Waffen spannen«, sagte Frederickson.
Sharpe zog den Hahn zurück und hörte ihn klickend einrasten. Er wurde plötzlich von Sorge erfasst, dass das Zündhütchen aus der Vertiefung fallen würde, doch als er hinschaute, sah er, dass es fest eingefügt war.
»Zehn Schritte, Gentlemen«, kündigte Lieutenant Ford an. »Eins. Zwei …«
Sharpe machte seine normalen Schritte. Er hielt die Pistole gesenkt. Er war überzeugt, vor Bampfylde keine Angst gezeigt zu haben, doch er glaubte, einen Eisklumpen im Magen zu haben, und ein Muskel zitterte an seinem linken Oberschenkel. Seine Kehle war trocken. Er konnte Harper aus dem Augenwinkel sehen.
»… Sieben. Acht.« Lieutenant Ford hob die Stimme, damit sie den Wind übertönte. Sharpe war nah genug am Rand der Klippe, um die französischen Hummerfischer zu sehen, die wegruderten, um der Unterströmung am Fuß der Klippe zu entgehen.
»Neun!«, rief Ford. Dann folgte eine Pause, ein nervöses Zögern vor der letzten Zahl. »Zehn!«
Sharpe machte den letzten Schritt und drehte sich um, sodass er mit dem Rücken zum Atlantikwind stand. Bampfylde stand bereits in seitlicher Schussposition und hatte den ausgestreckten rechten Arm mit der Pistole erhoben. Er wirkte sehr nahe für Sharpe, der plötzlich das Gefühl hatte, den rechten Arm nicht heben zu können. Er dachte an Jane, die in schrecklicher Anspannung wartete, und riss den Arm hoch, weil er die Mündung von Bampfyldes Pistole bereits nur als schwarzes Loch sah, das genau zwischen seine Augen zu weisen schien.
Er starrte auf das schwarze Loch und spürte plötzlich die innere Ruhe wie in einer Schlacht. Das Gefühl der Ruhe und Sicherheit war so unerwartet, aber so vertraut, dass er lächelte.
Und Bampfylde feuerte.
Eine Flamme stach durch Rauch auf Sharpe zu, doch er hatte bereits gehört, dass die Kugel mit einem Krachen wie ein Peitschenhieb an seinem Kopf vorbeiging. Die Kugel konnte kaum mehr als eine Fingerbreite an seinem linken Ohr vorbeigezischt sein, und Sharpe fragte sich, ob beide Pistolen Rechtsdrall hatten. Er wartete, wollte, dass sich der Rauch von Bampfyldes Schuss verzog. Er lächelte immer noch, ohne es zu wissen. Bampfylde waren zweifellos die Nerven durchgegangen. Er hatte zu schnell gefeuert und seinen Schuss vergeudet. Sharpe hatte jetzt alle Zeit, die er brauchte, um Rache für die Männer zu nehmen, die in der Festung Teste de Buch gefallen waren.
Der Wind verwehte den Rauch, und der Blick auf Bampfylde, der mit dem Profil zu Sharpe stand, war frei. Der immer noch seitlich stehende Navy-Offizier zog den Bauch ein, um ein kleineres Ziel zu bieten. Sharpe sah über das Korn der Pistole das weiße Seidenhemd. Er zielte ein wenig mehr nach links, für den Fall, dass die Waffe einen Rechtsdrall hatte. Er würde tief feuern, weil die meisten Waffen hoch schossen. Wenn diese Pistole nicht hoch feuerte, dann würde die Kugel Bampfylde in Höhe des Bauchs in die Seite treffen. Das würde ihn töten, aber langsam, so langsam, wie einige von Sharpes Männern gestorben waren, nachdem Bampfylde sie hinter den feindlichen Linien im Stich gelassen hatte.
Sharpes Finger spannten sich am Abzug. Der Rauch war jetzt vor Bampfylde verweht und nur noch ein dünner Schleier, der landeinwärts davontrieb.
»Schieß und sei verdammt!«, schrie Bampfylde. Sharpe, der gerade hatte abdrücken wollen, sah jetzt, dass Bampfylde vor Angst zitterte.
»Schieß, verdammt!«, rief Bampfylde von Neuem, und Sharpe wusste, dass sein Sieg vollkommen war, denn aus dem stolzen Mann war ein zitternder Feigling geworden. Sharpe hatte Bampfylde der Feigheit bezichtigt, und jetzt hatte er die Anschuldigung bewiesen.
»Schieß schon!«, stieß Bampfylde verzweifelt hervor.
Sharpe visierte ein letztes Mal, senkte die Mündung ein wenig, um den Aufwärtsruck auszugleichen, und feuerte.
Die Pistole ruckte überhaupt nicht nach oben und hatte einen leichten Linksdrall, keinen Rechtsdrall. So wurde es kein Schuss in die Seite, sondern die Kugel durchschlug Bampfyldes beide Gesäßbacken. Sie fetzte seine weiße Uniformhose auf und riss blutige Furchen durch sein Fleisch. Bampfylde quiekte wie ein angestochenes Schwein und machte einen Satz vorwärts. Er ließ seine Pistole fallen, stürzte auf die Knie, und Sharpe spürte den Triumph nach einer gut erledigten Arbeit. Blut tränkte Bampfyldes Hose und breitete sich aus. Der Arzt lief schwerfällig mit seiner schwarzen Tasche auf den Verwundeten zu, aber Lieutenant Ford kniete bereits neben Bampfylde. »Es ist nur eine Fleischwunde, Sir.«
»Er hat mir das Rückgrat zerschossen«, keuchte Bampfylde mit sichtlichen Schmerzen.
»Er hat Ihnen den Arsch gelöchert«, sagte Frederickson grinsend.
Ford blickte zu Frederickson auf. »Stimmen Sie zu, dass der Ehre Genüge getan ist, Sir?«
Frederickson musste sich ein Lachen verkneifen. »Ausgezeichnet Genüge getan, Lieutenant. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.«
Der Doktor kniete sich neben dem Navy-Offizier nieder.
»Es ist nur eine Fleischwunde, die verbunden werden muss. Es wird ein bisschen wehtun, aber Sie haben Glück gehabt.«
Ford übersetzte für Bampfylde, doch der Navy-Captain hörte nicht hin. Stattdessen starrte er zornig und unter Tränen der Scham auf den Offizier der Riflemen, der zu ihm kam und ihn überragte. Sharpe sagte nichts. Er warf die Pistole hin, wandte sich ab und ging davon. Er hatte den Mann nicht getötet, was ihn ärgerte, aber der Ehre war Genüge getan worden. Er hatte Gras vor dem Frühstück gegessen, und jetzt musste er den labilen Frieden mit Jane festigen, sie mit seiner Liebe nach England schicken und zu der Stätte zurückkehren, die er am besten kannte und am meisten fürchtete: dem Schlachtfeld.
Bordeaux gehörte nach wie vor dem Kaiser, doch niemand konnte sagen, wie lange noch. Die Kais waren verlassen, die Lagerhäuser so leer wie die Stadtkasse. Ein paar Leute erklärten sich noch loyal zu Napoleon, aber die meisten sehnten sich nach dem Frieden, der die Geschäfte wiederbeleben würde, und als Symbol dieser Sehnsucht steckten sie sich weiße Kokarden an, die das Abzeichen von Frankreichs Königshaus waren. Zuerst wurden die Kokarden versteckt getragen, doch von Tag zu Tag waren mehr und mehr zu sehen als Trotz gegenüber den Truppen der Bonapartisten, die geblieben waren. Diese Verteidiger des Kaisers waren in geringer Zahl und mitleiderregend schwach. Einige verkrüppelte Veteranen und Pensionäre bemannten die Festungen am Fluss, und ein halbes Bataillon junger Infanteristen hielt die Präfektur, doch alle guten Truppen waren süd- und ostwärts marschiert, um Marschall Soult zu verstärken. Ermuntert durch ihre Abwesenheit, wuchsen in der hungernden Stadt Unzufriedenheit und die Bereitschaft zur Rebellion.
An einem kalten und regnerischen Märzmorgen traf ein einzelner Wagen vor der Präfektur ein. Der Wagen enthielt vier schwarze Kisten und wurde von einem Trupp Kavalleristen eskortiert, die sonderbarerweise unter dem Kommando eines Infanterie-Colonels standen. Der Wagen stoppte auf dem Hof der Präfektur, und die Dragonereskorte verharrte müde in den Sätteln ihrer erschöpften und schlammbespritzten Pferde. Die Kavalleristen trugen ihr Haar zu cadenettes geflochten, zu kleinen Zöpfen, die ein Zeichen ihres Elitestatus waren.
Der Infanterie-Colonel, ein älterer, narbiger Mann, stieg langsam vom Pferd und ging zum Eingang der Präfektur, wo ein Posten die Muskete präsentierte. Der Colonel war zu erschöpft, um die Ehrenbezeigung des Postens zu würdigen. Er ging grußlos in die Präfektur. Die Kavallerieeskorte blieb unter dem Kommando eines Dragoner-Sergents zurück, dessen Gesichtshaut an Leder erinnerte, das von Messerstichen aufgeschlitzt war. Er verharrte auf dem Pferd und hielt seinen schweren Kavalleriesäbel quer über dem Sattelhorn. Der nervöse Posten, der dem feindseligen Blick des Sergents auswich, sah, dass die Säbelklinge eine leichte Kerbe von einem erst vor Kurzem stattgefundenen Kampf hatte.
»He! Schweinegesicht!« Der Sergent hatte das verstohlene Interesse des Postens bemerkt.
»Sergent?«
»Wasser. Besorg Wasser für mein Pferd.«
Der Posten, der den Befehl hatte, sich nicht von der Stelle zu rühren, versuchte den Befehl zu ignorieren.
»He, Schweinegesicht! Ich sagte, du sollst Wasser holen!«
»Ich habe den Befehl …«
Der Posten verstummte, als der Sergent eine verschrammte Pistole aus einem Sattelholster zog.
Der Sergent spannte die Pistole. »Was ist nun, Schweinegesicht?«
Der Posten starrte in die dunkle Pistolenmündung. Dann eilte er davon, um einen Eimer Wasser zu holen.
Unterdessen wurde der Infanterie-Colonel in einen großen Raum geführt, der einst prächtige Marmorwände, eine gewölbte Stuckdecke und Parkettboden gehabt hatte, jetzt jedoch schmutzig, unordentlich und trotz des kleinen Feuers im großen Kamin kalt war. Ein kleiner Mann mit Brille war der einzige Anwesende. Er saß gebeugt an einem grünen Tisch aus Malachit, auf dem viele Papiere zwischen dicken, erloschenen Kerzenstummeln lagen.
»Sie sind Ducos?«, fragte der Infanterist, ohne zu grüßen.
»Ich bin Commandant Pierre Ducos.« Ducos blickte nicht von seiner Arbeit auf.
»Ich bin Colonel Maillot.« Maillot wirkte fast zu müde zum Sprechen, als er seine Säbeltasche öffnete, eine versiegelte Botschaft hervorholte und auf den Tisch legte. Maillot legte die Botschaft absichtlich auf das Schriftstück, an dem Ducos schrieb.
Pierre Ducos ignorierte die beleidigende Geste. Er hob die Botschaft an und schaute auf das rote Siegel, das eine Biene zeigte. Andere mochten erstaunt sein, eine Botschaft mit dem privaten Siegel des Kaisers zu erhalten, doch Ducos’ Miene drückte anscheinend Ärger darüber aus, dass der Kaiser ihm weitere Arbeit aufhalste. Jeder andere hätte die Botschaft sogleich geöffnet und gelesen, doch Ducos beendete seine Arbeit, die der Colonel unterbrochen hatte.
»Sagen Sie, Colonel«, fragte Ducos mit ungewöhnlich tiefer Stimme für einen so kleinen Mann, »was halten Sie von einem Général de Brigade, der sich von einer Hand voll Vagabunden besiegen lässt?«
Maillot war zu erschöpft, um irgendein Urteil abzugeben, und so schwieg er. Ducos, der seinen vertraulichen Bericht über die Ereignisse in der Festung Teste de Buch an den Kaiser schrieb, tunkte die Schreibfeder in das Tintenfässchen und schrieb weiter. Es dauerte fünf Minuten, bis sich Ducos dazu herabließ, das Tintenfass zu schließen und Napoleons Botschaft zu öffnen. Er las stumm zwei Seiten und warf dann entsprechend der Anweisung auf einer der Seiten die andere ins Kaminfeuer. »Sie haben lange gebraucht, um mir die Botschaftzu überbringen.«
Die Worte waren schroff, doch Maillot zeigte keinen Ärger. Er ging zum Kaminfeuer und hielt die kalten Hände über die Wärme der brennenden Scheite. »Ich wäre eher hier gewesen, aber die Straßen sind nicht mehr sicher, Commandant. Selbst mit einer Kavallerieeskorte muss man sich vor Banditen in Acht nehmen.« Er sagte das Wort »Banditen« spöttisch, denn beide Männer wussten, dass es sich dabei entweder um Deserteure aus Napoleons Armeen oder um junge Männer handelte, die aufs Land geflüchtet waren, um ihrer Einberufung zu entgehen. Maillot verschwieg, dass er von solchen Banditen angegriffen worden war. Sechs Dragoner waren ums Leben gekommen, einschließlich Maillots Stellvertreter, aber Maillot hatte einen Gegenangriff gestartet und die Banditen verfolgen und bestrafen lassen. Colonel Maillot, ein Veteran der Kriege des Kaisers, ließ sich nicht von Straßenräubern austricksen.
Ducos nahm die Brille ab und wischte die runden Gläser an einer Ecke seines blauen Uniformrocks ab. »Die Fracht ist sicher?«
»Unten im Hof. In einem Artilleriewagen. Die Eskorte braucht Essen und Wasser, und die Pferde müssen ebenfalls versorgt werden.«
Ducos furchte die Stirn, um zu zeigen, dass er über solchen banalen Dingen stand. »Weiß die Eskorte, was sich in dem Wagen befindet?«
»Natürlich nicht.«
»Was vermuten die Männer?«
Maillot zuckte mit den Schultern. »Macht das was? Sie wissen nur, dass sie vier nicht gekennzeichnete Kisten nach Bordeaux gebracht haben.«
Ducos hob die verbliebene Seite der Botschaft an. »Dies gibt mir die Befehlsgewalt über die Eskorte, und ich will wissen, ob man ihr vertrauen kann.«
Maillot setzte sich auf einen Stuhl und streckte die langen Beine mit den schlammbespritzten Stiefeln aus. »Die Männer stehen jetzt unter dem Kommando von Sergent Challon, der ein guter Mann ist, und sie befolgen seine Befehle und werden nichts tun, was ihn verärgert. Aber kann man ihnen vertrauen? Wer weiß? Sie haben vielleicht inzwischen erraten, was in den Kisten ist, aber bisher sind sie loyal geblieben.« Maillot unterdrückte ein Gähnen. »Im Augenblick interessieren sie sich mehr für Essen und Wasser.«
»Und Sie, Colonel?«, fragte Ducos.
»Ich brauche ebenfalls Essen und Wasser.«
Ducos verzog das Gesicht, um anzuzeigen, dass seine Frage missverstanden worden war. »Was tun Sie jetzt, Colonel?«
»Ich kehre selbstverständlich zum Kaiser zurück. Die Fracht steht nun unter Ihrer Verantwortung. Und ich bin verdammt froh, sie los zu sein. Ein Soldat sollte jetzt kämpfen und nicht als Spediteur fungieren.«
Ducos, der soeben die Verantwortung eines Spediteurs erhalten hatte, setzte die geputzte Brille auf. »Der Kaiser erweist mir eine große Ehre.«
»Er vertraut Ihnen«, sagte Maillot.
»Und er vertraut Ihnen«, gab Ducos das Kompliment zurück.
»Ich war viele Jahre mit ihm zusammen.«
Ducos musterte den grauhaarigen Colonel. Zweifellos war Maillot viele Jahre mit Napoleon zusammen gewesen, aber er war niemals über den Rang Colonel hinaus befördert worden. Andere Franzosen waren aus den Mannschaften aufgestiegen und befehligten ganze Armeen im Gegensatz zu diesem großen, narbigen Veteranen mit dem vertrauenswürdigen Gesicht. Ducos sagte sich, dass Maillot ein Dummkopf war, einer der treuen Doggen des Kaisers, ein Mann für Botengänge, ein Mann ohne Fantasie.
»Bordeaux ist kein sicherer Platz«, sagte Ducos leise, fast wie im Selbstgespräch. »Der Bürgermeister hat eine Botschaft zu den Engländern geschickt und sie gebeten, herzukommen. Er denkt, ich weiß nichts davon, aber ich habe hier eine Kopie.«
»Dann nehmen Sie ihn fest«, sagte Maillot gleichmütig.
»Womit? Die Hälfte der Stadtwache trägt jetzt die weiße Kokarde, und die andere Hälfte würde es ebenfalls tun, wenn sie den Mut hätte.« Ducos stand auf, ging zu einem Fenster und starrte in den Regen, der vom Wind über den Place St. Julien getrieben wurde. »Der Wagen wird heute Nacht hier sicher sein, und Ihre Männer können einige der freien Quartiere nehmen.« Ducos wandte sich um und lächelte plötzlich. »Aber Sie, Colonel, werden mir die Ehre erweisen, mit mir in meinem Quartier zu Abend zu essen, ja?«
Maillot wünschte sich nur, schlafen zu können, aber er wusste, wie hoch dieser kleine, bebrillte Mann in Napoleons Gunst stand, und so nahm er aus Höflichkeit und weil Ducos die Einladung herzlich ausgesprochen hatte, widerstrebend an.
Zu Maillots Überraschung erwies sich Ducos als erstaunlich unterhaltsamer Gastgeber, und Maillot, der am Nachmittag zwei Stunden geschlafen hatte, erwärmte sich für den kleinen Mann, der so offen über seine Dienste für den Kaiser plauderte. »Ich war nie ein richtiger Soldat wie Sie, Colonel«, sagte Ducos bescheiden. »Meine Talente wurden benutzt, um den Feind zu bestechen, zu überlisten und zu betrügen.« Ducos sprach an diesem Abend nicht von seinen Fehlschlägen der letzten Zeit, sondern von seinen Erfolgen der Vergangenheit, als er einige spanische Guerillaführer zu Friedensgesprächen gelockt hatte und sie alle abgeschlachtet worden waren, als sie vertrauensvoll eingetroffen waren. Ducos lächelte bei der Erinnerung. »Manchmal fehlt mir Spanien.«
»Ich habe dort nie gekämpft.« Maillot schenkte sich Brandy ein. »Aber man erzählte mir von den Guerilleros. Wie kann man gegen Männer kämpfen, die keine Uniform tragen?«
»Indem man so viele Zivilisten tötet, wie man kann, natürlich.« Ducos lächelte wehmütig. »Ich vermisse das warme Klima.«
Maillot lachte darüber. »Sie waren offenbar nicht in Russland.«
»Stimmt.« Ducos erschauerte allein bei dem Gedanken an Russland. Dann drehte er sich auf seinem Stuhl um und spähte in die Dunkelheit hinaus. »Es regnet nicht mehr, mein lieber Maillot. Möchten Sie mit mir ein Stück durch den Garten gehen?«
Die beiden Männer gingen über den nassen Rasen, und ihr Zigarrenrauch stieg zu den Zweigen der Birnbäume empor. Maillot dachte anscheinend immer noch an den Russlandfeldzug, denn er lachte plötzlich auf und erklärte dann, wie raffiniert der Kaiser in Moskau gewesen war.
»Raffiniert?« Ducos klang erstaunt. »Für diejenigen von uns, die nicht dort waren, wirkte es nicht sehr raffiniert.«
»Das ist es ja gerade«, sagte Maillot. »Wir hörten über die Unruhe daheim, und was machte der Kaiser? Er schickte Befehle, dass die Tänzerinnen vom Pariser Ballett ohne Rock und Strümpfe auftreten sollten!« Maillot lachte bei der Erinnerung. Dann wandte er sich zu der hohen Steinmauer des Gartens und knöpfte seine Reithose auf. Er sprach weiter, während er urinierte. »Wir hörten später, dass Paris alle Gefallenen in Russland vergaß, weil alle nur noch über Mademoiselle Rossilliers nackte Schenkel sprachen. Waren Sie zu dieser Zeit in Paris?«
»Ich war in Spanien.« Ducos stand genau hinter Maillot. Während der Colonel redete, zog Ducos eine kleine Pistole aus seiner Gesäßtasche und spannte sie leise. Jetzt zielte er auf Maillots Nacken. »Ich war in Spanien«, wiederholte Ducos und schloss die Augen, als er abdrückte. Die Kugel zerschmetterte einen von Maillots Rückenwirbeln, und der grauhaarige Kopf ruckte blutig zurück. Der Colonel brach mit einem seufzenden Laut zusammen. Sein Kopf ruckte vor und prallte gegen die Mauer. Sein Körper zuckte noch einmal und regte sich dann nicht mehr. Der stinkende Pistolenrauch wallte unter den Birnbaumzweigen.
Ducos würgte, kämpfte gegen Übelkeit an und hatte sich dann unter Kontrolle. Eine Stimme ertönte aus einem Nachbarhaus. Jemand wollte eine Erklärung für den Schuss, doch als Ducos antwortete, wurde keine weitere Frage gestellt.
Im Morgengrauen war die Leiche unter einem Komposthaufen verborgen.
Ducos hatte nicht geschlafen. Es waren keine Gewissensbisse wegen Maillots Tod, die ihn wachgehalten hatten, sondern es war das Wissen über die Ungeheuerlichkeit, die dieser Tod bedeutete. Ducos hatte durch den Mord alles aufgegeben, was ihm einst das Teuerste gewesen war. Er war aufgewachsen in dem Glauben an die heiligen Ideale der Revolution, dann hatte er gelernt, dass Napoleons kaiserliche Ambitionen in Wirklichkeit die gleichen Ideale waren, jedoch von dem Genius eines Mannes in einzigartigen Ruhm umgewandelt worden waren. Jetzt brach Napoleons Ruhm zusammen, und die Ideale mussten weiterleben, und erst jetzt erkannte Ducos, dass Frankreich selbst die Verkörperung dieser Größe war.
Ducos hatte sich in dieser kalten Nacht eingeredet, dass das nebensächliche Drum und Dran des kaiserlichen Frankreich geopfert werden konnte. Ein neues Frankreich würde entstehen, und Ducos würde diesem neuen Frankreich aus einer Position mächtiger Verantwortlichkeit heraus dienen. Im Augenblick war jedoch noch eine Zeit des Wartens und der Sicherheit nötig. So befahl er am Morgen den Dragoner-Sergent Challon in die Präfektur und überreichte ihm, als er ihm am Malachittisch gegenübersaß, die Seite der Botschaft des Kaisers. »Lesen Sie das, Sergent.«
Challon nahm lässig und selbstsicher das Schriftstück, doch dann wurde ihm klar, dass er den bebrillten Offizier nicht bluffen konnte, und er ließ es sinken. »Ich kann nicht lesen, Commandant.«
Ducos starrte in die blutunterlaufenen Augen des Sergents. »Durch dieses Dokument werden Sie mir unterstellt, Sergent. Es ist unterzeichnet vom Kaiser persönlich.«
»Jawohl, Commandant«, sagte Challon tonlos.
»Das bedeutet, dass Sie meine Befehle befolgen.«
»Jawohl, Commandant.«
Dann ging Ducos ein Risiko ein. Auf dem Tisch lag eine Zeitung, und Ducos befahl Challon, sie auf den Boden zu werfen.
Der Sergent wunderte sich über den Befehl, befolgte ihn jedoch. Dann erstarrte er.
Unter der Zeitung waren zwei weiße Kokarden verborgen gewesen.
Challon starrte auf die Symbole der Feinde Napoleons, und Ducos beobachtete den Sergent mit den Zöpfen. Challon war kein Mann, der seine Gefühle verbergen konnte. Sein lederhäutiges, narbiges Gesicht verriet seine Gedanken, als würde er sie laut aussprechen. Als Erstes verriet die Miene Ducos, dass Sergent Challon wusste, was in den vier Kisten war. Es hätte Ducos auch erstaunt, wenn Challon es nicht gewusst hätte. Als Zweites verriet das Mienenspiel des Sergents, dass er – genau wie Ducos – diesen Inhalt haben wollte.
Challon schaute von den Kokarden zu dem kleinen Commandant auf. »Darf ich fragen, wo Colonel Maillot ist, Commandant?«
»Colonel Maillot erkrankte plötzlich an Fieber, und mein Arzt meint, es wird sich als tödlich erweisen.«
»Ich bedaure, das zu hören, Commandant, denn einige der Jungs mochten den Colonel.« Challons Stimme klang sehr steif. Und einen Augenblick lang, während er in Challons hart blickende Augen schaute, dachte Ducos, dass er sich schlimm verkalkuliert hatte. Dann sah Challon auf die belastenden Kokarden und sagte: »Aber einige der Jungs werden es lernen, mit der Trauer zu leben.«
Erleichterung erfüllte Ducos, doch er war viel zu gerissen, um sie sich anmerken zu lassen. Challon war sein Mann, das wusste Ducos jetzt. »Das Fieber kann sehr ansteckend sein«, sagte Ducos sanft.
»Das habe ich gehört, Commandant.«
»Und unsere Verantwortung erfordert wenigstens sechs Mann. Sind Sie da meiner Meinung?«
»Ich denke, mehr als sechs werden das Fieber überleben«, sagte Challon ebenso andeutungsweise wie Ducos.
Sie waren jetzt Verbündete beim Verrat, und keiner konnte es offen aussprechen, obwohl sie sich gegenseitig perfekt verstanden.
»Gut.« Ducos nahm eine der Kokarden. Challon zögerte, dann nahm er die andere, und so war der Pakt besiegelt.
Zwei Tage später hüllte von See kommender Nebel Bordeaux in weiße feuchte Schwaden ein, und neun Reiter ritten in der Morgendämmerung ostwärts. Pierre Ducos führte sie. Er trug Zivilkleidung und war mit einem Degen und zwei Pistolen bewaffnet. Sergent Challon und seine Männer hatten ihre grünen Uniformen an, jeder hatte sich jedoch des schweren Metallhelms entledigt. Ihre Satteltaschen waren prallvoll wie die Tragekörbe der drei Packpferde, die drei der Soldaten mitführten.
Täuschen, betrügen, tarnen und austricksen – das waren die Fähigkeiten, die Ducos seinem Kaiser gegeben hatte und die jetzt Ducos’ eigenen Zwecken dienen mussten. Der Hufschlag der Pferde hallte durch das Stadttor hinaus und verklang, als die Reiter im Nebel verschwanden.
KAPITEL 1
»Natürlich wusste der Peer davon …«, Major General Nairn sprach von dem Duell, »… aber unter uns gesagt, ich bezweifle, dass er unglücklich deswegen war. Die Navy hat ihn in letzter Zeit ziemlich verärgert.«
»Ich rechnete damit, verhaftet zu werden«, sagte Sharpe.
»Das wäre auch der Fall gewesen, wenn Sie den Kerl getötet hätten. Selbst Wellington kann nicht einfach über den Tod eines Navy-Offiziers hinweggehen. Aber es war clever von Ihnen, nur den Hintern des Mannes zu treffen.«
Nairn lachte bellend bei dem Gedanken an Bampfyldes Verwundung.
»Ich wollte ihn eigentlich töten«, bekannte Sharpe.
»Es war viel schlauer von Ihnen, ihn am Hintern zu verwunden. Und lassen Sie mich sagen, wie sehr ich mich freue, Sie zu sehen, mein lieber Sharpe. Ich nehme an, Jane geht es gut?«
»So ist es, Sir.«
Sharpes Tonfall veranlasste Nairn, den Rifleman amüsiert zu mustern. »Sehe ich da Anzeichen darauf, dass der Haussegen schief hängt, Sharpe?«
»Sehr schief, Sir.«
Sharpe hatte drei Tage gebraucht, um die vorrückende Armee einzuholen, und einen weiteren Tag, um Nairn zu finden, dessen Brigade sich an der linken Flanke des Vormarschs befand. Sharpe hatte den Schotten schließlich auf einer Hügelkuppe oberhalb einer Furt gefunden, die von den Briten an diesem Morgen eingenommen worden war und durch die jetzt eine ganze Division marschierte. Von den Franzosen waren nur ein paar Schwadronen Kavallerie auf dem Rückzug weit im Osten zu sehen, doch eine Batterie französischer Artillerie feuerte gelegentlich aus einem Waldstück, das sich etwa eine Meile jenseits des Flusses erstreckte.
»Sie haben Frederickson mitgebracht?«, fragte Nairn.
»Er und seine Männer sind am Fuß des Hügels.«
»Bampfylde den Arsch gelöchert!« Nairn lachte von Neuem. »Kann ich aus dem schief hängenden Haussegen schließen, dass Jane nicht mitgekommen ist?«
»Sie segelte vor zwei Tagen nach England, Sir.«
»Das Beste für Ihre Frau. Mir gefielen noch nie Offiziere, die ihre Frauen mitschleppen wie Gepäck. Das soll natürlich keine Beleidigung sein. Jane ist ein nettes Mädchen, aber trotzdem Ballast für eine Armee. Hallo! Allmächtiger!« Letzteres galt einer Kanonenkugel, die über den Fluss flog und den Hügel heraufhüpfte, sodass Nairn sein Pferd zu einer Ausweichbewegung zwingen musste, bei der er fast aus dem Sattel gestürzt wäre. Der Schotte parierte und beruhigte sein Pferd und wies dann über den Fluss. »Sie sehen, was los ist, Sharpe. Die verdammten Franzosen versuchen uns bei jedem Fluss zu stoppen, und wir umgehen sie einfach und marschieren weiter.« Am Fuß des Hügels wartete Nairns Brigade darauf, bis sie an der Reihe war, den Fluss zu durchfurten. Die Brigade bestand aus einem Hochlandbataillon und zwei englischen Landbataillonen.
»Was genau erwarten Sie von mir, Sir?«, fragte Sharpe.
»Ich will verdammt sein, wenn ich das weiß. Amüsieren Sie sich. So wie ich!« Der Schotte, der jahrelang langweilige Stabsarbeit für Wellington gemacht hatte, blühte wirklich bei seinem neuen Kommando auf. Nairn bedauerte nur, dass es bis jetzt noch keine Schlacht gegeben hatte, in der er beweisen konnte, wie dumm es von Wellington gewesen war, ihm nicht viel eher eine Brigade zu geben. »Gottverdammt, Sharpe, es ist nicht mehr viel vom Krieg übrig. Ich wünsche mir einen Kampf gegen die Knoblauchstinker.«
Sharpe mochte den Befehl erhalten haben, sich zu amüsieren, aber schon bald stellte er fest, dass die Arbeit als Stabschef einer Brigade enorm lange Tage und scheinbar endlose Probleme mit sich brachte. Er arbeitete, wo immer Nairns Hauptquartier war, manchmal in einem abgelegenen Bauernhaus, aber für gewöhnlich in einer Gruppe von Zelten, die aufgeschlagen wurden, wo auch immer die Brigade biwakierte. Manchmal hörte Sharpe das ferne Donnern im Osten und wusste, dass eine französische Nachhut in Aktion war, aber er hatte weder die Zeit noch die Pflicht, sich am Kampf zu beteiligen. Er wusste nur, dass jeder durchquerte Fluss und jede Meile eingenommenes Land mehr Arbeit für die Stabsoffiziere bedeutete, die Männer mit Nahrungsmitteln und Munition zu versorgen und die Befehle der Division in die Tat umzusetzen.
Es war eine lehrreiche Aufgabe für Sharpe. Er hatte immer die Verachtung eines Kampfsoldaten für die meisten Stabsoffiziere geteilt und gedacht, dass diese arroganten Typen überbezahlt und unterbeschäftigt waren, doch als Sharpe die Probleme, die die Organisation einer Brigade mit sich brachten, erkannte, stellte er ebenso fest, dass es seine Aufgabe war und nicht die Nairns, diese Probleme zu lösen. Einer der typischen Tage, knapp zwei Wochen nach seiner Ankunft bei der Brigade, begann mit einem Gesuch des Commanders einer Batterie von berittener Artillerie, dessen Versorgungswagen im Wirrwarr französischer Feldwege hinter dem britischen Vormarsch verloren gegangen war. Es zählte nicht zu Sharpes Pflichten, den verschollenen Wagen aufzutreiben, doch die Kanoniere hatten den Befehl, Nairns Vormarsch zu unterstützen, und Sharpe war sich im Klaren darüber, dass Feldgeschütze ohne Kanonenkugeln nutzlos waren, und so schickte er einen Adjutanten auf die Suche nach dem verschollenen Nachschub. Beim Frühstück brachte eine Patrouille von Leichter Kavallerie der Deutschen Legion des Königs zwanzig französische Gefangene zu dem Bauernhaus, das vorübergehend als Nairns Hauptquartier diente. Der befehlshabende Offizier der Kavalleristen rief nach einem kompetenten Offizier, und als Sharpe auftauchte, wies er auf die furchtsamen feindlichen Soldaten. »Ich will die Scheißer nicht haben.« Der Kavallerieoffizier galoppierte davon, und Sharpe musste die Franzosen durchfüttern, bewachen und ärztliche Hilfe für ein halbes Dutzend Gefangene auftreiben, die von den Deutschen verwundet worden waren.
Ein Befehl traf von der Division ein. Nairn musste mit seiner Brigade drei Meilen weiter ostwärts vorrücken. Die Brigade sollte eigentlich einen Ruhetag haben, während die südlichen Divisionen zu ihr aufrückten, aber die Befehle waren offenbar geändert worden. Sharpe schickte einen Adjutanten auf die Suche nach Nairn, der die Gelegenheit genutzt hatte, auf Entenjagd zu gehen. Als dann alle Angestellten, Köche, Gefangene und Ordonnanzen der Offiziere abmarschbereit waren, traf eine neue Botschaft ein, mit der die erste rückgängig gemacht wurde. Die Maultiere wurden abgeladen und dringende Botschaften per Kurier auf den Weg geschickt, um die Marschbefehle rückgängig zu machen, die längst an die Bataillone ergangen waren. Ein anderer Kurier wurde zu Nairn geschickt, um ihm zu melden, dass er die Entenjagd fortsetzen konnte.
Dann brachten drei Militärpolizisten einen Mann aus dem schottischen Hochland zum Hauptquartier. Sie hatten ihn erwischt, als er eine Gans aus einem französischen Dorf gestohlen hatte. Obwohl der Schotte zweifellos schuldig und die Gans unbestreitbar geschlachtet worden war, wusste Sharpe, dass Nairn irgendeinen Grund finden würde, um dem schottischen Landsmann das Leben zu retten. Zwei spanische Offiziere trafen ein und fragten nach Anweisungen für General Morillos Division, und weil sie es nicht eilig hatten und Wellington betont hatte, wie wichtig es war, die spanischen Verbündeten gut zu behandeln, überredete Sharpe sie, zum Mittagessen zu bleiben, das aus einer gestohlenen und gebratenen Gans und Hartbrot bestand.
Ein Dorfpriester kam ins Hauptquartier und wollte die Zusicherung, dass die Frauen seiner Gemeinde sicher vor Belästigungen durch die Briten sein würden, und mit dem nächsten Atemzug erwähnte er, dass er einiges von Maréchal Soults Kavallerie nordwestlich des Dorfes gesehen hätte. Sharpe glaubte den Bericht nicht, der darauf schließen ließ, dass die Franzosen versuchten, die Briten zu umfassen, aber er musste die Meldung an die Division weitergeben, die daraufhin nichts unternahm.
Bis zum Nachmittag waren ein Dutzend neue Dauerbefehle abzuschreiben und zu Nairns drei Bataillonen zu schicken. Sharpe fragte sich, ob er die Zeit haben würde, den Spaniern beim Mittagessen Gesellschaft zu leisten, aber dann hatte er das Problem mit den Rindern der Brigade am Hals.
»Sie taugen einfach nichts, Sir.« Der Chef der Treiber, ein Mann aus Yorkshire, starrte finster auf die Rinder, die auf eine Weide hinter dem Hauptquartier getrieben worden waren.
Die Tiere waren als wandelnde Speisekammer der Brigade geschickt worden, die der Mann aus Yorkshire auf dem Vormarsch der Armee mittreiben sollte. »Die Nässe ist daran schuld, Sir.«
»Sie sehen recht gut genährt aus«, sagte Sharpe und hoffte, dass Optimismus das Problem verbannen würde.
»Sie sind fleischig, das stimmt«, räumte der Mann aus Yorkshire ein, »aber Sie sollten ihre Hufe sehen, Sir. Es ist grausam, so etwas einem Tier anzutun.«
Sharpe bückte sich bei der nächsten Kuh und sah, dass sich ein Huf vom Fell gelöst hatte. Die Lücke war mit milchigem Schleim gefüllt.
»Wenn sie so nässen, sind sie verloren«, sagte der Treiber grollend. »Die schaffen keine Meile mehr, und ich kann nicht begreifen, wie man so etwas einem Tier antun kann. Man kann die Rinder nicht wie Menschen marschieren lassen. Sie müssen Ruhepausen haben.« Der Mann aus Yorkshire war erbittert und zornig.
Zweihundert Rinder schienen Sharpe vorwurfsvoll anzustarren, als er sich aufrichtete. »Sind alle so dran?«
»Alle bis auf eine Hand voll, Sir, und es bedeutet, dass sie getötet werden müssen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.«
So mussten Schlachter aufgetrieben, Munition ausgegeben und Fässer und Salz zum Pökeln des Fleisches besorgt werden. Den ganzen Nachmittag lang waren das Muhen und das Krachen von Musketenschüssen zu hören, und der Geruch von Pulverrauch und Blut erfüllte das Hauptquartier. Lärm und Gestank vertrieben immerhin die beiden Spanier, die sonst anscheinend entschlossen gewesen wären, Nairns kostbaren Vorrat an erbeutetem Brandy zu dezimieren. Ein Adjutant traf von der Division ein und wollte wissen, was die Schüsse zu bedeuten hätten, und Sharpe schickte den Mann mit einer kurzen Beschwerde über die Qualität der gelieferten Rinder fort. Es war ihm klar, dass die Beschwerde ignoriert werden würde.
Am Ende des Tages hatte Sharpe trotz seiner unablässigen Aktivitäten das Gefühl, dass das meiste von seiner Arbeit unerledigt geblieben war. Er sagte das Nairn, als sie sich vor dem Abendessen in der Wohnstube des Bauernhauses trafen. Der Schotte war wie immer überschwänglich. »Acht Enten! Das war fast so befriedigend wie eine gute Schlacht.«
»Ich habe genug Arbeit ohne Schlachten«, grollte Sharpe.
»Da spricht der wahre Stabsoffizier.« Nairn streckte die Beine aus, damit ihm seine Ordonnanz die schlammbedeckten Stiefel ausziehen konnte. »Irgendwelche wichtigen Neuigkeiten?«, fragte er Sharpe.
Sharpe entschied sich, Nairn nicht mit dem Problem in punkto Rinder zu belasten. »Das einzig Bemerkenswerte von heute ist die Tatsache, dass Colonel Taplow keine Schwierigkeiten machte.«
Lieutenant Colonel Taplow befehligte eines der beiden englischen Bataillone von Nairns Brigade. Er war ein kleiner, cholerischer Mann mit bemerkenswert unhöflicher Art, der sich bei jedem Befehl in seiner Würde verletzt sah. Nairn mochte den schwierigen Mann. »Taplow ist leicht genug zu verstehen. Sehen Sie in ihm den typischen Engländer: stur, stupide und solide. Wie ein Stück von nicht durchgegartem Schweinefleisch.«
»Oder von gepökeltem Rindfleisch.« Sharpe ließ sich nicht von dem Schotten ködern. »Und ich hoffe, Sie mögen gepökeltes Rindfleisch, Sir, denn Sie werden verdammt viel davon bekommen.«
Am nächsten Tag ging der Vormarsch weiter. Jedes Dorf begrüßte die Briten mit misstrauischer Neugier, die später in erstaunte Anerkennung überging, als die Dorfbewohner feststellten, dass die Briten im Gegensatz zu ihren eigenen Soldaten für die Nahrungsmittel bezahlten, die sie aus Scheunen und Lagerhäusern nahmen. Soldaten fanden französische Mädchen, die sich dann zu den spanischen und portugiesischen Frauen gesellten, die hinter den vorrückenden Bataillonen herzogen. Die Frauen brachten mehr Probleme als die Soldaten, denn viele der Spanierinnen hatten einen unglaublichen Hass auf Franzosen, der zu schnellen und wilden Messerkämpfen führen konnte. Sharpe musste einmal gewaltsam zwei Frauen trennen, und als das spanische Mädchen von ihrer französischen Feindin abließ und auf Sharpe einstechen wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als es mit dem Gewehrkolben niederzuschlagen.
Sergeant Harper hatte seine Frau nach Hause geschickt, bevor er St. Jean de Luz verlassen hatte. Isabella und das Baby waren nach Pasajes, gleich hinter der französischen Grenze, gegangen und sollten dort auf Harper warten. »Sie wird dort gut zurechtkommen«, sagte Harper zu Sharpe. »Sie ist glücklicher bei ihren Landsleuten.«
»Machst du dir keine Sorgen um sie?«
Harper reagierte erstaunt auf die Frage. »Warum sollte ich? Ich habe ihr Geld gegeben, und sie weiß, dass ich sie und das Kind abholen werde, wenn es so weit ist.«
Harper sorgte sich nicht um seine Isabella, aber Sharpe konnte Janes Abwesenheit kaum ertragen. Er sagte sich, dass es albern war, schon jetzt irgendwelche Briefe aus England zu erwarten, doch er durchsuchte jeden neuen Postsack, der die Brigade erreichte. Zu anderen Zeiten versuchte er, sich vorzustellen, wo Jane war und was sie tat. Er malte sich aus, was für ein Haus sie kaufen würde, ein prächtiges Steinhaus in einer idyllischen Landschaft. Im Haus würde Platz sein, um den schweren Säbel und das verschrammte Gewehr aufzuhängen. Er stellte sich den Besuch von Freunden und lange Unterhaltungen bei Kerzenschein vor, bei denen er sich an diese länger werdenden Frühlingstage erinnern würde, an denen sie eine Armee durch ihr Heimatland verfolgten. Vor seinem geistigen Auge sah er einen Kinderhort, wo seine Kinder fern von Gestank und Pulverrauch aufwachsen würden.
Es waren die Träume eines Soldaten vom Frieden, und der Frieden lag in der Luft wie der Duft der Mandelblüte. Jeder Tag brachte neue Gerüchte vom Ende des Krieges. Es hieß, Napoleon habe Gift genommen, dann besagte ein gegensätzliches Gerücht, dass der Kaiser eine russische Armee nördlich von Paris vernichtend geschlagen habe, aber nur einen Tag später schwor ein spanischer Oberst einen heiligen Eid, dass die Preußen Bonaparte besiegt und seine Leiche an ihre Jagdhunde verfüttert hätten. Ein italienischer Deserteur aus Marschall Soults Armee berichtete, der Kaiser sei in die Vereinigten Staaten geflüchtet, während der Kaplan von Lieutenant Colonel Taplows Füsilieren völlig sicher war, dass Napoleon einen Frieden mit Britanniens Prinzregenten aushandele. Der Kaplan hatte es von seiner Frau gehört, deren Bruder der Tanzlehrer von einer Mätresse des Prinzen war, der er den Laufpass gegeben hatte.
Durch solche Gerüchte genährt, drehten sich die Gespräche bei der Armee mehr und mehr um die geheimnisvollen Umstände der Friedenszeit. Abgesehen von ein paar Monaten im Jahre 1803 hatten die meisten Männer nie Frieden zwischen Britannien und Frankreich erlebt. Diese Männer waren Soldaten, ihr Handwerk war das Töten von Franzosen, und der Friede war für sie sowohl Bedrohung als auch Versprechen. Die Bedrohungen durch den Frieden waren real, Arbeitslosigkeit und Armut, während die Versprechen verschwommen waren und für die meisten Männer der Armee nicht existierten. Ein Offizier konnte seinen Abschied nehmen, erhielt den halben Sold und war in der Lage, sich damit etwas im Zivilleben aufzubauen, aber die meisten der Soldaten hatten sich auf Lebenszeit verpflichtet, und der Frieden würde für sie bedeuten, dass sie auf Garnisonen in der ganzen Welt verteilt werden würden. Ein paar würden entlassen werden, sich aber ohne Pension und mit einer düsteren Zukunft in einer Welt zurechtfinden müssen, in der andere Männer nützliche Berufe gelernt hatten.
»Werden Sie mir Papiere geben?«, fragte Harper dennoch eines Abends.
»Du bekommst Papiere, Patrick, das verspreche ich«, antwortete Sharpe. Die »Papiere« waren das Entlassungsdokument, das dafür bürgte, dass Sergeant Patrick Harper wegen Verwundungen verabschiedet worden war. »Was wirst du dann tun?«, fragte Sharpe.
Harper hatte keine Zweifel. »Die Frau holen und heimkehren.«
»Nach Donegal?«
»Wohin sonst?«
Sharpe dachte daran, dass Donegal weit von Dorset entfernt war. »Wir werden unsere Freunde vermissen«, sagte er stattdessen.
»Das stimmt, Sir.«