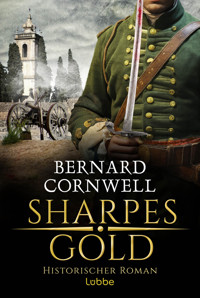
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Spanien, August 1810. Sharpe erhält den Auftrag, einen Schatz aufzuspüren, der hinter den feindlichen Linien verborgen liegt. Das Gold soll den britischen Truppen in Portugal zugutekommen, die kurz vor der Niederlage stehen. Doch ein gefürchteter Partisanenführer stellt sich ihm in den Weg. Damit hat Sharpe einen neuen Todfeind, nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch im Kampf um die Gunst einer schönen Frau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
EPILOG
HISTORISCHE ANMERKUNG
Leseprobe – Steels Ehre
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 80er-Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
Weitere Informationen finden Sie aufwww.bernardcornwell.net
Bernard Cornwell
SHARPESGOLD
Historischer Roman
Aus dem Englischen vonBernd Müller
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Überarbeitete Fassung des 1990 bei Bastei Lübbe erschienenen Romans »Sharps Gold«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1981 by Bernard Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Gold«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2012/2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Rainer Delfs
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Shutterstock: Olemac | Rita Miranda | Joao Morais | Almeida | NatalyFox | Conrad Schaefer | GTW
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-1549-0
luebbe.de
lesejury.de
KAPITEL 1
Der Krieg war verloren – noch nicht zu Ende, aber verloren. Alle wussten es, von den Divisionsgenerälen bis zu den Dirnen Lissabons: dass die Briten in die Falle gegangen und eingemacht worden waren, bereit für den Kochtopf. Ganz Europa wartete darauf, dass der Meisterkoch Bonaparte die Berge überqueren und persönlich letzte Hand an den Braten legen würde.
Dann fügte sich Schimpf zur bevorstehenden Schande. Wie es schien, war das kleine britische Heer der Aufmerksamkeit des großen Bonaparte nicht wert. Der Krieg war verloren.
Spanien war besiegt. Die letzten spanischen Armeen waren aufgerieben, auf dem Scheiterhaufen der Geschichte gelandet. Übrig blieben nur der befestigte Hafen von Cádiz und die Bauern, die die »Guerilla« ausfochten, den »kleinen Krieg«. Sie kämpften mit spanischen Messern und britischen Gewehren, mit Hinterhalten und Terroranschlägen, bis die französischen Truppen das spanische Volk hassen und fürchten lernten. Aber der kleine Krieg war nicht der wahre Krieg, und der, darin war man sich einig, war verloren.
Captain Richard Sharpe, vormals Angehöriger der 95th Rifles Seiner Majestät, nun Offizier der Leichten Kompanie des South Essex Regiments, hielt den Krieg nicht für verloren, war jedoch trotzdem übel gelaunt, verdrießlich und reizbar. Der Regen, der seit Tagesanbruch gefallen war, hatte die staubige Straßendecke in glitschigen Schlamm verwandelt und seine Schützenuniform unangenehm klamm werden lassen. Er hatte sich abgesondert und marschierte schweigend dahin, dem Geschwätz seiner Männer lauschend. Lieutenant Robert Knowles und Sergeant Patrick Harper, die sich normalerweise zu ihm gesellt hätten, ließen ihn in Ruhe. Lieutenant Knowles hatte sich zu einer Bemerkung über Sharpes Laune hinreißen lassen, doch der hünenhafte irische Sergeant hatte den Kopf geschüttelt.
»Keine Chance, ihn aufzumuntern, Sir. Es gefällt ihm, mieser Laune zu sein, wahrhaftig. Wie ich den Bastard kenne, wird er von allein darüber hinwegkommen.«
Knowles zuckte mit den Schultern. Er fand es ganz und gar unpassend, dass ein Sergeant einen Captain mit »Bastard« betitelte, aber es hatte keinen Sinn, sich dagegen zu verwahren. Der Sergeant würde nur unschuldig dreinblicken und Knowles wahrheitsgemäß versichern, dass die Eltern des Captains nicht verheiratet gewesen seien. Obendrein hatte Patrick Harper jahrelang an Sharpes Seite gekämpft und eine Freundschaft zu dem Captain aufgebaut, um die Knowles ihn richtiggehend beneidete. Knowles hatte Monate gebraucht, diese Freundschaft zu verstehen. Sie gründete sich nicht, wie viele Offiziere annahmen, auf die Tatsache, dass Sharpe früher einmal als einfacher Soldat in Reih und Glied marschiert war und gekämpft hatte und deshalb nun, nachdem ihm die Ehre zuteil geworden war, der Offiziersmesse angehören zu dürfen, weiterhin die Gesellschaft der Mannschaften suchte.
»Einmal ein Bauer, immer ein Bauer«, hatte ein Offizier gespöttelt. Sharpe hatte es gehört und den Mann angesehen, und Knowles hatte erlebt, wie unter diesem frostigen, herausfordernden Blick dem anderen die Angst kam. Außerdem verbrachten Sharpe und Harper nicht etwa ihre Freizeit miteinander. Ihr Rangunterschied machte es unmöglich. Dennoch erkannte Knowles hinter aller Förmlichkeit die Freundschaft. Beide waren sie hochgewachsene Männer, der Ire noch dazu bärenstark, und beide vertrauten sie auf ihre Fähigkeiten.
Knowles konnte sich keinen von ihnen ohne Uniform vorstellen. Sie waren für ihr Gewerbe wie geschaffen, und ausgerechnet in der Schlacht, wenn die meisten Männer ängstlich auf ihr eigenes Überleben bedacht waren, herrschte dieses unheimlich anmutende Einverständnis zwischen Sharpe und Harper. Beinahe so, als seien sie auf dem Schlachtfeld zu Hause, dachte Knowles und beneidete sie.
Er blickte zum Himmel auf, zu den niedrigen Wolken, die zu beiden Seiten der Straße die Hügelkämme berührten. »Verfluchtes Wetter.«
»Bei uns daheim, Sir, würden wir’s einen schönen Tag nennen!« Harper grinste Knowles zu. Dabei tropfte ihm der Regen vom Tschako. Dann sah er sich nach der Kompanie um, die Sharpes eilig marschierender Gestalt folgte. Die Männer waren ein wenig aus dem Tritt, rutschten immer wieder aus. Da erhob Harper seine Stimme. »Auf, ihr Protestantenpack! Der Krieg wartet nicht auf euch!«
Er begleitete sein Gebrüll mit einem Grinsen, denn er war stolz, dass sie schneller vorankamen als das übrige Regiment, und froh darüber, dass das South Essex endlich nach Norden aufgebrochen war, wo die Schlachten des Sommers geschlagen werden sollten.
Patrick Harper hatte – wie alle anderen – die Gerüchte über die französische Streitmacht und ihren neuen Kommandanten gehört, aber er dachte nicht daran, sich wegen der Zukunft schlaflose Nächte zu machen, auch wenn das South Essex von der Zahl her jämmerlich unterlegen war.
Im März waren in Portsmouth Ersatzeinheiten in See gestochen, aber der Konvoi war in einen Sturm geraten, und Wochen später hieß es, an den Stränden der südlichen Biscaya seien Hunderte von Leichen angespült worden. Jedenfalls musste das Regiment nun mit weniger als der Hälfte seiner Sollstärke in den Kampf ziehen. Harper war es egal. Auch in Talavera war das Heer zahlenmäßig zwei zu eins unterlegen gewesen, und am heutigen Abend würde es in der Stadt Celorico, wo sich die Truppen sammelten, auf den Straßen Frauen geben und Wein in den Geschäften. Für einen Jungen aus Donegal konnte es im Leben weitaus schlimmer zugehen. Patrick Harper begann zu pfeifen.
Sharpe hörte das Pfeifen und widerstand dem Impuls, den Sergeant anzuschnauzen. Er erkannte diesen Impuls als Folgeerscheinung seiner Gereiztheit, konnte aber nicht umhin, sich darüber zu ärgern, dass Harper seine übliche Gelassenheit zur Schau stellte. Sharpe glaubte nicht, dass an den Gerüchten über die Niederlage etwas dran war, denn für einen Soldaten war solch eine Schlappe undenkbar. Die passierte nur dem Feind.
Andererseits verachtete Sharpe sich selbst, weil ihm die unbarmherzige Logik der Zahlen zusetzte. Das Debakel lag in der Luft, ob er es nun glaubte oder nicht. Er musste ständig daran denken und marschierte deshalb noch schneller, als sei die beschwerliche Gangart geeignet, jedweden Pessimismus auszulöschen.
Immerhin unternahmen sie endlich etwas. Seit Talavera hatte das Regiment an der öden Südgrenze zwischen Spanien und Portugal Patrouillendienst geleistet, und der Winter war lang und eintönig gewesen. Die Sonne war auf- und wieder untergegangen, das Regiment war zum Drill angetreten, sie hatten die menschenleeren Hügel beobachtet, und es hatte zu viel Muße gegeben, zu viel Weichlichkeit. Die Offiziere hatten die zurückgelassene Brustplatte eines französischen Kavalleristen gefunden und als Rasierschüssel benutzt, und Sharpe hatte zu seiner Empörung festgestellt, dass er den Luxus heißen Wassers in einer Schüssel als alltägliches Ereignis hinzunehmen begann!
Und dann die Hochzeiten. Zwanzig allein während der letzten drei Monate. So war es gekommen, dass meilenweit hinter ihnen die übrigen neun Kompanien des South Essex eine bunte Prozession aus Frauen und Kindern, Ehefrauen und Huren anführten, einem reisenden Rummelplatz ähnlich. Aber immerhin marschierten sie jetzt in diesem jahreszeitlich ungewöhnlich feuchten Sommer gen Norden, wo der französische Angriff erfolgen und alle Zweifel und Ängste im Kampf gebannt werden sollten.
Die Straße erreichte eine Anhöhe. Dahinter lag ein flaches Tal mit einem kleinen Dorf in der Mitte. In diesem Dorf befand sich Kavallerie, vermutlich genau wie das South Essex auf dem Weg nach Norden. Als Sharpe der vielen Pferde ansichtig wurde, ließ er seinen Ärger erkennen, indem er auf die Straße spuckte.
Diese verfluchte Kavallerie mit ihrem affektierten Gehabe, ihrer unverblümten Herablassung gegenüber der Infanterie. Dann sah er die Uniformen der abgesessenen Reiter und schämte sich seiner Reaktion. Die Männer trugen das Blau der Deutschen Legion des Königs, und Sharpe hatte Respekt vor den Deutschen. Sie waren Berufssoldaten, und Sharpe war ebenfalls in erster Linie Berufssoldat. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Er hatte kein Geld, um sich Beförderung zu erkaufen, und seine Zukunft hing einzig von seinem Können und seiner Erfahrung ab.
Erfahrung hatte er im Überfluss. Siebzehn seiner dreiunddreißig Jahre war er Soldat gewesen, erst als Private, dann als Sergeant. Dann war der Schwindel erregende Sprung in den Offiziersrang erfolgt. Und sämtliche Beförderungen hatte er sich auf dem Schlachtfeld verdient. Er hatte in Flandern gekämpft, in Indien und nun auf der Iberischen Halbinsel. Dabei war er sich darüber im Klaren, dass ihn das Heer, sobald Frieden einkehrte, wie eine glühend heiße Kartoffel fallen lassen würde. Nur in Kriegszeiten wurden Berufssoldaten wie er gebraucht, wie Harper, wie die zähen Deutschen, die in britischen Diensten gegen Frankreich kämpften.
Er ließ die Kompanie auf der Dorfstraße unter den neugierigen Blicken der Kavalleristen haltmachen. Einer von ihnen, ein Offizier, zog den Gurt mit dem Säbel hoch und kam auf Sharpe zu. »Captain?« Der Kavallerist ließ es wie eine Frage klingen, weil Sharpes einzige Rangabzeichen die verblasste scharlachrote Schärpe und sein Degen waren.
Sharpe nickte. »Captain Sharpe, South Essex.«
Der deutsche Offizier zog die Augenbrauen hoch, sein Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. »Captain Sharpe! Talavera!« Er schüttelte Sharpe ausgiebig die Hand, klopfte ihm auf die Schulter, wandte sich dann lautstark an seine Männer. Die blauberockten Kavalleristen grinsten und nickten Sharpe zu. Sie hatten alle von ihm gehört, von dem Mann, der in Talavera den französischen Adler erbeutet hatte.
Sharpe wies mit dem Kopf auf Patrick Harper und die Männer. »Vergessen Sie Sergeant Harper nicht und die Kompanie. Wir sind alle hier.«
Der Deutsche strahlte die Leichte Kompanie an. »Das habt ihr gut gemacht!« Er schlug vor Sharpe die Hacken zusammen und deutete eine Verbeugung an. »Lossow, Hauptmann Lossow zu Ihren Diensten. Sind Sie unterwegs nach Celorico?« Das Englisch des Deutschen war zwar nicht akzentfrei, aber gut. Seine Männer, wusste Sharpe, würden vermutlich nicht Englisch sprechen.
Sharpe nickte wieder. »Und Sie?«
Lossow schüttelte den Kopf. »Zum Coa-Fluss. Auf Patrouille. Der Feind kommt immer näher, deshalb wird es zu Kampfhandlungen kommen.« Das schien ihn zu freuen, und Sharpe beneidete die Kavallerie. Sämtliche Kämpfe fanden an den steilen Ufern des Coa statt, nicht in Celorico. Lossow lachte. »Diesmal bekommen wir den Adler, ja?«
Sharpe wünschte ihm Glück. Wenn überhaupt ein Kavallerieregiment ein französisches Bataillon aufreiben konnte, dann die Deutschen. Die britische Kavallerie war durchaus tapfer und gut beritten, aber sie hatte keine Disziplin. Die englischen Berittenen langweilten sich auf Patrouille oder im Wachdienst. Sie träumten nur von der Furcht einflößenden Attacke mit erhobenen Säbeln, die ihre Pferde außer Atem geraten ließ, bei der die Männer versprengt wurden und verwundbar. Sharpe waren wie allen Infanteristen des Heeres die Deutschen lieber, weil sie sich auskannten und ihre Sache gut machten.
Lossow nahm die guten Wünsche grinsend entgegen. Er hatte ein vierkantiges Gesicht mit einem angenehmen, freundlichen Lächeln, und seine Augen blickten schelmisch aus dem Netz feiner Linien hervor, mit denen die allzu lange Beobachtung vom Feind besetzter Horizonte sein Gesicht gezeichnet hatte. »Oh, noch eins, Captain. Die verdammten Profose sind hier im Dorf.« Die Bezeichnung ging Lossow schwer von der Zunge, als würde er sonst keinen Gebrauch von englischen Schimpfwörtern machen, außer um die Militärpolizei zu beschreiben, für die es in keiner anderen Sprache ein angemessenes Schimpfwort gab.
Sharpe dankte ihm und wandte sich an die Kompanie. »Ihr habt Hauptmann Lossow gehört! Die Profose sind hier. Also haltet eure diebischen Finger im Zaum. Verstanden?« Sie verstanden ihn. Niemand wollte auf der Stelle gehängt werden, nur weil er beim Plündern ertappt worden war. »Wir machen zehn Minuten Rast. Lass abtreten, Sergeant.«
Die Deutschen brachen auf, vermummt gegen den Regen, und Sharpe ging die einzige Straße entlang auf die Kirche zu. Das Dorf war armselig und verlassen. Die Türen der Hütten hingen leer in ihren Angeln. Die Bewohner waren nach Süden und Westen gezogen, wie die portugiesische Regierung angeordnet hatte. Wenn die Franzosen vorrückten, sollten sie kein Getreide, keine Tiere, sondern mit Steinen gefüllte oder durch tote Schafe vergiftete Brunnen vorfinden – ein Land voller Hunger und Durst.
Patrick Harper, der spürte, dass sich Sharpes Laune nach der Begegnung mit Lossow gebessert hatte, ging neben seinem Captain her. »Hier gibt’s nichts zu plündern, Sir.«
Sharpe warf einen Seitenblick auf die Männer, die nun gebückt in die Hütten traten. »Die finden bestimmt was.«
Die Profose hatten neben der Kirche haltgemacht. Sie waren zu dritt und saßen reglos auf ihren Rappen, wie Straßenräuber, die auf eine Kutsche mit fetter Beute warten. Ihre Ausrüstung war nagelneu, ihre Gesichter wirkten sonnengerötet. Sharpe vermutete, dass sie frisch aus England eingetroffen waren, allerdings war ihm ein Rätsel, warum die Horse Guards Militärpolizei anstelle kämpfender Truppen schickten. Er nickte höflich. »Guten Morgen.«
Einer der drei, dem ein Offiziersdegen aus dem Umhang ragte, nickte zurück. Wie alle Polizisten schien er angesichts einer freundlichen Geste misstrauisch zu werden. Er nahm die grüne Schützenuniform in Augenschein. »In dieser Gegend soll’s keine Schützen geben.«
Sharpe ließ diese Anschuldigung unbeantwortet. Wenn der Profos sie für Deserteure hielt, war der Profos ein Narr. Deserteure bewegten sich nicht bei Tageslicht auf öffentlichen Straßen, sie trugen keine Uniform und kamen nicht lässig auf Militärpolizisten zugeschlendert. Sharpe und Harper hatten wie die anderen achtzehn Schützen der Kompanie ihre alten Uniformen aus Stolz behalten, hatten das dunkle Grün dem Rot der Linienbataillone vorgezogen.
Der Profos ließ die Augen zwischen den beiden Männern hin- und herschweifen. »Sie haben Marschbefehl?«
»Der General verlangt nach uns, Sir«, entgegnete Harper fröhlich.
Ein winziges Lächeln huschte über das Gesicht des Profos und verschwand. »Sie meinen, Lord Wellington will Sie sehen?«
»In der Tat, ja.«
Sharpes Stimme hatte einen warnenden Unterton, aber der Profos schien es nicht zu bemerken. Er sah Sharpe von oben bis unten an und ließ sein Misstrauen durchblicken. Sharpes Erscheinung war ungewöhnlich. Er hatte seine verblasste, zerrissene grüne Jacke über eine französische Kavalleriemontur gezogen. An den Füßen trug er hohe Lederstiefel, die einst von einem Obersten der Kaiserlichen Garde Napoleons in Paris gekauft worden waren. Auf dem Rücken trug er wie die meisten seiner Männer einen französischen Tornister, und über seiner Schulter hing, obwohl er Offizier war, ein Gewehr. Von seinen Offiziersepauletten waren nur noch abgerissene Fäden übrig, und die scharlachrote Schärpe war fleckig und verblasst. Selbst Sharpes Degen, das andere Zeichen seines Rangs, entsprach nicht den Vorschriften. Als Offizier einer Leichten Kompanie hätte er den gebogenen Säbel der britischen Leichten Kavallerie tragen müssen, aber Richard Sharpe zog den geraden, unhandlichen Degen der Schweren Kavallerie vor. Die Kavalleristen hassten ihn, sie behaupteten, sein Gewicht mache schnelles Parieren unmöglich. Aber Sharpe war sechs Fuß groß und kräftig genug, die beinahe ein Yard lange, schwere Stahlklinge mit trügerischer Leichtigkeit zu handhaben.
Der Profos war beunruhigt. »Welchem Regiment gehören Sie an?«
»Wir sind die Leichte Kompanie des South Essex.« Sharpe achtete darauf, dass seine Stimme einen freundlichen Tonfall hatte.
Der Profos reagierte, indem er sein Pferd vorwärtstrieb, bis er die Straße überschauen und Sharpes Männer betrachten konnte. Er sah keinen augenblicklich zwingenden Grund, jemanden aufzuhängen, daher wandte er sich erneut den beiden Männern zu. Als seine Blicke Harpers Schultern erreichten, verharrten sie überrascht. Der Ire, der noch drei Zoll größer war als Sharpe, wirkte ohnehin einschüchternd genug, aber seine Waffen waren noch vorschriftswidriger als Sharpes mächtiger Degen. Außer seinem Gewehr hatte er sich ein Ungetüm von einer Schusswaffe umgehängt, ein plumpes Scheusal mit sieben Läufen. Der Profos hob den Zeigefinger. »Was ist das?«
»Ein Gewehr mit sieben Läufen, Sir.« Harper war anzuhören, wie stolz er auf seine neue Waffe war.
»Wo haben Sie sie her?«
»Ein Weihnachtsgeschenk, Sir.«
Sharpe grinste. Es handelte sich tatsächlich um ein Geschenk zur Weihnachtszeit von Sharpe an seinen Sergeant, aber es war nicht zu übersehen, dass der Profos mit seinen beiden schweigenden Gefährten das nicht glaubte. Er fuhr fort, das Gewehr anzustarren, eine von Henry Nocks weniger erfolgreichen Erfindungen.
Sharpe nahm an, dass der Profos so eines noch nie gesehen hatte. Nur wenige Hundert Exemplare waren für die Navy angefertigt worden, und seinerzeit hatte man die Idee für gut gehalten. Sieben Läufe von je zwanzig Zoll Länge wurden über ein einziges Steinschloss abgefeuert, und man ging davon aus, dass die Matrosen aus ihrer gefährlichen Kampfstellung hoch droben in den Wanten Verheerung anrichten würden, wenn sie die sieben Läufe auf die überfüllten feindlichen Decks abschossen. Nur eines hatte man übersehen: Sieben Halbzoll-Läufe, gemeinsam abgefeuert, ergaben einen fürchterlichen Schuss ähnlich dem einer kleinen Kanone, der nicht nur Verheerung anrichtete, sondern auch jedem, der den Hahn betätigte, das Schlüsselbein brach. Soweit Sharpe bekannt war, hatte nur Harper die brutale Kraft, die man benötigte, um das Gewehr zu bedienen. Und selbst der Ire war, als er es ausprobiert hatte, verblüfft über den heftigen Rückstoß gewesen, mit dem die sieben Kugeln aus den flammenden Mündungen schossen.
Der Profos schnüffelte. »Ein Weihnachtsgeschenk?«
»Von mir«, sagte Sharpe.
»Und Sie sind?«
»Captain Richard Sharpe, South Essex. Und Sie?«
Der Profos versteifte sich. »Lieutenant Ayres, Sir.« Das letzte Wort brachte er nur widerstrebend heraus.
»Und wohin sind Sie unterwegs, Lieutenant Ayres?«
Sharpe ärgerte sich über das Misstrauen des Mannes, über die sinnlose Zurschaustellung seiner Macht. Daher hatten seine Fragen einen gehässigen Beiklang. Sharpe konnte auf dem Rücken die Narben einer Auspeitschung vorweisen, die ein Offizier wie dieser veranlasst hatte: Captain Morris, ein arroganter Maulheld, mit seinem speichelleckerischen Vertrauten Sergeant Hakeswill. Sharpe trug nicht nur die Narben, sondern auch die Erinnerung daran mit sich herum – und den Schwur, dass er sich eines Tages an diesen beiden Männern rächen würde. Morris, wusste er, war in Dublin stationiert. Hakeswill hielt sich Gott weiß wo auf. Eines Tages, versprach sich Sharpe, würde er ihn finden. Fürs Erste jedoch hatte er es mit diesem jungen Schnösel zu tun, der mehr Befugnisse hatte als Verstand. »Wohin, Lieutenant?«
»Nach Celorico, Sir.«
»Dann gute Reise, Lieutenant.«
Ayres nickte. »Ich werde mich erst umsehen, Sir. Wenn Sie nichts dagegen haben.«
Sharpe sah zu, wie die drei Männer die Straße entlangritten. Von den breiten, schwarzen Leibern ihrer Pferde perlte der Regen. »Hoffentlich hast du recht, Sergeant.«
»Recht, Sir?«
»Dass es nichts zu plündern gibt.«
Der Gedanke kam beiden gleichzeitig, ausgelöst durch ihr Gespür für Schwierigkeiten, und sie rannten los. Sharpe holte die Pfeife aus der kleinen Tasche an seinem Patronengurt und blies darauf die lang gezogenen Töne, die normalerweise für das Schlachtfeld reserviert waren, wenn die Leichte Kompanie in gelockerter Angriffsformation ausgeschwärmt war und die Sergeants die Männer zurückpfeifen mussten, damit sie sich sammelten und im Schutz des Bataillons neu formierten. Die Profose hörten die Pfiffe, spornten ihre Pferde an und bogen zwischen zwei niedrigen Hütten ein, um die Höfe abzusuchen, während Sharpes Männer vorn aus den Türen stürzten und murrend in Reihen antraten.
Harper blieb vor der Kompanie stehen. »Tornister auf!«
Hinter den Hütten erklang ein Schrei. Sharpe drehte sich um. Lieutenant Knowles war dicht neben ihm aufgetaucht.
»Was ist los, Sir?«
»Wir haben Schwierigkeiten mit der Militärpolizei. Die Schweinehunde spielen sich auf.«
Sie waren entschlossen, etwas zu finden, das war ihm klar, und als Sharpes Augen nun über seine Untergebenen schweiften, stellte sich das beklemmende Gefühl ein, dass Lieutenant Ayres Erfolg gehabt hatte. Es hätten achtundvierzig Soldaten sein müssen, drei Sergeants und die beiden Offiziere, aber ein Mann fehlte: Private Batten. Der verfluchte Schütze Batten, der nun von einem triumphierenden Profos an den Haaren zwischen den Hütten hervorgezerrt wurde.
»Ein Plünderer, Sir. Auf frischer Tat ertappt.« Ayres lächelte.
Batten, der ununterbrochen nörgelte, der stöhnte, wenn es regnete, und sich empörte, wenn es zu regnen aufhörte, weil ihm die Sonne in die Augen schien. Schütze Batten, der eigenhändig jedes Steinschloss zerbrach, der überzeugt war, die ganze Welt habe sich verschworen, ihn zu erzürnen, und der nun, gepackt von einem von Ayres’ Männern, erschrocken dastand. Wenn es in seiner Kompanie einen Mann gab, den Sharpe gern aufgehängt hätte, dann Batten, aber er konnte verdammt gut darauf verzichten, sich diese Aufgabe von einem Profos abnehmen zu lassen.
Sharpe blickte zu Ayres auf. »Was hat er geplündert, Lieutenant?«
»Das hier.«
Ayres hob ein mageres Huhn in die Höhe, als sei es die Krone Englands. Jemand hatte ihm den Hals umgedreht, aber die Beine zuckten und zappelten noch in der Luft. Sharpe spürte Wut in sich aufsteigen, nicht auf die Profose, sondern auf Batten.
»Ich werde mich seiner annehmen, Lieutenant.«
Batten wich vor seinem Captain zurück.
Ayres schüttelte den Kopf. »Sie missverstehen die Lage, Sir.« Er sprach mit sanfter Herablassung. »Plünderer werden gehängt, Sir. Auf der Stelle, Sir. Als warnendes Beispiel für andere.«
In der Kompanie kam Raunen auf, das erst verstummte, als Harper lauthals Ruhe befahl. Battens Augen huschten umher, als suche er nach einem Weg, diesem jüngsten Beweis für die Ungerechtigkeit der Welt zu entgehen. Sharpe schnauzte ihn an. »Batten!«
»Sir?«
»Wo hast du das Huhn gefunden?«
»Auf dem Feld, Sir. Ehrlich.« Er schnitt eine Grimasse, als er fester an den Haaren gezogen wurde. »Das war ein wildes Huhn, Sir.«
Aus den Reihen der Männer stieg Gelächter auf. Harper ließ es durchgehen. Ayres schnaubte. »Ein wildes Huhn. Gefährliche Biester, wie, Sir? Er lügt. Ich habe ihn in der Hütte vorgefunden.«
Sharpe glaubte ihm, war jedoch nicht bereit, schon aufzugeben. »Wer lebt in der Hütte, Lieutenant?«
Ayres zog die Brauen hoch. »Also, wirklich, Sir, ich habe mich nicht mit jedem Elendsviertel Portugals bekannt gemacht.« Er wandte sich an seine Männer. »Knüpft ihn auf.«
»Lieutenant Ayres.« Der Tonfall Sharpes sorgte dafür, dass auf der Straße jede Bewegung aufhörte. »Woher wissen Sie, dass die Hütte bewohnt ist?«
»Überzeugen Sie sich doch selbst.«
»Sir.«
Ayres schluckte. »Sir.«
Sharpe hob die Stimme. »Halten sich dort Leute auf, Lieutenant?«
»Nein, Sir. Aber sie ist bewohnt.«
»Woher wollen Sie das wissen? Das Dorf ist menschenleer. Hier gibt es niemanden, dem man ein Huhn stehlen könnte.«
Ayres legte sich seine Antwort zurecht. Das Dorf war tatsächlich verlassen, seine Bewohner hatten sich vor den angreifenden Franzosen in Sicherheit gebracht, aber Abwesenheit bedeutete noch keinen Verzicht auf Eigentümerschaft. Er schüttelte den Kopf. »Das Huhn ist portugiesisches Besitztum, Sir.« Wieder wandte er sich ab. »Hängt ihn auf!«
»Halt!«, brüllte Sharpe, und wieder hörte alle Bewegung auf. »Sie werden ihn nicht hängen, also gehen Sie nur ruhig Ihrer Wege.«
Ayres wirbelte zu Sharpe herum. »Er wurde auf frischer Tat ertappt, und deshalb soll der Bastard hängen. Ihre Männer sind wahrscheinlich eine Horde verdammter Diebe. Deshalb brauchen sie ein Exempel, und weiß Gott, sie werden es bekommen!« Er erhob sich in den Steigbügeln und brüllte die Kompanie an. »Ihr werdet ihn hängen sehen! Und wenn ihr stehlt, werdet ihr auch gehängt!«
Ein Klicken unterbrach ihn. Er senkte den Blick, und die Wut in seinem Gesicht machte Erstaunen Platz. Sharpe hielt sein Baker-Gewehr in der Hand, mit gespanntem Hahn, und die Mündung zeigte auf Ayres.
»Lassen Sie ihn frei, Lieutenant.«
»Sind Sie verrückt geworden?«
Ayres war erblasst und im Sattel zusammengesunken. Sergeant Harper trat spontan vor und stellte sich neben Sharpe. Er ignorierte die Hand, die ihn beiseitewinkte. Ayres starrte die Männer vor sich an, beide hochgewachsen, beide mit den harten Gesichtern von Kämpfern. Dann regte sich bei ihm die Erinnerung. Er blickte Sharpe an, dieses Gesicht, das dauernd einen spöttischen Ausdruck zu tragen schien, hervorgerufen durch die Narbe, die quer über seine rechte Wange verlief. Und plötzlich erinnerte er sich. Wilde Hühner, Vogelfänger! Die Leichte Kompanie des South Essex. Waren dies die beiden Männer, die den Adler erbeutet hatten? Die um sich schlagend in ein französisches Regiment eingedrungen und mit der Standarte wieder herausgekommen waren? Er wollte es gern glauben.
Sharpe merkte, wie die Augen des Lieutenants unstet wurden, und wusste, dass er gesiegt hatte, aber dieser Sieg würde ihn teuer zu stehen kommen. Das Heer war nicht erbaut über Männer, die ihre Gewehre auf Profose richteten, auch nicht, wenn sie ungeladen waren.
Ayres versetzte Batten einen Stoß. »Da haben Sie Ihren Dieb, Captain. Wir aber sprechen uns noch.«
Sharpe senkte das Gewehr. Ayres wartete, bis Batten den Pferden nicht mehr im Weg stand, dann riss er die Zügel herum und ritt seinen Männern voraus in Richtung Celorico. »Sie werden von mir hören!«, rief er zurück.
Sharpe spürte, wie die Probleme ähnlich einer brodelnden schwarzen Wolke am Horizont heraufzogen. Er drehte sich nach Batten um. »Hast du die verdammte Henne gestohlen?«
»Jawohl, Sir.« Batten wies mit schlaffer Hand auf den davonreitenden Profos. »Er hat sie mitgenommen, Sir.« Wie er es sagte, klang das wie eine Ungerechtigkeit.
»Ich wünschte, verdammt noch mal, er hätte dich mitgenommen. Ich wünschte, er hätte deine verdammten Eingeweide über das ganze verdammte Gelände verteilt.« Batten wich vor Sharpes Zorn zurück. »Wie lauten die verdammten Regeln, Batten?«
Batten blinzelte Sharpe an. »Regeln, Sir?«
»Du kennst die verdammten Regeln. Sage sie auf.«
Das Heer gab dicke Bände mit Vorschriften heraus, aber Sharpe hatte seinen Männern drei Regeln eingeschärft. Sie waren einfach, sie funktionierten, und die Männer wussten, dass sie mit Bestrafung zu rechnen hatten, wenn sie dagegen verstießen. Batten räusperte sich.
»Wir sollen gut kämpfen, Sir. Uns nicht unerlaubt besaufen, Sir. Und …«
»Weiter.«
»Wir sollen nicht stehlen, Sir, es sei denn vom Feind oder wenn wir sonst verhungern, Sir.«
»Warst du dabei, zu verhungern?«
Batten war anzusehen, dass er gern ja gesagt hätte, aber jeder Mann hatte noch zwei Tagesrationen in seinem Proviantbeutel. »Nein, Sir.«
Sharpe schlug ihn, ließ all seine Enttäuschung in die Faust einfließen, die Battens Brust traf, ihm den Atem raubte und ihn keuchend auf der nassen Straße zu Boden gehen ließ. »Du bist ein verdammter Narr, Batten, ein jämmerlicher, elender, schleimiger Hurensohn von einem Narren.« Er wandte sich ab von dem Mann, dessen Muskete im Schlamm gelandet war. »Kompanie! Marsch!«
Sie marschierten hinter dem hochgewachsenen Schützen her, während Batten sich aufrappelte, ohne viel Erfolg das Wasser abzuwischen versuchte, das ins Schloss seines Gewehrs gelaufen war, und dann der Kompanie hinterherlief. Er drängte sich in Reih und Glied und wandte sich murrend an seine schweigenden Gefährten. »Der darf mich doch nicht einfach schlagen!«
»Halt den Mund, Batten!« Harpers Stimme war so unwirsch wie die seines Captains. »Du kennst die Regeln. Wär es dir lieber, jetzt hilflos am Strang zu zappeln?«
Der Sergeant brüllte die Kompanie an, sie sollten die Beine in die Hand nehmen, sagte ihnen jeden Schritt an und fragte sich dabei die ganze Zeit, welches Schicksal Sharpe nun wohl bevorstand. Eine Beschwerde dieses verdammten Profos würde ein Verhör nach sich ziehen, wenn nicht gar ein Verfahren vor dem Militärgericht. Und das nur wegen dieses erbärmlichen Batten, wegen eines gescheiterten Pferdehändlers, den Harper am liebsten persönlich umgebracht hätte. Lieutenant Knowles schien auf denselben Gedanken gekommen zu sein. Er ging neben dem Iren her und blickte ihn mit besorgtem Gesicht an. »Alles nur wegen eines Huhns, Sergeant?«
Harper blickte auf den jungen Lieutenant hinab. »Das möcht ich bezweifeln, Sir.« Er wandte sich an die Soldaten. »Daniel!«
Hagman, einer der ehemaligen Rifles, brach aus der Reihe aus und gesellte sich zu dem Sergeant. Er war der Älteste der Kompanie, schon über vierzig, aber er war der beste Schütze. Hagman stammte aus der Grafschaft Cheshire und war als Wilderer groß geworden. Er konnte einem französischen General auf dreihundert Yards Entfernung die Knöpfe vom Mantel schießen. »Sergeant?«
»Wie viele Hühner waren es insgesamt?«
Hagman grinste zahnlos, warf einen verstohlenen Blick auf die Kompanie, sah dann zu Harper auf. Der Sergeant war ein gerechter Mann, der nie mehr als seinen gebührenden Anteil verlangte. »Ein Dutzend, Sergeant.«
Harper blickte Knowles vielsagend an. »Da haben Sie’s, Sir. Dort gab’s mindestens sechzehn wilde Hühner. Vermutlich zwanzig. Gott weiß, was sie dort zu suchen hatten, warum ihre Besitzer sie nicht mitgenommen haben.«
»Schwer zu fangen, Sir, diese Hühner.« Hagman kicherte. »War’s das, Sergeant?«
Harper grinste auf den Schützen hinab. »Ein Bein für jeden Offizier, Daniel. Und keins von den zähen.«
Hagman sah Knowles von der Seite an. »Sehr wohl, Sir. Jedem ein Bein.« Er reihte sich wieder ein.
Knowles schmunzelte. Ein Bein für jeden Offizier, das hieß ein gutes Bruststück für den Sergeant, Hühnerbrühe für alle und nichts für den Schützen Batten. Und für Sharpe? Knowles merkte, wie ihm der Mut verging. Der Krieg war verloren, es regnete immer noch, und morgen würde Captain Richard Sharpe tief in Schwierigkeiten mit der Militärpolizei stecken, bis hinauf an den von Säbelhieben vernarbten Hals.
KAPITEL 2
Wenn überhaupt ein Symbol für die drohende Niederlage gebraucht wurde, bot sich die Kirche Sao Paolo in Celorico, das vorübergehende Hauptquartier des South Essex, dafür geradezu an. Sharpe stand auf der Empore und sah dem Priester zu, wie er einen prächtigen Lettner übertünchte. Die Chorschranke war aus massivem Silber, uralt und fein gearbeitet, das Geschenk eines längst vergessenen Gemeindemitglieds. Nur die Gesichter seiner Familie waren in denen der trauernden Frauen und Jünger verewigt, die zum Kruzifix aufblickten. Der Priester stand auf einem Gerüst und ließ dicke Kalkfarbe auf seine Soutane tropfen. Er sah erst Sharpe, dann den Lettner an und zuckte mit den Schultern.
»Beim letzten Mal hat die Reinigung drei Monate gedauert.«
»Beim letzten Mal?«
»Als die Franzosen abgezogen waren.« Der Priester wirkte erbittert und ließ seinen Pinsel wütend über die feine Filigranarbeit fahren. »Wenn die wüssten, dass es sich um Silber handelt, würden sie es stückweise heraushauen und mitnehmen.« Er verpasste der angenagelten, zusammengesunkenen Christusfigur eine Portion Farbe, dann nahm er wie zur Entschuldigung den Pinsel in die linke Hand, um mit der Rechten ein provisorisches Kreuzzeichen über seinem befleckten Gewand zu machen.
»Vielleicht kommen sie diesmal nicht so weit.«
Das klang wenig überzeugend, selbst in Sharpes eigenen Ohren, und der Priester machte sich nicht die Mühe, ihm zu antworten. Er lachte nur freudlos und tauchte den Pinsel in seinen Farbeimer. Sie wissen Bescheid, dachte Sharpe, sie wissen alle, dass die Franzosen im Anmarsch sind und die Briten auf dem Rückzug. Der Priester flößte ihm Schuldgefühle ein, als würde er persönlich die Stadt und ihre Bewohner verraten. Er stieg hinab ins Dunkel der Kirche, wo in der Nähe des Hauptportals der Kommissionär des Bataillons die Aufschichtung frisch gebackenen Brots für die Abendration überwachte.
Das Portal wurde geöffnet. Spätnachmittägliches Sonnenlicht drang herein, und Lawford, in seine beste Galauniform gekleidet, winkte Sharpe zu. »Fertig?«
»Jawohl, Sir.«
Draußen wartete Major Forrest und lächelte Sharpe nervös zu. »Keine Sorge, Richard.«
»Sorge?« Der ehrenwerte Lieutenant Colonel William Lawford war erbost. »Er hat allen Grund, sich Sorgen zu machen.« Er musterte Sharpe von oben bis unten. »Ist das Ihr bester Aufzug?«
Sharpe befühlte den Riss in seinem Ärmel. »Sonst habe ich nichts, Sir.«
»Nichts? Und was ist mit der neuen Uniform? Guter Gott, Richard, Sie sehen wie ein Landstreicher aus.«
»Die Uniform ist in Lissabon, Sir. Eingemottet. Leichte Kompanien sollen nur leichtes Gepäck dabeihaben.«
Lawford schnaubte. »Und Profose mit Gewehren bedrohen sollen sie auch nicht. Los jetzt, wir wollen nicht zu spät kommen.« Er setzte sich den Dreispitz auf und erwiderte den Salut der beiden Wachtposten, die amüsiert seinem Ausbruch gelauscht hatten.
Sharpe hob die Hand. »Einen Augenblick, Sir.« Er fegte ein imaginäres Staubkorn von dem goldenen Regimentsabzeichen, das der Lieutenant Colonel an seiner weißen Schärpe befestigt hatte. Das Abzeichen war neu, von Lawford im Anschluss an Talavera in Auftrag gegeben. Es zeigte einen Adler in Ketten – teilte der ganzen Welt mit, dass das South Essex das einzige Regiment auf der Iberischen Halbinsel war, das eine französische Standarte erobert hatte. Sharpe trat zufrieden einen Schritt zurück. »So ist es besser, Sir.«
Lawford verstand den Hinweis und lächelte. »Sie sind ein Hundesohn, Sharpe. Bloß weil Sie einen Adler erobert haben, können Sie sich noch längst nicht alles erlauben.«
»Während ein Idiot, bloß weil er sich als Profos aufgeputzt hat, sich alles erlauben darf?«
»Ja«, entgegnete Lawford. »Das darf er. Kommen Sie.«
Seltsam, dachte Sharpe, dass er Lawford, obwohl dieser alles in sich vereinte, was ihm in Bezug auf Privilegien und Reichtum missfiel, dennoch gern hatte und zufrieden war, ihm zu gehorchen. Sie waren gleichaltrig, dreiunddreißig, aber Lawford war immer Offizier gewesen, hatte sich nie Sorgen um seine Beförderung gemacht, weil er sich den jeweils nächsten Rang ohne Schwierigkeiten leisten konnte, und sich nie darum gekümmert, wo im nächsten Jahr das Geld herkommen würde. Vor sieben Jahren war Lawford Lieutenant gewesen und Richard Sharpe sein Sergeant. Sie hatten gemeinsam in Indien gegen die Marathen gekämpft, und der Sergeant hatte den Offizier im Verlies des Tippu Sultan am Leben erhalten. Als Gegenleistung hatte Lawford dem Sergeant Lesen und Schreiben beigebracht und ihn dadurch für den Offiziersrang qualifiziert, sollte er je so töricht sein, eine Heldentat auf dem Schlachtfeld zu begehen, die geeignet war, einen Mann aus den Mannschaften in die erlauchte Gesellschaft der Offiziere zu erheben.
Sharpe folgte Lawford durch die überfüllten Straßen zu Wellingtons Hauptquartier und überlegte, während er die herrliche Uniform des Lieutenant Colonels betrachtete und seine teure Ausrüstung, wo sie wohl nach weiteren sieben Jahren sein würden. Lawford war ehrgeizig, genau wie Sharpe, aber der Lieutenant Colonel hatte die Abstammung und das Geld, um es weit zu bringen. Er wird General sein, dachte Sharpe und grinste, denn er wusste, dass Lawford auch dann noch ihn oder jemanden wie ihn brauchen würde. Sharpe war Lawfords Auge und Ohr, sein professioneller Soldat, der Mann, der das Mienenspiel jener gescheiterten Kriminellen, Trunkenbolde und Verzweifelten zu deuten wusste, aus denen seither die beste Infanterie der Welt geworden war.
Mehr als das, Sharpe konnte jede Spur am Boden deuten, er konnte die Absichten des Feindes erahnen, und Lawford, für den das Militär nur ein Mittel zum glorreichen und erhabenen Zweck war, verließ sich auf die Instinkte und die Begabung seines ehemaligen Sergeants.
Lawford, entschied Sharpe, hatte im vergangenen Jahr gute Arbeit geleistet. Er hatte ein verbittertes, verrohtes, verängstigtes Regiment übernommen und eine Kampfeinheit daraus gemacht, die es mit jedem anderen Frontbataillon aufnehmen konnte. Sharpes Adler hatte dazu beigetragen. Er hatte die Schande von Valdelacasa ausgelöscht, wo das South Essex unter Sir Henry Simmerson eine Regimentsfahne und seinen Stolz eingebüßt hatte. Aber an dem Adler lag es nicht allein; Lawford, der das Gespür eines Politikers besaß, hatte den Männern vertraut und zugleich hart mit ihnen gearbeitet. Er hatte ihnen frisches Selbstvertrauen gegeben. Und das Abzeichen, das jeder Mann an seinem Tschako trug, ließ alle Soldaten des Regiments am Ruhm von Talavera teilhaben.
Lawford führte sie durch das Gedränge aus Offizieren und Stadtbewohnern. Major Forrest blickte Sharpe immer wieder von der Seite an und lächelte dabei so gütig, dass er mehr denn je wie ein freundlicher Landpfarrer aussah, der sich für die dörflichen Festspiele als Soldat verkleidet hat. Er versuchte, Sharpe Mut zuzusprechen. »Zum Kriegsgerichtsverfahren wird es nicht kommen, Richard, auf keinen Fall! Wahrscheinlich werden Sie sich entschuldigen müssen oder etwas Ähnliches, und dann wird Gras über die Sache wachsen.«
Sharpe schüttelte den Kopf. »Ich denke nicht daran, mich zu entschuldigen, Sir.«
Lawford blieb stehen, drehte sich um und stieß Sharpe mit dem Finger vor die Brust. »Wenn man Ihnen befiehlt, Richard Sharpe, sich zu entschuldigen, werden Sie sich, verdammt noch mal, entschuldigen. Sie werden zu Kreuze kriechen, liebedienern, katzbuckeln oder scharwenzeln, wie man es Ihnen befiehlt. Haben Sie verstanden?«
Sharpe schlug die Hacken seiner hohen französischen Stiefel zusammen. »Sir!«
Lawford explodierte, aufgebracht wie nur selten. »Allmächtiger, Richard, haben Sie denn, verdammt noch mal, nichts begriffen? Dies ist ein Vergehen, das allemal vors Kriegsgericht gehört. Ayres hat dem Profoskommandeur etwas vorgeheult, und der Kommandeur hat dem General etwas vorgeheult, die Autorität der Militärpolizei dürfe nicht untergraben werden. Und der General, Mister Sharpe, bringt für diesen Standpunkt einige Sympathie auf.« Lawfords leidenschaftliche Rede hatte eine kleine Schar interessierter Beobachter angezogen. Seine Wut verrauchte so schnell, wie sie ausgebrochen war, aber er fuhr fort, seinen Finger in Sharpes Brust zu bohren. »Der General will mehr Profose haben, nicht weniger, und er ist verständlicherweise nicht glücklich bei dem Gedanken, dass Captain Richard Sharpe sie zum Abschuss freigegeben hat.«
»Jawohl, Sir.«
Lawford ließ sich nicht von Sharpes zerknirschter Miene besänftigen, die nach Ansicht des Lieutenant Colonels nicht durch wahre Reue motiviert sein konnte. »Und glauben Sie nicht, Captain Sharpe, dass der General, nur weil er uns hierher beordert hat, Ihr Verhalten wohlwollend beurteilen wird. Er hat Ihnen in der Vergangenheit oft genug die erbärmliche Haut gerettet, und es kann sein, dass er nicht willens ist, es noch einmal zu tun. Verstanden?«
Eine Gruppe von Kavallerieoffizieren, die vor einer Weinhandlung standen, spendete Beifall. Lawford warf ihnen einen missbilligenden Blick zu, aber als er seinen Weg fortsetzte, ahmte hinter ihm jemand das Hornsignal für Angriff auf ganzer Front nach.
Sharpe folgte ihm. Lawford mochte recht haben. Der General hatte das South Essex herbefohlen, warum, wusste keiner. Sharpe hatte gehofft, dass sie irgendwelche Spezialaufgaben erhalten würden, etwas, das jegliche Erinnerung an die Langeweile des Winters vertrieb. Aber der Vorfall mit Lieutenant Ayres konnte für Sharpe alles ändern, konnte ihm ein Kriegsgerichtsverfahren einbringen und eine Zukunft, die weitaus trister war als der Patrouillendienst an einer menschenleeren Grenze.
Vor Wellingtons Hauptquartier standen vier Ochsenkarren, noch ein Hinweis auf den baldigen Aufbruch des Heeres, aber ansonsten war alles still. Das einzige ungewöhnliche Objekt war ein hoher Mast, der vom Dach des Hauses aufragte. An seiner Spitze befand sich ein Querbalken, von dem vier geteerte Schafsblasen herabhingen.
Sharpe starrte neugierig hinauf. Es war das erste Mal, dass er den neuen Telegrafen zu sehen bekam, und er wünschte sich, ihn in Aktion zu erleben, wenn die schwarzen, mit Luft gefüllten Blasen an ihren Seilen angehoben oder gesenkt wurden und auf dem Weg über andere, ähnliche Stationen Nachrichten in die entlegene Festung von Almeida und an die Truppen gesandt wurden, die das Ufer des Coa schützten.
Das System war von der Royal Navy übernommen worden, und man hatte Matrosen dazu abgestellt, den Telegrafen zu bedienen. Jedem Buchstaben des Alphabets war eine bestimmte Anordnung der vier schwarzen Säcke zugewiesen, und häufige Wörter wie »Regiment«, »Feind« und »General« wurden auf eine einzige Kombination abgekürzt, die durch ein riesiges Marinefernrohr meilenweit entfernt zu sehen war.
Sharpe hatte gehört, dass eine Botschaft in weniger als zehn Minuten zwanzig Meilen zurücklegen konnte, und als sie sich nun den beiden gelangweilten Posten näherten, die das Hauptquartier des Generals bewachten, fragte er sich, welche anderen modernen Gerätschaften die Notwendigkeit dieses langen Krieges gegen Napoleon wohl noch hervorbringen würde.
Er vergaß den Telegrafen, sobald sie den kühlen Empfangsraum des Hauses betraten, und empfand stattdessen einen Anflug von Angst vor dem anstehenden Verhör. Es war schon merkwürdig, auf welche Weise seine Soldatenlaufbahn mit Wellington verbunden war. Sie hatten in Flandern, in Indien und nun auf der Iberischen Halbinsel auf denselben Schlachtfeldern gekämpft, und in seinem Tornister führte Sharpe ein Fernrohr mit, das ein Geschenk des Generals gewesen war. In das Nussbaumrohr war eine kleine gebogene Messingplakette eingelassen, und auf ihr stand In Dankbarkeit, AW. 23. September 1803. Sir Arthur Wellesley war überzeugt, dass Sergeant Sharpe ihm das Leben gerettet hatte, obwohl Sharpe sich, ehrlich gestanden, kaum an das Ereignis erinnern konnte, außer dass das Pferd des Generals aufgespießt worden war und die indischen Bajonette und Krummsäbel immer näher gerückt waren. Und was hatte ein Sergeant zu tun, wenn nicht, sich dazwischenzuwerfen und den Kampf aufzunehmen?
Das war in der Schlacht von Assaye gewesen, einem verdammten Gemetzel. Sharpe hatte dort mit angesehen, wie seine Offiziere unter den Salven der reich verzierten Gewehre starben. Da war in ihm der Kampfgeist entbrannt. Er hatte die Überlebenden weitergeführt, und der Feind war besiegt worden. Nur knapp, bei Gott, aber ein Sieg war nun einmal ein Sieg. Anschließend hatte man ihn zum Offizier gemacht, gestriegelt wie ein Prachtbulle, und der Mann, der ihn damals belobigt hatte, musste nun über sein Schicksal entscheiden.
»Seine Lordschaft wird Sie jetzt empfangen.« Ein verbindlicher junger Major lächelte ihnen von der Tür her zu, als seien sie zum Tee eingeladen.
Es war ein Jahr her, seit Sharpe Wellington zum letzten Mal gesehen hatte, aber nichts hatte sich verändert: immer noch der gleiche mit Papieren bedeckte Tisch, über der Adlernase dieselben blauen Augen, die nichts verrieten, derselbe sympathische Mund, der sich nun ein Lächeln abrang.
Sharpe war froh, dass sich keine Profose im Raum aufhielten, sodass er wenigstens nicht in Gegenwart des Generals zu Kreuze kriechen musste. Dessen ungeachtet fürchtete er den Zorn des sonst so ruhigen Mannes und beobachtete gespannt, wie dieser die Feder aus der Hand legte und mit ausdruckslosen Augen zu ihm aufblickte. Es war, als würde Wellington ihn nicht wiedererkennen.
»Haben Sie Lieutenant Ayres mit einem Gewehr bedroht, Captain Sharpe?« Das Wort »Captain« sprach er mit leichter Betonung aus.
»Jawohl, Sir.«
Wellington nickte. Er wirkte müde. Er stand auf und trat ans Fenster, spähte hinaus, als warte er auf etwas. Im Raum herrschte Schweigen, nur unterbrochen von Kettengeklirr und dem Gerumpel von Rädern, als eine Artillerieeinheit auf der Straße vorbeifuhr. Sharpe fiel auf, dass der General nervös war. Wellington drehte sich wieder zu ihm um.
»Ist Ihnen klar, Captain Sharpe, was für einen Schaden unsere Sache erleidet, wenn unsere Soldaten Diebstähle oder Vergewaltigungen begehen?« Seine Stimme klang vernichtend ruhig.
»Jawohl, Sir.«
»Das hoffe ich, Captain Sharpe, das hoffe ich.« Er nahm wieder Platz. »Unsere Feinde werden zum Stehlen angehalten, weil sie anders nicht ernährt werden können. Deshalb werden sie gehasst, wohin sie sich auch wenden. Ich gebe Geld aus – Gott weiß, wie viel Geld – für Lieferung und Transport und den Einkauf von Nahrungsmitteln von der Bevölkerung, damit unsere Soldaten nicht zu stehlen brauchen. Wir tun dies, damit sie von den Einwohnern willkommen geheißen und unterstützt werden. Verstehen Sie das?«
Sharpe wünschte sich, die Strafpredigt wäre vorbei. »Jawohl, Sir.«
Über ihren Köpfen war plötzlich ein seltsames Geräusch zu hören, ein Schleifen und Rasseln, und Wellington richtete den Blick an die Zimmerdecke, als wüsste er dieses Geräusch zu deuten. Sharpe kam der Gedanke, dass sich der Telegraf in Gang gesetzt haben musste, dass die luftgefüllten Blasen an den Seilen hinauf- und herabgezogen wurden und eine verschlüsselte Botschaft jener Truppenteile brachten, die den Franzosen gegenüberstanden. Der General hörte einige Sekunden lang zu, dann senkte er den Kopf und sah Sharpe an. »Ihre Beförderung ist noch nicht bestätigt worden.«
Es gab nicht viel, was der General hätte sagen können, um Sharpe zu beunruhigen. Offiziell war er nach wie vor Lieutenant, nur ein Lieutenant, der vor einem Jahr von Wellington in den Rang eines Captains erhoben worden war. Wenn die Horse Guards in Whitehall dagegen waren, und er wusste, dass sie derart unvorschriftsmäßige Beförderungen in der Regel verweigerten, würde er bald wieder Lieutenant sein. Er sagte nichts, während Wellington ihn beobachtete. Wenn dies ein Warnschuss sein sollte, gedachte er ihn schweigend hinzunehmen.
Der General seufzte, hob ein Blatt Papier auf, legte es wieder hin. »Der Soldat wurde bestraft?«
»Jawohl, Sir.« Er dachte an Batten, wie dieser atemlos auf dem Boden gelegen hatte.
»Dann sorgen Sie bitte dafür, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Nicht einmal, Captain Sharpe, wenn es um wilde Hühner geht.«
Mein Gott, dachte Sharpe, der weiß alles, was in diesem Heer vorgeht. Schweigen breitete sich aus. War es schon vorbei? Kein Kriegsgericht? Keine Entschuldigung? Er hüstelte, und Wellington blickte auf.
»Ja?«
»Ich hatte mehr erwartet, Sir. Kriegs- oder Standgericht.«
Sharpe hörte, wie Lawford verlegen von einem Bein aufs andere trat, aber den General schien es nicht zu stören. Er stand auf und ließ sein seltenes schmales Lächeln sehen.
»Ich würde Sie, Captain Sharpe, und diesen verdammten Sergeant liebend gern aufknüpfen. Aber ich fürchte, wir werden Sie noch brauchen. Wie, glauben Sie, stehen in diesem Sommer unsere Chancen?«
Erneut breitete sich Schweigen aus. Der Themenwechsel hatte sie allesamt überrascht. Lawford räusperte sich. »Es herrscht einige Besorgnis, Mylord, bezüglich der Absichten des Feindes und darüber, wie wir reagieren sollen.«
Wieder ein frostiges Lächeln. »Der Feind hat die Absicht, uns aufs Meer abzudrängen, und zwar bald. Wie sollen wir reagieren?« Wellington, erkannte Sharpe, wollte Zeit gewinnen. Er wartete auf etwas beziehungsweise auf jemanden.
Lawford war unbehaglich zumute. Diese Frage hätte er sich lieber vom General beantworten lassen. »Wir stellen ihn im Kampf, Sir?«
»Dreißigtausend Soldaten, dazu fünfundzwanzigtausend unerprobte Portugiesen, gegen dreihundertfünfzigtausend Mann?«
Wellington ließ die Zahlen in der Luft hängen wie den Staub, der im schräg einflutenden Sonnenlicht über seinem Tisch waberte. Über ihnen war nach wie vor das Scharren der Füße jener Männer zu hören, die den Telegrafen bedienten. Die Zahlen, wusste Sharpe, waren übertrieben. Masséna brauchte allein Tausende dieser Männer, um die Guerilleros in Schach zu halten. Dennoch war der zahlenmäßige Unterschied beängstigend. Wellington schnüffelte. Es klopfte an der Tür.
»Herein.«
»Sir.«
Der Major, der sie in den Raum geführt hatte, überreichte dem General einen Zettel. Der las ihn, schloss einen Moment lang die Augen und seufzte.
»Der Rest der Nachricht kommt noch?«
»Jawohl, Sir. Aber das Wesentliche ist da.«
Der Major ging, und Wellington lehnte sich in seinem Sessel zurück. Die Nachricht war schlecht, das sah Sharpe ihm an, aber wohl nicht unerwartet. Er erinnerte sich, dass Wellington einst gesagt hatte, die Durchführung eines Feldzugs sei so ähnlich, als wolle man ein Pferdegespann mithilfe eines Seilgeschirrs lenken. Die Seile würden immer wieder reißen, und ein General könne nichts anderes tun, als die Enden zu verknoten und weiterzumachen. So ein Seil drohte hier und jetzt zu zerfasern, noch dazu ein wichtiges, und Sharpe beobachtete, wie Wellington mit den Fingern auf der Tischkante trommelte. Seine Augen richteten sich auf Sharpe, huschten dann zu Lawford hinüber.
»Lieutenant Colonel?«
»Sir?«
»Ich leihe mir Captain Sharpe von Ihnen aus, samt seiner Kompanie. Wahrscheinlich werde ich sie nicht länger als einen Monat brauchen.«
»Jawohl, Mylord.« Lawford sah Sharpe an und zuckte mit den Schultern.
Wellington erhob sich. Er wirkte erleichtert, als sei soeben eine Entscheidung gefallen. »Der Krieg ist nicht verloren, meine Herren, obwohl ich weiß, dass mein Optimismus nicht überall geteilt wird.« Er war eindeutig verbittert, wütend auf die Defätisten, deren Briefe in die Heimat von den Zeitungen abgedruckt wurden. »Möglich, dass wir die Franzosen im Kampf stellen können, und wenn wir es tun, werden wir siegen.« Sharpe hatte das nie bezweifelt. Von allen britischen Generälen war dies der Einzige, der wusste, wie die Franzosen zu schlagen waren. »Aber unser Sieg wird ihr Vordringen nur verzögern.« Wellington entrollte eine Karte, starrte unverwandt darauf und ließ sie wieder los, sodass sie sich von allein zusammenrollte. »Nein, meine Herren, unser Überleben hängt von etwas anderem ab. Von einer Sache, die Sie, Captain Sharpe, mir bringen müssen. Müssen, haben Sie gehört? Müssen.«
Sharpe hatte den General noch nie so eindringlich sprechen hören. »Jawohl, Sir.«
Lawford räusperte sich. »Und wenn er versagt, Mylord?«
Noch einmal das frostige Lächeln. »Davon würde ich ihm abraten.« Er wandte sich Sharpe zu. »Sie sind nicht meine einzige Trumpfkarte, Mister Sharpe, aber Sie sind – wichtig. Es gehen nämlich Dinge vor, meine Herren, von denen dieses Heer nichts weiß. Wenn es davon wüsste, wäre es generell optimistischer gestimmt.« Er setzte sich und verzichtete darauf, sie aufzuklären. Sharpe nahm an, dass er sie absichtlich im Unklaren ließ. Er wollte seinerseits mit einem Gerücht gegen die Defätisten angehen, und auch das gehörte zu den Aufgaben eines Generals. Dann hob Wellington den Blick. »Sie unterstehen nun meinem Befehl, Captain Sharpe. Ihre Männer müssen heute Nacht zum Abmarsch bereitstehen. Sie dürfen nicht durch Frauen oder unnötiges Gepäck behindert werden, und sie müssen volle Munitionszuteilung erhalten.«
»Jawohl, Sir.«
»Und Sie kommen in einer Stunde wieder hierher. Sie haben zwei Aufgaben zu erfüllen.«
Sharpe fragte sich, ob ihm sofort mitgeteilt werden sollte, worum es sich handelte. »Sir?«
»Erstens, Mister Sharpe, werden Sie dann Ihre Befehle erhalten. Nicht von mir, sondern von einem Ihrer alten Kampfgefährten.« Wellington sah Sharpes fragenden Blick. »Major Hogan.«
Sharpes Gesicht verriet seine Freude. Hogan, der Pionier, der schweigsame Ire, war ein Freund, auf dessen Vernunft sich Sharpe während der schwierigen Tage vor Talavera verlassen hatte. Wellington sah die Freude und versuchte sie zu dämpfen. »Vorher jedoch, Mister Sharpe, werden Sie sich bei Lieutenant Ayres entschuldigen.« Er wartete auf Sharpes Reaktion.
»Aber natürlich, Sir. Das hatte ich ohnehin vor.« Sharpe blickte schockiert drein bei dem Gedanken, er könne je ein anderes Vorgehen geplant haben, und seine unschuldig aufgerissenen Augen glaubten einen Anflug von Amüsement hinter dem kalten blauen Blick des Generals entdeckt zu haben.
Wellington wandte sich an Lawford und schlug mit der bei ihm üblichen entwaffnenden Geschwindigkeit einen liebenswürdigen Ton an. »Ihnen geht es gut, Lieutenant Colonel?«
»Danke, Sir. Jawohl.« Lawford strahlte vor Freude. Er hatte in Wellingtons Stab gedient und kannte den General gut.
»Essen Sie doch heute mit mir zu Abend. Um die übliche Zeit.« Der General sah Forrest an. »Und Sie, Major?«
»Mit Vergnügen, Sir.«
»Gut.« Sein Blick kehrte zu Sharpe zurück. »Captain Sharpe wird zu beschäftigt sein, fürchte ich.« Er entließ sie mit einem Nicken. »Guten Tag, meine Herren.«
Vor dem Hauptquartier bliesen die Hörner zum Abend, und die Sonne ging in herrlichem Karmesinrot unter. Drinnen in seinem stillen Arbeitszimmer hielt der General einen Moment lang inne, ehe er sich wieder an die Schreibarbeit machte, die vor dem abendlichen Hammelbraten erledigt werden musste. Hogan, dachte er, hatte recht. Wenn wie in diesem Fall ein Wunder gebraucht wurde, um den Feldzug zu retten, dann war der Spitzbube, den er soeben verabschiedet hatte, der beste Mann, um es zu vollbringen. Er war mehr als ein Spitzbube: ein Kämpfer und obendrein ein Mann, für den Versagen undenkbar war. Und dennoch war er ein Spitzbube, dachte Wellington, ein verdammter Spitzbube.
KAPITEL 3
Sharpe hatte die Stunde bis zu seiner Rückkehr in Wellingtons Hauptquartier damit verbracht, alle möglichen abenteuerlichen Lösungen des Rätsels zu ersinnen, was er dem General wohl bringen sollte. Vielleicht, überlegte er, während er die Kompanie auf Trab brachte, handelte es sich um eine neue französische Geheimwaffe, ähnlich dem Raketensystem des britischen Colonels Congreve, von dem so viel zu hören, aber so wenig zu sehen war. Oder vielleicht hatten, was noch unwahrscheinlicher war, die Briten insgeheim Napoleons geschiedener Gemahlin Josephine Asyl angeboten, und sie hatte sich in Spanien eingeschmuggelt, um als Faustpfand der hohen Politik des Krieges zu dienen. Er war sich immer noch im Unklaren, als er endlich in einen großen Raum des Hauptquartiers geführt wurde, wo ihn ein Empfangskomitee mit förmlichem, gezwungenem Gebaren erwartete, in Begleitung des entsetzlich verlegenen Lieutenant Ayres.
Der salbungsvolle junge Major lächelte Sharpe an, als sei er ein lieber, angemeldeter Gast. »Ah, Captain Sharpe. Sie kennen den Kommandeur der Militärpolizei, Lieutenant Ayres haben Sie auch schon kennengelernt, und dies ist Colonel Williams. Meine Herren?« Der Major führte eine zierliche Geste aus, als wolle er sie allesamt einladen, sich zu setzen und ein Glas Sherry zu nehmen. Wie es schien, war Colonel Williams, feist und mit rot geädertem Gesicht, zum Sprecher ernannt worden.
»Schändlich, Sharpe. Einfach schändlich!«
Sharpe starrte auf einen Punkt direkt über Williams’ Kopf und achtete darauf, dass er nicht blinzelte. Das war eine nützliche Methode, Leute aus der Fassung zu bringen, und siehe da, Williams geriet unter seinem scheinbar starren Blick ins Wanken und wies hilflos auf Lieutenant Ayres.
»Sie haben seine Autorität aufs Spiel gesetzt und Ihre eigene überschritten. Eine Schande!«
»Jawohl, Sir. Ich bitte um Verzeihung!«
»Was?« Williams schien über Sharpes unvermittelte Entschuldigung verblüfft zu sein. Lieutenant Ayres wand sich vor Unbehagen, während der Profoskommandeur offensichtlich ungeduldig darauf wartete, dem Schauspiel ein Ende zu bereiten. Williams räusperte sich, wollte ihn wohl nicht so leicht davonkommen lassen. »Sie entschuldigen sich?«
»Jawohl, Sir. Vorbehaltlos, Sir. Eine entsetzliche Schande, Sir. Ich bitte inständig um Verzeihung, Sir, bedaure mein Verhalten sehr, Sir, genau wie Lieutenant Ayres sicherlich das seine.«
Ayres, aufgeschreckt durch ein unvermitteltes Lächeln Sharpes, nickte hastig. »Das tue ich, Sir, das tue ich.«
Williams wirbelte zu dem unseligen Lieutenant herum. »Was haben Sie zu bedauern, Ayres? Heißt das, es steckt mehr dahinter, als ich angenommen hatte?«
Der Kommandeur seufzte und scharrte mit den Füßen. »Ich denke, der Zweck der Begegnung ist erfüllt, meine Herren, und ich habe zu arbeiten.« Er blickte Sharpe an. »Ich danke Ihnen, Captain, für Ihre Entschuldigung. Wir lassen Sie jetzt allein.«
Als sie den Raum verließen, hörte Sharpe noch, wie Colonel Williams Ayres ins Gebet nahm, wieso es für ihn etwas zu bedauern gäbe. Sharpe gestattete sich ein Grinsen, aus dem ein breites Lächeln wurde, als erneut die Tür aufging und Michael Hogan hereinkam. Der kleine Ire schloss sorgsam die Tür und lächelte Sharpe zu.
»Eine geziemende Entschuldigung, wie ich sie von dir nicht anders erwartet habe. Wie geht’s?«
Sie schüttelten sich die Hand, und die Freude stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Der Krieg, erwies sich, meinte es gut mit Hogan. Er war in seiner Funktion als Pionier in Wellingtons Stab aufgenommen und befördert worden. Er sprach Portugiesisch und Spanisch und besaß obendrein einen gesunden Menschenverstand, wie er selten vorkam. Sharpe zog angesichts der eleganten neuen Uniform Hogans die Brauen hoch.
»Also, was gibt man Ihnen hier zu tun?«
»So dies und jenes.« Hogan strahlte ihn an, hielt inne, nieste dann kräftig. »Heiliger St. Patrick! Verdammter Irish Blackguard!«
Sharpe blickte verwirrt drein, da hielt Hogan ihm seine Schnupftabaksdose hin. »Kann hier keinen Scotch Rappee kriegen, nur Irish Blackguard. Das ist ein Gefühl, als würde man Kartätschen einatmen.«
»Geben Sie’s doch auf.«
Hogan lachte. »Ich hab’s versucht, schaff es aber nicht.« Seine Augen tränten, als sich der nächste Niesanfall zusammenbraute. »Gott im Himmel!«
»Also, was tun Sie nun wirklich?«
Hogan wischte sich eine Träne von der Wange. »Nicht viel, Richard. Ich finde das eine oder andere heraus, über den Feind, du verstehst schon. Und ich zeichne Karten. All so etwas. Wir nennen es ›Aufklärung‹, aber das ist nur ein schwülstiger Ausdruck dafür, dass man ein wenig über den Gegner Bescheid weiß. Außerdem habe ich Aufgaben in Lissabon.« Er machte eine abwertende Handbewegung. »Ich komme zurecht.«
In Lissabon, wo sich Josefina aufhielt. Der Gedanke kam Hogan gleichzeitig mit Sharpe, und der kleine Ire lächelte und beantwortete die unausgesprochene Frage. »Ja, es geht ihr gut.«
Josefina, die Sharpe kurze Zeit geliebt hatte, für die er gemordet und die ihn wegen eines Kavallerieoffiziers verlassen hatte. Er dachte nach wie vor an sie, erinnerte sich der wenigen Nächte, aber dies war weder die Zeit noch der Ort, solcherlei Erinnerungen nachzuhängen. Er verdrängte den Gedanken an sie und die Eifersucht, die er gegenüber Captain Claud Hardy empfand, und wechselte das Thema.
»Und was ist das für ein Ding, das ich dem General heranschaffen muss?«
Hogan lehnte sich zurück. »Nervos belli, pecuniam infinitam.«
»Sie wissen doch, ich verstehe kein Spanisch.«
Hogan lächelte milde. »Latein, Richard, Latein. Deine Schulbildung lässt sehr zu wünschen übrig. Cicero hat das gesagt: ›Die Triebfeder des Krieges ist eine unbegrenzte Menge Geldes.‹«
»Geld?«
»Gold, um es präziser zu sagen. Eimerweise Gold. Eine verdammte Riesensumme, mein lieber Richard, und wir wollen sie haben. Nein, wir wollen sie nicht nur, wir brauchen sie. Ohne Gold …« Er beendete den Satz nicht, zuckte stattdessen bloß mit den Schultern.
»Sie belieben zu scherzen!«
Hogan zündete sorgsam eine weitere Kerze an – das Licht draußen vor den Fenstern ließ rasch nach – und fuhr mit ruhiger Stimme fort: »Ich wünschte, ich könnte darüber scherzen. Uns ist tatsächlich das Geld ausgegangen. Man sollte es nicht glauben, aber so ist es. Fünfundachtzig Millionen Pfund beträgt in diesem Jahr der Kriegsetat. Kannst du dir das vorstellen? Und wir sind am Ende.«
»Am Ende?«
Hogan zuckte wieder mit den Schultern. »Eine neue Regierung in London, verdammte Engländer, verlangen, dass wir Buch führen. Wir bezahlen Portugal sämtliche Unkosten, bewaffnen die halbe spanische Nation, und jetzt brauchen wir selber was.« Er betonte das »wir«. »Man könnte es, nehme ich an, eine vorübergehende Verlegenheit nennen. Wir brauchen das Geld schnell, binnen weniger Tage. Wir könnten es London abpressen, wenn wir ein paar Monate Zeit hätten, aber das dauert zu lange. Wir brauchen es jetzt.«
»Und wenn wir es nicht bekommen?«
»Wenn nicht, Richard, werden die Franzosen Lissabon erreichen, und alles Geld der Welt kann nichts daran ändern.« Er lächelte. Deshalb sollst du losgehen und das Geld holen.«
»Ich gehe los und hole das Geld.« Sharpe grinste den Iren an. »Wie denn? Soll ich es stehlen?«
»Sagen wir lieber ›ausleihen‹.« Hogans Stimme klang ernst. Sharpe sagte nichts, worauf der Ire seufzte und sich zurücklehnte. »Das Problem, Richard, besteht darin, dass das Gold eigentlich der spanischen Regierung gehört.«
»Wieso eigentlich?«
Hogan zog die Schultern hoch. »Wer weiß schon, wo sich die Regierung aufhält? Ist sie in Madrid, bei den Franzosen? Oder in Cádiz?«
»Und wo ist das Gold? In Paris?«
Hogan lächelte müde. »So weit weg nun auch wieder nicht. Zwei Tagesmärsche entfernt.« Seine Stimme wurde förmlich, als er begann, die erhaltenen Instruktionen zu wiederholen. »Ihr brecht heute Abend auf, marschiert nach Almeida. Der Weg über den Coa wird vom Sechzigsten Regiment bewacht. Ihr werdet dort erwartet. In Almeida triffst du Major Kearsey. Ab da stehst du unter seinem Befehl. Wir erwarten von dir, dass du nicht länger als eine Woche brauchst, und solltest du Hilfe brauchen, was hoffentlich nicht eintreten wird, ist dies alles, was du bekommst.«
Er schob ein Blatt Papier über den Tisch. Sharpe entfaltete es.





























