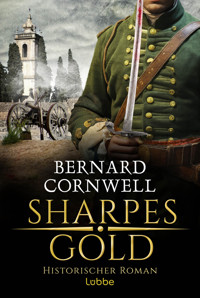9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Indien, 1803. Richard Sharpes Beförderung zum Offizier erweist sich als zweifelhafte Ehre. Die anderen Offiziere verachten ihn wegen seiner niederen Herkunft. Am größten jedoch ist der Hass seines alten Erzfeindes Obadiah Hakeswill. Als Sharpe einen Verrat Hakeswills aufdeckt, gerät er in einen Hinterhalt und überlebt nur mit knapper Not. Sharpe sinnt auf Rache. Doch der schmierige Hakeswill hat sich in der indischen Bergfestung von Gawilghur verschanzt, die von den britischen Truppen belagert wird. Beim Sturm auf die Festung ist Sharpe ganz vorn mit dabei, um dem Verräter ein für alle Mal das Handwerk zu legen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Karten
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
HISTORISCHE ANMERKUNGEN
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 80er-Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
Weitere Informationen finden Sie aufwww.bernardcornwell.net
Bernard Cornwell
SHARPESFESTUNG
Historischer Roman
Aus dem Englischen vonJoachim Honnef
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © Bernard Cornwell 1999
Titel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Fortress«
Originalverlag:HarperCollins Publishers
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2009/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Prüfung der militärhistorischen Details:
Historisches Uniformarchiv Alfred Umhey
Textredaktion: Rainer Delfs
Lektorat: Anja Arendt
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München unter Verwendung von Motiven von © Collaboration JS/arcangel; © saiko3p/shutterstock.com; CRS PHOTO/shutterstock.com
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-0043-4
luebbe.de
lesejury.de
Sharpes Festung istmit großem DankChristine Clark gewidmet
KAPITEL 1
Richard Sharpe wollte ein guter Offizier sein. Das wünschte er wirklich aus ganzem Herzen, doch irgendwie war es so schwierig, als versuche er mit einer Zunderbüchse im regengepeitschten Sturmwind Feuer zu machen. Entweder mochten ihn die Männer nicht oder sie ignorierten ihn oder sie waren zu plump vertraulich, während die anderen Offiziere des Bataillons ihn offenkundig nicht akzeptierten. Captain Urquhart hatte eines Abends in dem vergammelten Zelt, das als Offiziersmesse diente, gesagt: Man kann einem lahmen Karrengaul einen Rennsattel auflegen, doch das macht das Tier nicht schnell. Er hatte nicht über Sharpe geredet, nicht direkt, aber all die anderen Offiziere hatten zu ihm geblickt.
Das Bataillon befand sich im Niemandsland. Es war höllisch heiß und kein Windhauch milderte die Gluthitze. Ringsum verdeckten Getreidehalme die Sicht auf alles außer dem Himmel. Irgendwo im Norden donnerte ein Geschütz, und Sharpe hatte keine Ahnung, ob es ein britisches oder eine Kanone des Feindes war.
Ein trockener Graben verlief zwischen den hohen Halmen, und die Männer des Bataillons saßen auf der Böschung des Grabens und warteten auf Befehle. Ein, zwei hatten sich zurückgelegt und schliefen mit weit geöffnetem Mund, während Sergeant Colquhoun in seiner zerfledderten Bibel blätterte. Der Sergeant war kurzsichtig, sodass er die Heilige Schrift dicht unter seine Nase halten musste und Schweißtropfen auf die Seiten fielen. Für gewöhnlich las der Sergeant still, formte die Worte unhörbar mit den Lippen und runzelte die Stirn, wenn er bei einem schwierigen Namen stockte, doch heute drehte er nur langsam die Seiten mit angefeuchtetem Finger um.
»Suchen Sie nach Inspiration, Sergeant?«, fragte Sharpe.
»Nein, Sir«, antwortete Colquhoun. Er sagte es respektvoll, doch irgendwie schaffte er es, zu vermitteln, dass er die Frage unverschämt fand. Er befeuchtete mit der Zungenspitze einen Finger und blätterte die nächste Seite um.
So viel zu unserer Gesprächsbereitschaft, dachte Sharpe.
Irgendwo voraus, jenseits der Pflanzen, die höher ragten als ein Mann, feuerte eine andere Kanone. Der Knall wurde durch die hohen Stängel ringsum gedämpft. Ein Pferd wieherte, doch Sharpe konnte das Tier nicht sehen. Er sah durch die hohen Halme so gut wie nichts.
»Werden Sie uns eine Geschichte vorlesen, Sergeant?«, fragte Corporal McCallum. Er sprach Englisch statt Gälisch, was bedeutete, dass Sharpe es hören sollte.
»Nein, John, das werde ich nicht.«
»Nalos, Sergeant«, sagte McCallum. »Lesen Sie uns eine dieser schmutzigen Geschichten über Titten vor.«
Die Männer lachten und blickten zu Sharpe, um zu sehen, ob er etwas dagegen hatte.
Einer der Schläfer wurde wach und setzte sich ruckartig auf. Er blickte sich verwirrt um, dann murmelte er einen Fluch, schlug nach einer Fliege und legte sich zurück. Die anderen Soldaten der Kompanie ließen ihre Beine zum Schlammbett des Grabens baumeln, das mit grünem Schaum bedeckt war. Eine tote Eidechse lag in einem der Risse in dem getrockneten Schlamm. Sharpe fragte sich, wie sie den Aasfressern entgangen sein mochte.
»Das Gelächter von Narren, John McCallum, ist wie das Prasseln von Feuer unter dem Kochtopf«, sagte Sergeant Colquhoun.
»Fort mit Ihnen, Sergeant!«, erwiderte John McCallum. »Ich habe als kleiner Junge in der Kirche mal alles über eine Frau gehört, deren Titten wie Weintrauben waren.« McCallum drehte sich um, um Sharpe anzuschauen. »Haben Sie jemals Titten wie Weintrauben gesehen, Mister Sharpe?«
»Ihre Mutter habe ich nie kennengelernt, Corporal«, sagte Sharpe.
Die Männer lachten wieder. McCallum blickte finster drein. Sergeant Colquhoun ließ seine Bibel sinken und spähte zum Corporal. »Das Hohelied Salomos, John McCallum«, sagte Colquhoun, »beschreibt den Busen einer Frau als Weintrauben, und ich habe keinen Zweifel, dass es sich auf die Kleidung bezieht, die anständige Frauen im Heiligen Land trugen. Vielleicht hatten ihre Mieder Kugeln von verknoteter Wolle als Verzierung? Ich kann das nicht als eine Sache für Ihre Belustigung sehen.«
Eine weitere Kanone donnerte, und diesmal peitschte eine Kanonenkugel durch die hohen Pflanzen nahe beim Graben. Die Stängel gerieten in heftige Bewegung, und eine Wolke von Staub und kleinen Vögeln stieg in den wolkenlosen Himmel auf. Die Vögel flogen ein paar Sekunden in Panik herum, bevor sie zu ihrem schwankenden Stammplatz zurückkehrten.
»Ich habe eine Frau gekannt, die klumpige Titten hatte«, sagte Private Hollister. Er war ein stoppelbärtiger Hüne, der selten sprach. »Mann, das waren schwere Dinger – wie Kanonenkugeln.« Er runzelte die Stirn in der Erinnerung. »Sie ist gestorben.«
»Dieses Gespräch geziemt sich nicht«, sagte Colquhoun ruhig. Die Männer zuckten mit den Schultern und schwiegen.
Sharpe spielte mit dem Gedanken, den Sergeant über die Weintrauben zu befragen, doch er wusste, dass eine solche Frage nur zu Zoten der Männer führen würde, und als Offizier wollte er nicht riskieren, sich zum Narren zu machen. Trotzdem klang es komisch für ihn. Warum würde jemand sagen, eine Frau hätte Titten wie Weintrauben? Oder wie Kanonenkugeln?
Wieder knallte es in der Ferne, und es kam ihm vor wie Kartätschenfeuer. Er fragte sich, ob die Bastarde mit Kartätschen ausgerüstet waren. Nun, das waren sie natürlich, aber es hatte keinen Sinn, Kartätschen auf einem Getreidefeld zu verschwenden. Was war das überhaupt für ein Getreide? Es kam ihm sonderbar vor, aber Indien war voller Besonderheiten. Es gab nackte Blödmänner, die behaupteten, Heilige zu sein, Schlangenbeschwörer, die Reptilien nach ihrer Pfeife tanzen ließen, Tanzbären, die mit Glöckchen behängt waren, und Schlangenmenschen in Schwulenflitterklamotten – ein verrückter Zirkus. Und die Clowns würden Kartätschen haben. Sie würden auf die Rotröcke warten und die Blechbüchsen laden, die wie Entenschrot aus den Geschützläufen rasten. Die Ladungen werden uns zwischen den Binsen am Graben erwischen, dachte Sharpe, möge der Herr uns gnädig sein.
»Ich habe es gefunden«, sagte Colquhoun ernst.
»Was gefunden?«, wollte Sharps wissen.
»Ich war mir ziemlich sicher, dass die Bibel Hirse erwähnt. Und so ist es. Hesekiel, viertes Kapitel, neunter Vers.« Der Sergeant hielt die Heilige Schrift dicht unter die Augen. Er hatte ein rundes, pickliges Gesicht. »So nimm nun dir Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen, Hirsen und Spelt und tue alles in ein Fass und mache dir so viel Brot daraus …«, las er angestrengt vor. Dann schloss er die Bibel, wickelte ein Stück fleckiges Segeltuch darum und verstaute sie in seiner Tasche. »Es gefällt mir, Sir, wenn ich jeden Tag interessante Dinge in der Bibel finden kann. Das mag ich, und ich sehe sie und stelle mir vor, dass mein Herr und Erlöser dieselben Dinge sieht.«
»Aber warum Hirse?«, fragte Sharpe.
»Diese Saaten«, sagte Colquhoun und wies auf die hohen Stängel, von denen sie umgeben waren, »sind Hirse, Sir. Die Eingeborenen nennen sie jowari, doch unsere Bezeichnung ist Hirse.« Er wischte sich mit dem Ärmel Schweiß aus dem Gesicht. Das Rot seines Uniformrocks war zu einem matten Purpurton verblichen. »Dies ist natürlich Rispenhirse, aber ich bezweifle, dass die Heilige Schrift Rispenhirse besonders erwähnt.«
»Hirse, aha«, sagte Sharpe. Die Halme waren neun oder zehn Fuß hoch. »Muss verdammt schwer zu ernten sein«, sagte er.
Colquhoun schwieg. Der Sergeant versuchte immer, Kraftworte oder Flüche zu ignorieren.
»Was ist Spelt?«, fragte McCallum.
»Eine Getreideart im Heiligen Land«, antwortete Colquhoun, der es offensichtlich nicht wusste, sondern nur erriet.
»Klingt für mich wie ’ne Krankheit, die mit Quecksilber behandelt wird.« Ein, zwei Männer kicherten bei dem Hinweis auf Syphilis, doch Colquhoun ging darüber hinweg.
»Baut ihr in Schottland Hirse an?«, fragte Sharpe den Sergeant.
»Nicht, dass ich wüsste«, sagte Colquhoun nachdenklich, nachdem er ein paar Sekunden überlegt hatte. »Vielleicht im Tiefland. Da pflanzen sie komische Dinge an. Englische Dinge.« Er wandte sich ostentativ ab.
Blöder Hund, dachte Sharpe.
Wo, zur Hölle, war Captain Urquhart? Wo waren die anderen? Das Bataillon war lange vor dem Morgengrauen marschiert, und gegen Mittag hatte es erwartet, das Lager aufzuschlagen, doch dann war ein Gerücht aufgekommen, dass der Feind voraus wartete, und so hatte General Sir Arthur Wellesley befohlen, den Vormarsch fortzusetzen. Das 74. Regiment war in das Hirsefeld vorgedrungen, und zehn Minuten später hatte es den Befehl erhalten, neben dem ausgetrockneten Graben zu halten, während Captain Urquhart vorausritt, um mit dem Bataillonskommandeur zu sprechen.
Es war eine gute Kompanie, und sie brauchte Sharpe nicht. Urquhart führte sie gut, Colquhoun war ein großartiger Sergeant, die Männer waren zufrieden, wie es Soldaten nur sein konnten, und das Letzte, was die Kompanie brauchen konnte, war ein nagelneuer Offizier, ein Engländer, der noch vor zwei Monaten ein Sergeant gewesen war.
Die Männer unterhielten sich auf Gälisch, und Sharpe fragte sich – wie immer –, ob sie über ihn sprachen. Vermutlich nicht. Wahrscheinlicher war, dass sie über die Tanzmädchen von Ferdapoor sprachen, die mehr als Weintrauben hatten, eher verdammt große nackte Fleischmelonen. Es hatte eine Art Festival gegeben, und das Regiment war in eine Richtung marschiert und die halb nackten Mädchen in die entgegengesetzte, wobei Sergeant Colquhoun so rot wie ein nagelneuer Uniformrock geworden war und den Männern »Augen – geradeaus!« befohlen hatte. Was ein sinnloser Befehl gewesen war, denn ein Dutzend unbekleidete bibbis mit silbernen Glöckchen an den Handgelenken war vor den Augen des Bataillons über die Straße gehüpft, und selbst die Offiziere hatten sie angestarrt wie ausgehungerte Männer, die eine Platte mit Roastbeef sehen.
Und wenn die Männer nicht über Frauen sprachen, dann grollten sie über all das Marschieren in den letzten Wochen, in denen sie unter der glühenden Sonne durch das Marathen-Gebiet gezogen waren, ohne etwas von dem Feind zu sehen oder auch nur zu riechen. Aber gleichgültig, worüber sie redeten, sie sorgten verdammt dafür, dass Ensign Richard Sharpe davon ausgeschlossen wurde.
Was nur zu verständlich war, wie Sharpe fand. Er war lange genug in den Reihen der Mannschaften marschiert, um zu wissen, dass die Männer nicht mit Offizieren redeten, es sei denn, sie wurden angesprochen oder irgendein schleimiger Bastard wollte sich lieb Kind machen, um bevorzugt zu werden. Offiziere waren anders, doch Sharpe fühlte sich nicht so. Er fühlte sich einfach ausgeschlossen. Ich hätte Sergeant bleiben sollen, dachte er. Das war ihm in den letzten Wochen zunehmend durch den Kopf gegangen, und er hatte gewünscht, wieder in Seringapatams Waffenkammer bei Major Stokes zu sein. Das war schön gewesen! Und Simone Joubert, die Französin, die sich in der Schlacht bei Assaye an ihn geklammert hatte, war nach Seringapatam zurückgekehrt, um auf ihn zu warten. Besser dort Sergeant sein als hier ungewollter Offizier.
Eine Weile war kein Geschützfeuer zu hören gewesen. Vielleicht hatte der Feind gepackt, seine Ochsengespanne angespannt, die Kartätschen aufgeprotzt und war nordwärts abgehauen? In diesem Fall würde es eine schnelle Kehrtwendung geben, zurück zu dem Dorf, in dem das Gepäck lagerte, und einen weiteren lästigen Abend in der Offiziersmesse. Lieutenant Cahill würde Sharpe mit Falkenaugen beobachten, für jedes Glas Wein auf Sharpes Rechnung ein Twopence hinzufügen, und Sharpe als der jüngere Offizier würde den Toast auf den König ausbringen und so tun, als sähe er nicht, dass die Hälfte der Bastarde ihre Krüge in die Feldflaschen leerten. Einen Trinkspruch für einen Stuart-Thronanwärter ausbringen, der im römischen Exil gestorben war. Jakobiten, die vorgaben, dass George III. nicht der richtige König war. Nicht dass irgendwelche von ihnen wirklich unloyal waren, und dass der Wein aufs Wasser geschüttet wurde, war auch kein wahres Geheimnis, sondern sollte in Sharpe nur englische Empörung wecken. Sharpe war dies jedoch schnuppe.
Colquhoun bellte plötzlich auf Gälisch Befehle, und die Männer nahmen ihre Musketen auf, sprangen in den Bewässerungsgraben, formierten sich zu zwei Reihen und begannen nordwärts zu marschieren.
Sharpe schloss sich überrascht an. Er nahm an, dass er Colquhoun hätte fragen sollen, was los war, doch er wollte keine Unwissenheit zeigen, und dann sah er, dass der Rest des Regiments ebenfalls marschierte. Wohl deshalb hatte Colquhoun sich entschieden, gleichfalls vorzurücken. Der Sergeant machte nicht einmal den Versuch, Sharpe um Erlaubnis zu fragen. Warum sollte er auch? Selbst wenn Sharpe einen Befehl gab, blickten die Männer automatisch zu Colquhoun und befolgten ihn, wenn er nickte. So funktionierte das in der Kompanie: Urquhart war der Kompaniechef, Colquhoun kam nach ihm und Ensign Sharpe lief hinterher wie einer der dreckigen Hunde, die von den Männern aufgenommen worden waren.
Captain Urquhart trieb sein Pferd in den Wassergraben.
»Gut gemacht, Sergeant«, sagte er anerkennend zu Colquhoun, der das Lob ignorierte. Der Captain zog das Pferd herum, und dessen Hufe brachen durch die Schicht des getrockneten Schlamms und wirbelten Klumpen auf. »Die Hundesöhne warten voraus«, sagte Urquhart zu Sharpe.
»Ich dachte, sie wären abgehauen«, sagte Sharpe.
»Sie sind formiert und bereit«, entgegnete Urquhart. Der Captain sah gut aus, hatte ein ernstes Gesicht, eine stramme Haltung und gute Nerven. Die Männer vertrauten ihm. Eigentlich wäre Sharpe stolz gewesen, unter einem solchen Mann zu dienen, aber der Captain schien ärgerlich über Sharpes Anwesenheit in seiner Kompanie zu sein. »Wir werden bald nach rechts abschwenken!«, rief Urquhart Colquhoun zu. »Formieren Sie rechts eine Linie zu zwei Gliedern!«
»Aye, Sir.«
Urquhart blickte zum Himmel. »Noch drei Stunden Tageslicht«, schätzte er. »Das reicht für den Job. Sie werden die linke Flanke übernehmen, Ensign.«
»Jawohl, Sir«, sagte Sharpe. Und er wusste, dass er dort nichts zu tun haben würde. Die Männer kannten ihre Pflicht, die Corporals würden die Reihen schließen und Sharpe würde einfach hinterhertrotten, wie ein Hund, der an einen Karren angebunden war.
Es donnerte plötzlich gewaltig, als eine ganze Batterie feindlicher Kanonen das Feuer eröffnete. Sharpe hörte die Geschosse durch die Hirse peitschen, doch keines kam gefährlich nahe an die Kompanie heran. Die Dudelsackpfeifer des Regiments begannen zu spielen, und die Männer packten ihre Musketen fester und bereiteten sich innerlich auf die furchtbare Arbeit vor, die vor ihnen lag. Zwei weitere Geschütze feuerten, und diesmal sah Sharpe Rauchfetzen über der Hirse und wusste, dass ein Geschoss hoch über sie hinweg flog. Die Rauchspur der brennenden Lunte zitterte in der windstillen Luft, als Sharpe auf die Explosion wartete, die jedoch nicht erfolgte.
»Hat seine Lunte zu lang geschnitten«, sagte Urquhart. Sein Pferd war nervös, oder vielleicht behagte ihm der trügerische Boden in dem Wassergraben nicht. Urquhart trieb das Pferd zum Ufer hinauf und zertrampelte die Hirse. »Was für ein Zeug ist das?«, fragte er Sharpe. »Mais?«
»Colquhoun sagt, es ist Hirse«, erwiderte Sharpe, »Rispenhirse.«
Urquhart stieß einen Grunzlaut aus und trieb sein Pferd weiter vor die Kompanie. Sharpe wischte sich Schweiß vom Gesicht. Er trug den roten Uniformrock eines Offiziers mit den weißen Aufschlägen des 74. Regiments. Der Rock hatte einem Lieutenant Blaine gehört, der bei Assaye gefallen war, und Sharpe hatte den Rock bei einer Auktion zugunsten der toten Offiziere für einen Schilling gekauft. Dann hatte er mühselig das Kugelloch in der linken Brust vernäht, aber kein noch so intensives Schrubben hatte Blaines Blut, das dunkle Flecken in dem verblichenen Rot hinterlassen hatte, ganz unsichtbar machen können. Er trug die alte Hose, die ihm ausgegeben worden war, als er Sergeant gewesen war, und die roten Reitstiefel, die er einem arabischen Gefallenen in Ahmadnagar abgenommen hatte, und eine rote Offiziersschärpe von einem Leichnam in Assaye. Als Blankwaffe trug er einen leichten Kavalleriesäbel, die gleiche Waffe, die er in der Schlacht von Assaye benutzt hatte, um Wellesley das Leben zu retten. Den Säbel mochte er nicht besonders. Er war plump, und die gekrümmte Klinge war nie dort, wo man es annahm. Man schlug mit dem Säbel zu, und gerade wenn man dachte, es wäre ein Volltreffer, stellte man fest, dass die Klinge noch sechs Inches unterwegs sein würde. Die anderen Offiziere besaßen schottische Breitschwerter, groß, mit gerader Klinge, schwer und tödlich, und Sharpe hatte sich selbst mit einem ausrüsten wollen, doch er war vor den Preisen bei der Auktion zurückgeschreckt.
Er hätte sich jedes schottische Breitschwert bei der Auktion kaufen können, wenn er das gewünscht hätte, doch er hatte nicht den Eindruck erwecken wollen, dass er wohlhabend war. Das war zwar der Fall, aber bei einem Mann wie Sharpe sollte man keinen Reichtum vermuten. Er war aus den Mannschaften aufgestiegen, ein gemeiner Soldat, geboren und aufgewachsen in der Gosse, und er hatte ein halbes Dutzend Männer besiegt, um Wellesleys Leben zu retten. Der General hatte Sergeant Sharpe belohnt, indem er ihn zum Offizier ernannt hatte. Ensign Sharpe war zu schlau, um sein neues Bataillon wissen zu lassen, dass er das Vermögen eines Königs besaß. Den Reichtum eines toten Königs: die Juwelen, die er dem Tippu Sultan beim nach Blut und Pulverrauch stinkenden Wassertor in Seringapatam abgenommen hatte.
Würde er beliebter sein, wenn bekannt wäre, dass er reich war? Das bezweifelte er. Reichtum führte nicht zu Ansehen, es sei denn, er war ererbt. Außerdem lag es nicht an seiner Armut, dass Sharpe sowohl in der Offiziersmesse als auch von den Mannschaften ausgeschlossen wurde, sondern eher daran, dass er ein Fremder war. Das 74. Regiment war bei Assaye besiegt worden. Kein Offizier war unverwundet geblieben, und Kompanien, die vor der Schlacht siebzig oder achtzig Mann stark gewesen waren, hatten jetzt nur vierzig bis fünfzig Männer. Das Regiment war durch die Hölle und zurück gegangen, und die Überlebenden klammerten sich jetzt aneinander. Sharpe mochte bei Assaye gewesen sein, er mochte sich sogar auf dem Schlachtfeld ausgezeichnet haben, aber er hatte nicht das mörderische Martyrium des 74. Regiments erleiden müssen, also war er ein Außenseiter.
»Linie zur Rechten bilden!«, rief Sergeant Colquhoun, und die Kompanie schwenkte nach rechts ab und formierte sich zu einer Linie aus zwei Reihen. Der Graben im Hirsefeld hatte sich mit einem breiten, ausgetrockneten Flussbett vereinigt, und Sharpe blickte nach Norden und sah eine Spur von schmutzig weißem Pulverrauch am Horizont. Marathen-Geschütze, jedoch weit entfernt. Jetzt, da das Regiment nicht mehr von der hohen Hirse umgeben war, nahm Sharpe leichten Wind wahr. Er war nicht stark genug, um in der Hitze zu kühlen, doch er würde den Pulverrauch langsam fortwehen.
»Halt!«, rief Urquhart.
Die feindlichen Kanonen mochten weit entfernt sein, doch es schien, als würde das Regiment das Flussbett hinauf in die Mündungen dieser Geschütze marschieren. Immerhin war das 74. nicht allein. Das 78., ein weiteres Highland-Regiment, befand sich zu seiner Rechten, und auf jeder Seite dieser beiden schottischen Einheiten rückten lange Reihen von Madras-Sepoys vor.
Urquhart ritt zu Sharpe zurück. »Stevenson ist zu uns gestoßen.« Der Captain sprach laut genug, damit der Rest der Kompanie ihn verstehen konnte. Er ermunterte sie, indem er sie wissen ließ, dass sich die beiden kleinen britischen Armeen vereinigt hatten. General Wellesley kommandierte beide, doch wie meist teilte er seine Streitkräfte in zwei Einheiten, die kleinere unter Colonel Stevenson. Heute hatten sich die beiden Einheiten jedoch vereinigt, sodass zwölftausend Infanteristen gemeinsam angreifen konnten. Gegen wie viele Feinde? Sharpe konnte die Marathen-Armee jenseits ihrer Geschütze nicht sehen, doch zweifellos waren die Bastarde dort.
»Das bedeutet, dass das 94. irgendwo links von uns sein muss«, fügte Urquhart laut hinzu, und einige der Männer murmelten Zustimmendes zu der Nachricht. Das 94. war ein anderes schottisches Regiment, also griffen heute drei schottische Regimenter die Marathen an, drei schottische und zehn Sepoy-Bataillone, und die meisten der Schotten nahmen an, dass sie den Job allein erledigen konnten. Auch Sharpe war dieser Meinung. Vielleicht mochten sie ihn nicht besonders, doch er wusste, dass sie gute Soldaten waren. Harte Bastarde. Manchmal versuchte er sich vorzustellen, wie es für die Marathen sein musste, gegen die Schotten zu kämpfen. Höllisch, nahm er an. Die absolute Hölle. »Es bedarf zweimal so viel, einen Schotten zu töten, als einen Engländer zu erledigen«, hatte Colonel McCandless einmal gesagt, und Sharpe hatte es sich gemerkt.
Der arme McCandless. Er war gefallen, erschossen beim Kampf um Assaye. Jeder aus den Reihen des Feindes hätte den Colonel getötet haben können, doch Sharpe war überzeugt, dass der verräterische Engländer William Dodd den tödlichen Schuss abgegeben hatte. Und Dodd war noch frei, kämpfte immer noch für die Marathen, und Sharpe hatte an McCandless’ Grab geschworen, dass er den Schotten rächen würde. McCandless war ein guter Freund gewesen, und jetzt lag der Colonel so tief begraben, dass kein Aasfresser an seine Leiche heran konnte, und Sharpe fühlte sich ohne Freund in dieser Armee.
»Geschütze!«, ertönte ein Ruf hinter der Kompanie. »Platz machen!«
Zwei Batterien Sechspfünder-Geschütze wurden das ausgetrocknete Flussbett hochgezogen, um eine Artillerie-Linie vor der Infanterie zu bilden. Die Geschütze wurden »Galopper« genannt, weil sie leicht waren und für gewöhnlich von Pferden gezogen wurden, aber jetzt waren Gespanne von zehn Ochsen davor gespannt, sodass sie mehr dahintrotteten als galoppierten. Die Hörner der Ochsen waren angemalt, und einige der Tiere trugen Glöckchen um den Hals. Die schweren Geschütze waren alle irgendwo auf der Straße zurückgeblieben, so weit zurück, dass sie vielleicht zu spät für die Party des Tages kommen würden.
Das Gebiet war jetzt offener. Es gab voraus ein paar Streifen von hoher Rispenhirse, doch ostwärts erstreckte sich Ackerland, und Sharpe beobachtete, wie die Geschütze dorthin transportiert wurden. Der Feind beobachtete das ebenfalls, und die ersten Kanonenkugeln hüpften über das Ackerland, prallten ab und flogen über die britischen Geschütze hinweg.
»Es bleiben noch ein paar Minuten, bevor die Kanoniere sich über uns ärgern, nehme ich an«, sagte Urquhart, zog seinen Fuß aus dem Steigbügel und glitt vom Pferd neben Sharpe. »Jock«, rief er einem Soldaten zu, »kümmern Sie sich um mein Pferd!« Der Soldat führte das Tier zu einer Grasfläche, und Urquhart lud Sharpe mit einer Geste ein, ihm außer Hörweite der Kompanie zu folgen. Der Captain schien verlegen zu sein. Sharpe war es ebenfalls, denn er war nicht an solche Vertrautheit mit Urquhart gewohnt. »Rauchen Sie eine Zigarre, Sharpe?«, fragte der Captain.
»Manchmal, Sir.«
»Hier.« Urquhart bot Sharpe eine grob gerollte Zigarre an, dann machte er Feuer mit seiner Zunderbüchse. Er zündete zuerst seine eigene Zigarre an, dann hielt er die Büchse mit der flackernden Flamme Sharpe hin. »Der Major erzählte mir, dass eine neue Ersatztruppe in Madras eingetroffen ist.«
»Das ist gut, Sir.«
»Damit erreichen wir natürlich nicht die alte Stärke, aber es wird helfen«, sagte Urquhart. Er sah Sharpe nicht an, sondern starrte auf die britischen Geschütze, die stetig über das Ackerland vorrückten. Es waren nur ein Dutzend Kanonen, viel weniger als die Marathen-Geschütze. Eine Granate explodierte bei einem der Ochsengespanne, hüllte die Tiere in Rauch und fetzte Gras und Dreck aus dem Boden. Sharpe erwartete, dass der Beschuss die Ochsen stoppen würde, doch sie stapften weiter, wie durch ein Wunder unverletzt. »Wenn sie zu weit vorrücken«, murmelte Urquhart, »werden sie bald Fetzen sein. Sind Sie hier glücklich, Sharpe?«
»Glücklich, Sir?« Sharpe war verblüfft von der plötzlichen Frage.
Urquhart runzelte die Stirn, als finde er Sharpes Erwiderung unbefriedigend. »Glücklich«, wiederholte er, »zufrieden.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob ein Soldat glücklich sein kann, Sir.«
Urquhart schaute ihn missbilligend an. Er war so groß wie Sharpe. Gerüchte besagten, dass Urquhart sehr reich war, doch das einzige Anzeichen darauf war seine maßgeschneiderte Uniform, elegant im Kontrast zu Sharpes schäbigem Uniformrock. Urquhart lächelte selten, was seine Gesellschaft nicht leicht machte. Sharpe fragte sich, warum der Captain diese Unterhaltung gesucht hatte. Das passte so gar nicht zu dem reservierten Mann. Ob er wegen der bevorstehenden Schlacht nervös war? Sharpe hielt das für unwahrscheinlich, nachdem Urquhart die Hölle von Assaye überlebt hatte, aber er konnte keine andere Erklärung finden. »Ein Mann sollte zufrieden mit seiner Arbeit sein«, sagte Urquhart und paffte an seiner Zigarre, »und wenn er das nicht ist, dann ist das womöglich ein Anzeichen darauf, dass er den falschen Beruf ergriffen hat.«
»Ich habe nicht viel zu tun, Sir«, sagte Sharpe und wünschte, dass es nicht zu verdrossen klang.
»Das will ich auch annehmen«, sagte Urquhart langsam. »Ich verstehe Ihre Meinung. Ja, das ist mir klar.« Er blickte nachdenklich vor sich hin. »Die Kompanie läuft von selbst, nehme ich an, Colquhoun ist ein guter Kerl, und auch Sergeant Craig macht seine Sache gut, finden Sie nicht?«
»Jawohl, Sir.« Sharpe wusste, dass er Urquhart nicht dauernd mit »Sir« ansprechen musste, aber alte Gewohnheiten lassen sich nicht so schnell ändern.
»Sie sind beide gute Calvinisten, wissen Sie«, sagte Urquhart, »Das macht sie vertrauenswürdig.«
»Jawohl, Sir.« Sharpe war sich nicht ganz sicher, was ein Calvinist war, und er würde nicht fragen. Vielleicht war es etwas Ähnliches wie ein Freimaurer, und davon gab es viele im Bataillon, und Sharpe wusste ebenfalls nicht, was das war. Er kannte keinen Einzigen davon.
»Die Sache ist die, Sharpe«, fuhr Urquhart fort, ohne Sharpe dabei anzusehen, »dass Sie auf einem Vermögen sitzen, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Ein Vermögen, Sir?«, fragte Sharpe und versuchte zu verbergen, dass er alarmiert war. Hatte der Captain irgendwie von Sharpes Schatz aus Smaragden, Rubinen, Diamanten und Saphiren erfahren?
»Sie sind ein Ensign«, erklärte Urquhart, »und wenn Sie nicht glücklich sind, können Sie jederzeit Ihr Offizierspatent verkaufen. Viele prächtige Jungs in Schottland werden für Ihren Dienstrang bezahlen. Selbst einige Jungs hier. Ich nehme an, die Schottische Brigade hat einige Gentlemen in den Reihen.«
Das war es also. Urquhart war nicht nervös wegen des bevorstehenden Kampfes, sondern eher wegen Sharpes Reaktion bei dieser Unterhaltung. Der Captain wollte Sharpe loswerden, und bei dieser Erkenntnis fühlte er sich noch verlegener. Er hatte so sehr erhofft, Offizier zu werden, und jetzt wünschte er bereits, nie von der Beförderung geträumt zu haben. Was hatte er denn erwartet? Dass man ihm auf die Schulter klopfte und ihn als lange verlorenen Bruder willkommen hieß? Ihm das Kommando über eine Kompanie gab?
Urquhart sah ihn erwartungsvoll an und wartete auf eine Antwort, Sharpe sagte jedoch nichts.
»Vierhundert Pfund, Sharpe«, sagte Urquhart. »Das ist der offizielle Preis für ein Ensign-Patent, aber unter uns gesagt, können Sie noch mehr verlangen. Mindestens fünfzig weitere, vielleicht sogar hundert. Aber wenn Sie hier an einen einfachen Soldaten verkaufen, sollten Sie sich genau vergewissern, dass er zahlungsfähig ist.«
Sharpe schwieg immer noch. Gab es beim 94. gemeine Soldaten, die wirklich Gentlemen waren? Solche Männer konnten es sich erlauben, Offiziere zu sein und hatten die gute Kinderstube eines Offiziers, doch bis ein Patent frei war, dienten sie in den Mannschaften und aßen in der Offiziersmesse. Sie waren weder Fisch noch Fleisch. Wie Sharpe selbst. Und jeder davon würde die Chance ergreifen, ein Patent zu kaufen. Aber Sharpe brauchte das Geld nicht. Er besaß bereits ein Vermögen, und wenn er die Armee verlassen wollte, dann brauchte er nur auf sein Offizierspatent zu verzichten und konnte als reicher Mann davonspazieren.
»Natürlich«, fuhr Urquhart fort, ohne Sharpes Gedanken zu ahnen, »wenn ein anständiger Armeeagent einen schriftlichen Vertrag ausstellt, hätten Sie keine Sorgen. Die meisten unserer Jungs vertrauen auf John Borrey in Edinburgh, denn wenn Sie einen seiner Verträge sehen, können Sie volles Vertrauen hineinsetzen. Borrey ist ein ehrbarer Mann, ebenfalls ein Calvinist, wissen Sie.«
»Und ein Freimaurer, Sir?«, fragte Sharpe. Er wusste nicht, warum er das sagte, die Frage war ihm einfach herausgeplatzt. Vermutlich, um zu erfahren, ob ein Freimaurer das Gleiche war wie ein Calvinist.
»Das kann ich wirklich nicht sagen.« Urquharts Miene verfinsterte sich, und seine Stimme wurde kühler. »Das Entscheidende ist, dass man ihm trauen kann.«
Vierhundertfünfzig Pfund, dachte Sharpe. Kein Pappenstiel. Ein weiteres kleines Vermögen zusätzlich zu seinem Schatz, und er war versucht, Urquharts Rat zu beherzigen. Er würde im 74. nie willkommen sein, und mit dem Startkapital konnte er in England schon etwas anfangen.
»Denken Sie darüber nach, Sharpe«, sagte Urquhart, »denken Sie darüber nach. Jock, mein Pferd!«
Sharpe warf die Zigarre fort. Sein Mund war trocken, und der Rauch war beißend. Als Urquhart auf sein Pferd stieg und die gerade erst angerauchte Zigarre auf dem Boden liegen sah, bedachte er Sharpe mit einem unfreundlichen Blick. Einen Augenblick hatte es den Anschein, als ob er etwas sagen wollte, doch dann nahm er die Zügel auf und ritt davon.
Leck mich, dachte Sharpe. Ich kann dir nichts recht machen.
Die britischen Galloper-Geschütze waren jetzt in Reichweite der feindlichen Kanonen. Eines der Marathen-Geschosse landete genau auf einer Lafette. Ein Rad zersplitterte, und das Sechspfünder-Geschütz kippte zur Seite. Die Kanoniere sprangen von der Protze, doch bevor sie das Ersatzrad losmachen konnten, ging das Ochsengespann durch. Sie zogen das beschädigte Geschütz zu den Sepoys zurück, und eine große Staubwolke stieg auf, als die Radnabe über das trockene Erdreich schleifte. Die Kanoniere rannten, um die Ochsen abzufangen, doch dann geriet ein zweites Gespann in Panik. Die Ochsen hatten ihre bemalten Hörner gesenkt und flüchteten vor dem Beschuss. Die Marathen-Geschütze feuerten jetzt schnell. Eine Kanonenkugel schlug in ein zweites Gespann, und Ochsenblut spritzte himmelwärts. Die feindlichen Geschütze waren großkalibrig und hatten eine viel größere Reichweite als die kleinen britischen Sechspfünder. Ein paar Granaten explodierten hinter den in Panik geratenen Ochsen und trieben sie noch schneller auf die Sepoy-Bataillone zur Rechten von Wellesleys Linie zu. Die Protzen hüpften wild über den holprigen Grund. Sharpe sah, dass General Wellesley seinem Pferd die Sporen gab und auf die Sepoys zuritt. Zweifellos rief er ihnen zu, die Reihe zu öffnen und die Ochsen durch die Linie zu lassen, doch stattdessen warfen sich die Männer herum und hetzten davon.
»Mein Gott!«, entfuhr es Sharpe laut, und er fügte einen Fluch hinzu, was ihm einen tadelnden Blick von Sergeant Colquhoun einbrachte.
Zwei der Sepoy-Bataillone flüchteten. Sharpe sah, dass der General zwischen die Flüchtenden ritt, und er stellte sich vor, dass Wellesley die in Angst und Schrecken versetzten Männer anschrie, stehen zu bleiben und sich neu zu formieren. Stattdessen rannten sie weiter auf das Hirsefeld zu. Durch die Ochsen und die Wucht des feindlichen Beschusses, der das Grasland erbeben ließ und mit Staub und Rauch erfüllte, waren sie in Panik geraten.
Die Männer verschwanden zwischen der hohen Hirse und ließen nur verwirrte Offiziere zurück, und, erstaunlicherweise, die beiden in Panik geratenen Ochsengespanne, die kurz vor der Hirse ihre Flucht beendet hatten und jetzt geduldig darauf warteten, dass sie von den Kanonieren eingefangen wurden.
»Setzt euch hin!«, rief Urquhart seinen Männern zu, und die Kompanie kauerte sich in das ausgetrocknete Flussbett. Ein Mann zog eine Tonpfeife hervor und zündete sie an. Der Tabakrauch zerfaserte langsam im leichten Wind. Ein paar Männer tranken aus ihren Feldflaschen, aber die meisten sparten das Wasser für die Hitze, die kommen würde. Sharpe hielt nach den puckalees Ausschau, die Wasser bringen würden, konnte jedoch kein Anzeichen von ihnen entdecken. Als sein Blick wieder nach Norden schweifte, sah er auf dem Hügelkamm feindliche Kavallerie, deren lange Lanzen sich vom blauen Himmel abhoben. Zweifellos waren die feindlichen Reiter versucht, die britische Linie anzugreifen und noch mehr der nervösen Sepoys in die Flucht zu jagen, doch eine Schwadron britischer Kavallerie tauchte mit gezogenen Säbeln aus einem Waldstück auf, um die Flanke der feindlichen Reiter zu bedrohen. Keine der beiden Parteien griff an, stattdessen beobachteten sie einander. Die Dudelsackpfeifer hörten mit ihrem Spiel auf. Die verbliebenen Galopper-Geschütze wurden jetzt aufgestellt, gegenüber dem langen Hang, auf dem die feindlichen Kanonen am Horizont zu sehen waren.
»Sind alle Musketen geladen?«, fragte Urquhart Colquhoun.
»Das sollten sie besser sein, Sir, oder ich werde ungemütlich!«
Urquhart saß ab. Er hatte ein Dutzend volle Feldflaschen an seinen Sattel gebunden und band jetzt sechs davon los und gab sie der Kompanie. »Lassen Sie verteilen«, befahl er. Sharpe wünschte, er hätte selbst zusätzliches Wasser mitgebracht. Ein Soldat füllte etwas Wasser in seine Hände und ließ es von seinem Hund saufen. Dann setzte sich der Hund und kratzte sein von Flöhen zerbissenes Fell, während sein Herr sich zurücklegte und seinen Hut über die Augen zog.
Der Feind sollte seine Infanterie einsetzen, dachte Sharpe. Die gesamte. Einen massiven Angriff vom Horizont in Richtung Hirsefeld führen. Das Flussbett mit einer Horde schreiender Krieger füllen, die Panik erzeugen und nach dem Sieg greifen würden.
Doch der Horizont blieb leer bis auf die Geschütze und die feindlichen Lanzenreiter.
Und so warteten die Rotröcke.
Colonel William Dodd, befehlshabender Offizier von Dodds Kobras, trieb sein Pferd auf den Höhenrücken und starrte den Hang hinab. Die britische Streitmacht war in Unordnung. Es sah für ihn aus, als seien zwei oder mehr Bataillone in Panik geflohen und hätten ein klaffendes Loch auf der rechten Seite in der Linie der Rotröcke zurückgelassen. Er zog sein Pferd herum und trieb es zu den Bannern, unter denen der Kriegsherr der Marathen wartete. Dodd zwang sein Pferd durch die Reihe der Adjutanten, bis er Prinz Manu Bappu erreichte.
»Werfen Sie alles nach vorn, Sahib«, riet er Bappu, »und zwar jetzt!«
Manu Bappu zeigte kein Anzeichen darauf, dass er Dodd gehört hatte. Der Marathen-Kommandeur war ein großer und schlanker Mann mit vernarbtem Gesicht und kurzem schwarzem Bart. Er trug ein gelbes Gewand, und sein silberner Helm war mit einem langen Pferdeschweif geschmückt. Er behauptete, dass er den Säbel, den er gezogen hatte, bei einem Kampf mit einem britischen Kavallerie-Offizier erbeutet hatte. Dodd bezweifelte das, denn der Säbel war kein Modell, das ihm bekannt war, doch er hütete sich, Bappu zu diesem Punkt zu befragen. Bappu war nicht wie die meisten der Marathen-Führer, die Dodd kannte. Bappu mochte ein Prinz und der jüngere Bruder des feigen Radscha von Berar sein, aber er war jedenfalls ein Kämpfer.
»Greifen Sie jetzt an!«, sagte Dodd eindringlich. Am Morgen hatte er davon abgeraten, überhaupt gegen die Briten zu kämpfen, doch jetzt hielt er diesen Rat für falsch, denn die britische Attacke war im Ansatz stecken geblieben, lange bevor sie Musketen-Reichweite erreicht hatte. »Greifen Sie mit allem an, was Sie haben, Sahib«, drängte Dodd.
»Wenn ich alles nach vorne werfe, Colonel Dodd«, sagte Bappu mit seiner sonderbar zischenden Stimme, »dann werden meine Geschütze das Feuer einstellen müssen. Sollen die Briten ins Kanonenfeuer marschieren, und dann lassen wir die Infanterie los.« Bappu hatte seine Schneidezähne durch einen Lanzenstoß verloren, und so zischte er seine Worte. Es klingt wie von einer Kobra, dachte Dodd. Bappu wirkte sogar wie eine Schlange. Vielleicht lag das an seinen verdeckten Augen, oder vielleicht auch nur, weil er eine stumme Bedrohung ausstrahlte. Aber er konnte wenigstens kämpfen. Bappus Bruder, der Radscha von Berar, war vor der Schlacht bei Assaye geflohen, doch Bappu, der nicht bei Assaye anwesend gewesen war, war kein Feigling. Er konnte zubeißen wie eine Schlange.
»Die Briten sind bei Assaye ins Kanonenfeuer marschiert«, grollte Dodd, »und dort waren es weniger, und wir hatten mehr Geschütze. Dennoch haben sie gesiegt.«
Bappu tätschelte sein Pferd, als es beim Donnern einer nahen Kanone scheute. Es war ein großer schwarzer Araberhengst, dessen Sattel reich mit Silber geschmückt war. Pferd und Sattel waren Geschenke eines arabischen Scheichs, dessen Stammesangehörige nach Indien gesegelt waren, um in Bappus Regiment zu dienen. Sie waren Söldner aus der erbarmungslosen Wüste, die sich die Löwen Allahs nannten, und man hielt sie für das wildeste und grausamste Regiment in ganz Indien. Die Löwen Allahs wurden von Bappu ins Feld geführt: eine Phalanx dunkelgesichtiger Männer in weißen Uniformen, bewaffnet mit Musketen und langen Krummsäbeln. »Meinen Sie wirklich, wir sollten vor unseren Geschützen kämpfen?«, fragte Bappu.
»Musketen werden mehr töten als Kanonen«, sagte Dodd. Eines mochte er an Bappu: Der Mann war bereit, auf seinen Rat zu hören. »Treffen Sie sie auf halbem Weg, Sahib, dünnen Sie die Bastarde mit Musketenfeuer aus, dann ziehen Sie sich zurück und lassen Sie die Kartätschen den Rest erledigen. Besser noch, Sahib, lassen Sie die Geschütze an den Flanken aufstellen, um Sie von dort zu beharken.«
»Dazu ist es zu spät«, meinte Bappu.
»Nun, vielleicht.« Dodd rümpfte die Nase. Warum die Inder stur darauf bestanden, Geschütze vor der Infanterie in Stellung zu bringen, konnte er nicht begreifen. Es war eine blöde Idee, aber sie ließen sich nicht davon abbringen. Immer wieder sagte er ihnen, sie sollten ihre Kanonen zwischen den Regimentern aufstellen, sodass die Kanoniere schräg über die Infanterie hinweg feuern konnten, doch indische Kommandeure nahmen an, dass der Anblick von Geschützen direkt vor ihnen ihre Männer aufmunterte. »Aber setzen Sie einige Infanterie vor ihnen ein, Sahib«, drängte er.
Bappu dachte über Dodds Vorschlag nach. Er mochte den Engländer nicht sehr – er war ein großer, linkischer und verdrossener Mann mit langen, gelblichen Zähnen und einer sarkastischen Art –, doch Bappu hielt seinen Rat für gut. Der Prinz hatte noch nie gegen die Briten gekämpft, und es war ihm klar, dass sie sich irgendwie von den anderen Feinden unterschieden, die er auf vielen Schlachtfeldern im westlichen Indien abgeschlachtet hatte. Da war eine unerschütterliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod bei diesen Rotröcken, die sie gelassen in die heftigste Kanonade marschieren ließ. Er hatte das noch nicht mit eigenen Augen gesehen, doch von genug Männern gehört, um den Berichten zu glauben. Dennoch fand er es schwer, die bewährten Schlachtmethoden aufzugeben. Es kam ihm unnatürlich vor, seine Infanterie vor seinen Geschützen vorrücken und somit die Artillerie erst einmal nutzlos warten zu lassen. Er verfügte über achtunddreißig Kanonen – alle schwerer als jene, die bis jetzt von den Briten eingesetzt worden waren –, und seine Kanoniere waren so gut ausgebildet wie die jeder anderen Armee. Achtunddreißig großkalibrige Kanonen konnten vorrückende Infanterie fein abschlachten, doch wenn stimmte, was Dodd sagte, dann würden die Rotröcke den Beschuss stoisch ertragen und sich nicht aufhalten lassen. Abgesehen davon, dass einige bereits geflüchtet waren, was darauf schließen ließ, dass sie nervös waren, war dies der Tag, an dem sich die Götter endlich gegen die Briten wenden würden.
»Ich habe heute Morgen zwei Adler vor der Sonne gesehen«, sagte Bappu nachdenklich.
Na und?, dachte Dodd. Die verdammten Inder sind großartig im Weissagen. Sie starren immer in Töpfe mit Öl oder konsultieren heilige Männer oder machen sich Sorgen wegen eines unerwartet herabfallenden Blattes, doch es gab keine bessere Weissagung des Sieges als der Anblick eines Feindes, der die Flucht ergriff, bevor er auch nur das Schlachtfeld erreicht hatte.
»Ich nehme an, die Adler bedeuten den Sieg?«, fragte Dodd höflich.
»So ist es«, stimmte Bappu zu. Und die Weissagung legte nah, dass der Sieg seiner sein würde, ganz gleich, welche Taktik er benutzte, was ihn dazu veranlasste, nichts Neues auszuprobieren. Prinz Manu Bappu hatte noch nie gegen die Briten gekämpft, aber ebenso wenig hatten die Briten den Löwen Allahs in einer Schlacht gegenübergestanden. Und die zahlenmäßig größere Anzahl sprach zu Bappus Gunsten. Er blockierte den britischen Vormarsch mit vierzigtausend Mann, während die Rotröcke nicht mal ein Drittel dieser Anzahl aufbieten konnten. »Wir werden warten«, entschied Bappu, »und den Feind näher kommen lassen.« Er würde ihn erst mit Kanonenfeuer zerschmettern und dann mit Musketenfeuer vernichten. »Vielleicht werde ich die Löwen Allahs einsetzen, wenn die Briten näher heran sind, Colonel«, sagte er, um Dodd zu beruhigen.
»Ein Regiment wird nicht reichen«, sagte Dodd. »Nicht einmal Ihre Araber. Werfen Sie jeden Mann nach vorne, die gesamte Linie.«
»Vielleicht«, sagte Bappu vage, obwohl er nicht vorhatte, seine Infanterie vor den kostbaren Geschützen vorrücken zu lassen. Er hatte es nicht nötig. Die Vision der Adler hatte ihn vom Sieg überzeugt, und er glaubte, dass seine Kanoniere diesen Sieg erringen würden. Er stellte sich tote Rotröcke auf dem Ackerland vor. Er würde Vergeltung für Assaye üben und beweisen, dass die Rotröcke wie jeder andere Feind sterben konnten. »Reiten Sie zu Ihren Männern, Colonel Dodd«, sagte er ernst.
Dodd zog sein Pferd herum und galoppierte zur rechten Seite der Linie, wo seine Kobras in vier Reihen warteten. Es war ein feines Regiment, hervorragend ausgebildet. Dodd hatte es aus der Belagerung von Ahmadnagar befreit und dann aus dem Chaos von Assaye herausgeholt. Zwei Niederlagen, doch Dodds Männer hatten nie mit der Wimper gezuckt. Das Regiment war ein Teil von Sindhias Armee gewesen, doch nach Assaye hatten sich die Kobras mit der Infanterie des Radschas von Berar zurückgezogen, und Prinz Manu Bappu, aus dem Norden gerufen, um das Kommando über Berars arg mitgenommene Truppen zu übernehmen, hatte Dodd überredet, seine Loyalität gegenüber Sindhia auf den Radscha von Berar zu übertragen. Dodd hätte seine Loyalität ohnehin gewechselt, denn der entmutigte Sindhia suchte nach einer Möglichkeit, Frieden mit den Briten zu schließen. Bappu hatte zudem der Überredung Dodds mit Gold, Silber und einer Beförderung zum Colonel Nachdruck verliehen. Dodds Männern, allesamt Söldner, war es gleichgültig, welchem Herrn sie dienten, solange ihre Geldbeutel voll waren.
Gopal, Dodds Stellvertreter, begrüßte die Rückkehr des Colonels mit einem bekümmerten Blick. »Wir rücken nicht vor?«
»Er will, dass die Geschütze die Arbeit erledigen.«
Gopal hatte Zweifel in Dodds Stimme gehört. »Und das werden sie nicht?«
»Das haben sie schon in Assaye nicht geschafft«, sagte Dodd mürrisch. »Verdammt! Wir sollten hier überhaupt nicht gegen sie kämpfen! Gib Rotröcken nie offenes Terrain. Wir sollten die Bastarde auf Wälle klettern und Flüsse durchqueren lassen.«
Dodd war nervös, weil er eine Niederlage befürchtete, und er hatte auch Grund dazu, denn die Briten hatten einen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. Dieses Kopfgeld betrug jetzt siebenhundert Guineen, fast sechstausend Rupien, und all das wurde in Gold demjenigen versprochen, der William Dodd tot oder lebendig bei der East India Company ablieferte. Dodd war Lieutenant in der Armee der Company gewesen, doch er hatte seine Männer angestiftet, einen Goldschmied zu ermorden. Vor dem Prozess war Dodd desertiert und hatte hundert Sepoys auf die Fahnenflucht mitgenommen. Das hatte dazu geführt, dass ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde, und der Preis auf seinen Kopf war gestiegen, nachdem Dodd und seine verräterischen Sepoys die Garnison der Company bei Chasalgaon ermordet hatten. Jetzt war Dodds Kopf ein Vermögen wert, und William Dodd wusste nur zu gut, was Gier bewirken konnte. Deshalb hatte er Angst. Wenn heute Bappus Armee zusammenbrach, so wie sich die Marathen-Armee bei Assaye aufgelöst hatte, dann würde Dodd ein Fahnenflüchtiger in einem offenen Terrain sein, das von feindlicher Kavallerie beherrscht wurde.
»Wir sollten sie in den Hügeln bekämpfen«, sagte er grimmig.
»Dann sollten wir sie bei Gawilgarh bekämpfen«, sagte Gopal.
»Gawilgarh?«, fragte Dodd.
»Es ist die größte aller Marathen-Festungen, Sahib. Nicht mal alle Armeen Europas könnten Gawilgarh einnehmen.« Gopal sah, dass Dodd bei dieser Behauptung skeptisch war. »Selbst alle Armeen der Welt könnten diese Festung nicht einnehmen, Sahib«, fügte er ernst hinzu. »Sie steht auf Felsen, die fast den Himmel berühren, und von ihren Wällen aus sehen Menschen winzig wie Läuse aus.«
»Da gibt es jedoch einen Weg hinein«, sagte Dodd. »Es gibt immer einen Weg hinein.«
»Stimmt, Sahib, doch der Weg nach Gawilgarh führt über einen felsigen Bergrücken und nur in eine äußere Festung. Man mag sich den Weg durch diese äußeren Wälle freikämpfen, doch dann gelangt man an eine Schlucht und stellt fest, dass die eigentliche Festung auf der anderen Seite der Schlucht liegt. Dort gibt es weitere Wälle, weitere Geschütze, und ein enger Pfad und riesige Tore blockieren den Weg.« Gopal seufzte. »Ich habe es einst gesehen, vor vielen Jahren, und gebetet, dass ich nie gegen einen Feind kämpfen muss, der dort Zuflucht gesucht hat.«
Dodd sagte nichts. Er starrte den sanften Hang hinab zu der wartenden Infanterie der Rotröcke. Alle paar Sekunden war ein Staubwölkchen zu sehen, wo eine Kanonenkugel auf dem Boden aufschlug.
»Wenn die Dinge heute schlecht laufen«, sagte Gopal ruhig, »dann sollten wir nach Gawilgarh gehen, denn dort werden wir sicher sein. Die Briten können uns folgen, uns jedoch nicht erreichen. Sie werden an Gawilgarhs Felsen zerbrechen, während wir uns an den Wasserbecken der Festung ausruhen. Wir werden im Himmel sein, und sie werden wie Hunde unter uns sterben.«
Wenn Gopal recht hatte, würde er in Gawilgarh vor den Männern des Königs in Sicherheit sein. Aber zuerst mussten sie die Festung erreichen, und vielleicht würde das gar nicht nötig sein, denn möglicherweise gelang es Manu Bappu, die Rotröcke bereits hier zu besiegen. Bappu glaubte, dass keine Infanterie in Indien es mit seinen arabischen Söldnern aufnehmen konnte.
In der Ferne auf der Ebene konnte Dodd sehen, dass die beiden Bataillone, die in das Hirsefeld geflüchtet waren, jetzt zurück in die Linie gebracht wurden. Bald würde die Linie wieder vorrücken.
»Sag, dass unsere Geschütze nicht feuern sollen«, befahl er Gopal. Dodds Kobras besaßen fünf kleine eigene Kanonen, die dazu dienten, das Regiment zu unterstützen. Dodds Geschütze waren nicht vor den Männern in den weißen Uniformen postiert, sondern auf der rechten Flanke, wo sie den Feind mit einem mörderischen Feuerhagel von der Seite eindecken konnten. »Lass mit Kartätschen laden«, befahl er, »und wartet, bis sie nahe heran sind.« Vielleicht siegten sie hier, doch wenn das Schicksal es anders entschied, dann musste Dodd zumindest überleben und an einem anderen Platz weiterkämpfen, wo kein Mann besiegt werden konnte.
Bei Gawilgarh.
Die britische Linie rückte schließlich vor. Von Osten nach Westen erstreckte sie sich drei Meilen, wand sich durch Hirsefelder und wieder hinaus, durch Weideland und das breite, trockene Flussbett. Das Zentrum war eine Schlachtlinie von dreizehn Infanterie-Bataillonen, drei davon schottische und der Rest Sepoys, während zwei Regimenter Kavallerie auf der linken Flanke und vier auf der rechten vorrückten. Jenseits der regulären Kavallerie gab es zwei Abteilungen von Söldner-Reitern, die sich mit den Briten zusammengetan hatten, weil sie sich Beute erhofften. Trommeln dröhnten und Dudelsäcke spielten. Die Fahnen flatterten über den Köpfen. Ein großer Streifen Hirse wurde platt getreten, als die schwerfällige Linie nach Norden marschierte. Die britischen Geschütze eröffneten mit ihren Sechspfündern das Feuer auf die Marathen-Geschütze.
Diese Marathen-Geschütze feuerten ständig. Sharpe, der hinter der linken Flanke der 6. Kompanie ging, beobachtete ein besonderes Geschütz, das neben einer leuchtend bunten Gruppe von Fahnen auf der vom Feind gehaltenen Horizontlinie stand. Langsam zählte er bis sechzig, dann zählte er wieder und erkannte, dass das Geschütz fünf Schuss in zwei Minuten geschafft hatte. Er konnte nicht sicher sein, wie viele Geschütze am Horizont waren, denn eine große Wolke von Pulverrauch verbarg die Sicht darauf, doch er versuchte die Mündungsblitze inmitten des grauweißen Nebels zu zählen und schätzte, dass fast vierzig Kanonen dort feuerten. Vierzig mal fünf Schuss, das waren zweihundert. Also wurden hundert Schuss pro Minute gefeuert, und jeder Schuss, wenn gut gezielt, konnte zwei Mann töten, einen in der vorderen Reihe und einen dahinter. Wenn der Angriff nahe war, würden die Bastarde natürlich Kartätschen verwenden, und dann konnte jeder Schuss ein Dutzend Männer aus der Linie ausschalten. Jetzt stapften die Rotröcke noch schweigend vorwärts, und der Feind schickte Kanonenkugeln den sanften Hang hinab. Viele davon gingen daneben. Einige flogen über die Linie hinweg, ein paar schlugen davor auf, aber die feindlichen Kanoniere waren gut. Sie richteten ihre Kanonen mit der Zeit so aus, dass die Kugeln vom Boden vor der Linie der Rotröcke abprallten, und dann mehrfach hüpften und schließlich in Hüfthöhe oder tiefer doch noch ein Ziel fanden, es »streiften«, wie es die Kanoniere nannten. Wenn der erste Aufschlag zu weit vor der Linie des Feindes erfolgte, verlor die Kugel an Schwung, und die Rotröcke jubelten, wenn sie vor ihnen harmlos ausrollte, und wenn das erste Auftreffen zu nahe an der Angriffslinie geschah, konnte die Kugel über die Rotröcke hinwegfliegen. Die Kunst war, die Kugel so tief zu zielen, dass sie den Rotröcken die Beine wegriss.
Sharpe ging an einer verschossenen Kanonenkugel vorbei, die zwanzig Schritte vom Opfer entfernt lag und klebrig vom Blut war, auf dem es von Fliegen wimmelte.
»Aufschließen!«, brüllten die Sergeants, und Männer füllten die Lücken. Die britischen Geschütze feuerten in die Pulverrauchwolke des Feindes, doch ihre Geschosse schienen keine Wirkung zu haben, und so wurden die Geschütze weiter vorwärts befohlen. Die Ochsengespanne wurden herangebracht, die Geschütze aufgeprotzt und die Sechspfünder den Hang hinaufgezogen.
»Wie Kegeln.« Ensign Venables war an Sharpes Seite aufgetaucht. Roderick Venables war mit sechzehn Jahren der 7. Kompanie zugeteilt worden. Er war der jüngste Offizier des Bataillons gewesen, bis Sharpe hinzugekommen war, und Venables sah es als seine Aufgabe an, Sharpe beizubringen, wie sich Offiziere benehmen sollten. »Sie räumen uns ab wie auf der Kegelbahn, nicht wahr, Richard?«
Bevor Sharpe etwas erwidern konnte, warfen sich ein halbes Dutzend Männer zur Seite, als eine Kanonenkugel hart und tief auf sie zu hüpfte. Sie peitschte harmlos durch die Lücke, die sie geschaffen hatten. Die Männer lachten, weil sie ihr ausgewichen waren, und dann wurden sie von Sergeant Colquhoun in ihre Reihen zurückbefohlen.
»Sollten Sie nicht auf der Linken Ihrer Kompanie sein?«, fragte Sharpe Venables.
»Sie denken immer noch wie ein Sergeant, Richard«, sagte Venables. »Schweineohren ist es gleichgültig, wo ich bin.«
»Schweineohren« war Captain Lomax. Er hatte seinen Spitznamen nicht wegen irgendeiner Besonderheit seiner Ohren erhalten, sondern weil er eine Leidenschaft für kross gebratene Schweineohren hatte. Lomax war unbeschwert, nicht wie Urquhart, der sich streng an die Vorschriften hielt. »Außerdem«, fuhr Venables fort, »ist dort verdammt wenig zu tun. Die Jungs kennen ihren Job.«
»Es ist vertane Zeit, ein Ensign zu sein«, sagte Sharpe.
»Blödsinn! Ein Ensign ist nur ein Colonel in der Ausbildung«, sagte Venables. »Unsere Pflicht, Richard, ist es, eine Zierde zu sein und lange genug am Leben zu bleiben, um befördert zu werden. Aber keiner erwartet von uns, dass wir nützlich sind! Guter Gott! Ein rangniedriger Offizier soll nützlich sein? Das wäre ja ein Hammer.« Venables brach in Gelächter aus. Er war ein aufgeblasener, eitler Junge, aber einer der wenigen Offiziere im 74., die Sharpe Kameradschaft boten. »Haben Sie gehört, dass eine Ersatztruppe nach Madras gekommen ist?«, fragte er.
»Urquhart hat mir das gesagt.«
»Frische Männer. Neue Offiziere, dann werden Sie kein Neuling mehr sein.«
Sharpe schüttelte den Kopf. »Das kommt auf das Datum an, an dem die neuen Männer ihr Patent bekommen haben, nicht wahr?«
»Nehme ich an. Ganz recht. Und sie müssen von Britannien hergesegelt sein, lange bevor Sie die Leiter raufgeklettert sind. So werden Sie immer noch das Baby in der Offiziersmesse sein. Pech, alter Junge.«
Alter Junge? Stimmt, dachte Sharpe. Er war alt. Vermutlich zehn Jahre älter als Venables, doch Sharpe war sich nicht ganz sicher, denn niemand hatte sich die Mühe gemacht, sein Geburtsdatum aufzuschreiben. Ensigns waren Jungs, und Sharpe war ein Mann.
Venables stieß plötzlich einen Freudenschrei aus, und Sharpe blickte auf und sah, dass eine Kanonenkugel den Rand eines Bewässerungskanals getroffen hatte und mit einem Schauer von Erdreich aufwärts hüpfte.
»Schweineohren hat gesagt, er hat mal zwei Kanonenkugeln in der Luft miteinander kollidieren gesehen«, sagte Venables. »Nun, er hat es natürlich nicht tatsächlich gesehen, aber gehört. Er sagte, sie seien plötzlich am Himmel aufgetaucht. Peng! Und dann sind sie nach unten geplumpst.«
»Sie müssen in Stücke gebrochen sein«, meinte Sharpe.
»Das sind sie laut Schweineohren nicht«, behauptete Venables. »Er sagte, sie haben sich abgeplattet.« Eine Granate explodierte vor der Kompanie, und Metallstückchen flogen über die Männer hinweg. Keiner wurde verwundet, und die Reihen traten um die rauchenden Fragmente herum. Venables bückte sich, klaubte ein Stück auf und schwenkte es wegen der Hitze.
»Ich liebe Andenken«, sagte er und schob das Stück Eisen in eine Tasche. »Ich werde es nach Hause an meine Schwestern schicken. Warum stoppen unsere Geschütze nicht und feuern?«
»Sie sind noch zu weit entfernt«, sagte Sharpe. Die vorrückende Linie musste noch eine halbe Meile zurücklegen, und während die Sechspfünder auf diese Distanz feuern konnten, mussten sich die Kanoniere entschieden haben, wirklich nahe heranzugehen, damit ihre Schüsse nicht danebengingen. Geh nahe heran, das hatte Colonel McCandless immer zu Sharpe gesagt. Es war das Geheimnis der Schlacht. Geh nahe heran, bevor du mit dem Abschlachten anfängst.
Eine Kanonenkugel traf eine Reihe der 7. Kompanie. Es war nach ihrem ersten Aufprall mit der vollen Geschwindigkeit. Und zwei Männer taumelten in einem Schwall von Blut zurück.
»Mein Gott«, stieß Venables hervor. »Mein Gott!« Die Leichen waren ein Durcheinander von zersplitterten Knochen, zerrissenen Eingeweiden und zerschmetterten Waffen. Ein Corporal, dessen Aufgabe es war, die Reihen zu schließen, bückte sich, um den Gefallenen die Patronentaschen abzunehmen. »Zwei weitere Namen in der Kirche«, bemerkte Venables. »Wer war das, Corporal?«
»Die McFadden-Brüder, Sir!« Der Corporal musste schreien, um im Donnern der Marathen-Geschütze gehört zu werden.
»Arme Kerle«, sagte Venables. »Aber da gibt es noch sechs andere McFaddens. Eine fruchtbare Lady, diese Rosie McFadden.«
Sharpe überlegte, was das bedeutete, und glaubte es zu wissen. Venables war trotz seiner blasierten Miene blass, als hätte ihm der schreckliche Anblick der Leichen Übelkeit bereitet. Dies war seine erste Schlacht, denn er war während der Schlacht von Assaye an der Malabar-Krätze erkrankt gewesen. Der Ensign hatte immer erklärt, dass ihn der Anblick von Blut nicht aufregte, weil er seinem Vater, einem Chirurg aus Edinburgh, oft assistiert hatte, doch jetzt drehte er sich plötzlich zur Seite und erbrach sich. Sharpe ging unerschütterlich weiter. Einige der Männer wandten beim Geräusch von Venables Erbrechen den Kopf.
»Augen – geradeaus!«, bellte Sharpe.
Sergeant Colquhoun blickte gereizt zu Sharpe. Der Sergeant glaubte, dass jeder Befehl, der nicht von ihm oder von Captain Urquhart kam, ein unnötiger war.
Venables holte Sharpe ein. »Da muss ich irgendwas Verdorbenes gegessen haben.«
»Das kommt in Indien vor«, sagte Sharpe mitfühlend.
»Bei Ihnen nicht.«
»Bis jetzt noch nicht«, sagte Sharpe und wünschte, er hätte eine Muskete und könnte deren hölzernen Schaft als Glücksbringer berühren.
Captain Urquhart lenkte sein Pferd nach links. »Zu Ihrer Kompanie, Mister Venables!«
Venables ging hastig davon, und Urquhart ritt zurück zur rechten Flanke, ohne Sharpes Anwesenheit zur Kenntnis zu nehmen. Major Swinton, der das Bataillon befehligte, während Colonel Wallace für die Brigade verantwortlich war, galoppierte hinter den Reihen heran. Der Hufschlag trommelte dumpf auf der trockenen Erde. »Alles in Ordnung?«, rief Swinton Urquhart zu.
»Alles in Ordnung!«
»Guter Mann!« Swinton galoppierte weiter.
Die feindlichen Geschütze feuerten jetzt ständig, wie Donner, der nicht enden wollte. Ein Donner, in dem das Spiel der Dudelsackpfeifer fast unterging. Erdreich stieg wie Fontänen auf, wo Kanonenkugeln einschlugen.
Sharpe, der nach links blickte, sah entlang der langen Linie Gefallene liegen. Jenseits davon war ein Dorf. Wie, zur Hölle, war er an einem Dorf vorbeigegangen, ohne es auch nur zu bemerken? Es war nur eine Ansammlung von Hütten mit Dächern aus Schilf, mit einigen von Kakteen eingezäunten Vorgärten, aber er war daran vorbeigegangen, ohne sie wahrzunehmen. Niemand ließ sich dort blicken. Die Dorfbewohner hatten bestimmt ihre paar Töpfe und Pfannen gepackt und sich davongemacht, als sie den ersten Soldaten in der Nähe ihrer Felder gesehen hatten. Eine Kanonenkugel der Marathen-Geschütze schlug in eine der Hütten, zerschlug Schilf und Balken und ließ das Dach einstürzen.
Sharpe blickte in die andere Richtung und sah feindliche Kavallerie nahen. Sie war noch fern, und dann erhaschte er einen Blick auf die blauen und gelben Uniformen britischer leichter Dragoner, die dem Feind entgegen ritten. Gezogene Säbel spiegelten den Sonnenschein des späten Nachmittags wider. Sharpe glaubte, Trompetengeschmetter zu hören, aber vielleicht bildete er sich das im Hämmern der Waffen auch nur ein. Die Reiter verschwanden hinter einer Baumgruppe. Eine Kanonenkugel flog über die Linie hinweg und eine Granate explodierte zu ihrer Linken, dann verschob sich die Leichte Kompanie des 74., um einem Ochsengespann Platz zu machen, das südwärts zurückkehrte. Die britischen Kanonen waren weit voraus vor die Angriffslinie gezogen worden, und sie waren jetzt gedreht und aufgestellt. Kanoniere rammten Geschosse hinein, schoben Zündröhrchen in die Zündlöcher und traten zurück. Das Donnern der Geschütze hallte über das Feld, verdeckte die Sicht mit grauweißem Rauch und erfüllte die Luft mit dem widerlichen Gestank von faulen Eiern.
Die Trommler trommelten weiter, bestimmten den Rhythmus auf dem langen Marsch nordwärts. Im Moment war es eine Schlacht der Artilleristen. Die kleinen britischen Sechspfünder feuerten in die Rauchwolke, wo die größeren Marathen-Geschütze auf die vorrückenden Rotröcke feuerten.
Schweiß tröpfelte von Sharpes Stirn, brannte in seinen Augen und tropfte von seiner Nase. Fliegen schwirrten um sein Gesicht. Er zog den Säbel und stellte fest, dass der Griff glitschig vom Schweiß war. So wischte er ihn ab und rieb seine schweißnasse Hand am Saum seines roten Uniformrocks trocken. Plötzlich musste er dringend Wasser lassen, doch dies war nicht der richtige Zeitpunkt, um anzuhalten und den Hosenschlitz aufzuknöpfen. Halt es an, sagte er sich, pinkeln kannst du, wenn die Bastarde besiegt sind. Oder piss in die Hose, denn keiner kann das vom Schweiß unterscheiden, und es wird schnell genug trocknen. Wird aber riechen. Besser, du wartest. Wenn einer der Männer wüsste, dass ich mir in die Hosen gepisst habe, würde ich das nie ertragen. Hosenpisser Sharpe.
Eine Kanonenkugel sauste so nahe an Sharpe vorbei, dass sie ihm beinahe den Hut vom Kopf riss. Ein Fragment von etwas schwirrte an seiner linken Seite vorbei. Ein Mann lag am Boden und erbrach Blut. Ein Hund kläffte, und ein anderer zerrte bläuliche Gedärme aus einem aufgerissenen Bauch. Das Tier hatte beide Vorderpfoten auf die Leiche gelegt. Ein Corporal verscheuchte den Hund mit einem Tritt, doch als der Mann weiterging, rannte der Hund zu der Leiche zurück.
Sharpe sehnte sich nach einem Bad. Er wusste, dass er verlaust war, aber das war schließlich jeder. Selbst General Wellesley war vermutlich verlaust. Sharpe blickte ostwärts und sah den General hinter dem 78. Regiment, welches Kilts trug, reiten. Sharpe war bei Assaye Wellesleys Ordonnanz gewesen, und deshalb kannte er all die Stabsoffiziere, die hinter dem General ritten. Sie waren viel freundlicher als die Offiziere des
74. gewesen, aber da hatte man nicht von ihnen erwartet, dass sie ihn als Gleichberechtigten behandelten.
Leckt mich, dachte er. Vielleicht sollte er Urquharts Rat beherzigen. Heimkehren, das Geld nehmen, eine Kneipe kaufen und den Säbel an die Garderobe hängen. Würde Simone Joubert mit ihm nach England gehen? Vielleicht machte es ihr Spaß, eine Gaststätte zu betreiben. »Der beschissene Traum« konnte er die Kneipe nennen, und er würde von jedem Armeeoffizier den doppelten Preis für jedes Getränk verlangen.
Die Marathen-Geschütze verstummten plötzlich, wenigstens diejenigen, die direkt vor dem 74. waren, und der Wechsel in der Geräuschkulisse ließ Sharpe in die Rauchwolke spähen, die nur eine Viertelmeile entfernt über dem Hügelkamm hing. Weiterer Rauch hüllte das 74. ein, doch er stammte von den britischen Geschützen. Der Rauch des Feindes lichtete sich, wurde vom leichten Wind nordwärts getragen, aber es war nicht zu erkennen, weshalb die Geschütze in der Mitte der Marathen-Linie das Feuer eingestellt hatten. Vielleicht war den Scheißern die Munition ausgegangen. Wunschdenken, dachte Sharpe. Oder vielleicht laden sie mit Kartätschen auf, um die nahenden Rotröcke willkommen zu heißen.
Gott, er musste dringend pinkeln. Er hielt an, klemmte den Säbel unter einen Arm und knöpfte die Hose auf. Bei seiner Fummelei sprang ein Knopf ab. Er fluchte, bückte sich, um ihn aufzuheben, und dann leerte er seine Blase auf den trockenen Boden. In diesem Moment zog Urquhart sein Pferd herum und trieb es zu ihm. »Muss das jetzt sein, Mister Sharpe?«, fragte er gereizt.
Jawohl, Sir, die Blase war voll, sonst platze ich, Sir, und Sie sollen mit Ihren scharfen Augen verdammt sein, Sir, dachte Sharpe.
»Tut mir leid, Sir«, sagte Sharpe stattdessen. Anständige Offiziere pissten also vielleicht nicht? Er spürte, dass die Kompanie über ihn lachte, und rannte los, um sie einzuholen, wobei er an den Hosenknöpfen fummelte. Immer noch war nichts von den Geschützen in der Marathen-Linie zu hören. Warum nicht?
In diesem Moment feuerte eine Kanone auf einer der Flanken des Feindes schräg über das Feld, und die Kugel streifte durch die sechste Kompanie, riss einen Mann in der ersten Reihe von den Füßen und verwundete einen Mann hinter ihm an den Knien. Ein anderer Soldat begann zu humpeln, weil sein Bein von einem Knochensplitter seines Nachbarn aufgerissen worden war. Corporal McCallum, dessen Aufgabe es war, die Reihen zu schließen, zog einen Mann in die Lücke, während ein Dudelsackspieler herbeirannte, um den Verwundeten zu verbinden. Die Verwundeten wurden dort, wo sie gefallen waren, liegen gelassen, bis sie nach der Schlacht – sofern sie noch lebten – zu den Chirurgen getragen wurden. Und wenn sie deren Messer und Sägen überlebten, würden sie heimtransportiert werden, für nichts mehr tauglich, nur eine Last für die Gemeinde. Oder vielleicht hatten die Schotten keine Gemeinden. Sharpe war sich nicht sicher, aber er wusste genau, dass die Scheißer Armenhäuser hatten. Jeder hatte Armenhäuser und Armenfriedhöfe. Besser hier in der schwarzen Erde des feindlichen Indien begraben zu sein, als zu der Mildtätigkeit eines Armenhauses verdammt zu sein.