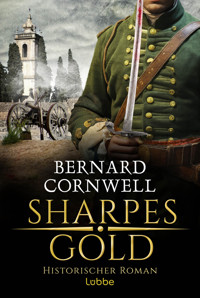9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Portugal 1811. Sharpe und seine Rifles sind gerade noch rechtzeitig zur Stelle, um die Vergewaltigung eines Mädchens zu verhindern. Die Übeltäter sind Mitglieder der Loup Brigade, einer französischen Eliteeinheit, benannt nach ihrem berüchtigten Kommandanten Brigadier Guy Loup. Und es kommt noch schlimmer: Die Männer haben alle Bewohner eines nahegelegenen Dorfes niedergemetzelt - sogar die Kinder. Für Sharpe steht fest: Von nun an heißt es Sharpes Rifles gegen die Loup Brigade.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Teil I
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
Teil II
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
HISTORISCHE ANMERKUNG
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 80er-Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
Weitere Informationen finden Sie aufwww.bernardcornwell.net
Bernard Cornwell
SHARPESGEFECHT
Richard Sharpe und die Schlachtvon Fuentes de Oñoro, Mai 1811
Aus dem Englischen vonRainer Schumacher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1996 by Bernard Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Battle«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Rainer Delfs
Titelillustration: © Bao Pham
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-4602-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Sharpes Schlacht istSean Bean gewidmet
Teil I
KAPITEL EINS
Sharpe fluchte und drehte die Karte frustriert um. »Das Ding ist völlig unbrauchbar«, knurrte er.
»Wir könnten immer noch Feuer damit machen«, schlug Sergeant Harper vor. »Guter Zunder ist in diesen Hügeln selten.«
»Für was anderes ist die auch nicht zu gebrauchen«, sagte Sharpe. Die von Hand gezeichnete Landkarte zeigte verstreute Dörfer. Dünne Linien stellten Straßen, Bäche oder Flüsse dar, und ein paar vage Wellen sollten wohl Hügel sein, doch alles, was Sharpe sah, waren Berge. Keine Straßen und keine Dörfer, sondern nur graue, kahle, von Felsen übersäte Berge, deren Gipfel im Nebel lagen, und schmale Täler, durch die vom Regen angeschwollene Bäche rauschten. Sharpe hatte seine Kompanie ins Hochland an der Grenze von Spanien und Portugal geführt, und dort hatten sie sich dann verirrt. Doch seine Kompanie, vierzig Soldaten mit Tornistern, Provianttaschen, Munitionskisten und Waffen, schien das nicht zu kümmern. Sie waren einfach nur dankbar für die Rast, und so saßen oder lagen sie neben dem Weg im Gras. Ein paar zündeten sich Pfeifen an, und andere schliefen, während Captain Richard Sharpe die Karte auf den Kopf drehte und dann vor Wut zu einem Ball zerknüllte. »Verdammt, wir haben uns verirrt«, verkündete er das Offensichtliche und korrigierte sich dann ehrlich: »Ich habe mich verirrt.«
»Mein Großvater hat sich auch mal verirrt«, erzählte Harper hilfsbereit. »Er hatte sich einen jungen Stier von einem Kerl in Cloghanelly gekauft und wollte eine Abkürzung über die Derryveagh Mountains nehmen. Dann kam Nebel auf, und mein Großvater konnte rechts von links nicht mehr voneinander unterscheiden. Er hatte sich verirrt wie ein Lamm, ja, das hatte er, und dann ist auch noch der Stier in den Nebel gerannt und im Barra Valley über eine Klippe gesprungen. Mein Großvater hat immer erzählt, dass man das arme Tier auf dem ganzen Weg nach unten brüllen hören konnte, und dann hat es einen Schlag gegeben, als hätte man einen Dudelsack vom Kirchturm geworfen, nur lauter, denn mein Großvater schätzte, dass der Knall noch in Ballybofey zu hören war. Später haben wir immer darüber gelacht, doch damals nicht. Gott, nein, damals war das eine Tragödie. Wir konnten es uns nämlich nicht leisten, einen guten Jungstier zu verlieren, und …«
»Und Jesus weinte«, unterbrach Sharpe ihn. »Ich kann mir auch etwas nicht leisten, nämlich einen verdammten Sergeant zu verlieren, der nichts Besseres zu tun hat, als über einen verdammten Stier zu plappern!«
»Das Tier war sehr wertvoll!«, protestierte Harper. »Außerdem haben wir uns doch verirrt, Sir, und nichts Besseres zu tun.«
Lieutenant Price, der auf dem Marsch die Nachhut kommandiert hatte, gesellte sich nun zu seinem befehlshabenden Offizier. »Haben wir uns verirrt, Sir?«
»Nein, Harry, wir sind nur hier, weil mir die Gegend so gut gefällt – wo auch immer ›hier‹ sein mag.« Grimmig ließ Sharpe seinen Blick über das feuchte, öde Tal wandern. Für gewöhnlich war er sehr stolz auf seinen Orientierungssinn und seine Fähigkeit, sich in fremden Gegenden zurechtzufinden, doch jetzt hatte er sich völlig verirrt, und da die Wolken auch noch die Sonne verbargen, wusste er noch nicht einmal, wo Norden lag. »Wir brauchen einen Kompass«, sagte er.
»Oder eine Karte«, schlug Lieutenant Price fröhlich vor.
»Wir haben eine verdammte Karte. Hier.« Sharpe drückte seinem Lieutenant den Papierball in die Hand. »Major Hogan hat die für mich gezeichnet, und ich kann nichts damit anfangen, absolut gar nichts.«
»Ich war nie gut im Kartenlesen«, gestand Price. »Einmal habe ich mich verirrt, als ich ein paar Rekruten von Chelmsford in die Kaserne führen sollte, und das war eine gerade Straße. Damals hatte ich auch eine Karte. Offenbar habe ich ein Talent, mich zu verirren.«
»Mein Großvater war genauso«, erklärte Harper stolz. »Er war kaum durch die Tür, da hat er sich schon verlaufen. Ich habe unserem Captain hier gerade erzählt, wie er mal einen Jungstier nach Slieve Snaght geführt hat. Das Wetter war ziemlich übel, wissen Sie, und er hat eine Abkürzung genommen …«
»Halt einfach den Mund«, knurrte Sharpe.
»An dem zerstörten Dorf sind wir falsch abgebogen«, sagte Price, legte die Stirn in Falten und schaute sich die zerknüllte Karte an. »Ich glaube, wir hätten auf der anderen Seite des kleinen Flusses bleiben sollen, Sir.« Price zeigte es Sharpe auf der Karte. »Das heißt, wenn das denn das Dorf hier ist. Das ist wirklich schwer zu sagen. Aber in jedem Fall bin ich sicher, dass wir den kleinen Fluss nicht hätten überqueren dürfen, Sir.«
Sharpe nahm an, dass der Lieutenant recht hatte, aber er wollte das nicht zugeben. Sie hatten den kleinen Fluss vor zwei Stunden überquert, und Gott allein wusste, wo sie jetzt waren. Sharpe wusste noch nicht einmal, ob sie sich noch in Portugal oder schon in Spanien befanden, und die Landschaft und das Wetter sahen auch noch mehr nach Schottland als nach der iberischen Halbinsel aus. Eigentlich sollte Sharpe nach Vilar Formoso marschieren, wo seine Kompanie, die Leichte Kompanie des South Essex Regiments, dem Bürgermeister als Leibgarde dienen sollte, eine Aussicht, die Sharpe nicht gerade fröhlich stimmte. Garnisonsdienst war nur wenig besser, als Militärpolizei zu spielen, und Militärpolizisten waren die niedrigste Lebensform in der Armee. Doch dem South Essex Regiment mangelte es an Männern, also hatte man es von der Front abgezogen und ihm administrative Aufgaben zugeteilt. Der größte Teil des Regiments eskortierte mit Nachschub beladene Ochsenkarren, die man mit Barken den Tajo hinauf aus Lissabon gebracht hatte, oder es bewachte französische Gefangene auf dem Weg zu den Schiffen, die sie nach England bringen sollten. Doch die Leichte Kompanie hatte sich verirrt, und das nur, weil Sharpe geglaubt hatte, Kanonendonner in der Ferne zu hören. Er war sofort in Richtung des Geräuschs marschiert, aber nur um festzustellen, dass er sich geirrt hatte. Der Gefechtslärm – wenn es denn wirklich Gefechtslärm und nicht einfach nur Donner gewesen war – war verhallt, und jetzt wusste Sharpe nicht mehr, wo er war.
»Sind Sie sicher, dass das hier das zerstörte Dorf ist?«, fragte er Price und deutete auf den Punkt auf der Karte, den sein Lieutenant ihm gezeigt hatte.
»Beschwören würde ich das nicht, Sir. Wie gesagt, ich kann keine Karten lesen. Es könnte jede der Kritzeleien hier sein – oder gar keine.«
»Warum, zum Teufel, zeigen Sie mir das dann?«
»In der Hoffnung, Sie zu inspirieren, Sir«, antwortete Price in beleidigtem Ton. »Ich habe nur versucht zu helfen, Sir. Ich wollte Ihnen Hoffnung machen.« Er schaute wieder auf die Karte. »Vielleicht ist die Karte ja einfach nicht gut«, sagte er.
»Wir könnten sie immer noch als Zunder nehmen«, wiederholte Harper seinen Vorschlag.
»Eines ist jedenfalls sicher«, sagte Sharpe, als er Price die Karte wieder abnahm, »wir haben die Wasserscheide noch nicht überquert, und das wiederum heißt, dass diese Bäche und Flüsse nach Westen fließen müssen.« Er hielt kurz inne. »Es sei denn natürlich, die ganze verdammte Welt steht auf dem Kopf, was vermutlich auch stimmt, aber solange auch nur die kleinste Chance besteht, dass dem verdammt noch mal nicht so ist, werden wir den Wasserläufen folgen. Hier …« Er warf Harper die Karte zu. »Zunder.«
»Das hat mein Großvater auch getan«, sagte Harper und steckte die zerknüllte Karte in seine ausgeblichene und ausgefranste grüne Jacke. »Er ist dem Wasser gefolgt …«
»Halt den Mund«, befahl Sharpe ihm wieder, doch er klang nicht mehr wütend. Stattdessen senkte er die Stimme, und gleichzeitig bedeutete er seinen Kameraden mit der linken Hand, sich hinzuhocken. »Da ist ein verdammter Froschfresser«, sagte er, »oder etwas Ähnliches. Ich habe so eine Uniform noch nie gesehen.«
»Verdammt«, sagte Price und duckte sich auf dem Pfad.
Denn knapp zweihundert Yards entfernt war ein Reiter aufgetaucht. Der Mann hatte die britischen Infanteristen noch nicht gesehen, und er schien auch nicht nach Feinden Ausschau zu halten. Im Schritt ritt er aus einem Seitental. Dann zügelte er sein Pferd, schwang sich müde aus dem Sattel, schlang die Zügel um seinen Arm, öffnete seine Hose und pisste neben den Weg. Von seiner Pfeife stieg Rauch in die feuchte Luft auf.
Harpers Gewehr klickte, als er den Hahn spannte. Sharpes Männer, sogar die, die bis jetzt geschlafen hatten, waren nun allesamt hellwach und lagen regungslos im Gras. Selbst wenn sich der Reiter umdrehte, würde er sie nicht entdecken. Sharpes Einheit bestand aus erfahrenen Plänklern. Seit zwei Jahren kämpften sie nun schon in Portugal und Spanien und nahmen es mit jedem auf.
»Erkennen Sie die Uniform?«, flüsterte Sharpe zu Price.
»Die habe ich noch nie gesehen, Sir.«
»Pat?«, wandte Sharpe sich an Harper.
»Der sieht wie ein verdammter Russe aus«, antwortete Harper. Er hatte zwar noch nie einen russischen Soldaten gesehen, aber aus irgendeinem Grund hatte er sich diese Kreaturen immer grau vorgestellt, und der geheimnisvolle Reiter war ganz in Grau gekleidet. Er trug eine kurze Dragonerjacke, eine graue Hose und hatte einen grauen Rosshaarschweif auf dem stahlgrauen Helm. Oder vielleicht, dachte Sharpe, war das auch nur ein grauer Stoffüberzug, damit das Metall des Helms nicht in der Sonne funkelte.
»Ein Spanier?«, überlegte Sharpe laut.
»Die Dons mögen es bunt, Sir«, sagte Harper. »Die sterben nicht gern in tristem Stoff.«
»Vielleicht ist das ja ein Guerillero«, schlug Sharpe vor.
»Er trägt eine Froschhose«, sagte Price, »und Froschwaffen.« Der pissende Reiter war in der Tat bewaffnet wie ein französischer Dragoner. Er trug einen geraden Säbel und hatte einen kurzen Karabiner im Sattelholster sowie Pistolen im Gürtel. Und er trug die Saroual genannte weite Hose, die bei den französischen Dragonern so beliebt war, doch Sharpe hatte noch nie einen französischen Dragoner in grauer Jacke gesehen. Die trugen immer Grün, allerdings nicht das dunkle Grün der britischen Riflemen, sondern ein helleres, leuchtendes.
»Vielleicht ist den Bastarden ja die grüne Farbe ausgegangen«, sagte Harper. Dann verstummte er, als der Reiter seine weite Hose zuknöpfte und sich wieder in den Sattel schwang. Der Mann ließ seinen Blick über das Tal schweifen, doch er sah offenbar nichts, was ihm Sorgen bereiten würde. Also wendete er sein Pferd und ritt wieder in das kleine Tal zurück. »Das war ein Kundschafter«, sagte Harper leise. »Er sollte nachsehen, ob jemand hier ist.«
»Dann hat er verdammt schlechte Arbeit gemacht«, bemerkte Sharpe.
»Wie auch immer«, sagte Price, »es ist gut, dass wir in die andere Richtung gehen.«
»Nein, das tun wir nicht, Harry«, widersprach Sharpe ihm. »Wir werden nachsehen, was das für Bastarde sind und was sie vorhaben.« Er deutete den Hang hinauf. »Sie zuerst, Harry. Nehmen Sie Ihre Männer, marschieren Sie halb rauf und warten Sie dann.«
Lieutenant Price führte die Rotröcke von Sharpes Kompanie den steilen Hang hinauf. Die eine Hälfte der Kompanie trug die roten Jacken der britischen Linieninfanterie und die andere wie Sharpe auch die grünen Jacken der Rifle-Regimenter. Es war einer dieser typischen Zufälle des Krieges gewesen, der Sharpe mit seinen Riflemen zu einem Rotrock-Bataillon geführt hatte, und die Bürokratie hatte anschließend dafür gesorgt, dass sie auch dort geblieben waren, und jetzt konnte man die Riflemen von den Rotröcken kaum noch unterscheiden, so schäbig waren ihre Uniformen. Aus der Ferne betrachtet wirkten ihre Uniformen weder rot noch grün, sondern einfach nur braun, vor allem aufgrund des billigen portugiesischen Tuchs, mit dem sie ihre Sachen flicken mussten.
»Glauben Sie, dass wir die Front überquert haben?«, fragte Harper Sharpe.
»Keine Ahnung«, knurrte Sharpe gereizt. Er ärgerte sich noch immer über sich selbst. »Nicht dass jemand wüsste, wo genau die Front verläuft«, sagte er zu seiner Verteidigung, und teilweise hatte er auch recht damit. Die Franzosen zogen sich aus Portugal zurück. Den ganzen Winter des Jahres 1810 über hatte der Feind die Front bei Torres Vedras gehalten, einen halben Tagesmarsch von Lissabon entfernt, und lieber gehungert und gefroren, als sich zu seinen Nachschubdepots in Spanien zurückzuziehen. Denn Maréchal Masséna hatte gewusst, dass er mit einem Rückzug Portugal den Briten überlassen hätte, wohingegen ein Angriff auf die befestigten Stellungen bei Torres Vedras Selbstmord gewesen wäre, und so war er einfach geblieben, wo er war. Die Franzosen waren weder vorgerückt noch hatten sie sich zurückgezogen. Sie hatten schlicht den Winter durch gehungert und die riesigen Erdwälle angestarrt, die die Briten und Portugiesen an den Hängen der schmalen Halbinsel nördlich von Lissabon aufgeschüttet hatten. Die Täler zwischen den Hügeln waren mit massiven Dämmen oder Stachelbarrikaden versperrt worden, während die Hügelkuppen und langen Hänge von Gräben durchzogen waren, darüber Schießscharten, aus denen Geschütze ragten. Und diese Befestigungen sowie der Winter, der Hunger und die erbarmungslosen Angriffe der Guerilleros hatten den Angriff der Franzosen auf Lissabon schlussendlich zurückgeschlagen, und im März hatten sie dann mit dem Rückzug begonnen. Jetzt war April, und der Rückzug war in den Hügeln und Bergen an der spanischen Grenze zum Stillstand gekommen, denn Maréchal Masséna hatte beschlossen, sich hier zum Kampf zu stellen. Hier wollte er die Briten schlagen, und es war ein guter Ort dafür, denn seinen Rücken deckten die beiden mächtigen Festungen von Badajoz und Ciudad Rodrigo. Dank dieser beiden spanischen Zitadellen war die Grenze so gut wie unüberwindbar, doch Sharpes größte Sorge galt im Augenblick nicht dem harten Feldzug, der sie erwartete, sondern dem geheimnisvollen grauen Reiter.
Lieutenant Price war inzwischen bis auf halbe Höhe den Hügel hinaufmarschiert, und dort gingen seine Rotröcke nun in Deckung, während Sharpe seinen Riflemen winkte, vorzurücken. Der Hang war steil, doch die Grünröcke kletterten schnell, denn wie alle Infanteristen hatten sie eine gesunde Furcht vor Kavallerie, und je steiler ein Hang war, desto sicherer waren sie davor.
Sharpe stieg an den sich ausruhenden Rotröcken vorbei zu dem Kamm hinauf, der die beiden Täler voneinander trennte. Kurz bevor er dort ankam, winkte er seinen Grünröcken, sich ins kurze Gras zu ducken, während er selbst das letzte Stück auf dem Bauch weiterkroch. Schließlich konnte er in das kleinere Tal hinabsehen, in dem der graue Reiter verschwunden war.
Und zweihundert Fuß unter sich sah er Franzosen.
Die Männer trugen allesamt graue Uniformen, doch Sharpe wusste, dass es sich um Franzosen handelte, denn einer der Kavalleristen hatte einen Guidon dabei, ein kleines Fähnchen, das an einer Lanze befestigt in der Hitze der Schlacht als Sammelpunkt diente, und dieses spezielle, schäbige Fähnchen war im Rot-Weiß-Blau des Feindes gehalten.
Der Standartenträger saß auf seinem Pferd in der Mitte einer kleinen, verlassenen Siedlung, während seine abgesessenen Kameraden ein halbes Dutzend Steinhütten durchsuchten. Die mit Reet gedeckten Gebäude dienten den Tieflandbauern vermutlich als Unterschlupf, wenn sie ihre Herden in den Sommermonaten auf die Hochweiden trieben.
Insgesamt war nur ein halbes Dutzend Reiter in der Siedlung, doch sie wurden von einer Hand voll französischer Infanteristen begleitet, die ebenfalls schlichte graue Mäntel trugen und nicht ihr übliches Blau. Sharpe zählte insgesamt achtzehn Mann zu Fuß.
Harper kroch neben Sharpe. »Jesus, Maria und Josef«, sagte er, als er die Infanterie sah. »Graue Uniformen?«
»Vielleicht hast du ja recht«, sagte Sharpe. »Vielleicht ist den Kerlen ja wirklich die Farbe ausgegangen.«
»Ich wünschte, ihnen würden auch die Kugeln ausgehen«, bemerkte Harper. »Und was tun wir jetzt?«
»Wir verpissen uns«, antwortete Sharpe. »Es ist sinnlos, mit aller Gewalt den Kampf zu suchen.«
»Amen, Sir.« Harper kroch wieder zurück. »Wir gehen doch sofort, oder?«
»Gib mir eine Minute«, sagte Sharpe und tastete auf seinem Rücken nach dem Fernrohr, das er immer in einer Tasche aus französischem Leder bei sich trug. Dann zog er die Hülle des Fernrohrs weit genug nach vorn, damit sich das Sonnenlicht nicht in der Linse spiegelte, und richtete es auf die winzigen Hütten.
Sharpe war alles Mögliche, aber mit Sicherheit nicht reich, doch das Fernrohr war ein exzellentes und teures Gerät von Matthew Berge in London. Das Okular war in Messing gefasst, und auf einer kleinen Plakette auf dem Wallnussrohr stand »In Dankbarkeit, AW. 23. September 1803«. AW stand dabei für Arthur Wellesley, den jetzigen Viscount Wellington, Lieutenant General und Oberkommandierender der britischen und portugiesischen Streitkräfte, die Maréchal Masséna bis zur spanischen Grenze verfolgt hatten. Doch am 23. September 1803 war der Ehrenwerte Sir Arthur Wellesley, damals noch Major General, in Indien zu nahe an die feindlichen Linien herangeritten. Ein Lanzenträger hatte sein Pferd niedergestochen, und Sir Arthur war zwischen die Feinde gestürzt. Sharpe erinnerte sich noch gut an die schrillen Triumphschreie der Inder, als ihnen der Rotrockgeneral vor die Füße gefallen war, doch die Sekunden danach waren irgendwie verschwommen. Dabei waren es genau die paar Sekunden gewesen, die ihn vom einfachen Soldaten zum Offizier gemacht hatten.
Jetzt richtete Sharpe Wellingtons Geschenk auf die Franzosen und beobachtete, wie ein Kavallerist einen Stoffeimer voll Wasser vom Bach herauftrug. Ein, zwei Sekunden lang glaubte Sharpe, dass der Mann das Wasser zu den angebundenen Pferden bringen wollte, doch dann blieb er zwischen zwei Häusern stehen und schüttete das Wasser auf den Boden. »Das sind Furagiere«, sagte Sharpe, »und sie nutzen den Wassertrick.«
»Die hungrigen Bastarde«, knurrte Harper.
Die Franzosen waren eher vom Hunger als von Waffen aus Portugal vertrieben worden. Auf seinem Rückzug nach Torres Vedras hatte Wellington ein verwüstetes Land hinterlassen: leere Scheunen, vergiftete Brunnen und geplünderte Getreidespeicher. Doch die Franzosen hatten den Hunger fünf Monate lang ertragen und jeden aufgegebenen Weiler und jedes verlassene Dorf nach versteckten Nahrungsvorräten durchsucht. Ein Mittel dazu war es, Wasser auf den Boden zu gießen, denn dort, wo Vorratskrüge vergraben waren, sickerte das Wasser schneller ein als andernorts.
»In diesen Hügeln versteckt doch niemand Nahrungsmittel«, sagte Harper in verächtlichem Ton. »Glauben die etwa, irgendjemand hat Getreide hier raufgeschleppt, nur um es zu verbuddeln?«
Dann schrie eine Frau.
Ein paar Sekunden lang glaubten Sharpe und Harper, das Geräusch stamme von einem Tier. Der Schrei war durch die Entfernung gedämpft und verzerrt gewesen. Außerdem waren nirgends Zivilisten in der Siedlung zu sehen. Doch als das schreckliche Geräusch von den Hügeln widerhallte, wurde den beiden Männern klar, was das bedeutete. »Diese Bastarde«, knurrte Harper.
Sharpe schob das Fernrohr wieder zusammen. »Sie ist in einer der Hütten«, sagte er. »Wie viele Männer sind wohl bei ihr? Zwei? Drei? Das heißt, dass da unten nicht mehr als dreißig von diesen Kerlen sind.«
»Und wir sind vierzig«, fügte Harper zweifelnd hinzu. Er hatte kein Problem mit der Zahl der Feinde, aber die Lage war nicht so eindeutig, als dass sie mit einem unblutigen Sieg hätten rechnen können.
Die Frau schrie erneut.
»Hol Lieutenant Price«, befahl Sharpe Harper. »Sag allen, sie sollen die Waffen laden, aber weg von der Kuppe bleiben.« Er drehte sich um. »Dan! Thompson! Cooper! Harris! Rauf hier!« Die Vier waren seine besten Schützen. »Haltet die Köpfe unten!«, warnte er die vier Männer. Dann wartete er, bis sie an der Kuppe waren. »In einer Minute werde ich den Rest der Rifles da runterführen. Ich will, dass ihr Vier hier oben bleibt und jeden Bastard abknallt, der uns Ärger machen könnte.«
»Die Bastarde ziehen schon wieder ab«, sagte Daniel Hagman. Hagman war der Älteste der Kompanie und der beste Schütze. Er war ein ehemaliger Wilderer aus Cheshire, den man vor die Wahl gestellt hatte, für ein paar gestohlene Fasane entweder zur Armee oder in die Kolonien zu gehen.
Sharpe drehte sich wieder um. Die Franzosen rückten ab, oder zumindest die meisten von ihnen, denn der Art nach zu urteilen, wie sich die Männer am Ende der Kolonne immer wieder umdrehten und zu den Hütten zurückriefen, hatten sie ein paar von ihren Kameraden in der Hütte zurückgelassen, in der die Frau geschrien hatte. Die zwölf Kavalleristen ritten voraus, und gemeinsam mit den Infanteristen marschierten sie den kleinen Bach entlang und in das größere Tal hinunter.
»Sie werden unvorsichtig«, bemerkte Thompson.
Sharpe nickte. Männer in der Siedlung zurückzulassen stellte ein Risiko dar, und es war nicht die Art der Franzosen, in diesem wilden Land Risiken einzugehen. In Spanien und Portugal wimmelte es nur so von Guerilleros, die den Guerilla kämpften, den »kleinen Krieg«, und dieser Krieg wurde weitaus erbitterter gekämpft und grausamer geführt als die eher formalen Schlachten zwischen den Briten und Franzosen.
Sharpe wusste das aus eigener Erfahrung, denn letztes Jahr hatte es ihn in den wilden Norden verschlagen. Dort hatte er mit Guerilleros nach spanischem Gold gesucht, und die Wildheit und Brutalität der Widerstandskämpfer hatte ihm immer wieder einen Schauder über den Rücken gejagt. Dennoch war eine von ihnen, Teresa Moreno, Sharpes Geliebte geworden. Inzwischen nannte sie sich La Aguja, die Nadel, und jeder Franzose, den sie mit ihrer langen, dünnen Klinge aufspießte, war Teil der endlosen Rache, die sie den Soldaten geschworen hatte, von denen sie vergewaltigt worden war.
Teresa war nun weit weg. Sie kämpfte in der Gegend um Badajoz, während in der Siedlung unter Sharpe eine andere Frau die Aufmerksamkeit der Franzosen erdulden musste, und wieder fragte sich Sharpe, warum diese grauuniformierten Soldaten es für sicher hielten, ihre Kameraden in dem verlassenen Dorf zurückzulassen, damit sie ihr Verbrechen vollenden konnten. Waren sie sich wirklich so sicher, dass keine Guerilleros in der Nähe waren?
Harper kam wieder zurück. Er atmete schwer, nachdem er Prices Rotröcke den Hang hinaufgeführt hatte. »Gott schütze Irland«, keuchte er und ließ sich neben Sharpe fallen, »aber diese Bastarde ziehen ja schon wieder ab.«
»Ich glaube, sie haben ein paar Mann zurückgelassen. Bist du bereit?«
»Klar.« Harper spannte wieder den Hahn.
»Tornister ab«, befahl Sharpe seinen Riflemen und schüttelte auch seinen eigenen von der Schulter. Dann drehte er sich noch einmal zu Lieutenant Price um. »Warten Sie hier, Harry, und achten Sie auf meine Pfiffe. Zwei heißen, dass Sie von hier oben das Feuer eröffnen sollen, und drei, dass ich Sie unten im Dorf sehen will.« Er schaute zu Hagman. »Schieß erst, wenn sie uns sehen, Dan. Wenn es uns gelingt, ins Dorf zu gelangen, ohne gesehen zu werden, wird es nur umso leichter.« Er hob die Stimme, sodass die anderen Riflemen ihn ebenfalls hören konnten. »Wir werden so schnell wie möglich runterlaufen«, sagte er. »Alle bereit? Gewehre geladen und gespannt? Dann los! Jetzt!«
Die Riflemen sprangen über die Kuppe und folgten Sharpe kopfüber den steilen Hang hinunter. Sharpe schaute immer wieder nach links, wo sich die kleine französische Kolonne am Bach entlang entfernte, doch keiner der Franzosen drehte sich um, und das Trappeln der Hufe und die schweren Schritte der Infanteristen übertönten das Geräusch der Grünröcke, die den Hügel hinunterrannten. Erst als Sharpe nur noch wenige Yards von der ersten Hütte entfernt war, drehte sich ein Franzose um und schrie. Im selben Augenblick schoss Hagman, und der Knall der Baker Rifle hallte zuerst vom gegenüberliegenden Hang des kleinen Tals wider und dann von den Hängen des größeren. Und das Echo hallte weiter, wurde leiser und leiser, und schließlich ging es im Knallen der anderen Riflemen unter, die ebenfalls das Feuer eröffneten.
Sharpe sprang die letzten paar Yards hinunter. Bei der Landung fiel er hin, rappelte sich wieder auf und rannte an einem Misthaufen neben einer Hauswand vorbei. Ein Pferd war dort an einer Stahlstange festgebunden, die man neben einer der kleinen Hütten in den Boden gerammt hatte, und plötzlich erschien ein Franzose in der Tür. Der Mann trug ein Hemd und eine graue Jacke, doch von der Hüfte abwärts war er nackt. Als er Sharpe sah, hob er die Muskete, doch dann bemerkte er die Riflemen hinter Sharpe, und so ließ er die Waffe sofort fallen und hob die Hände.
Sharpe hatte seinen Säbel gezogen und rannte nun auf die Haustür zu. Dort angekommen, stieß er den sich ergebenden Mann beiseite und stürmte in die Hütte. Sie bestand nur aus einem Raum mit Holzbalken an der Decke, und es war dunkel, aber nicht so dunkel, als dass er das nackte Mädchen nicht hätte sehen können, das verängstigt in eine Ecke kroch. Sie hatte Blut an den Beinen. Ein zweiter Franzose, dessen Kavalleriehose auf den Knöcheln hing, versuchte, nach seinem Säbel zu greifen, doch Sharpe trat ihm zwischen die Beine. Er trat ihn so hart, dass der Mann schrie und dann keine Luft mehr für einen zweiten Schrei hatte. Stattdessen sackte er auf den blutigen Boden, wimmerte und zog die Knie an die Brust. Da lagen noch zwei weitere Männer auf dem unbefestigten Boden, doch als Sharpe sich mit gezücktem Säbel zu ihnen umdrehte, sah er, dass es sich um Zivilisten handelte. Sie waren tot. Man hatte ihnen die Kehlen durchgeschnitten.
Musketenfeuer hallte durch das Tal. Sharpe ging wieder zur Tür zurück, wo der halb nackte Franzose kniete, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. »Pat!«, rief Sharpe.
Harper organisierte die Riflemen. »Wir haben die Froschfresser im Griff, Sir«, kam der Sergeant Sharpes Frage zuvor. Die Riflemen kauerten neben den Hütten, schossen, luden nach und feuerten erneut. Dichter weißer Rauch, der nach verfaulten Eiern roch, quoll aus den Mündungen ihrer Baker Rifles. Die Franzosen erwiderten das Feuer, und ihre Musketenkugeln schlugen in die Wände des Dorfes, als Sharpe sich wieder in die Hütte zurückduckte. Er schnappte sich die Waffen der beiden Franzosen und warf sie aus der Tür. »Perkins!«, schrie er.
Rifleman Perkins rannte zur Tür. Er war der Jüngste von Sharpes Männern – vermutlich zumindest, denn er wusste zwar nicht, wann er geboren worden war, aber er musste sich in jedem Fall noch nicht rasieren. »Sir?«
»Wenn sich einer der Bastarde bewegt, knall ihn ab.«
Perkins mochte ja noch jung sein, aber der Ausdruck auf seinem schmalen Gesicht erschreckte den unverletzten Franzosen so sehr, dass er unwillkürlich die flache Hand ausstreckte, als wolle er den jungen Rifleman anflehen, ihn nicht zu erschießen.
»Ich werde mich um die Bastarde kümmern, Sir«, sagte Perkins und steckte sein Schwertbajonett auf das Gewehr.
Sharpe sah die Kleider des Mädchens, die irgendjemand unter einen grob zusammengezimmerten Tisch geworfen hatte. Er sammelte die verdreckten Sachen ein und gab sie dem Mädchen zurück. Sie war bleich, verängstigt, und sie weinte. Es war ein junges Ding, kaum dem Kindesalter entwachsen.
»Bastarde«, knurrte Sharpe die beiden Gefangenen an. Dann lief er hinaus. Eine Musketenkugel zischte über ihn hinweg, als er sich neben Harper in Deckung warf.
»Die Froschfresser sind gut, Sir«, bemerkte der Ire reumütig.
»Ich dachte, ihr hättet sie im Griff.«
»Na ja, die sehen das offenbar anders«, sagte Harper, lugte aus der Deckung hervor, zielte, schoss und duckte sich wieder. »Die Bastarde sind gut, wirklich gut.« Er lud nach.
Und die Franzosen waren tatsächlich gut. Sharpe hatte erwartet, dass so ein kleiner Trupp Franzosen vor dem Gewehrfeuer fliehen würde, doch stattdessen hatten sie eine Plänklerformation gebildet, und aus einer leicht zu treffenden, dicht marschierenden Kolonne waren viele schwere Ziele geworden. Das halbe Dutzend Dragoner, das die Infanteristen begleitete, war abgesessen und kämpfte nun zu Fuß. Ein Mann hatte rasch die Pferde außer Schussweite geführt, und jetzt drohten die vereinten Karabiner der Dragoner und die Musketen der Infanteristen Sharpes Riflemen zu überwältigen.
Die Baker Rifles waren zwar wesentlich genauer als die Karabiner und Musketen der Franzosen, und sie konnten auf fast viermal so große Entfernung töten, doch sie ließen sich nur langsam laden. Die Kugeln, die allesamt in Leder gewickelt waren, um an den Zügen im Lauf Halt zu finden, mussten förmlich in die Waffe gezwungen werden, während man Musketenkugeln einfach in die glatten Läufe rammen konnte.
Sharpes Männer verzichteten bereits auf die Lederflicken, um schneller laden zu können, doch ohne das Leder konnten die Gewehre ihren größten Vorteil nicht mehr ausspielen: die tödliche Genauigkeit. Hagman und seine drei Kameraden feuerten noch immer vom Hügel hinab, doch sie waren zu wenige, um einen großen Unterschied zu machen, und so bewahrten nur die steinernen Wände des Dorfes Sharpes Riflemen vor der Vernichtung.
Sharpe holte eine kleine Pfeife aus der Tasche an seinem Bandolier. Er pfiff zweimal. Dann nahm er sein eigenes Gewehr vom Rücken, lugte um die Ecke des Hauses und zielte auf eine kleine Rauchwolke weiter unten im Tal. Er schoss. Der Rückschlag trieb ihm das Gewehr im selben Augenblick in die Schulter, als eine französische Musketenkugel die Wand neben seinem Kopf zerfetzte. Ein Steinsplitter schlug in seine vernarbte Wange und riss sie auf. Der Splitter verfehlte das Auge nur um einen halben Zoll.
»Die Bastarde sind wirklich gut«, wiederholte Sharpe widerwillig, was Harper schon anerkennend festgestellt hatte. Dann kündigte eine laute Musketensalve die Ankunft von Harry Price und seinen Rotröcken auf der Hügelkuppe an.
Und bereits Prices erste Salve brachte die Entscheidung. Sharpe hörte eine französische Stimme Befehle schreien, und eine Sekunde später löste sich die Gefechtslinie der Franzosen auf, und sie verschwanden. Harry Price hatte nur noch Zeit für eine weitere Salve, bevor der grauuniformierte Feind außer Reichweite war.
»Green! Horrell! McDonald! Cresacre! Smith! Sergeant Latimer!«, rief Sharpe seinen Riflemen zu. »Geht fünfzig Schritt das Tal runter und bildet eine Sicherungslinie, aber nehmt die Beine in die Hand, wenn sich die Kerle noch einmal umentscheiden und zurückkommen. Und jetzt – Bewegung! Der Rest bleibt hier!«
»Himmel, Sir, Sie sollten mal einen Blick hier reinwerfen.« Harper hatte die Tür der nächsten Hütte mit dem Lauf seines Salvengewehrs aufgestoßen. Die Waffe, ursprünglich für den Enterkampf entworfen, bestand aus sieben Halbzoll-Läufen, die über eine einzige Zündpfanne gezündet wurden. Es war eine Art Miniaturkanone, und nur die größten und stärksten Männer konnten die Waffe abfeuern, ohne sich schwer die Schulter zu verstauchen. Und Harper war einer der stärksten Männer, die Sharpe je gekannt hatte, aber auch einer der sentimentalsten, und jetzt war der große Ire den Tränen nahe. »Oh, Himmel Herr Jesus, der du für uns gelitten hast«, sagte Harper und bekreuzigte sich. »Diese Bastarde.«
Sharpe hatte das Blut bereits gerochen, und jetzt schaute er an dem Sergeant vorbei, und vor lauter Ekel bildete sich ein Kloß in seinem Hals. »O Gott«, keuchte er.
Denn das kleine Haus war voller Blut. Die Wände waren damit bespritzt und der Boden damit durchtränkt, und darauf lagen die leblosen Körper von Kindern. Sharpe versuchte, die kleinen Leichen zu zählen, doch er konnte kaum erkennen, wo ein blutüberströmter Körper endete und der nächste begann. Die Kinder waren offensichtlich ausgezogen worden, und dann hatte man ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Und man hatte auch einen kleinen Hund getötet und den bepelzten, vom Blut getränkten Kadaver auf die Kinder geworfen, deren Haut auf dem schwarz-roten Blut unnatürlich weiß wirkte.
»Oh, gütiger Herr Jesus«, sagte Sharpe, wich aus den stinkenden Schatten zurück und schnappte nach Luft. Er hatte schon viele schreckliche Dinge in seinem Leben gesehen. Er war in der Londoner Gosse als Sohn einer verarmten Hure geboren worden, und er war den britischen Trommeln von Flandern bis nach Madras gefolgt. Er hatte in den Indischen Kriegen gekämpft und jetzt an den Stränden Portugals und der Grenze zu Spanien, doch noch nie hatte er Kinder gesehen, die man wie abgeschlachtetes Vieh auf einen Haufen geworfen hatte, noch nicht einmal in den Folterkammern des Tippu Sultan in Seringapatam.
»Hier sind noch mehr, Sir!«, rief Corporal Jackson. Jackson hatte sich gerade in der Tür einer Hütte übergeben, wo ein altes Ehepaar blutig auf einem Haufen lag. Sie waren auf nur allzu offensichtliche Art gefoltert worden.
Sharpe dachte an Teresa, die gerade gegen eben diesen Abschaum kämpfte, der seine Opfer folterte und ausweidete, und die Gedanken, die ihm dabei kamen, konnte er einfach nicht ertragen. Also legte er die Hände um den Mund und rief den Hügel hinauf: »Harris! Komm runter!«
Rifleman Harris war der gebildetste Mann der Kompanie. Früher war er mal Schulmeister gewesen, sogar ein respektabler, doch die Langeweile hatte ihn zum Trinker gemacht, und das war sein Ruin gewesen oder zumindest der Grund, warum er zur Armee gegangen war. Allerdings liebte er es noch immer, seine Gelehrsamkeit zur Schau zu stellen.
»Sir?«, sagte Harris, als er im Dorf ankam.
»Sprichst du Französisch?«
»Jawohl, Sir.«
»In dem Haus da sind zwei Froschfresser. Finde heraus, zu welcher Einheit sie gehören und was die Bastarde hier zu suchen hatten. Und, Harris …!«
»Sir?« Der schwermütige, rothaarige Harris drehte sich noch einmal um.
»Du musst mit diesen Bastarden nicht sanft umgehen.«
Selbst Harris, der Sharpe gut kannte, schien vom Tonfall seines Captains entsetzt zu sein. »Jawohl, Sir.«
Sharpe ging über den winzigen Dorfplatz zurück. Seine Männer hatten die beiden Hütten auf der anderen Seite des Bachs durchsucht, dort aber keine Leichen mehr gefunden. Offenbar war das Massaker auf die drei Hütten beschränkt, neben denen Sergeant Harper stand, das Gesicht düster und voller Schmerz.
Patrick Harper war ein Ulsterman aus Donegal. Hunger und Armut hatten ihn einst in die Reihen der britischen Armee getrieben. Er war ein Riese, vier Zoll größer als Sharpe, und der maß schon sechs Fuß. Im Kampf war Harper eine Furcht erregende Gestalt, dabei war er in Wahrheit eher freundlich, humorvoll und gutmütig. Und diese Gutmütigkeit war es dann auch, die den größten Widerspruch in seinem Leben überdeckte, nämlich die Tatsache, dass er den König, für den er kämpfte, nicht gerade liebte, und er hatte auch nicht viel für das Land übrig, das er verteidigte. Dennoch gab es kaum einen besseren Soldaten in der Armee von König George und niemanden, der seinen Freunden gegenüber so loyal war wie Harper. Und diese Freunde waren es dann auch, wofür Harper kämpfte, und der engste dieser Freunde war Sharpe und das trotz ihres unterschiedlichen Rangs.
»Das waren doch nur kleine Kinder«, sagte Harper nun. »Wer tut so was?«
»Die da.« Sharpe deutete mit dem Kopf das schmale Tal hinab, wo sich der Bach mit dem kleinen Fluss vereinte. Die grauen Franzosen hatten dort angehalten. Sie waren zu weit weg für die Gewehre, aber immer noch nahe genug, um zu sehen, was in dem Dorf geschah, das sie geplündert und dessen Bewohner sie massakriert hatten.
»Ein paar der Kleinen sind auch noch vergewaltigt worden«, sagte Harper.
»Das habe ich gesehen«, erwiderte Sharpe tonlos.
»Wie konnten die nur so etwas tun?«
»Darauf gibt es keine Antwort, Pat. Das weiß Gott allein.« Sharpe war übel, wie auch Harper übel war, doch nach den Wurzeln der Sünde zu suchen würde die toten Kinder auch nicht rächen, die geistige Gesundheit des vergewaltigten Mädchens retten oder die blutüberströmten Toten begraben. Und Philosophie würde einer kleinen Leichten Kompanie, die gefährlich offen im Vorfeld des Feindes aufmarschiert war, wie Sharpe jetzt erkannte, auch nicht helfen, sicher zu den britischen Linien zurückzukehren. »Wenn du das unbedingt wissen willst, Pat, dann frag einen gottverdammten Kaplan. Vorausgesetzt natürlich, du findest einen außerhalb der Bordelle von Lissabon«, knurrte Sharpe und drehte sich dann wieder zu den Schlachthäusern um. »Wie, zum Teufel, sollen wir die alle begraben?«
»Das können wir nicht, Sir. Wir sollten einfach die Häuserwände über ihnen zum Einsturz bringen«, schlug Harper vor. Er schaute in das Tal hinab. »Am liebsten würde ich diesen Bastarden die Hälse umdrehen. Was sollen wir mit den beiden machen, die wir geschnappt haben?«
»Umbringen«, antwortete Sharpe rundheraus. »Aber jetzt werden wir wohl erst einmal ein, zwei Antworten erhalten«, fügte er hinzu, als er Harris aus der Hütte kommen sah.
Harris hielt einen der stahlgrauen Dragonerhelme in der Hand. Jetzt sah Sharpe auch, dass er tatsächlich nicht mit einem Tuch bespannt war, sondern von einem langen grauen Rosshaarschweif geziert wurde.
Harris strich mit der rechten Hand über den Schweif, als er auf Sharpe zuging. »Ich habe herausgefunden, wer die Bastarde sind, Sir«, berichtete er, als er näher kam. »Sie gehören zur Brigade Loup, der Wolfsbrigade. Sie ist nach ihrem befehlshabenden Offizier benannt, Sir, nach einem Kerl mit Namen Loup, Brigadier Guy Loup. Und Loup heißt Wolf auf Französisch, Sir. Sie betrachten sich als Eliteeinheit. Den Winter über hatten sie den Auftrag, den Weg durch die Berge freizuhalten, und das haben sie geschafft, indem sie den Einheimischen die Seele aus dem Leib geprügelt haben. Wird auch nur einer von Loups Männern getötet, dann bringt er aus Rache fünfzig Zivilisten um. Genau deshalb waren sie auch hier, Sir. Ein paar von seinen Männern sind in einen Hinterhalt geraten und getötet worden, und das hier ist der Preis dafür.« Harris deutete auf die Totenhäuser. »Und Loup ist nicht weit weg, Sir«, fügte er warnend hinzu. »Es sei denn, diese Kerle lügen, aber das bezweifle ich. Loup hat eine Abteilung hier zurückgelassen und ist mit einer Schwadron ins nächste Tal geritten, um dort ein paar Flüchtlinge zu jagen.«
Sharpe schaute zu dem Pferd des Kavalleristen, das noch immer in der Mitte des Dorfes angebunden war, und dachte an den Infanteristen, den er gefangen genommen hatte. »Diese Wolfsbrigade«, fragte er, »ist das eine Kavallerie- oder eine Infanteriebrigade?«
»Beides, Sir«, antwortete Harris. »Es ist eine besondere Brigade, Sir, speziell aufgestellt zur Guerillabekämpfung. Loup hat zwei Bataillone Infanterie und ein Bataillon Dragoner.«
»Und die tragen alle Grau?«
»Wie Wölfe, Sir«, bestätigte Harris.
»Na ja, und wir wissen ja alle, was man mit Wölfen macht«, sagte Sharpe und drehte sich im selben Augenblick um, als Sergeant Latimer eine Warnung rief.
Latimer kommandierte die kleine Sicherungslinie zwischen Sharpe und den Franzosen, doch es war kein neuer Angriff, der den Ruf provoziert hatte, sondern vier französische Reiter, die sich den Briten näherten. Einer von ihnen trug den Guidon mit der Trikolore, doch die kleine Standarte war halb verdeckt von einem schmutzigen weißen Hemd, das man auf die Lanzenspitze gesteckt hatte.
»Die Bastarde wollen mit uns reden«, sagte Sharpe.
»Überlassen Sie das mir«, knurrte Harper böse und spannte den Hahn seines Salvengewehrs.
»Nein!«, sagte Sharpe. »Und geh los und sag allen, sie sollen bloß nicht schießen. Das ist ein Befehl!«
»Aye, Sir.« Harper löste den Hahn wieder, funkelte die näher kommenden Franzosen an und ging dann los, um die Grünröcke zu warnen, ihr Temperament im Zaum zu halten und den Finger vom Abzug zu lassen.
Sharpe warf sich das Gewehr über die Schulter, zog seinen Säbel zurecht und schlenderte auf die vier Franzosen zu.
Zwei der Reiter waren Offiziere, flankiert von Standartenträgern. Das Verhältnis von Flaggen zu Männern wirkte unverschämt hoch. Offenbar hielten sich die Offiziere anderen Sterblichen für überlegen. Dabei hätte der Guidon mit der Trikolore als Standarte gereicht, doch es musste wohl noch ein zweites Banner sein, und das war außergewöhnlich. Ein französischer Adler mit vergoldeten Schwingen saß auf der Spitze, und unter den Sockel hatte man ein Querstück genagelt. Die meisten Adler hatten eine Trikolore aus Seide am Stab, doch am Querstück von diesem hier baumelten sechs Wolfsschwänze. Die Standarte hatte etwas Barbarisches an sich. Sie erinnerte an weit zurückliegende Zeiten, als heidnische Horden von Steppenkriegern auf ihren Pferden Tod und Zerstörung über die Länder der Christenheit gebracht hatten.
Und wenn die Wolfsstandarte Sharpe schon das Blut in den Adern gefrieren ließ, so war das nichts im Vergleich zu dem Gefühl, das ihn überkam, als er den Mann sah, der den anderen vorausritt. Bis auf die Stiefel war alles an dem Mann grau. Seine Jacke war grau, sein Pferd, sein Helm mit dem Rosshaarschweif, und sein gefütterter Mantel war mit grauem Wolfsfell abgesetzt wie auch die Schäfte seiner Stiefel. Selbst die Scheide seines langen Säbels und das Sattelholster für den Karabiner waren aus grauem Wolfsleder, und den Nasenriemen des Halfters schmückte ein grauer Streifen Fell. Sogar der Bart des Mannes war grau. Es war ein kurzer Bart, ordentlich gestutzt, doch der Rest des Gesichts war wild, gnadenlos und voller Narben, ein Albtraumgesicht. Ein blutunterlaufenes und ein blindes, milchiges Auge starrten aus diesem wettergegerbten, kampferfahrenen Gesicht, als der Mann sein Pferd neben Sharpe zügelte.
»Mein Name ist Loup«, sagte er. »Brigadier Général Loup von der Armee Seiner Kaiserlichen Majestät.« Sein Tonfall war seltsam sanft und höflich, und sein Englisch hatte einen leichten schottischen Akzent.
»Sharpe«, stellte sich der Rifleman vor. »Captain Sharpe, British Army.«
Die drei anderen Franzosen hatten gut ein Dutzend Yards entfernt angehalten. Sie schauten zu, wie ihr Brigadier das Bein über den Sattel schwang und sich geschickt auf den Pfad gleiten ließ. Loup reichte zwar nicht an Sharpe heran, aber er war immer noch groß, muskulös und agil. Sharpe schätzte den französischen Brigadier auf etwa vierzig Jahre, sechs Jahre älter als er selbst. Loup holte zwei Zigarren aus seiner pelzbesetzten Säbeltasche und bot Sharpe eine davon an.
»Ich nehme nichts von Mördern«, sagte Sharpe.
Loup lachte über Sharpes Entrüstung. »Dann sind Sie dumm, Captain. Wollen Sie mir das damit sagen? Dass Sie dumm sind? Nun ja, wie auch immer. Ich war ein Gefangener, wissen Sie, in Schottland, in Edinburgh. Das ist eine sehr, sehr alte Stadt, aber mit wunderschönen Frauen. Ein paar von ihnen haben mich Englisch gelehrt, und ich habe ihnen beigebracht, was sie alles mit ihren langweiligen, calvinistischen Ehemännern machen können. Wir Offiziere durften uns frei bewegen, nachdem wir unser Ehrenwort gegeben hatten, nicht zu fliehen. Wir wohnten nicht weit von der Candlemaker Row. Kennen Sie sich dort aus? Nein? Sie sollten Edinburgh wirklich einmal besuchen, Captain. Trotz der Calvinisten und der furchtbaren Küche ist das eine schöne Stadt, sehr gebildet und gastfreundlich. Als der Frieden von Amiens unterzeichnet wurde, wäre ich fast dortgeblieben.«
Loup hielt kurz inne, um Feuerstein auf Stahl zu schlagen und dann auf den verkohlten Zunder in seiner Zunderkiste zu blasen, bis eine Flamme erschien, an der er seine Zigarre anzünden konnte.
»Ja, ich wäre fast geblieben, aber Sie wissen ja, wie das ist. Sie war mit einem anderen Mann verheiratet, und ich liebe Frankreich. Also bin ich jetzt hier und sie dort, und ohne Zweifel träumt sie häufiger von mir als ich von ihr.« Er seufzte. »Doch das Wetter hier hat mich an sie erinnert. Wir haben oft im Bett gelegen und den Regen und den Nebel vor den Fenstern der Candlemaker Row betrachtet. Es ist ziemlich kalt heute, nicht wahr?«
»Für Sie ist das doch kein Problem, so wie Sie gekleidet sind«, erwiderte Sharpe. »Sie tragen doch mehr Pelz als eine Nutte zu Weihnachten.«
Loup lächelte. Es war kein freundliches Lächeln. Ihm fehlten zwei Zähne, und die verbliebenen waren gelb. Er hatte freundlich mit Sharpe gesprochen, charmant sogar, doch es war der aalglatte Charme einer Katze gewesen, kurz bevor sie zuschlägt. Er zog an seiner Zigarre, und die Spitze glühte rot, während Loup Sharpe mit seinem blutunterlaufenen Auge anstarrte.
Loup sah einen großen Mann mit einem viel benutzten Gewehr über der Schulter und einem schartigen, hässlichen Säbel an der Seite. Sharpes Uniform war voller Löcher, schmutzig und geflickt. Die schwarze Schulterschnur hing zerfleddert zwischen ein paar Silberknöpfen, die nur noch von wenigen Fäden gehalten wurden, und unter dem Jackett trug Sharpe eine mit Leder verstärkte, französische Kavallerieweste. Die Überreste einer roten Offiziersschärpe zierten Sharpes Hüfte, und um den Hals trug er locker ein zusammengeknotetes schwarzes Tuch. Es war die Uniform eines Mannes, der die elegante Friedenskleidung eines Soldaten schon lange gegen die praktische Kluft eines Kämpfers getauscht hatte. Und er war auch ein harter Mann, nahm Loup an, denn Sharpe hatte nicht nur eine lange Narbe auf der Wange. Seine Haltung und sein Verhalten bezeugten, dass er lieber kämpfen statt reden wollte. Loup zuckte mit den Schultern. Er beschloss, auf weitere Höflichkeiten zu verzichten, und kam auf den Punkt. »Ich bin gekommen, um meine beiden Männer zu holen«, sagte er.
»Die können Sie vergessen, Brigadier«, erwiderte Sharpe. Er war fest entschlossen, diesem Franzosen nicht die Ehre zu erweisen, ihn »Sir« oder »Monsieur« zu nennen.
Loup hob die Augenbrauen. »Sind sie tot?«
»Noch nicht, aber bald.«
Loup vertrieb eine Fliege, die hartnäckig um seine Nase summte. Die stählernen Spangen seines Helms baumelten offen neben seinem Gesicht und erinnerten so an die Cadenettes genannten Schläfenzöpfe der französischen Husaren. Er zog wieder an seiner Zigarre und lächelte. »Captain, darf ich Sie an die Regeln des Krieges erinnern?«
Sharpe antwortete Loup mit einem Wort, von dem er glaubte, dass der Franzose es nicht in der feinen Gesellschaft von Edinburgh gehört hatte.
»Ich lasse mich von Mördern nicht belehren«, fuhr Sharpe fort, »nicht über die Regeln des Krieges. Was Ihre Männer in diesem Dorf getan haben, das war kein Krieg. Das war ein Massaker.«
»Natürlich war das Krieg«, widersprach ihm Loup gelassen, »und Sie müssen mir ebenfalls keinen Vortrag halten, Captain.«
»Einen Vortrag vielleicht nicht, Brigadier, aber eine Lektion könnten Sie verdammt gut gebrauchen.«
Loup lachte. Er drehte sich um und ging zum Ufer des Bachs, wo er die Arme ausstreckte, ausgiebig gähnte und sich dann bückte, um eine Hand voll Wasser zu trinken. Schließlich wandte er sich wieder Sharpe zu.
»Ich will Ihnen mal erklären, was meine Aufgabe ist, Captain, und dann stellen Sie sich mal vor, wie Sie an meiner Stelle handeln würden. Vielleicht gerät Ihre britische Moral dann ja ins Wanken. Meine Aufgabe, Captain, ist es, die Straßen durch diese Berge zu überwachen und zu sichern, damit der Nachschub sie ungehindert passieren kann, mit dem wir die Briten – also Sie – wieder ins Meer treiben wollen. Mein Feind ist jedoch kein Soldat in einer Uniform und mit einem Ehrenkodex, sondern ein Haufen Zivilisten, die einen nicht unerheblichen Groll gegen meine Präsenz hier hegen. Und das ist auch gut so, sage ich! Sollen sie mich ruhig hassen, denn das ist ihr Recht, aber wenn sie mich angreifen, Captain, dann werde ich mich verteidigen, und zwar so wild und entschlossen, so gnadenlos und konsequent, dass sie es sich das nächste Mal tausend Mal überlegen werden, meine Männer anzugreifen. Wissen Sie, was die Hauptwaffe der Guerilla ist, Captain? Terror. Purer Terror. Also sorge ich dafür, dass ich noch schrecklicher bin als mein Feind, und mein Feind in dieser Gegend hier ist wahrlich furchtbar. Haben Sie schon einmal von El Castrador gehört?«
»Dem Kastrierer?«, riet Sharpe die Übersetzung.
»Ja, genau. Den Namen hat er sich durch das verdient, was er mit Franzosen macht. Allerdings macht er das, wenn sie noch leben, und dann lässt er sie verbluten. Und ich bedaure, zugeben zu müssen, dass El Castrador noch immer lebt, aber ich kann auch sagen, dass seit drei Monaten keiner meiner Männer mehr kastriert worden ist, und wissen Sie auch warum? Weil El Castradors Männer mich mehr fürchten als ihn. Ich habe ihn besiegt, Captain. Ich habe diese Berge wieder sicher gemacht. Captain, das hier sind die einzigen Berge in ganz Spanien, durch die ein Franzose sicher reiten kann, und ich will Ihnen auch sagen warum. Ich habe die größte Waffe der Guerilleros gegen sie selbst gerichtet. Ich kastriere sie, so wie sie auch mich kastrieren würden, nur nehme ich ein stumpfes Messer.« Brigadier Loup lächelte Sharpe grimmig an. »Und jetzt sagen Sie mir, Captain: Wenn man Ihre Männer kastrieren, blenden, ausweiden und bei lebendigem Leibe häuten würde, würden Sie dann nicht genau das Gleiche tun wie ich?«
»Mit Kindern?« Sharpe deutete mit dem Daumen zum Dorf zurück.
Überrascht riss Loup sein gesundes Auge auf, als empfinde er Sharpes Einwand als unsoldatisch. »Würden Sie auch eine Ratte verschonen, nur weil sie jung ist? Ungeziefer ist und bleibt Ungeziefer, Captain, egal wie alt es ist.«
»Sie haben doch gerade gesagt, die Berge seien sicher«, sagte Sharpe. »Warum dann das Töten?«
»Weil letzte Woche zwei meiner Männer in einem Dorf nicht weit von hier in einen Hinterhalt geraten und getötet worden sind. Die Familien der Mörder haben hier in dem Glauben Zuflucht gesucht, dass ich sie nicht finden würde. Aber ich habe sie gefunden, und jetzt, Captain, kann ich Ihnen versichern, dass in Fuentes de Oñoro niemand mehr meine Männer überfallen wird.«
»O doch, und zwar, wenn ich sie finde.«
Loup schüttelte traurig den Kopf. »Sie sind mit Ihren Drohungen wirklich schnell bei der Hand, Captain. Aber ich glaube, wenn Sie gegen mich kämpfen, dann werden Sie recht bald Vorsicht lernen. Aber kommen wir zu unserem aktuellen Problem zurück. Geben Sie mir einfach meine Männer, und ich ziehe ab.«
Sharpe hielt kurz inne und dachte nach. Dann zuckte er mit den Schultern und drehte sich um. »Sergeant Harper!«
»Sir!«
»Holen Sie die beiden Froschfresser!«
Harper zögerte, als wolle er wissen, was Sharpe vorhatte, doch dann drehte er sich widerwillig zu den Hütten um, und kurz darauf kehrte er mit den beiden französischen Gefangenen zurück. Beide waren nach wie vor von der Hüfte abwärts nackt, und einer krümmte sich noch immer vor Schmerz.
»Ist er verletzt?«, fragte Loup.
»Ich habe ihm in die Eier getreten«, sagte Sharpe. »Er hat ein Mädchen vergewaltigt.«
Loup schien die Antwort zu amüsieren. »Haben Sie ein Problem mit Vergewaltigungen, Captain Sharpe?«
»Seltsam für einen Mann, nicht wahr? Aber ja, das habe ich.«
»Wir haben auch ein paar solcher Offiziere«, sagte Loup, »doch wenn sie erst einmal einige Monate in Spanien gewesen sind, dann sind sie von ihrer Empfindsamkeit geheilt. Die Frauen hier kämpfen genauso wie die Männer, und wenn eine Frau glaubt, dass ihr Rock sie beschützt, dann irrt sie sich. Und Vergewaltigung ist ein Teil des Terrors, und sie dient auch noch einem anderen Zweck. Wenn man Soldaten vergewaltigen lässt, kümmert es sie nicht mehr, ob sie Hunger leiden oder seit einem Jahr keinen Sold mehr gesehen haben. Vergewaltigung ist eine Waffe wie jede andere auch, Captain.«
»Das werde ich mir merken, Brigadier, wenn ich in Frankreich einmarschiere«, erwiderte Sharpe und drehte sich dann wieder zu den Hütten um. »Bleiben Sie da stehen, Sergeant!« Harper hatte mit den beiden Gefangenen inzwischen den Dorfausgang erreicht. »Und, Sergeant …«
»Sir?«
»Holen Sie ihre Hosen. Sie sollen sich erst einmal ordentlich anziehen.«
Loup war mit dem Verlauf seiner Mission sichtlich zufrieden, und er lächelte Sharpe an. »Sie sind ausgesprochen vernünftig. Gut. Ich hätte es gehasst, genauso gegen Sie kämpfen zu müssen wie gegen die Spanier.«
Sharpe betrachtete Loups barbarische Uniform. Es war ein Kostüm, dachte er, eine Verkleidung, um Kindern Angst einzujagen, das Kostüm eines Wolfsmenschen wie aus einem Albtraum, doch der Säbel dieses Wolfsmenschen war auch nicht länger als Sharpes und sein Karabiner wesentlich ungenauer als Sharpes Gewehr.
»Ich glaube nicht, dass Sie gegen uns kämpfen könnten, Brigadier«, sagte Sharpe, »jedenfalls nicht erfolgreich. Wir sind nämlich echte Soldaten, wissen Sie, keine unbewaffneten Frauen und Kinder.«
Loup versteifte sich. »Captain Sharpe, Sie werden herausfinden, dass die Brigade Loup gegen jeden kämpfen kann, überall und egal wie. Ich verliere nie, Captain.«
»Wenn Sie nie verlieren, Brigadier, wie sind Sie dann als Gefangener nach Edinburgh gekommen?« Sharpe schnaubte verächtlich. »Vermutlich haben Sie tief und fest geschlafen, als man Sie geschnappt hat.«
»Ich war Passagier auf einem Schiff nach Ägypten, Captain, und die Royal Navy hat uns aufgebracht. Diese Niederlage kann man ja wohl kaum mir ankreiden.« Loup beobachtete, wie seine beiden Männer sich die Hosen anzogen. »Wo ist das Pferd von Kavallerist Godin?«
»Wo Kavallerist Godin hingeht, braucht er kein Pferd mehr«, erwiderte Sharpe.
»Er soll zu Fuß gehen? Nun ja, dann ist das eben so. Das Pferd sei Ihnen als Beute gegönnt, Captain«, sagte Loup großmütig.
»Sie haben mich falsch verstanden, Brigadier«, entgegnete Sharpe. »Die beiden wandern direkt in die Hölle. Ich lasse sie sich nur anziehen, weil sie immer noch Soldaten sind, und selbst so lausige Soldaten wie Ihre haben es verdient, in ihren Hosen zu sterben.« Er drehte sich wieder zum Dorf um. »Sergeant! Stellen Sie die beiden an die Wand! Ich will vier Schützen pro Gefangenen! Vorwärts!«
»Captain!«, schnappte Loup, und seine Hand zuckte zum Säbel.
»Sie machen mir keine Angst, Loup. Weder Sie noch Ihr schickes Kostüm«, sagte Sharpe. »Wenn Sie diesen Säbel ziehen, dann werden wir Ihr Blut mit der Parlamentärsfahne aufwischen. Ich habe Scharfschützen auf dem Kamm da oben, die Ihnen auf zweihundert Yards das gesunde Auge ausschießen können, und einer dieser Schützen hat Sie gerade im Visier.«
Loup schaute den Hügel hinauf. Deutlich sah er dort Prices Rotröcke und einen Grünrock, aber er konnte nicht erkennen, wie viele Männer nun wirklich zu Sharpes Truppe gehörten. Er drehte sich wieder zu Sharpe um.
»Sie sind ein Captain, nur ein Captain. Und das heißt, Sie haben was? Eine Kompanie? Vielleicht zwei? Die Briten würden einem einfachen Captain nie mehr als zwei Kompanien anvertrauen, doch der Rest meiner Brigade steht keine halbe Meile von hier entfernt. Wenn Sie meine Männer töten, dann werden wir Sie jagen wie einen räudigen Hund, und so werden Sie auch sterben, Sie und Ihre Männer. Für Sie werde ich eine Ausnahme machen, was die Regeln des Krieges betrifft, Captain Sharpe, so wie auch Sie eine Ausnahme für meine Männer machen, und Sie werden auf die gleiche Art und Weise sterben wie meine spanischen Feinde: durch ein sehr, sehr stumpfes Messer, Captain Sharpe.«
Sharpe ignorierte die Drohung und drehte sich stattdessen erneut zum Dorf um.
»Ist das Erschießungskommando bereit, Sergeant?«
»Bereit, Sir. Bereit und voller Eifer!«
Sharpe schaute zu dem Franzosen. »Ihre Brigade ist meilenweit entfernt, Brigadier. Wäre sie wirklich in der Nähe, würden Sie nicht mit mir reden, sondern angreifen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Ich muss der Gerechtigkeit Genüge tun.«
»Nein!«, zischte Loup scharf genug, dass Sharpe sich wieder umdrehte. »Ich habe eine Abmachung mit meinen Männern. Das verstehen Sie doch, oder, Captain? Sie sind Offizier, ich bin Offizier, und ich habe meinen Männern versprochen, sie nie im Stich zu lassen. Lassen Sie nicht zu, dass ich mein Versprechen breche.«
»Ihr Versprechen ist mir scheißegal«, erwiderte Sharpe.
Loup hatte mit dieser Art von Antwort gerechnet, und so zuckte er nur mit den Schultern. »Dann lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, was Ihnen vielleicht nicht ganz so scheißegal ist. Ich weiß, wer Sie sind, Captain Sharpe, und wenn Sie mir meine Männer nicht zurückgeben, dann werde ich einen Preis auf Ihren Kopf aussetzen. Ich werde jedem Mann in Portugal und Spanien einen Grund geben, Sie zu jagen. Wenn Sie diese beiden Männer erschießen, dann unterschreiben Sie Ihr eigenes Todesurteil.«
Sharpe lächelte. »Sie sind wirklich ein schlechter Verlierer, Brigadier.«
»Und Sie nicht?«
Sharpe ging weg. »Ich habe noch nie verloren«, sagte er über die Schulter zurück. »Woher soll ich das also wissen?«
»Ihr Todesurteil, Sharpe!«, schrie Loup.
Sharpe hob zwei Finger. Er hatte einmal gehört, dass die englischen Bogenschützen bei Agincourt diese Geste erfunden hatten, um die Franzosen zu verspotten, die damit gedroht hatten, ihnen im Falle der Gefangennahme die Finger abzuschneiden, mit denen sie den Bogen spannten. Und jetzt verspottete Sharpe damit wieder einen Franzosen.
Dann ging er ins Dorf, um die Männer des Wolfsmenschen zu töten.
Major Michael Hogan fand Wellington, als dieser eine Brücke über den Turones inspizierte, wo drei französische Bataillone versucht hatten, die vorrückenden Briten aufzuhalten. Die daraus resultierende Schlacht war kurz und brutal gewesen, und nun zeugte eine Spur von französischen und britischen Leichen von der Heftigkeit des Gefechts. Ein Wall von Leichen markierte die Stelle, wo die beiden Seiten aufeinandergetroffen waren. Ein furchtbar blutdurchtränkter Streifen Erde zeigte, wo zwei britische Geschütze Breschen in die feindlichen Reihen geschlagen hatten, und weiter verstreute Leichen zeugten vom Rückzug der Franzosen. Sie waren so schnell gelaufen, dass ihre Pioniere keine Zeit mehr gehabt hatten, die Brücke zu sprengen.
»Fletcher glaubt, die Brücke stamme noch von den Römern, Hogan«, begrüßte Wellington den irischen Major.
»Mylord, manchmal frage ich mich, ob in Spanien und Portugal seit der Römerzeit überhaupt eine Brücke gebaut worden ist.« Hogan trug einen dicken Mantel zum Schutz vor der feuchten Kälte des Tages. Er nickte den drei Adjutanten Seiner Lordschaft freundlich zu, dann übergab er dem General einen versiegelten Brief. Das Siegel zeigte das königlich-spanische Wappen und war bereits gebrochen. »Ich habe mir erlaubt, den Brief vorsichtshalber zu lesen, Mylord«, erklärte Hogan.
»Ärger?«, fragte Wellington.
»Andernfalls würde ich Sie nicht belästigen, Mylord«, antwortete Hogan düster.
Wellington legte die Stirn in Falten und las den Brief. Der General war ein gut aussehender Mann, zweiundvierzig Jahre alt, aber immer noch genauso gesund und kräftig wie seine Soldaten. Und Hogan hielt ihn auch für klüger als die meisten anderen Offiziere. Die britische Armee, das wusste Hogan, hatte die unglückliche Neigung, die unfähigsten und am wenigsten qualifizierten Männer in die höchsten Positionen zu befördern, doch aus irgendeinem Grund hatte das System in diesem Fall versagt, und Sir Arthur Wellesley, inzwischen der Viscount Wellington, hatte den Oberbefehl über die Armee Seiner Majestät in Portugal erhalten. Und eine bessere Führung konnte sich der Major nicht vorstellen, aber Michael Hogan musste auch einräumen, dass er in dieser Frage vielleicht ein wenig voreingenommen war. Immerhin hatte Wellington Hogans Karriere gefördert und den gerissenen Iren zum Chef seines Nachrichtendienstes gemacht, und als Folge davon war ihre Beziehung nicht nur eng, sondern auch fruchtbar.
Der General las den Brief erneut, und diesmal warf er auch einen Blick auf die Übersetzung, die Hogan fürsorglich angefertigt hatte. In der Zwischenzeit ließ Hogan seinen Blick über das Schlachtfeld wandern, wo Arbeitskommandos die Folgen des Gefechts beseitigten. Östlich der Brücke, dort wo Serpentinen von der Brücke den Berg hinaufführten, suchte ein Dutzend Arbeitskommandos in den Büschen nach Leichen und zurückgelassener Ausrüstung. Die toten Franzosen wurden entkleidet und wie Klafterholz neben einem langen, flachen Massengrab aufgeschichtet, das ein paar Männer gerade aushoben. Andere wiederum stapelten französische Musketen und warfen Kochgeschirr, Patronentaschen, Stiefel und Decken auf einen Karren. Und die Franzosen hatten auch noch weit exotischere Dinge hinterlassen. Auf ihrem Rückzug hatten sie Tausende portugiesische Dörfer geplündert, und so sammelten Wellingtons Männer nun Kirchengewänder, Kerzenleuchter und Silberteller ein.
»Es ist schon erstaunlich, was Soldaten auf dem Rückzug so alles mitschleppen«, bemerkte der General zu Hogan. »Bei einer Leiche haben wir einen Melkschemel gefunden. Einen simplen Melkschemel! Was hat sich dieser Mann nur dabei gedacht? Wollte er ihn etwa mit nach Frankreich nehmen?« Wellington hielt Hogan den Brief hin. »Verdammt«, murmelte er zunächst, um dann mit Nachdruck zu verkünden: »Gottverdammt noch mal!« Er winkte seinen Adjutanten zu gehen. Er wollte allein mit Hogan sein. »Je mehr ich über Seine Allerkatholischste Majestät König Ferdinand VII. erfahre, Hogan, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass man ihn bei der Geburt besser hätte ertränken sollen.«
Hogan lächelte. »Ich glaube, in diesem Fall wäre Ersticken die übliche Methode, Mylord.«
»Ach, ist das so?«
»In der Tat, Mylord, denn dann lässt sich nichts Unlauteres nachweisen. Die Mutter erklärt schlicht, sie habe sich im Schlaf herumgewälzt und die gesegnete kleine Kreatur unter sich begraben, und dann verkündet die Kirche, ein neuer Engel sei geboren worden.«
»In meiner Familie«, sagte der General, »werden ungewollte Kinder zur Armee geschickt.«
»Ich nehme an, das hat den gleichen Effekt, Mylord. Nur das mit den Engeln fehlt.«
Wellington stieß ein kurzes Lachen aus und wedelte dann mit dem Brief. »Wie hat der uns eigentlich erreicht?«
»Auf dem üblichen Weg, Mylord. Ferdinands Diener haben ihn aus Valencay geschmuggelt und nach Süden in die Pyrenäen gebracht, wo sie ihn dann Guerilleros übergeben haben, damit die ihn uns bringen.«
»Und vermutlich haben sie auch eine Kopie nach London geschickt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Kopie abzufangen?«
»Unglücklicherweise ist der Brief schon zwei Wochen alt, Mylord. Vermutlich ist die Kopie bereits angekommen.«
»Gottverdammt noch mal. Verdammt!« Wellington starrte düster zur Brücke, wo seine Männer gerade ein französisches Kanonenrohr bargen. »Was sollen wir nun tun, Hogan? Was sollen wir nun tun?«