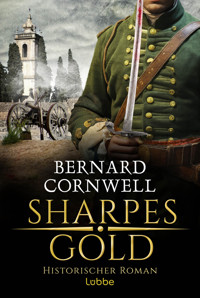9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Spanien, Januar 1812. Für Richard Sharpe ist es der schlimmste Winter seines Lebens. Er verliert zu Unrecht das Kommando über seine Schützen. Ihm bleibt nur eine Chance, dieses zurückzuerobern: Er muss die Attacke auf die unbezwingbare Festung von Badajoz anführen. Ein Himmelfahrtskommando. Zu allem Überfluss taucht auch noch Sharpes Nemesis auf, Sergeant Hakeswill, den Mann, den man nicht töten kann - und Sharpe hat es bereits oft genug versucht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Bernard Cornwell
SHARPESRIVALEN
Richard Sharpe und die Belagerungvon Badajoz, Januar bis April 1812
Aus dem Englischen vonBernd Müller
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Überarbeitete Fassung des 1993 bei Bastei Lübbe erschienenen Romans »Sharps Rivalen«
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1982 by Bernard Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Company«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Rainer Delfs
Titelillustration: © Bao Pham
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-5378-2
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
»Sharpes Rivalen«ist der Harper-Familie gewidmet,Charlie und Marie,Patrick, Donna und Terry,in Zuneigung und Dankbarkeit
»Zu einem Fest des Todes kommst du nun …«
William ShakespeareHenry VI., Erster Teil, Vierter Aufzug,Fünfte Szene
VORWORT
Die Geschichte der Belagerung von Badajoz, der Gegenstand von »Sharpes Rivalen«, ist eine der großen, dramatischen Geschichten des Krieges auf der Iberischen Halbinsel sowie ein Ereignis, über das die britische Armee aufgrund der damit verbundenen Schrecken gerne den Mantel des Schweigens gebreitet hätte.
Badajoz war und ist eine große Festungsstadt, die einst die Südstraße über die bergige Grenze zwischen Portugal und Spanien bewacht hat. Es ist zwar eine stark vereinfachte Darstellung, aber sehr hilfreich, wenn man sagt, dass es zwei Straßen über diese Grenze gab, und beide Straßen wurden von mächtigen Stadtfestungen gesichert: die nördliche von Ciudad Rodrigo und die südliche von Badajoz. Solange diese beiden Festungen nicht in Wellingtons Hand waren, konnte er seine Armee nicht nach Spanien führen. Also mussten sie genommen werden.
Badajoz war die düstere der beiden Städte. Nicht viele Touristen verirren sich dorthin, denn es gibt nur wenig, was Fremde als anziehend empfinden könnten. Die Burg steht noch, und die Stadtmauern ragen finster in den Himmel, aber anderswo in Spanien gibt es schönere Burgen, und Avilas Mauern zum Beispiel sind weitaus pittoresker. Badajoz wirkt dagegen eher unglücklich. Es ist eine schmutzige Industriestadt, die nichts von der sonnigen Lebendigkeit der berühmteren Städte Spaniens hat.
Badajoz’ unglücklichste Nacht war der 6. April 1812, ein Montag. Die Stadt wurde von einer britischen Armee belagert, der es bereits gelungen war, drei Breschen in die hohen Stadtmauern zu schlagen. Viele Leute glauben, eine Bresche sei eine Lücke, die man in die Mauer geschossen hat, doch tatsächlich handelte es sich mehr um ein Mauerstück, das in sich zusammengefallen war. Die Trümmer bilden dann eine steile Rampe zu den Resten der Mauer, und auf der anderen Seite geht es genauso steil wieder hinab. Solch eine Bresche war im Ernstfall mit Fallen übersät, vermutlich vermint, und hinter ihr hatte man neue Verteidigungsstellungen errichtet, um die Angreifer zu begrüßen. In Europa gibt es keine Breschen mehr. Sie sind alle repariert worden, sodass die Mauern wieder verteidigt werden konnten, doch viele Jahre, nachdem ich »Sharpes Rivalen« geschrieben hatte, war ich in der Festung von Gawilgarh im Süden Indiens. Ich folgte noch immer den Spuren von Sharpe und Wellington, und dort konnte ich tatsächlich eine nicht reparierte Bresche hinaufklettern. Zugegeben, ich bin nicht mehr so rank und schlank wie damals, als ich in der 3. Klasse zum Stammspieler unseres Rugbyteams avancierte, aber auch damals wäre es mir verdammt schwergefallen, diese Rampe hinaufzusteigen. Man konnte nicht einfach gehen, sondern musste auf allen vieren hinauf. Eine Bresche galt als begehbar, wenn ein Mann sie nur mit Muskete und Bajonett ausgerüstet erklimmen konnte, aber auch dann musste er sich immer wieder auf dem lockeren Untergrund abstützen oder festhalten, während die gut verschanzten Verteidiger ihn unter schweren Beschuss nahmen. Eine Bresche zu durchschreiten war, als klettere man unter konzentriertem Feuer auf einen Berg. Es war eine furchtbare Angelegenheit.
Und die französischen Verteidiger von Badajoz waren auf den Angriff vorbereitet. Ihre Moral war gut, denn Badajoz war eine ungewöhnliche Stadt. Dort lebte eine große Zahl von Afrancesados, von Spaniern, die mit den Franzosen sympathisierten. Und die Garnison wurde von einem intelligenten und gerissenen Kommandeur geführt, der die Breschen in Todesfallen verwandelt hatte. Die Franzosen waren selbstbewusst und das aus gutem Grund. Sie waren fest davon überzeugt, dass die Rotröcke es nie in die Stadt schaffen würden. Der Angriff war in vielerlei Hinsicht verrückt, doch mehr will ich an dieser Stelle nicht dazu sagen, denn was in jener finstern Nacht geschah, ist Gegenstand dieses Buches. Ich will lediglich hinzufügen, dass diese Nacht durch die Anwesenheit meines Lieblingsschurken sogar noch dunkler wird: Sergeant Obadiah Hakeswill, der vielleicht schlimmste Feind, dem Sharpe je wird gegenübertreten müssen.
Teil I
JANUAR 1812
KAPITEL 1
Wenn man bei Sonnenaufgang ein helles Pferd auf eine Meile Entfernung erkennen kann, heißt das, die Nacht ist vorbei. Späher dürfen sich nun entspannen, Wachbataillone abtreten, denn der Moment für einen Überraschungsangriff im Morgengrauen ist vorüber.
Nicht jedoch an diesem Morgen. Ein Grauschimmel wäre kaum auf einhundert Schritt zu erkennen gewesen, von einer Meile ganz zu schweigen, und die Dämmerung war von schmutzigem Kanonenrauch durchzogen, der von den Schneewolken farblich nicht zu unterscheiden war. Nur ein einziges Lebewesen regte sich im grauen Niemandsland zwischen den britischen und den französischen Linien, ein kleiner dunkler Vogel, der emsig durch den Schnee hüpfte. Captain Richard Sharpe beobachtete in seinen Mantel gehüllt den Vogel und wünschte sich, er würde davonfliegen. Beweg dich, du Halunke! Flieg! Er hasste den Aberglauben, den er nicht loswerden konnte. Er hatte den winzigen Vogel entdeckt, und plötzlich und unverhofft war ihm der Gedanke gekommen, dass der Tag einen bösen Ausgang nehmen müsse, wenn der Vogel nicht binnen dreißig Sekunden davonflog.
Er zählte. Neunzehn, zwanzig, und immer noch hüpfte der vermaledeite Vogel durch den Schnee. Er konnte nicht erkennen, welcher Gattung der Vogel angehörte. Sergeant Harper hätte natürlich Bescheid gewusst. Der hünenhafte Ire kannte alle Vögel, aber das Wissen, um was für einen Vogel es sich handelte, hätte ohnehin nicht geholfen. Beweg dich! Vierundzwanzig, fünfundzwanzig. Verzweifelt formte er rasch einen Schneeball und ließ ihn den Abhang hinunterrollen, sodass sich der kleine Vogel Sekunden vor Ablauf der Frist erschrocken aufschwang, hinein in den wabernden Rauch. Ein Mann musste eben manchmal seines eigenen Glückes Schmied sein.
Gott! Wie kalt es doch war! Den Franzosen machte das nichts aus. Sie saßen hinter den mächtigen Verteidigungsanlagen von Ciudad Rodrigo im Schutze der Häuser und wärmten sich an lodernden Kaminen, aber die britischen und portugiesischen Soldaten kampierten im Freien. Sie schliefen an großen Lagerfeuern, die in der Nacht verloschen, und tags zuvor hatte man bei Tagesanbruch vier portugiesische Wachtposten erfroren aufgefunden. Sie hatten mit am Boden festgefrorenen Mänteln am Ufer des Agueda gelegen. Man hatte sie in den Fluss geworfen, sodass die dünne Eisdecke brach, denn niemand war bei diesem Wetter bereit, Gräber auszuheben. Die Soldaten hatten genug vom Graben. Zwölf Tage lang hatten sie nichts anderes getan. Batterien, Stellungen, Schützengräben – am liebsten hätten sie nie mehr gegraben. Sie wollten kämpfen. Sie wollten mit ihren langen Bajonetten das Glacis, die flach ansteigende Erdaufschüttung vor dem Festungsgraben von Ciudad Rodrigo, erstürmen, wollten sich in die Bresche werfen, wollten die Franzosen vernichten und die Feuerstellen und Häuser für sich erobern. Sie sehnten sich nach Wärme.
Sharpe, Captain der Leichten Kompanie des Regiments South Essex, lag im Schnee und beobachtete durch sein Fernrohr die größte Bresche. Viel konnte er nicht erkennen. Selbst vom Hang aus, ganze fünfhundert Yards von der Stadt entfernt, verbarg das Glacis bis auf deren oberste Spitze fast die gesamte Stadtmauer von Ciudad Rodrigo. Er stellte fest, dass die britischen Kanonen einigen Schaden angerichtet hatten, und er wusste, dass sich Steine und Schutt in den unsichtbaren Graben ergossen haben mussten. Dadurch war eine provisorische Rampe von etwa dreißig Yards Breite entstanden, die die Angreifer zu erklimmen hatten, um ins Innere der Festungsstadt zu gelangen.
Er wünschte sich, jenseits der Bresche die Gassen am Fuße des zerschossenen Kirchturms dicht an der Mauer einsehen zu können. Sicher waren die Franzosen dort emsig dabei, neue Verteidigungsanlagen zu bauen und die zerstörten Kanonen zu ersetzen, sodass dem Angriff, wenn er über die Geröllhalde an der Bresche erfolgte, mit präzise geplantem Grauen, mit Feuer und Kartätschen und mit nächtlichem Tod begegnet werden konnte.
Sharpe hatte Angst.
Er schämte sich dieser seltsamen, nur ihm bekannten Tatsache. Er war sich nicht sicher, dass der Angriff an diesem Tag erfolgen würde, doch die Soldaten hatten das Gespür von Männern, die wussten, wann die Zeit reif war, und sie waren überzeugt, dass Wellington noch in dieser Nacht den Angriff einleiten würde.
Niemand wusste, welche Bataillone er dazu beordern würde, aber welchen Einheiten es auch bestimmt sein würde, die Attacke zu übernehmen, sie würden nicht die Ersten sein, die diese Bresche angingen. Das war eine Aufgabe, die ausschließlich für Freiwillige geeignet war, ein »Himmelfahrtskommando«, dessen selbstmörderische Pflicht darin bestand, das Feuer der Verteidiger auf sich zu ziehen, sie zu zwingen, dass sie ihre sorgsam vorbereiteten Fallen zuschnappen ließen. Sie mussten den Bataillonen, die ihnen folgten, einen blutigen Pfad ebnen.
Nicht viele der am Himmelfahrtskommando Beteiligten würden überleben. Der befehlshabende Lieutenant würde, wenn er noch lebte, auf der Stelle zum Captain ernannt werden und seine beiden Sergeants zu Ensigns. Die Versprechen auf Beförderung wurden leichten Herzens gegeben, da sie selten eingelöst werden mussten. Dennoch fehlte es nie an Freiwilligen.
Das Himmelfahrtskommando war etwas für die Tapferen. Diese Tapferkeit mochte aus Verzweiflung geboren sein oder aus Torheit, doch Tapferkeit war es in jedem Fall. Männer, die ein solches Unternehmen überlebten, waren fürs Leben gezeichnet. Sie waren berühmt bei ihren Kameraden, wurden von geringeren Männern beneidet. Nur die Schützenregimenter verliehen allen Überlebenden ein Abzeichen, einen Lorbeerkranz, der auf den Ärmel genäht wurde. Aber Sharpe ging es nicht um Auszeichnungen. Ihm ging es darum, eine Mutprobe zu bestehen, eine entscheidende Mutprobe, die beinahe mit Sicherheit den Tod brachte. Er hatte noch nie an einem Himmelfahrtskommando teilgenommen. Der Wunsch, es zu tun, war töricht, dessen war er sich bewusst, doch er war unleugbar vorhanden.
Und es war nicht die Mutprobe allein. Richard Sharpe war auf Beförderung aus. Er war mit sechzehn Jahren als einfacher Soldat in die Army eingetreten und hatte sich durch die Mannschaftsränge hochgedient, bis er Sergeant geworden war. Auf dem Schlachtfeld von Assaye hatte er Sir Arthur Wellesley das Leben gerettet und war mit dem Fernrohr und einem Offizierspatent belohnt worden. Ensign Sharpe, aufgestiegen aus der Gosse, aber nach wie vor ehrgeizig, musste immer noch Tag für Tag beweisen, dass er ein besserer Soldat war als die Söhne privilegierter Familien, die sich ihre Beförderung erkauften und mit ihrem Vermögen im Rücken mühelos aufstiegen.
Aus Ensign Sharpe wurde Lieutenant Sharpe, und in der neuen, dunkelgrünen Uniform der 95th Rifles hatte er sich durch Spanien und Portugal gekämpft – beim Rückzug von La Coruña, Rolica, Vimeiro, bei der Überquerung des Duero und in Talavera. Bei Talavera hatte er den französischen Adler erbeutet. Damals hatten Sergeant Harper und er sich inmitten eines feindlichen Regiments den Weg frei gehackt, hatten den Standartenträger niedergemacht und Wellesley die Trophäe überbracht. Der war zum Viscount Wellington of Talavera ernannt worden, und Sharpe hatte man kurz vor der Schlacht zum Captain befördert. Das hatte er sich am meisten gewünscht: Gelegenheit, seine eigene Kompanie zu befehligen. Doch seine Ernennung lag jetzt zweieinhalb Jahre zurück und war immer noch nicht bestätigt worden.
Er konnte es kaum glauben. Im Juli war er nach England heimgekehrt und hatte die letzten sechs Monate des Jahres 1811 damit verbracht, in London und den südenglischen Grafschaften Männer für das schrumpfende Regiment South Essex zu rekrutieren.
In London hatte man ihn gefeiert, der Patriotische Verein hatte ihm zu Ehren ein Festessen gegeben und ihm als Belohnung für die Eroberung des französischen Adlers einen Degen im Wert von fünfzig Guineen überreicht. Der Morning Chronicle hatte ihn den »narbenbedeckten Helden des Schlachtfeldes von Talavera« getauft, und plötzlich war, wenigstens ein paar Tage lang, jedermann darauf erpicht gewesen, den hoch gewachsenen, dunkelhaarigen Rifleman kennenzulernen und die Narbe zu sehen, die seinem Gesicht einen unnatürlich spöttischen Ausdruck verlieh.
Er hatte sich in der überdekorierten Weichlichkeit der Londoner Salons fehl am Platz gefühlt und hatte sein Unbehagen kaschiert, indem er sich schweigsamer Distanz befleißigte. Seine Zurückhaltung war von seinen Gastgeberinnen als gefährlich attraktiv empfunden worden. Sie hatten ihre Töchter ins obere Stockwerk verbannt und den Captain der Rifles für sich vereinnahmt.
Doch der Held des Schlachtfeldes von Talavera war dem Generalstab der Armee bei den Horse Guards nur zur Last gefallen. Es war ein Fehler gewesen, ein dummer Fehler, aber er hatte in Whitehall vorgesprochen und war dort in einen kahlen Warteraum geführt worden. Durch eine hohe, zerbrochene Fensterscheibe hatte er einige Tropfen herbstlichen Regens abbekommen, während er mit seinem mächtigen Kavalleriesäbel über den Knien da saß und ein pockennarbiger Mann aus der Schreibstube festzustellen versuchte, was aus seiner Ernennungsurkunde geworden war. Sharpe wollte einfach wissen, ob er tatsächlich Captain war, sanktioniert durch die Bestätigung der Horse Guards, oder nur ein Lieutenant mit geborgtem Rang. Der Schreiber hatte ihn drei Stunden warten lassen, war jedoch schließlich auf ihn zurückgekommen. »Sharpe? Mit ›e‹ am Ende?«
Sharpe hatte genickt. Um ihn herum hatte eine Schar auf halben Sold gesetzter Offiziere, die krank, lahm oder halb erblindet waren, neugierig zugehört. Sie waren alle auf der Suche nach einem Posten und hofften, dass Sharpe eine Enttäuschung erleben würde. Der Schreiber hatte Staub von den Papieren in seiner Hand geblasen.
»Ihre Uniform entspricht nicht den Vorschriften.« Er hatte Sharpes dunkelgrüne Jacke mit einem Seitenblick bedacht. »Das South Essex Regiment, sagten Sie?«
»Jawohl.«
»Aber das ist doch, wenn ich mich nicht irre, und ich irre mich selten, die Uniform des 95th Regiments?« Der Schreiber hatte ein leises, selbstzufriedenes Lachen von sich gegeben, als ginge es darum, einen kleineren Sieg zu feiern. Sharpe hatte nichts gesagt. Er trug die Uniform der Rifles, weil er stolz war auf sein altes Regiment, weil seine Abstellung zum South Essex nur als vorübergehende Angliederung gedacht war. Wie hätte er diesem beschränkten Bürokraten klar machen sollen, was es bedeutet hatte, eine kleine Schar von Rifles aus den Schrecken des Rückzugs nach La Coruña zu retten? Sich mit ihnen der Armee in Portugal anzuschließen, wo sie willkürlich den Rotröcken des South Essex zugeteilt worden waren? Der Schreiber hatte die Nase gerümpft und geschnüffelt. »Vorschriftswidrig, Mister Sharpe, in hohem Maße vorschriftswidrig.« Mit tintenbefleckten Fingern hatte er das oberste Blatt Papier aufgenommen. »Dies ist das fragliche Dokument.«
Er hatte Sharpes Ernennungsurkunde so angefasst, als könne er sich davon ein zweites Mal die Pocken holen. »Ihnen wurde 1809 der Rang eines Captains verliehen?«
»Von Lord Wellington.«
Mit diesem Namen war in Whitehall kein Staat zu machen. »Der es besser hätte wissen müssen. Meine Güte, Mister Sharpe. Er hätte es wirklich besser wissen müssen! Die Angelegenheit ist höchst irregulär.«
»Aber doch sicherlich nicht ohne Präzedenzfall?« Sharpe hatte dem Drang widerstanden, seinen Ärger an dem Schreiber auszulassen. »Ich dachte, es wäre Ihre Aufgabe, solche Dokumente zu bestätigen.«
»Oder abzulehnen!« Der Schreiber hatte wieder gelacht, und die auf halben Sold gesetzten Offiziere hatten gegrinst. »Oder sie abzulehnen, Mister Sharpe!«
Durch den Schornstein war Regen eingedrungen, sodass das kärgliche Kohlenfeuer im Kamin zischte. Der Schreiber, dessen magere Schultern vom lautlosen Gelächter zuckten, hatte einen Kneifer aus den Falten seiner Kleidung hervorgezogen und ihn sich aufgesetzt, als könne die Ernennungsurkunde, wenn man sie durch verschmierte Gläser betrachtete, neuen Anlass zur Heiterkeit bieten. »Wir lehnen sie ab, Sir, die meisten lehnen wir ab. Man lässt sie einmal durchgehen, und schon muss man sie immer durchgehen lassen. Das bringt das System durcheinander. Sie wissen schon. Es gibt gewisse Regeln, Vorschriften, Dauerbefehle!« Der Schreiber hatte den Kopf geschüttelt, weil offensichtlich war, dass Sharpe nicht verstanden hatte, wie es bei der Army zuging.
Sharpe hatte gewartet, bis das Kopfschütteln vorbei war. »Sie scheinen lange gebraucht zu haben, um über diese Ernennung zu entscheiden.«
»Und die Entscheidung ist noch nicht gefallen!«, hatte der Schreiber stolz gesagt, als sei die Tiefe der bei den Horse Guards versammelten Weisheit am Faktor der Zeit zu ermessen. »Um die Wahrheit zu sagen, Mister Sharpe, es wurde ein Fehler gemacht. Ein bedauerlicher Fehler, aber Ihr Besuch hat diesen Fehler rektifiziert.« Er hatte über den Rand seines Kneifers hinweg zu dem hoch gewachsenen Rifleman aufgeblickt. »Wir sind Ihnen wirklich höchst dankbar, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben.«
»Was für ein Fehler?«
»Die Akte war falsch abgelegt.« Der Schreiber hatte ein zweites Blatt Papier von der linken in die rechte Hand genommen. »Unter Lieutenant Robert Sharp, ohne ›e‹ am Ende, der 1810 am Fieber verstorben ist. Ansonsten waren seine Papiere in bester Ordnung.«
»Meine etwa nicht?«
»In der Tat, nein, aber Sie sind ja auch noch am Leben.« Der Schreiber hatte Sharpe verdrießlich angesehen. »Wenn ein Offizier in die Ewigkeit eingeht, gibt uns das Gelegenheit, seine Papiere zu ordnen.« Er hatte den Kneifer abgenommen und ihn an Sharpes gefalteter Ernennungsurkunde abgewischt. »Wir werden uns darum kümmern, Mister Sharpe, und zwar prompt. Das verspreche ich Ihnen. Prompt!«
»Bald?«
»Sagte ich das nicht? Es wäre falsch, mehr zu sagen.« Der Schreiber hatte seinen Kneifer weggesteckt. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, es herrscht Krieg, und ich habe noch andere Pflichten zu erfüllen!«
Nachträglich hatte Sharpe eingesehen, dass es falsch gewesen war, Whitehall einen Besuch abzustatten, aber es war nun einmal geschehen, und ihm blieb nichts anderes übrig, als weiterhin zu warten. Gewiss, hatte er sich jeden Tag ein Dutzend Mal gesagt, konnten sie die Ernennung nicht einfach ablehnen. Doch nicht, nachdem er den Adler erbeutet hatte! Nachdem er das Gold aus der brennenden Stadt Almeida geschafft hatte, nachdem er die besten französischen Truppen in den Todesfallen von Fuentes de Onoro niedergemetzelt hatte?
Er starrte niedergeschlagen über das verschneite Land auf die Bresche in den Verteidigungsanlagen von Ciudad Rodrigo. Er wusste, dass er sich zu dem Himmelfahrtskommando hätte melden müssen. Hätte er es befehligt und dabei überlebt, hätte ihm niemand mehr den Rang eines Captains streitig machen können. Damit hätte er sich bewiesen, sich den Rang erobert, und die pockennarbigen Bürokraten von Whitehall hätten sich bis in die wohl geordnete Ewigkeit den Kopf kratzen können, weil sie nichts, aber auch gar nichts hätten tun können, um ihm die Ernennung zu verweigern. Sollten sie doch allesamt die Krätze kriegen!
»Richard Sharpe!« Hinter ihm ertönte freudig eine ruhige Stimme, und Sharpe drehte sich um.
»Sir!«
»Hab ich’s doch geahnt! Wusste ich doch, dass du wieder bei der Armee eingetrudelt bist.« Major Michael Hogan rutschte durch den Schnee auf ihn zu. »Wie geht es dir?«
»Mir geht es gut.« Sharpe richtete sich mühsam auf. Er wischte sich den Schnee vom Mantel und schüttelte Hogans behandschuhte Hand.
Der Pionier lachte ihn an. »Du siehst aus wie ein ersoffener Kesselflicker, wahrhaftig, aber ich freue mich, dich zu sehen.« Die Stimme des Iren klang tief und warm. »Wie war es in England?«
»Kalt und feucht.«
»Ah, na ja, England ist Protestantenland.« Hogan zog es vor, zu ignorieren, dass die spanische Landschaft um ihn herum ebenfalls eisig und nass war. »Und wie geht es Sergeant Harper? Hat ihm England gefallen?«
»Allerdings. Und was ihm daran besonders gefallen hat, war drall und hat gekichert.«
Hogan lachte. »Ein vernünftiger Mann. Wirst du ihn von mir grüßen?«
»Das werde ich.« Die beiden Männer blickten zur Stadt hinüber. Die britischen Belagerungsgeschütze, lange Vierundzwanzigpfünder, feuerten ununterbrochen. Ihr Krachen wurde vom Schnee gedämpft, und ihre Geschosse ließen von den Mauern zu beiden Seiten der Hauptbresche Schnee und Steinsplitter aufstieben. Sharpe warf Hogan einen Seitenblick zu. »Ist es Geheimsache, dass wir heute Nacht angreifen?«
»Ja, es wird geheim gehalten. Natürlich wissen wie immer alle Bescheid. Noch vor dem General. Gerüchteweise ist von sieben Uhr die Rede.«
»Ob in dem Gerücht wohl auch vom South Essex die Rede ist?«
Hogan schüttelte den Kopf. Er gehörte Wellingtons Stab an und wusste, was geplant war. »Nein, aber ich hatte gehofft, euren Colonel zu überreden, dass er mir deine Kompanie ausleiht.«
»Meine?« Sharpe war erfreut. »Warum?«
»Eine Kleinigkeit. Ich will dich und deine Jungs nicht etwa in die Bresche jagen, aber den Pionieren fehlt es wie immer an Personal, und es gibt einen Haufen Gerätschaften, die das Glacis hinaufgeschafft werden müssen. Wäre dir das recht?«
»Natürlich.« Sharpe fragte sich, ob er Hogan von seinem Wunsch erzählen sollte, sich zum Himmelfahrtskommando zu melden, aber er wusste, dass der irische Pionier ihn für verrückt halten würde, daher sagte er nichts. Stattdessen überließ er Hogan sein Fernrohr und wartete schweigend ab, während der Pionier die Bresche in Augenschein nahm. Hogan grunzte. »Die ist längst begehbar.«
»Ganz sicher?« Als Sharpe das Glas zurücknahm, tasteten seine Finger instinktiv über die eingelassene Messingplakette: »In Dankbarkeit. AW. 23. September 1803.«
»Sicher sind wir nie. Aber meiner Meinung nach besteht keine Aussicht, dass es besser wird.« Die Pioniere hatten die Aufgabe, Meldung zu machen, sobald eine Bresche »begehbar« war, sobald sich ihrer Meinung nach die Schutthalde von der angreifenden Infanterie erklimmen ließ. Sharpe blickte den kleinen, ältlichen Major an.
»Glücklich scheinen Sie darüber nicht zu sein.«
»Natürlich bin ich nicht glücklich. Niemand ist glücklich über eine Belagerung.« Wie vor ihm Sharpe versuchte sich nun Hogan vorzustellen, was für Schrecken die Franzosen jenseits der Bresche bereithielten.
Eine Belagerung war theoretisch die wissenschaftlichste aller Kampfformen. Die Angreifer schlugen Breschen in die Verteidigungsanlagen, und beide Seiten wussten, wann diese Breschen begehbar waren, doch alle Vorteile lagen auf Seiten der Verteidiger. Sie wussten, wo der Hauptangriff erfolgen würde und wann, und sie wussten ungefähr, wie viele Soldaten auf einmal durch die Bresche eindringen konnten.
An diesem Punkt hörte die Wissenschaft auf. Es erforderte großes Geschick, die Batterien aufzustellen und die Schützengräben richtig anzuordnen, aber wenn die Wissenschaft der Pioniere erst die Bresche geschlagen hatte, blieb es der Infanterie überlassen, die Mauern zu stürmen und im Schutt zu sterben.
Die Belagerungsgeschütze taten, was sie konnten. Sie würden bis zum allerletzten Augenblick schießen, wie sie jetzt schossen, doch bald würden die Bajonette ihre Arbeit übernehmen, und die Angreifer würden allein von roher Wut durch das lauernde Entsetzen getrieben werden. Sharpe empfand erneut die Angst, die mit dem Sturm auf eine Bresche verbunden war.
Der Ire schien seine Gedanken zu erahnen. Er klopfte Sharpe auf die Schulter. »Ich hab diesmal ein gutes Gefühl, Richard. Es wird schon alles gut gehen.« Er wechselte das Thema. »Hast du von deiner Frau gehört?«
»Von welcher?«
Hogan schnaubte. »Von welcher! Von Teresa natürlich!«
Sharpe schüttelte den Kopf. »Seit sechzehn Monaten nicht mehr. Ich weiß nicht, wo sie sich aufhält.« Ja, dachte er, nicht einmal, ob sie noch lebt. Sie kämpfte in der »Guerilla« gegen die Franzosen, im sogenannten »Kleinen Krieg«, und die Hügel und Felsen ihres Kampfgebietes waren nicht weit von Ciudad Rodrigo entfernt. Er hatte sie nicht wiedergesehen, seit sie sich vor Almeida getrennt hatten. Als er nun an sie dachte, spürte er in seinem Innern ein plötzliches Verlangen. Sie hatte das Gesicht eines Falken, schmal und grausam, schwarzes Haar und dunkle Augen. Teresas Schönheit war die eines edlen Degens: schlank und hart.
Seither hatte er in England Jane Gibbons kennengelernt, deren Bruder Lieutenant Gibbons versucht hatte, ihn bei Talavera umzubringen. Nun war Gibbons selbst tot. Jane Gibbons war eine Schönheit in dem Sinne, wie sich Männer Schönheit erträumen: blond und feminin und so schlank wie Teresa, doch da hörte die Ähnlichkeit schon auf. Die Spanierin konnte innerhalb von dreißig Sekunden das Schloss eines Baker-Gewehrs reinigen, konnte auf zweihundert Schritt einen Mann töten, konnte einen Hinterhalt legen und wusste, wie man einem gefangenen Franzosen einen langsamen Tod bereitete, als Vergeltung für die Vergewaltigung und Ermordung ihrer eigenen Mutter. Jane Gibbons dagegen verstand es, das Pianoforte zu spielen und einen wohlgesetzten Brief zu schreiben, sie wusste, wie man bei einem ländlichen Ball einen Fächer einsetzt, und fand Vergnügen daran, ihr Geld bei den Hutmacherinnen von Chelmsford zu lassen. Sie waren so gegensätzlich wie Stahl und Seide, doch Sharpe begehrte sie beide, obwohl ihm klar war, dass derlei Träume aussichtslos waren.
»Sie lebt«, sagte Hogan leise.
»Lebt?«
»Teresa.« Hogan musste es wissen. Trotz des Mangels an Pionieren hatte Wellington Hogan in seinen Stab aufgenommen. Der Ire sprach Spanisch, Portugiesisch und Französisch, konnte die feindlichen Codes entschlüsseln und verwandte viel Zeit darauf, mit den Guerilleros zusammenzuarbeiten oder mit Wellingtons Erkundungsoffizieren, die allein und in voller Uniform hinter den französischen Linien umher ritten. Hogan sammelte das, was Wellington als »Erkenntnisse« bezeichnete, und Sharpe wusste, dass Hogan Bescheid wissen musste, wenn Teresa noch am Kampf beteiligt war.
»Was genau haben Sie gehört?«
»Nicht viel. Sie hat sich längere Zeit allein im Süden aufgehalten, aber nun soll sie wieder in den Bergen sein. Ihr Bruder befehligt den Kampftrupp, nicht sie. Aber sie wird nach wie vor ›La Aguja‹ genannt.«
Sharpe lächelte. Er selbst hatte ihr diesen Beinamen verliehen: die Nadel. »Warum ist sie nach Süden gegangen?«
»Ich weiß es nicht.« Hogan lächelte ihm zu. »Kopf hoch. Du wirst sie wiedersehen. Außerdem würde ich sie selbst gern kennenlernen.«
Sharpe schüttelte den Kopf. Es war lange her, und sie hatte keine Anstrengungen unternommen, ihn zu finden. »Es muss eine letzte Frau geben, Sir, genau wie eine letzte Schlacht.«
Hogan brüllte vor Lachen. »Gott im Himmel! Eine letzte Frau. Du ewiger Pessimist! Als Nächstes wirst du mir mitteilen, dass du dich zur Priesterlaufbahn entschlossen hast.« Er wischte sich eine Träne von der Wange. »Eine letzte Frau, so was!« Er wandte sich ab, um noch einmal zur Stadt hinüber zu blicken. »Hör zu, mein Freund, ich muss mich nützlich machen, sonst bin ich der letzte Ire in Wellingtons Stab gewesen. Wirst du auch gut auf dich aufpassen?«
Sharpe grinste und nickte. »Ich werd’s schon überleben.«
»Eine nützliche Selbsttäuschung. Ich freue mich, dass du wieder da bist.« Er lächelte und begann durch den Schnee zu stapfen auf Wellingtons Hauptquartier zu.
Sharpe richtete erneut seine Aufmerksamkeit auf Ciudad Rodrigo. Überleben. Dies war eine schlechte Zeit, um zu kämpfen. Die Jahreswende war die Zeit, in der die Männer in die Zukunft blickten, in der sie von fernen Freuden träumten, von einem kleinen Haus und einer guten Frau, von abendlichen Freundesbesuchen. Der Winter war die Zeit, in der ganze Armeen in ihren Unterkünften blieben und darauf warteten, dass der Frühlingssonnenschein die Straßen trocknete und die Flüsse schrumpfen ließ. Doch Wellington war in den ersten Tagen des neuen Jahres abmarschiert, und die französische Garnison von Ciudad Rodrigo war eines kalten Morgens erwacht, um festzustellen, dass Krieg und Tod im Jahre 1812 früh eingetroffen waren.
Und Ciudad Rodrigo war erst der Anfang. Es gab nur zwei Straßen von Portugal nach Spanien, die das Gewicht der schweren Artillerie standhielten, das endlose Mahlen der Räder an den Munitionskarren, den stampfenden Marschtritt von Bataillonen und Schwadronen. Ciudad Rodrigo sicherte die nördliche Straße, und am heutigen Abend, wenn die Kirchenglocke siebenmal läutete, gedachte Wellington die Festung einzunehmen. Als Nächstes, wusste die gesamte Armee, wusste ganz Spanien, galt es die südliche Straße zu erobern. Aus Gründen der Sicherheit, um Portugal zu beschützen, um nach Spanien eindringen zu können, mussten die Briten beide Straßen kontrollieren. Und wenn sie die südliche Straße kontrollieren wollten, mussten sie zunächst Badajoz einnehmen.
Badajoz. Sharpe war dort gewesen, nach Talavera und bevor die spanische Armee die Stadt auf jämmerliche Weise den Franzosen überlassen hatte. Ciudad Rodrigo war groß, jedoch klein im Vergleich zu Badajoz. Im Schnee sahen die Mauern eindrucksvoll aus, doch neben den Bastionen von Badajoz hätten sie kümmerlich gewirkt. Richard Sharpe ließ seine Gedanken mit dem Kanonenrauch über Ciudad Rodrigo gen Süden ziehen, über die Berge hinweg, dorthin, wo die mächtige Festung dunkle Schatten auf die kalten Wasser des Rio Guadiana warf. Badajoz. Zweimal war es den Briten misslungen, den Franzosen die Stadt abzuringen. Bald mussten sie es wieder versuchen.
Er wandte sich ab und begab sich zurück zu seiner Kompanie am Fuße des Hügels.
Natürlich konnte es sein, dass ein Wunder geschah. Die Garnison von Badajoz konnte vom Fieber befallen werden, das Magazin konnte in die Luft fliegen, der Krieg konnte beendet werden, aber Sharpe wusste, dass das vergebliche Hoffnungen waren, beflügelt vom kalten Wind.
Er dachte an seinen Offiziersrang, an seine Beförderung, und obwohl er wusste, dass Lawford, sein Colonel, ihm niemals das Kommando über die Kompanie entziehen würde, fragte er sich immer noch, warum er sich nicht zu dem Himmelfahrtskommando gemeldet hatte. Dieser Schritt hätte seinen Rang gesichert. Obendrein hätte er damit die Probe bestanden, mit der Angst fertig zu werden, die jeden Mann ergriff, wenn er als Erster eine mit aller Macht verteidigte Bresche stürmte.
Aber er hatte sich nun einmal nicht gemeldet, und wenn er seine Tapferkeit, die er in der Vergangenheit so oft bewiesen hatte, bei der Erstürmung von Ciudad Rodrigo nicht beweisen konnte, würde er den Beweis eben später antreten.
In Badajoz.
KAPITEL 2
Die Befehle trafen am Spätnachmittag ein. Sie überraschten niemanden, ließen jedoch bei den Bataillonen stille Geschäftigkeit aufkommen. Bajonette wurden geschliffen und geölt. Musketen ein ums andere Mal überprüft. Währenddessen schlugen die Geschosse der Belagerungsgeschütze weiter in die französischen Bastionen ein, um die unsichtbar wartenden Kanonen zu zerstören. Grauer Rauch stieg von den Batterien auf und vereinigte sich mit den niedrigen, brodelnden Wolken, die von der Farbe her nassem Schießpulver glichen.
Sharpes Leichte Kompanie sollte, wie Hogan verlangt hatte, zusammen mit den Pionieren auf die größte Bresche vorrücken. Sie sollten riesige Säcke Heu mit sich führen, die man in den abschüssigen Graben werfen würde, um so ein mächtiges Polster zu schaffen, auf dem das Himmelfahrtskommando und die angreifenden Bataillone unversehrt landen konnten.
Sharpe sah zu, wie seine Männer nacheinander in die vordersten Schützengräben stiegen, jeder mit einem der grotesken vollgestopften Säcke in der Hand. Sergeant Harper ließ seinen Sack fallen, setzte sich darauf, knuffte ihn zurecht, bis er es bequem hatte, und lehnte sich dann zurück. »Besser als ein Federbett, Sir.«
Fast jeder Dritte in Wellingtons Armee stammte wie der Sergeant aus Irland. Patrick Harper war ein hünenhafter Mann, sechseinhalb Fuß muskelbepackter Selbstzufriedenheit, dem es längst nicht mehr seltsam vorkam, dass er in einer Armee kämpfte, die nicht seine eigene war. Der Hunger hatte ihn aus dem heimischen Donegal rekrutiert. In seinem Kopf hielten sich die Erinnerungen an seine Heimat, die Liebe zu ihrer Religion und Sprache und ein finsterer Stolz auf ihre alten Kriegshelden. Er kämpfte nicht für England, und schon gar nicht für das South Essex Regiment, sondern für sich und für Sharpe. Sharpe war sein Offizier, ein Rifleman wie er und sein Freund, falls Freundschaft zwischen einem Captain und einem Sergeant überhaupt möglich war.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!