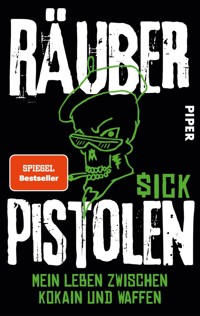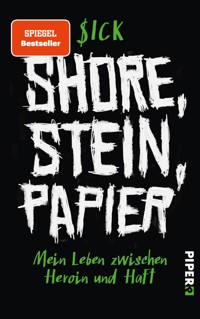
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Shore« ist der Straßenname für Heroin, »Stein« ist Koks und »Papier« ist Geld. Über zwanzig Jahre sind das die Eckpfeiler in $icks Leben. Nachdem er mit 15 zum ersten Mal Shore raucht, rutscht er immer tiefer ab in eine Spirale aus Drogensucht, Beschaffungskriminalität und Haftstrafen. Nach der Geburt seiner Tochter und verschiedenen Entzugsprogrammen ist $ick heute clean. In der erfolgreichen YouTube-Serie Shore, Stein, Papier redete er sich alles von der Seele, für seine ehrliche und authentische Erzählweise wurde er beim Grimme Online Award 2015 mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. In diesem Buch erzählt er seine Geschichte – unverblümt und ohne erhobenen Zeigefinger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deZum Schutz der Persönlichkeitsrechte wurden Namen, Orte und Personen verändert. Handlungen und Gespräche beruhen auf wahren Gegebenheiten, sind jedoch aus der Erinnerung rekonstruiert und erheben nicht den Anspruch, die alleinige Wahrheit zu sein.ISBN 978-3-492-97558-2© Piper Verlag GmbH, München 2016Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenInnenabbildungen: Dido Walstra, NürnbergDatenkonvertierung: Uhl+Massopust, AalenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Und am Ende bleibt nur eine Geschichte.
Irgendwo in Hannover, früher Morgen, Herbst 1995
Das Blut läuft dünn wie Wasser aus den Einstichstellen an meinen Armen und Handrücken. Immer wieder jage ich mir die Nadel im Schein der Straßenlaterne in den linken und dann in den rechten Arm. Am liebsten würde ich die Nadel an der Halsschlagader ansetzen, aber dazu bin ich auch mit Spiegel nicht mehr in der Lage. Meine Hände zittern und vor meinen Augen verschwimmt alles.
Tränen schießen mir in die Augen. Durch den Nebel in meinem Kopf sehe ich den Sensenmann auf mich zukommen. Jedes Mal, wenn ich mir die Kanüle ins Fleisch bohre, kommt er einen Schritt näher, so nahe, dass ich glaube, ihn berühren zu können, wenn ich die Hand nach ihm ausstrecken würde. Trotzdem höre ich nicht auf, mich mit dem Stahl zu penetrieren. Auf dem Asphalt zwischen meinen Füßen glänzt eine Blutlache.
Als die Kripo das erste Mal hinter mir vorbeifährt, fingere ich nach der Geldrolle in meiner blutverschmierten, schmutzigen Jeans und lege sie neben mir auf die Bank. Ein schneller Griff in die Socken und knapp zehn Gramm Koka wandern direkt daneben. Ich verstecke beides am Fuß eines Baumes, dann setze ich mich wieder zurück auf die Bank.
Völlig überdosiert und jetzt auch noch mit Bullenstress im Nacken stochere ich in meinen Venen herum. Einen Druck schaffe ich bestimmt noch, bevor sie mich verhaften. Wieder und wieder versuche ich, mir einen Knaller zu setzen. Doch entweder steche ich durch die Vene oder ich rutsche sofort wieder raus. Ich vibriere wie ein Dildo auf Stufe drei. Immer wieder kommen mir die Tränen und verschleiern mir die Optik. Die Jungs von der Staatsgewalt drehen ihre dritte Runde. Vielleicht hab ich noch zwei, drei Minuten, bevor der Bullenfilm losgeht. Eher weniger.
Getroffen! Das Blut schießt in die Pumpe, ich greife um und drück mir die komplette Ladung in die Vene. Der Kokainexpress rast mit einem Höllentempo durch meinen Schädel. Langsam ziehe ich die Nadel aus der Vene und das Blut läuft mir am Unterarm runter, über den zerstochenen Handrücken, sammelt sich an der Spitze meines Zeigefingers, tropft im Sekundentakt auf den Asphalt.
Wenige Augenblicke später stehen zwei Beamte der Kriminalpolizei neben mir. Einer sagt was von »Spritze weglegen« und »Personenkontrolle«. Die Worte kommen von ganz weit weg, wie durch einen langen, dunklen Tunnel, der in meinem betäubten Schädel endet.
Ich stehe auf, schwankend wie ein Volltrunkener. Die Zugfahrt in meinem Kopf ist noch nicht vorbei. Ich krame alles aus meinen Taschen heraus und werfe es auf die Bank.
Einer der Beamten schnappt sich mein Portemonnaie und wühlt darin nach meinen Personalien. Natürlich findet er nichts, außer etwa 200 Mark in kleinen Scheinen und ein paar Zettel mit Telefonnummern und akas statt Namen.
Ich bin müde, völlig ausgelutscht und nur wenige Schritte trennen mich vom Exitus. Also gebe ich meinen richtigen, vollständigen Namen und mein Geburtsdatum an. Ich allein bin nicht mehr in der Lage, aus diesem Teufelskreis auszubrechen.
Seit Tagen schon wusste ich, dass der Tod und ich aufeinander zurannten, aber ich hörte einfach nicht auf, mir den Dreck in die Venen zu jagen. Wie von Sinnen kam ich dieser unglaublichen Gier nach, die das Kokain mit sich bringt, und machte innerhalb von knapp zehn Monaten ein zerschlissenes Nadelkissen aus meinem Körper.
Es liegt ein Haftbefehl gegen mich vor. Einer der beiden Polizisten will mir die Acht anlegen, doch der andere hält ihn davon ab.
»Versuchst du wegzurennen, wenn wir auf die Handschellen verzichten?«, fragt er mich fast väterlich.
Ich schüttele den Kopf und gehe schwankend auf ihr Dienstfahrzeug zu, die beiden Beamten links und rechts an meiner Seite. Ich bedanke mich mechanisch, als sie mir die Wagentür öffnen und lasse mich auf die Rückbank fallen. Ein zweites Mal befreit mich eine Verhaftung aus den Klauen meiner Sucht. Dieses Mal rettet sie mir tatsächlich das Leben.
Als wir am Waterlooplatz bei den Arrestzellen ankommen, fordern die Beamten sofort einen Arzt an. Sie sind ziemlich besorgt wegen meines Zustands, und es dauert nicht lange, bis ein Doktor in dem kleinen Büro auftaucht und mich untersucht. Nach wenigen Minuten bekomme ich eine 6-ml-Dosis Methadon, muss meine Schnürsenkel und meinen Gürtel abgeben und werde in eine der winzigen Zellen gebracht. Ein vielleicht eins fünfzig breiter Raum, etwa drei Meter lang, eine Stahlpritsche mit schwarzem Kunststoffbezug, zwei JVA-Wolldecken darauf und das ist alles. Keine Toilette, kein Waschbecken, nur ein Notfallknopf, eine Ampel, rechts neben der Zellentür. Aber das alles ist mir egal!
Ganze zehn Monate hatte mich die Hure Koka im wilden Galopp durch ihr weißes Wunderland geritten. Jetzt ist der letzte Kokainexpress schon lange abgefahren. Das Methadon kommt wie eine warme Welle über mich. Ich sacke auf die Pritsche, ziehe mir eine der Decken über und schlafe ein.
Wie alles begann
Sindelfingen, März 1986
»Los, trödel nich so rum. Wir wollen endlich los.« Meine Mutter schob mich ungeduldig vor sich her. Sie war aufgekratzt und nervös. Ihr neuer Freund aus Hannover war seit gut einer Stunde da und nach ein paar Küsschen verstauten sie die größten Möbel sofort in dem Kastenwagen, mit dem der Typ angejuckelt gekommen war. Mama hatte ihn während des Aufenthalts in einer Rehaklinik, wo sie sich wegen ihres Rückens behandeln lassen hatte, kennen und anscheinend auch lieben gelernt. Ich für meinen Teil konnte den Mann vom ersten Moment an nicht leiden.
Widerstrebend folgte ich ihrer Aufforderung und verließ unsere alte Wohnung. Der halbe Hausflur stand noch voll mit Kartons, Koffern, Taschen und ein paar Möbeln. Ein letztes Mal zog meine Mutter die Wohnungstür hinter sich zu. Sie seufzte und rang sich ein trauriges Lächeln ab.
»So, das war’s. Alles raus.«
Ich war voll angepisst und zog ein langes Gesicht. Ich wollte hier nicht weg und in scheiß Hannover wohnen. In unserer Hochhaussiedlung fühlte ich mich sehr wohl, hier war ich neun Jahre lang zu Hause gewesen, nachdem meine Mutter kurz nach meinem vierten Geburtstag mit mir hergezogen war. Hier hatte ich doch all meine Freunde, verdammt! Plötzlich musste ich an die coole BMX-Strecke denken, und an das Luftgewehr, mit dem wir so oft die Laternen in der Siedlung kaputt geschossen hatten.
»Jetzt guck nich so grimmig. Wirst schon sehen, es wird dir gefallen. Dein neues Zimmer hat sogar einen eigenen Balkon.«
»Na toll«, antwortete ich genervt. Als ob das jetzt alles gutmachen würde. Was stellte sie sich denn vor? Beleidigt und mit den Händen in der Tasche lehnte ich an der Flurwand, den Kopf tief zwischen die Schultern gezogen und den Blick auf den Laminatboden geheftet.
»Kann ich nicht hier bei Bernd bleiben?« Der Trotz in meiner Stimme beinhaltete eigentlich schon die Antwort auf diese Frage, aber Bernd war schließlich bis gerade eben noch mein Stiefvater gewesen. Warum also sollte ich nicht hier bei ihm bleiben können? Auch wenn er nicht mein Erzeuger und dazu noch Alkoholiker war. Das war auch der Trennungsgrund meiner Mutter, aber ich fand ihn toll. Ich wäre sofort bei ihm geblieben.
Sie aber zog ihr strengstes Gesicht und schüttelte energisch den Kopf. »Das geht nicht. Das Thema hatten wir doch schon. Du kommst schön mit und jetzt beweg dich endlich.« Ihr Ton ließ keinerlei Widerspruch zu und ich ergab mich enttäuscht der Situation. Lustlos und beleidigt schob ich eine meiner Klamottentaschen vor mir durch den Flur, die Hände in den Hosentaschen zu Fäusten geballt.
Was hätte ich jetzt auch noch tun können? Weglaufen und mich verstecken vielleicht? Das wollte ich irgendwie nicht. Heulen, toben und jammern hatte ich als Erstes ausprobiert, hatte aber nichts genutzt. Auch dass ich am vorletzten Abend sturzbetrunken nach Hause gekommen war, änderte nichts an der Tatsache, dass wir nach Hannover umzogen. Jeder Widerstand war zwecklos und stieß wie auf Granit. Ganz egal, was ich sagte oder tat. Mama hatte sich entschieden.
»Los, mach dich mal nützlich und klemm den Keil unter die Fahrstuhltür.« Genervt kickte sie mir einen Türstopper zu, schob schwer atmend einen Karton nach dem anderen durch den Flur und trieb mich weiter an. »Jetzt nimm doch endlich mal die Hände aus den Taschen, die Kartons hüpfen nich von alleine in den Fahrstuhl.«
Sie hatte es wirklich verdammt eilig, hier wegzukommen. Die Trennung war ihr äußerst unangenehm und sie wollte Bernd unter keinen Umständen begegnen. Sie hatten sich alles gesagt.
Die kleine Aufzugkabine war schon fast bis zur Hälfte beladen, als Rick wieder mit dem großen Fahrstuhl im Treppenhaus ankam und uns half, die restlichen Sachen einzuladen. Fertig. Unsere finale Fahrt in diesem Fahrstuhl begann. Ich mit diesem Rick, ein paar Kartons und meinem BMX-Rad in dem großen und meine Mutter in dem kleinen Lift.
Mit glasigen Augen schaute ich mich ein letztes Mal in der blassgrünen Kabine mit der verspiegelten Rückwand um. Rick und ich sprachen kein Wort. Ich hätte heulen können. Grad war ich groß genug, um alleine im Aufzug den Knopf mit der 13 zu erreichen und jetzt mussten wir hier weg? Mit fünf, sechs Jahren war ich selbst auf Zehnspitzen nur bis an den Knopf der achten Etage gekommen. Alle übrigen Stockwerke bis zu unserer Etage musste ich mich dann zu Fuß hochschleppen. Das war immer blöd gewesen. Aber es hatte tierisch Spaß gemacht, von ganz oben aus der fünfzehnten Etage in einem Höllentempo runterzurennen, bis man taumelnd und mit einem üblen Drehwurm im Erdgeschoss oder Keller ankam. Am lustigsten war es, wenn wir mit Hausbewohnern auf einer der unteren Etagen zusammenstießen. Wenn man bereits zehn, zwölf Etagen im Kreis nach unten geflitzt war, fühlte man sich ungefähr so, als hinge man an einem Kettenkarussell. In diesem Zustand auszuweichen oder gar rechtzeitig zu bremsen, klappte oft nur bedingt. Immer wieder hatten die Nachbarn deshalb auf uns geschimpft. Aber trotzdem. Ich wollte hier nicht weg, Mann.
Keine halbe Stunde später rollten wir vom Parkplatz Richtung Autobahnauffahrt. Vor uns erhob sich das Breuningerland, ein riesiges Einkaufszentrum, in dem es Dutzende von Geschäften gab. Meine Mutter hatte da drin mal gearbeitet. Bei Feinkost Böhm, um genau zu sein. Dort gab es die edelsten Leckereien aus aller Welt. Man konnte dort sogar lebende Tiere kaufen. Hummer, blaue Krebse, verschiedenste Fischsorten und allerlei andere komische Meeresbewohner tummelten sich in einem mannshohen Glasbecken bei der Fischtheke. Immer wieder hatte ich mir daran die Nase platt gedrückt.
Natürlich gab es dort auch echten russischen Kaviar und die teuersten, stinkigsten Käsesorten, die man sich nur vorstellen kann. Ebenso extravagant war die Süßigkeitenabteilung, für die meine Mutter zuständig war. Pralinen mit irgendwelchen ekelhaften Füllungen und dunkle Zartbitterschokolade und so was alles. Nicht wirklich was für mich. Und sowieso, ich hatte längst Augen für etwas anderes in Mamas Laden.
Eine Zeit lang musste ich nämlich jeden Mittwochmorgen mit meiner Mutter dorthin und half ihr beim Auffüllen der Regale. In Wirklichkeit brauchte sie meine Hilfe aber gar nicht. Sie wollte mich nur nicht alleine zu Hause lassen. Mittwochs hatte ich immer die ersten beiden Schulstunden frei und Bernd war um diese Zeit natürlich schon längst bei der Arbeit. Also keiner da, der mich im Auge behalten konnte, und so kam ich nicht drum rum und musste mit. Ich hasste es.
Irgendwann begann ich, Flachmänner mit Chantré und Mariacron an der Kasse zu stehlen, wenn ich mich unbeobachtet fühlte, und schleppte den Schnaps mit in die Schule.
Natürlich blieb das damals nicht lange unbemerkt und meine Eltern wurden benachrichtigt. Als dann auch noch rauskam, wo ich den Alkohol herhatte, durfte ich mittwochmorgens wieder zu Hause bleiben und von dort aus zur Schule fahren. Meine Ersatzstrafe bestand aus zwei Wochen Hausarrest und Fernsehverbot.
Wir bogen auf die Autobahn ab und zwei Wimpernschläge später war der große Einkaufskomplex nur noch ein kleiner brauner Punkt am rechten Rand meines Blickfelds, bis er endgültig verschwand.
Auf der anderen Seite, hinter der grünen Schallschutzmauer, thronte unsere alte Siedlung. Im Schatten der vier fünfzehnstöckigen Hochhäuser, allesamt Werkswohnungen von Daimler-Benz, hatte ich neun glückliche Jahre verbracht. Das angrenzende Waldgebiet war ein Paradies für mich und meine Kumpels gewesen. Mein Hamster Fridolin lag dort seit knapp zwei Jahren begraben.
Rechts vor uns tauchte das Holiday Inn Hotel auf. Dort hatte ich mich immer wieder in den Wellnessbereich geschlichen. Man musste nicht unbedingt Hotelgast sein, um das Schwimmbecken und die Sauna dort nutzen zu können. Man musste es nur bezahlen können oder eben reinhuschen, wenn einer der Gäste das Hotel verließ. Keinen interessierte es, wenn ein Kind ohne Schlüssel im Hotel rumrannte. Im Gegenteil, die meisten hielten einem sogar noch die Tür auf.
Als irgendwann meine Tante Karin aus Frankreich zu Besuch bei uns gewesen war, hatte ich mit ihr den Colaautomaten im Solariumbereich geplündert. Sie ist die Halbschwester meiner Mutter und zwei Jahre jünger als ich. Mit unseren dünnen Ärmchen hatten wir es damals tatsächlich geschafft, die Getränkedosen durch den Ausgabeschacht des Automaten herauszufingern. Eine Büchse nach der anderen, schön langsam, wir wollten ja nicht stecken bleiben. Immer wieder hatten wir unsere Aktion unterbrechen müssen, wenn Hotelgäste vorbeikamen. Egal, wir hörten erst auf, als die Kiste komplett geleert war.
Natürlich konnten wir nicht im Ansatz so viel Limonade trinken, wie wir gestohlen hatten und mit nach Hause nehmen ging natürlich auch nicht. Wie hätten wir das erklären sollen? Zudem sprach Karin nur Französisch, sie würde vermutlich eine völlig andere Geschichte erzählen als ich. Nach kurzem Überlegen ließen wir stattdessen also alle Dosen auf dem leeren Parkplatz der Messehalle nebenan explodieren. Einer von uns schleuderte die vollen Blechbüchsen so hoch er konnte in die Luft und der andere versuchte, sie mit einem Stein abzuwerfen. Auch wenn wir sie so gut wie nie trafen, am Ende explodierten sie trotzdem alle durch den Aufprall auf dem Beton und verspritzten mit einem zischenden Laut den süßen Inhalt.
Wir klebten von oben bis unten und sahen aus wie die Schweine, als wir vom »Schwimmen« nach Hause kamen. Wir fingen uns einen gehörigen Anschiss ein und anschließend ging es ab in die Wanne. Karin und ich krümmten uns damals nur so vor Lachen.
Jetzt regnete es und das wiederkehrende Geräusch der Scheibenwischer holte mich in die Realität zurück. Wir waren unterwegs nach Hannover. Die Stadt meiner Kindheit lag nun endgültig hinter mir.
Goetheplatz 1
Am frühen Abend stiegen wir in Hannover aus dem Kastenwagen. Der Wind peitschte feinen Nieselregen in mein Gesicht. Ich war hundemüde und fühlte mich total beschissen. Die Fahrt war die Hölle gewesen, besonders seit unserem letzten Stopp.
Eigentlich war ich schon ab der Hälfte der Strecke nicht mehr beleidigt, sondern nur noch traurig über den Verlust.
Irgendwann steuerte Rick einen Rastplatz an, weil meine Mutter und ich dringend auf die Toilette mussten. Meine Mutter kletterte sofort hektisch aus dem Wagen und stürmte auf die Toiletten zu, doch mich hielt Rick am Arm zurück.
»Hör mal, deine Mutter liebe ich wirklich, glaub mir. Aber du, du bist nur ein unerwünschtes Mitbringsel.« Er ließ mich wieder los, stieg aus und tat, als wäre nichts gewesen.
Von jetzt auf gleich wurde mir übel. Seine Worte trafen mich wie ein Schlag in die Magengrube. Wieso sagte er mir so etwas? Was sollte das? Alles in meinem Schädel drehte sich und vor Wut schossen mir die Tränen in die Augen. Ich fühlte mich hilflos, verloren und allein.
Wie in Trance ging ich zur Toilette. Als ich wenig später zurück in den Wagen stieg, war ich vollkommen überfordert von meinen Emotionen und ich zitterte am ganzen Körper. Ich hasste diesen Typen. Und meine Mutter hasste ich gleich mit! Dafür, dass sie ihn anscheinend liebte und mich mit zu ihm nach Hannover schleppte. Meine Welt stand kopf, und ich verstand rein gar nichts mehr. Der Mann war doch das totale Arschloch! Was fand sie bloß an ihm? Ich fühlte mich verraten und war mir sicher, dass sie sowieso zu ihm halten würde. Deshalb behielt ich erst mal für mich, was er gesagt hatte und versuchte, die beiden auszublenden. Ich glotzte frustriert und mit verschränkten Armen in die Dunkelheit. Den Rest der Fahrt habe ich dann kein Wort mehr über die Lippen gebracht.
In dem Moment ertönte die Signalglocke einer Straßenbahn hinter uns und riss mich aus meinen düsteren Gedanken. Ich fuhr herum und schaute den quietschenden Waggons nach.
»Das sind unsere Straßenbahnen von der Üstra. Damit wirst du bestimmt bald öfter fahren.«
Rick schloss die Haustür auf und nickte dabei in die Richtung der Bahn.
Als ob ich mich mit ihm nach der Nummer noch über Züge unterhalten wollte. Idiot! Ich ignorierte ihn und wartete vor der Tür, bis meine Mutter bei uns war.
Die kitschig bunten Lichterketten in der Kioskscheibe links neben dem Eingang spiegelten sich im regennassen Asphalt. Es war laut hier und überall lag Müll auf dem Gehweg. Hannover. Was für ein Drecksloch!
Inzwischen waren wir schon eine gute Woche hier, in Ricks moderner Dreizimmer-Eigentumswohnung. Alle Räume waren schneeweiß gestrichen. Der komplette Boden war mit großen weißen Fliesen ausgelegt und mit den schwarz-weißen Massivholzkommoden aus Sindelfingen wirkte die gesamte Wohnung irgendwie kalt.
Überall stapelten sich Ricks Briefmarkenalben und Hunderte kleiner Kunststoffkästchen mit losen Marken. Wenn der Typ nicht auf der Arbeit war, saß er mit übereinandergeschlagenen Beinen am Esstisch im Wohnzimmer und sortierte diese bescheuerten Papierschnipsel.
Ich hoffte jedes Mal, dass er mich nicht ansprach, wenn wir uns in der Wohnung notgedrungen über den Weg liefen, fühlte mich unwohl, war immer noch frustriert und beleidigt und verkroch mich seit unserer Ankunft fast ausschließlich in meinem neuen Zimmer.
Das nasskalte Wetter und der dunkelgraue Himmel passten perfekt zu meiner Stimmung. Zwar hatte ich wirklich meinen eigenen Balkon und das weiße Ledersofa, das ich als Bett nutzte, war eigentlich auch ganz toll, wie auch der Fernseher und die Stereoanlage, die mir Rick mit seinem widerlichen Grinsen und begleitet vom Jubel meiner Mutter ins Zimmer gestellt hatte. Aber trotzdem. Hier war es scheiße! Am liebsten wäre ich sofort nach Sindelfingen zurück. Zur Not auch zu Fuß.
Ich fühlte mich extrem ungeliebt und unverstanden in dieser Zeit. Dieses Gefühl steigerte sich noch, nachdem ich meiner Mutter am zweiten oder dritten Tag von der Sache mit Rick erzählt hatte. Sie dachte damals wirklich, dass ich sie anlog, nur um ihr meinen Willen aufzuzwingen. Ich war so unglaublich verletzt und gleichzeitig wütend auf sie und zog mich immer mehr zurück. Die konnten mich alle mal.
»Du kannst ab Montag wieder zur Schule gehen, is ganz hier in der Nähe.« Ich war gerade im Begriff, mir ein Brot zu schmieren, als meine Mutter neben mir in der Küche auftauchte und mir das eröffnete.
»Toll. Soll ich mich jetzt darüber freuen oder was?« Giftig schaute ich sie an und mein pampiger Unterton löste direkt den nächsten Streit aus, der auf beiden Seiten in einem heftigen Heulkrampf endete. Wir drehten uns nur noch im Kreis. Keiner von uns würde von seinem Standpunkt abweichen und nachgeben. Und so kam es, wie es kommen musste.
Hauptschule am Hohen Ufer & der Jugo
Meine neue Schule lag unmittelbar am Leineufer. Dort wo auch heute noch jeden Samstag der große Flohmarkt stattfindet, nur einen Steinwurf vom Rotlichtbezirk entfernt.
Rick hatte irgendwann beim Essen erzählt, dass dort Fritz Haarmann, der Vampir von Hannover, vor rund hundert Jahren sein Unwesen getrieben hatte.
Die Presse nannte ihn damals den Totmacher. Er hatte mehr als zwanzig Jungs und junge Männer durch einen Biss in den Hals oder durch Erwürgen getötet. Da Haarmann mit Fleischkonserven und gebrauchter Kleidung handelte, hielt sich damals hartnäckig das Gerücht, er hätte seine Opfer zu Dosenfutter verarbeitet und verkauft.
Als die Polizei im Zuge der Ermittlungen gegen Fritz Haarmann den Wasserspiegel der Leine senkte, fand sie dreihundert Knochen von mindestens zweiundzwanzig verschiedenen Menschen.
1925 wurde Fritz Haarmann in Hannover mit dem Fallbeil hingerichtet.
Das war das einzige Mal gewesen, dass ich Rick wirklich zugehört hatte seit seinem blöden Spruch auf dem Rastplatz. Mit der Geschichte hatte er es tatsächlich geschafft, meine Neugierde auf diese Stadt zu wecken. Zudem fühlte ich mich immer mehr wie ein Gefangener in meinem Zimmer und war ziemlich froh, als die Schule wieder losging.
Als ich mich an meinem ersten Tag in der Hauptschule am Hohen Ufer meinen neuen Klassenkameraden vorstellte, brach die Hälfte von ihnen wegen meines schwäbischen Dialekts direkt in schallendes Gelächter aus. Die ersten dummen Sprüche fielen, kaum dass ich zwei Sätze gesagt hatte.
Die Lehrerin hatte große Mühe, die Klasse wieder in den Griff zu bekommen. Erst die lautstarke Androhung von Nachsitzen brachte halbwegs Ruhe ins Klassenzimmer. Mir schoss das Blut in den Kopf, wie ein reißender Fluss rauschte es mir in den Ohren und ohne ein weiteres Wort setzte ich mich auf meinen Platz.
Mir war kotzübel und ich kam mir vor wie eine Attraktion im Zoo. Alle glotzten mich an. Immer wieder tuschelten meine neuen Mitschüler leise miteinander und blickten verstohlen zu mir rüber, um dann aufs Neue in Gelächter auszubrechen.
Vor Scham wäre ich am liebsten im Erdboden versunken. Ich fühlte mich so unglaublich gedemütigt und provoziert.
Schon am ersten oder zweiten Schultag verwies mich die Lehrerin aus dem Klassenzimmer. Ich war durch die Sticheleien der anderen ausgerastet, hatte meinen Stuhl quer durch den Raum getreten und die halbe Klasse angebrüllt und beleidigt. Die meisten von ihnen zuckten erschrocken zurück, was mir zusätzlichen Aufwind verlieh.
Ich war zwar auch in Sindelfingen schon mal unangenehm im Unterricht aufgefallen, aber das hier war ein neues Level. Erschrocken über mich selbst, aber auch stolz, mich gewehrt zu haben, ließ ich mich von meiner neuen Lehrerin am Arm auf den Gang zerren. Sie entschärfte die angespannte Situation durch meinen Rauswurf, denn drei meiner Klassenkameraden waren sofort aufgesprungen und hatten sich hinter ihren Tischen aufgebaut, um sich notfalls gegen mich zu verteidigen. Ich schäumte vor Wut. Die Jungs grinsten dreckig.
Vor dem Klassenzimmer wies mich die Klassenlehrerin zurecht. Ich musste schlucken, um sie nicht als blöde Kuh zu beschimpfen. Dann ließ sie mich einfach stehen und wieder fühlte ich mich ungerecht behandelt.
Ich war noch keinen Monat auf der neuen Schule, als ich schon das dritte oder vierte Mal aus der Klasse flog und auf dem Gang einen Mitschüler aus meiner Parallelklasse kennenlernte. Er war Jugoslawe. Ein schlaksiger Kerl mit dunklen, fast schwarzen Haaren, sehr blassem Gesicht und einer Nase, die mich stark an eine Streichholzschachtel erinnerte.
Auch er war aus dem Unterricht geflogen und hatte das Spektakel in unserem Klassenzimmer vom Flur aus mitbekommen.
»Alter, was geht denn bei euch ab?« Er kam auf mich zu, grinste und deutete auf die Klassentür, die meine Lehrerin gerade wieder hinter sich zuzog. Er war fast einen Kopf größer als ich und ich zögerte einen kurzen Moment, bevor ich ihm antwortete.
»Ich bin neu hier und die verarschen mich die ganze Zeit«, presste ich genervt hervor.
Als er meinen Dialekt hörte, grinste er gleich noch breiter. Anscheinend fand auch er mich zum Lachen.
Ich drehte mich angepisst weg und verdrückte mich frustriert Richtung Aula. Ich musste raus hier, an die frische Luft, hatte ein flaues Gefühl im Magen und meine Ohren glühten. Ich war verzweifelt und wütend auf die ganze verdammte Welt. Was zum Teufel sollte ich hier?
Ich stand keine zwei Minuten auf dem Hof, als ich hinter mir die Stimme von eben hörte. »Willste ne Kippe?«
Verschämt wischte ich mir die Tränen aus den Augenwinkeln und drehte mich zu ihm um.
Er nickte mir aufmunternd zu und hielt mir eine Schachtel Marlboro mit Feuerzeug unter die Nase. »Was is? Rauchst du nich?«
Wortlos fingerte ich eine der Zigaretten aus der Schachtel und griff nach dem Feuerzeug.
»Nich hier, Mann. Lass mal da rübergehen.« Er ging vorweg und ich folgte ihm wortlos ans Ufer der Leine und zündete mir mit ihm eine an. Meine erste Zigarette seit Sindelfingen.
Ich rauchte schon seit ich zwölf war ab und zu. Gelegentlich hatte ich Bernd in den letzten Monaten vor unserem Umzug ganze Schachteln aus seinen Zigarettenstangen geklaut. Ich wollte damals bei den Älteren im Jugendzentrum cool rüberkommen und verteilte immer ein paar der geklauten Zigaretten und bekam irgendwann im Gegenzug mein erstes Bier von den Jungs. Obwohl es mir nicht schmeckte, folgten später am Abend einige mehr. Bei einer Nachtwanderung hatte ich mich dann so stark betrunken, dass ich die ganze Rückfahrt über kotzend aus dem Beifahrerfenster hing.
Natürlich machten die Sozialarbeiter Meldung über unser Rauch- und Saufgelage und erteilten mir und ein paar anderen Jungs ein Jahr Hausverbot im Jugendzentrum. Es gab einen riesen Stress, und danach musste ich meine Mutter sogar eine Zeit lang anhauchen, wenn ich zu Hause reinkam. Ich versuchte es mit Hustenbonbons, aber das machte sie nur noch misstrauischer und wütender. Sie fühlte sich natürlich verarscht von mir und immer wieder flogen deswegen und wegen des Rauchens die Fetzen zwischen uns. Aber scheiß drauf! Die konnte mich sowieso gerade mal.
Ich zog den Rauch tief in die Lunge und bekam einen üblen Hustenanfall. Genau wie bei meinen allerersten Rauchversuchen im Wald hinter den Hochhäusern. Der Jugo lachte sich schlapp über mich, während ich versuchte, mich zu beruhigen. Jeder Atemzug schmerzte in der Brust. Das Nikotin hatte mich ziemlich schwindelig gemacht und ich musste mich setzen. Alles fühlte sich wattig und weit weg an. Ein schönes Gefühl, ich mochte es. Direkt noch einen Zug hinterher. Und noch einen.
Leider verkürzten sich die Kreislaufkicks bei jedem Zug und viel zu schnell blieben sie ganz aus. Aber trotzdem, es fühlte sich gut an, zum ersten Mal in dieser Stadt.
Der Jugo war cool. Er hatte etwas sehr Sympathisches an sich. Wir hatten beim Rauchen mehr miteinander gelacht als geredet und schlenderten nun langsam zurück zur Schule. Ich mochte den Jungen, der in seinen komischen Cowboystiefeln vor mir herlief. Er grinste zwar auch jedes Mal aufs Neue blöd, wenn ich redete, aber er lachte mich nicht dafür aus.
Er war selbst noch nicht lange an der Schule und hatte auch so seine Anpassungsschwierigkeiten. Aus der Schule in seinem Wohnbezirk, der Nordstadt, hatte man ihn wegen Vandalismus rausgeworfen und so war er hier in der Stadtmitte gelandet. Er hasste es genauso und war wie ich gegen seinen Willen hier. Ich hatte meinen ersten Verbündeten gefunden und als der Pausengong ertönte, betraten wir gemeinsam den Schulhof.
Spielplatzbande
»Na endlich, Alter! Ich warte schon ne halbe Ewigkeit auf dich.«
Der Jugo saß auf den Stufen der Christuskirche, schnippte mir seine glühende Kippe entgegen und grinste mich frech an, als ich unmittelbar vor ihm eine Vollbremsung mit meinem BMX hinlegte. »Lass uns erst zu mir nach Hause und dann auf den Spieler, die anderen sind bestimmt auch schon da oder kommen gleich noch.«
Ich nickte nur. Heute würde ich seine Freunde und Familie kennenlernen. Er hatte mir in der Schule schon einiges über sie erzählt. Wir überquerten den Engelbosteler Damm und bogen in die Marschnerstraße ein. Nach wenigen Minuten erreichten wir den Spielplatz, von dem ich ebenfalls schon gehört hatte. Ich war ziemlich aufgeregt.
»Hier hängen wir immer rum und da vorne rechts um die Ecke wohne ich.«
Fast stolz präsentierte er mir mit ausgestreckten Armen die alten Klettergerüste und Schaukeln. Der Spielplatz war menschenleer und überall im Sand lagen Kippen rum. Auf der steinernen Tischtennisplatte standen noch die Reste einer zerfallenen Sandburg. »Lass uns später wiederkommen. Ich will kurz nach Hause, bevor mein Alter von der Arbeit kommt.«
Als der Jugo fünf Minuten später die Wohnungstür aufschloss, schlug uns der Duft von frisch gebratenem Fleisch und Zwiebeln entgegen.
»Bin wieder da! Und hab Besuch mitgebracht«, rief er laut in die Wohnung, während wir uns die Schuhe auszogen. Keine zwei Sekunden später war sein kleiner Bruder zur Stelle und glotzte mich neugierig an. Er war etwas pummelig, beinahe blond und die Nervensäge stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Seine Zungenspitze wanderte aufgeregt von links nach rechts über die Oberlippe.
»Was is?«, fauchte der Jugo seinen kleinen Bruder an, baute sich wie ein Boxer vor ihm auf und schlug ihm mit den Fäusten eine Links-Rechts-Kombination auf den Oberarm.
»Aua!« Der Kleine wich einen Schritt zurück, rieb sich kurz die getroffene Stelle, um dann wie ein Bekloppter auf seinen Bruder loszugehen. »Du blöder Wichser, wieso boxt du mich?«
Noch bevor ich meine Schuhe richtig ausgezogen hatte, war eine ausgewachsene Rauferei zwischen den beiden Brüdern im Gange.
Als ihre Mutter um die Ecke kam, zerrte der Große den Kleinen gerade an den Haaren durchs Wohnzimmer und hielt ihn am ausgestreckten Arm auf Distanz. Der Kurze schimpfte wie ein Rohrspatz und ruderte wild mit den Armen, traf seinen Bruder aber trotzdem nicht. Und der lachte sich über seinen kleinen Bruder kaputt. »Lass mich los, du Arsch!«
Klatsch! Mein Kollege zuckte erschrocken zusammen, als die flache Hand seiner Mama ihn im Nacken traf. Der Kleine nutzte die Gelegenheit und trat ihm von hinten in die Beine, rannte dann blitzschnell an uns vorbei und flüchtete ins Kinderzimmer.
Schweigend und mit unterdrücktem Grinsen beobachtete ich die Situation. So wie’s aussah, war das hier wohl Standard. Brüder eben.
Es dauerte ein paar Augenblicke, bis sich die Lage wieder entspannt hatte und seine Mama ihn losließ. Sie hatte ihn am Kragen geschnappt, als er Anstalten machte, den Kleinen nach dem Tritt zu verfolgen, und lautstark auf Jugoslawisch mit ihm geschimpft.
»Komm, lass uns direkt wieder abhauen.« Schnaufend und mit frustriertem Gesichtsausdruck schob er sich an mir vorbei in den Flur und zog sich seine Schuhe wieder an. Ich nickte seiner Mutter freundlich zu. Die hatte sich mittlerweile zwischen uns und dem Kinderzimmer postiert, um die beiden Streithähne auseinanderzuhalten. Sie erwiderte meinen Gruß mit einem lauten Seufzer und einem gequälten Lächeln und verschwand dann schimpfend in ihrer Küche.
»Ja, ja, laber nich«, rief der Jugo seiner Mutter zu, dann knallte er die Wohnungstür mit voller Wucht ins Schloss und nahm mit großen Sprüngen die Treppenstufen.
»Was war das denn?«, fragte ich ihn unten angekommen. Das Meckern seiner Mutter über das Zuknallen der Tür hallte im Treppenhaus hinter uns.
»Is immer das Gleiche, Mann. Immer nimmt sie den kleinen Fettsack in Schutz und ich krieg die Schuld für alles.«
An der nächsten Häuserecke kamen uns die beiden italienischen Schwestern entgegen, von denen der Jugo mir schon des Öfteren vorgeschwärmt hatte. Er hatte nicht übertrieben. Die beiden waren wirklich hübsch. Sehr hübsch sogar. Sie waren zierlich, hatten lange dunkelblonde Haare und Augen wie Raubkatzen. Die von Luna waren grüngrau und die Augen ihrer jüngeren Schwester Morena leuchteten blau.
»Hey, is das der Kumpel, von dem du uns erzählt hast?« Die drei begrüßten sich mit einem Küsschen auf die Wange und auch ich wurde ohne Zögern herzlich von den beiden Schwestern gedrückt. Wooh! Ihre Haare dufteten wie ein Meer aus Erdbeeren. Nur einmal war ich einem Mädchen so nah gekommen, aber das lag schon über zwei Jahre zurück und hatte sich völlig anders angefühlt. Mir schoss das Blut in den Kopf und mein Herz klopfte wie wild. Ich zitterte innerlich vor Freude und Aufregung und grinste vermutlich ziemlich dämlich vor mich hin. Schätze, in dem Moment war mein Interesse an Mädchen endgültig geweckt. Vielleicht war Hannover ja doch nicht so scheiße?
An diesem Tag sollte ich auch noch den Julius kennenlernen. Den Spitznamen hatte er dem Wuchs seiner pechschwarzen Haare zu verdanken. Seine Frisur sah aus wie der Helm von Caesar bei Asterix und Obelix. Selbst die dazugehörigen Koteletten wuchsen ihm mit seinen knapp 14 Jahren schon. Er war einer der vier Griechen, die zu der Bande vom Jugo gehörten. Ein lustiger, zappeliger kleiner Kerl, der mich ebenfalls sofort begrüßte, als würde ich schon immer dazugehören. Ich mochte ihn und seine quirlige Art auf Anhieb. Selbst als er meinen schwäbischen Akzent imitierte und sich über meine Röhrenjeans lustig machte, feierte ich ihn.
Als es dunkel wurde, schwang ich mich auf mein BMX und fuhr nach Hause. Die Mädchen hatten sich zuerst verabschiedet. Die beiden Jungs und mich trieb der Hunger etwas später auch nach Hause. Es war ziemlich kühl und ich fror erbärmlich in meinem dünnen Pulli, aber das war mir egal. Ich hatte neue Freunde gefunden und war glücklich und zufrieden. Ich ließ den Nachmittag Revue passieren, während ich wie ein Wahnsinniger in die Pedale trat und jeden Bürgersteig und jeden Huckel mit einem Bunny Hop nahm.
Der Julius hatte sogar was von Haschisch und Eimerrauchen erzählt. Eigentlich hatte er schon heute etwas zum Kiffen mitbringen wollen. Aber aus irgendeinem Grund hatte das leider nicht geklappt. In Sindelfingen im Jugendzentrum, besser gesagt dahinter, hatte ich auch schon zwei, drei Mal an einem Joint gezogen, aber nie etwas gemerkt. Aber so wie es aussah, würde sich das schon sehr bald ändern.
Die erste große Liebe
Inzwischen war ein gutes Jahr ins Land gezogen und ich war zu einem vollwertigen Mitglied meiner neuen Clique herangewachsen. Ich mochte sie alle und sie alle mochten mich.
Die beiden griechischen Brüder, die brutal auf Michael Jackson abfuhren und immer wieder den Moonwalk auf dem Spielplatz aufführten, genauso wie ihren dicken Landsmann, der durch seine Art und Körperfülle stark an einen Bären erinnerte. Ich verbrachte so ziemlich jede freie Minute mit ihnen auf dem Spielplatz in der Nordstadt und ging schon nach kurzer Zeit wie selbstverständlich beim Jugo zu Hause ein und aus. Seine Mutter nötigte mich jedes Mal aufs Neue zum Essen, wenn ich bei ihnen war, und die Prügeleien der beiden Brüdern gehörten mittlerweile zu meinem Alltag. Auch bei den Eltern der anderen war ich ein immer wieder gern gesehener Gast. Ich war endlich in Hannover angekommen. Irgendwie hatte sich ganz von allein alles zum Positiven gewendet und an Sindelfingen verschwendete ich schon seit einer halben Ewigkeit keinen Gedanken mehr. Vielleicht lag es nur daran, dass ich seit meinem zweiten Besuch auf dem Spielplatz kiffte wie ein Tier. Oder aber an dem sicheren Gefühl, dass ich ein paar richtig gute Freunde gefunden hatte. Keine Ahnung. Spielte damals auch keine Rolle.
Obwohl ich drei dicke Eimer geraucht hatte, war ich völlig aufgekratzt, als wir über die Liegewiese im Freibad liefen und die anderen suchten. Nicht weil wir gerade über den Zaun geklettert waren, sondern weil ich hier gleich auf Maria treffen würde, eine temperamentvolle Spanierin mit Zigeunerblut. Sie hatte wunderschönes dunkles, langes Haar mit großen Locken, die sich wie Korkenzieher über ihre zierlichen Schultern legten und ihr hübsches Gesicht umschmeichelten. Ihre Augen sahen aus wie Bernstein im Schatten und für eine 13-Jährige hatte sie eine gewaltige Oberweite.
Wenige Wochen zuvor war sie ein paarmal mit Morena und Luna auf den Spieler gekommen und hatte die Nachmittage dort mit uns verbracht. Immer wieder berührte sie mich wie aus Versehen am Arm, strich mir über Haare oder Rücken, wenn wir nebeneinander auf einem der Klettergerüste saßen und uns unterhielten. Und jedes Mal, wenn das passierte, glühten meine Ohren und ich zog mich automatisch zurück und wich ihrem Blick aus.
Ich hasste es, wenn ich das tat, konnte aber nichts dagegen tun, denn sie gefiel mir von Anfang an sehr gut, aber ich war schüchtern und hatte noch keine Antennen für ihre zärtlichen Signale.
Als sie registrierte, dass ich Idiot nur mit Rückzug auf ihre Annäherungsversuche reagierte, kam sie irgendwann einfach nicht mehr. Selbstverständlich bemerkte ich das, dachte aber nicht weiter darüber nach und hakte die Sache für mich ab.
Tage später steckten mir Luna und Morena dann, dass sich Maria bei ihnen den Frust von der Seele geredet und ihnen gestanden hatte, dass sie total in mich verknallt und wohl sehr traurig darüber war, dass ich es einfach nicht raffte oder gar keinen Bock auf sie hatte. Dem war natürlich nicht so. Wie gesagt, ich war einfach nur verdammt schüchtern. Seit ihrem Geständnis hatten mich die beiden immer wieder belabert und versicherten mir, dass Maria nur auf ein Zeichen von mir wartete. Sie wollte ganz sicher keine Spielchen mit mir spielen und mich auch nicht zurückweisen. Irgendwann überzeugten sie mich und ich versprach ihnen, mich mit Maria zu treffen. Das war vor drei Tagen gewesen.
Es war brütend heiß und die Freibadbesucher drängelten sich dicht an dicht auf ihren Decken und Handtüchern. Die warme Luft roch nach Chlor und Sonnenmilch.
»Hey! Hier sind wir!« Morena hatte uns in der Menge entdeckt und winkte uns mit beiden Armen zu. Fast wären wir an ihnen vorbeigegangen. Das Hasch knallte in Verbindung mit der Hitze ziemlich heftig und durch meinen Schleier sahen die Halbnackten irgendwie alle gleich aus. Sie grinste bis über beide Ohren und drängte mich bestimmt, aber freundlich dazu, mein Badetuch zwischen ihrem und dem von Maria auszubreiten. So schüchtern und bekifft wie ich war, wollte ich mich nämlich erst zu den Jungs legen. Aber das lief nicht.
»Naaa du, wie geht’s dir? Schön, dich zu sehen.« Maria saß im Schneidersitz vor mir und lächelte mich an. Sie sah super aus in ihrem weinroten Bikini. Ihre Kurven sprengten fast ihr Oberteil. Wir begrüßten uns mit links, rechts Küsschen auf beide Wangen und drückten uns.
Kokosnussduft zog mir in die Nase und vernebelte mir das Hirn. Ihre samtweiche braune Haut war heiß und glänzte in der Sonne. Wooh! Ich schätze, in genau dieser Sekunde fing sie mich mit ihrem Duft und ihrem Anblick ein. Ich war von jetzt auf gleich verliebt und all meine Ängste verpufften.
Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, wie Luna und Morena uns beim Turteln beobachteten und sich über den Verkupplungserfolg freuten. Außerdem wurden sie die Jungs für uns los, wenn sie uns mit Wasserbällen oder Kaltwasserbomben bewarfen oder die Frischverliebten sonst irgendwie abnervten.
Maria und mir war das alles völlig egal. Es gab nur noch uns beide, sonst nichts. Wir lagen dicht beieinander auf der Seite, die Köpfe auf den Schultern abgestützt und versanken tief in den Augen des anderen. Immer wieder berührten wir uns wie zufällig und jedes Mal lief mir ein Schauer des Entzückens über den Rücken.
»Lass uns Eis holen.« Sie sprang auf und schaute mich auffordernd an. Ein Tropfen Schweiß lief ihr vom Hals zwischen die Brüste und wanderte langsam weiter über ihren flachen Bauch. Mein Blick verfolgte ihn wie hypnotisiert, bis er in dem Bündchen ihres Bikinihöschens versickerte. »Los, komm.«
Sie musste mich nicht lange bitten. Händchenhaltend schlängelten wir uns durch die Sonnenanbeter auf ihren bunten Handtuchinseln. Vorbei an grölenden, spielenden Kindern, fettbäuchigen Mamas und Papas und Rentnern mit komischen Badeanzügen und Strohhüten.
An den Umkleidekabinen nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und zog Maria frech grinsend in eine der Kabinen. Mein Herz raste und sprengte mir fast den Brustkorb. Ich verschloss die Tür hinter uns und drehte mich zu ihr um. Wir zitterten beide vor Aufregung.
Sie kam einen Schritt auf mich zu, nahm mich in die Arme und schmiegte sich ganz fest an mich. Ihr Körper war heiß von der Nachmittagssonne und ihre Haut war weich wie Seide. Auffordernd legte sie den Kopf in den Nacken, leckte sich mit der Zungenspitze über ihre vollen Lippen und schaute mir verträumt in die Augen. Jetzt oder nie!
Ihr Mund schmeckte wie Omas Nachtisch und mir wurden die Knie weich. Aus sanften Küsschen wurden schnell meine ersten wilden Zungenküsse. Das erste Mal lud mich ein Mädchen ein, ihre Brüste zu streicheln und zu küssen, das erste Mal nahm ein Mädchen mein Ding in die Hand lächelte mich dabei an. Um ein Haar wär alles in die Shorts gegangen.
Ich fühlte mich großartig und hätte die ganze Welt umarmen können, als wir knapp zwei Stunden später mit zerzausten Haaren und geschwollenen Lippen aus der Umkleidekabine torkelten.
»Wo kommt ihr denn her?« Der Jugo und Luna standen schwitzend in der Warteschlange vor dem Kiosk, während der Julius mit Karatefaxen die nervenden Kinder um sie verscheuchte. Alle drei grinsten fragend in unsere Richtung, als wir uns eng umschlungen an den Kindern vorbeidrängelten und uns bei ihnen einreihten.
»Uuuuuund?« Luna zog Maria sofort ein Stück zur Seite, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. Die beiden kicherten und ich stellte mich den Jungs.
Patsch! Als Erstes bekam ich vom Jugo einen Fingerspitzenklatscher, der es in sich hatte, auf den fetten Knutschfleck an meinem Hals. Ich schubste ihn weg, doch da sprang mich schon der Julius von der Seite an, umklammerte meinen Oberkörper mit allen vieren wie ein räudiger Köter das Bein seines Herrchens und rieb sich heftig an mir.
»Hast du fein ficki, ficki gemacht, hast du fein gemacht.«
Lachend versuchte ich, ihn abzuschütteln, doch er krallte sich immer fester an mich und tat, als wollte er mir einen Zungenkuss verpassen. Dabei hauchte er immer wieder mit französischem Akzent und seinem dämlichsten Grinsen im Gesicht: »Küss mich, mon chéri.«
Er war total stoned, hatte Augen wie ein Chinese mit Bindehautentzündung und ein übles Pappmaul. Seine Zunge war aschgrau. Er und die Jungs hatten den ganzen Nachmittag Mischung im Akkord gemacht und waren zwischendurch immer wieder im Gebüsch verschwunden, um ein paar Eimer zu rauchen.
»Man, verpiss dich, du Affe!« Immer noch zerrte er an mir rum, warf mir Küsschen zu und ließ mich erst los, als Maria ihm einen deftigen Tritt in den Hintern verpasste.
»Aua! Was trittst du mich, du blöde Kuh?«
Sie machte ein Gesicht, das sagte, du weißt warum und küsste mich.
Es war ein schöner Tag und meine Welt war in Ordnung. Maria schmiegte sich an mich und streichelte mir zärtlich über den Rücken. Wir brauchten jetzt alle ganz dringend Eis und kalte Getränke.
Bevor wir am frühen Abend nach Hause aufbrachen, verzogen sich die Mädchen noch unter die Dusche. Und ich nutzte die Gelegenheit, um mit den Jungs schnell einen durchzuziehen. Maria kiffte nicht und sie fand es auch bei mir nicht toll. Egal.
»Kommste noch mit zu mir?«, fragte mich der Jugo, als wir aus dem Gebüsch zurück zu unserem Platz taumelten und unsere Sachen zusammenpackten. Überall wo wir gelegen hatten, lagen Kippenstummel, Obstreste und leere Verpackungen von Süßigkeiten auf der Wiese herum. Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld.
»Nee, ich begleite Maria nach Hause. Sie will mir zeigen, wo sie wohnt. Wir sehen uns morgen. Holste mich ab und wir schwänzen die ersten zwei Stunden?«
Er nickte. »Geht klar. Bin um acht bei dir.«
Wir verabschiedeten uns von dem Rest der Bande und gingen Richtung Umkleide. Morena war die Erste, die uns aus der Dusche entgegenkam.
»Ich freu mich ja so für euch beide«, jauchzte sie, sprang mich an und drückte mir einen dicken Schmatzer auf die Backe. Ich lächelte verlegen und nahm Maria in die Arme, die mit Luna im Schlepptau direkt hinter ihr um die Ecke kam. Ihr Haar duftete wie ein Korb voll reifer Früchte. Wir begleiteten die anderen noch zur S-Bahn-Haltestelle an der Schulenburger Landstraße und trennten uns dann von ihnen.
Wir brauchten eine Ewigkeit für den kurzen Weg zu ihr nach Hause. Immer wieder blieben wir eng umschlungen in irgendwelchen halbdunklen Hauseingängen stehen, knutschten wild rum und befummelten uns kichernd. Eigentlich hätte Maria schon um 19 Uhr zu Hause sein müssen, aber wir konnten verdammt noch mal die Finger nicht voneinander lassen. Der Tag war einfach zu schön, um sich jetzt schon voneinander zu verabschieden.
Mittlerweile war es schon 22 Uhr und bereits drei Mal war Maria im Treppenhaus verschwunden, um nach oben in die Wohnung zu gehen. Doch jedes Mal kehrte sie grinsend wie ein Honigkuchenpferd zu mir zurück, um mir noch einen Abschiedskuss aufzudrücken. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Sie konnte sich genauso wenig von mir trennen wie ich mich von ihr. Sie sah so unglaublich niedlich aus in ihrem weißen Top, den zerfransten, kurzen Jeans und ihren Flipflops. Es fiel mir von Mal zu Mal schwerer, sie gehen zu lassen.
Doch ihr Papa und ihr großer Bruder würden jede Sekunde von ihrer Schicht aus der Schleifpapierfabrik am Hainhölzer Bahnhof zurückkommen und die beiden durften unter gar keinen Umständen etwas von ihrem Verhältnis mit mir mitbekommen.
»Scheiße, jetzt muss ich aber wirklich hoch, sonst erwischt Papa mich doch noch.«
Ein letzter atemberaubender Kuss und weg war sie. Ich folgte ihr ein viertes Mal mit meinen Blicken durchs Treppenhaus und dann verschwand sie endgültig in der elterlichen Wohnung.
Blöd, dass ihr Vater so streng war. Ich würde mich beweisen und Geduld haben müssen. Marias 18-jährige Schwester durfte ihren Freund erst seit knapp einem Jahr und nach endlosen Diskussionen mit nach Hause bringen. Und das, obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre mit ihm zusammen war. Maria war gerade mal 13. Ihr Vater würde mit absoluter Sicherheit kein Verständnis für unsere junge Liebe aufbringen. Im Gegenteil, sie würde unter Garantie Hausarrest dafür bekommen. Gott sei Dank war ihre Mama da völlig anders und wenn ihr Vater und ihr Bruder nicht zu Hause waren, konnte sie im Grunde machen, was sie wollte. Das musste uns für den Anfang genügen.
Als ich an diesem Abend glücklich und erschöpft in meinem Bett lag, konnte ich sehr lange nicht einschlafen. Meine Lippen brannten noch immer wie Feuer und die Schmetterlinge in meinem Bauch tanzten einen feurigen Flamenco. Genau wie Maria. Auch sie tanzte Flamenco. Sie hatte mir heute versprochen, irgendwann einmal für mich ganz alleine zu tanzen. Mit leuchtenden Augen hatte sie mir von ihrem traditionellen Kleid vorgeschwärmt, das sie bei den Aufführungen mit ihrer Truppe aus dem spanischen Club immer trug, und mir dabei ein paar ihrer Tanzeinlagen vorgeführt. Sie hatte sich gedreht, geklatscht und gesteppt und dabei mit der Sonne um die Wette gestrahlt. Sie hatte mich verzaubert. Ich war das erste Mal verliebt. Bis über beide Ohren.
Das erste Mal Shore rauchen
Hannover, Frühjahr 1988
Noch immer musste ich mich vor Marias Vater und ihrem Bruder verstecken. Nur wenn die beiden zusammen Spät- oder Nachtschicht hatten, konnte ich sie zu Hause besuchen. Sonst war ihre Wohnung immer noch Sperrzone für mich. Doch ihre Mama hatte sich aus Versehen verplappert und so ahnten sie inzwischen, dass Maria einen Freund hatte, und waren alles andere als begeistert. Wenn ihr Papa gewusst hätte, dass ich schon seit letztem Oktober in seiner Wohnung ein und aus ging und ihre Mama das auch noch erlaubte, er wäre tausendprozentig ausgerastet.
Mama hingegen hatte mich schon lange ins Herz geschlossen und stopfte mich jedes Mal, wenn ich aufkreuzte, mit spanischer Küche voll. Ich liebte die Chorizo, die ihr Mann öfter mal vom spanischen Club in der Nordstadt mitbrachte. Eine pikante Paprikawurst, die einem die Finger und den Mund rot einfärbte. Ihre Tortillas und Meeresfrüchte-Paellas waren der Knaller und wie die Mama vom Jugo war auch sie beleidigt und schimpfte mit mir, wenn man ihrem Wunsch zu essen nicht nachkam. Aber selbst dabei war sie immer herzlich und inzwischen so etwas wie eine zweite Mama für mich geworden.
»Du esse.« Sie lispelte, wenn sie mich in gebrochenem Deutsch zum Essen aufforderte. Dabei vollführte sie ihre typische Hand-zum-Mund-Bewegung. »Du esse.«
Ich nickte nur und folgte ihr. Sie würde sowieso erst Ruhe geben, wenn ich kauend und mit vollen Backen in ihrer Küche saß. Es gab Spiegeleier mit Weißbrot, Chorizo und Manchego. Ein spanischer Hartkäse, in den ich mich hätte reinsetzen können.
Sie musterte mich prüfend, als ich mich ihr gegenüber auf die Eckbank quetschte.
»Qué pasa?«
Maria und ich hatten uns wieder einmal wegen meiner Kifferei in der Wolle gehabt. Unzählige Male hatte ich ihr versprochen, damit aufzuhören. Wir gifteten uns ziemlich heftig an und sie knallte daraufhin lautstark die Türen. Am Ende hatte Maria bitterlich geweint und mich aus ihrem Zimmer geworfen. Wie so häufig in den letzten Wochen. Natürlich hatte Mama das ganze Programm live mitbekommen.
Aber was sollte ich ihr schon sagen? Wir sprachen ja noch nicht einmal dieselbe Sprache. Und selbst wenn. Ich seufzte nur, zuckte mit den Achseln und stocherte lustlos in meinem Essen herum.
Als Maria kurz darauf zu uns in die Küche kam und sofort wieder rumzickte, hatte ich endgültig genug für einen Tag. Noch während sie und ihre Mutter sich auf Spanisch anbrüllten, sprang ich eilig in meine Schuhe, schnappte mir meine Jacke und haute ab, ohne mich zu verabschieden.
Das war vor gut fünf Stunden gewesen. Jetzt war ich im Jugendzentrum Feuerwache. Auf einer Geburtstagsparty von jemandem, den ich nicht mal kannte, und torkelte durch die Räumlichkeiten, völlig bekifft und dazu noch leicht angetrunken. Ich suchte meine Jungs und Mädels. Wir waren vor knapp zwei Stunden alle zusammen angekommen und nun fand ich sie in dem verwinkelten Jugendzentrum nicht wieder. Wo zum Teufel waren die alle abgeblieben?
Scheiß drauf. Ich wollte noch kurz pissen gehen und dann draußen nach ihnen Ausschau halten. Vermutlich hatten sie mich auch schon gesucht und waren dann einfach ohne mich einen durchziehen gegangen. Ich stieß die Tür auf und betrat den Toilettenflur. Drei Mädchen standen vor einem der Waschräume.
»Mach die scheiß Tür auf, Mann!« Sie sahen genervt aus und eine von ihnen hämmerte mit der flachen Hand mehrfach gegen die grüne Holztür.
»Maaann, verpisst euch endlich, ihr blöden Kühe!«
Das war doch die Stimme vom Julius, die da gedämpft aus der Toilette klang. Und dann plötzlich Lunas Stimme. »Geht draußen pissen, ihr Fotzen!«
Ich grinste breit. Die drei Mädels zogen sich entrüstet in den Partyraum zurück. Ich sah ihnen nach, bis die Tür hinter ihnen zugefallen war, dann klopfte ich an.
»Hey, rafft ihr’s nich oder was? Ihr sollt abhauen, verdammt!« Diesmal war es definitiv der kleine Pole. Sein osteuropäischer Akzent war unverkennbar.
Ich kannte ihn noch nicht sonderlich gut, er hatte erst im letzten halben Jahr seinen Platz in unserer Clique gefunden, während ich hauptsächlich mit Maria rumgehangen hatte und nur selten mit den Jungs unterwegs gewesen war. Bei diesen Gelegenheiten hatte ich ihn kennengelernt und danach immer wieder mal auf unserem Spielplatz angetroffen. Wir konnten uns von Anfang an gut leiden. Er war ein cooler Typ, noch keine 13 Jahre alt, aber das störte mich genauso wenig wie die anderen. Zumal er nicht jünger aussah als wir und meistens richtig gutes Dope in der Tasche hatte.
»Halt’s Maul, Mann. Was macht ihr denn da drinnen?«, antwortete ich lachend durch die Tür.
Keine Reaktion.
Erneut bollerte ich gegen die Tür.
»Lasst mich rein, ihr Spastis!« Ich hörte sie flüstern und dann, wie sich jemand auf der anderen Seite stöhnend an der Klinke hochzog. Die Tür öffnete sich einen Spaltbreit und ich sah in das Gesicht unseres griechischen Bären. Seine Augen waren glasig und Rußspuren zogen sich über seine linke Backe. Er grinste mich total dicht durch den Türspalt an.
»Was geht hier?«, fragte ich und zwängte mich an ihm vorbei in den Waschraum. Dichter, eigenartig riechender Qualm schlug mir entgegen. »Was macht ihr denn da?« Neugierig und verwundert blickte ich von einem zum anderen. Unglaublich, wie breit die alle aussahen. Noch nie zuvor hatte ich meine Leute in so einem Zustand gesehen. Und sie waren alle hier, ohne Ausnahme. Die vier Chaoten von der Souvlaki-Fraktion, natürlich Luna und der Jugo. Genauso wie Morena und unser Nesthäckchen, der Pole. Die gesamte Truppe hatte sich hier versammelt.
Und fast jeder von ihnen hatte einen schmalen Streifen Alufolie in der Hand, darauf ein komischer dunkler Fleck. Er ähnelte dem Splitter einer braunen Bierflasche.
Wenn dieser dann von unten mit dem Feuerzeug erhitzt wurde, floss er über die Folie und Qualm stieg auf. Diesen wiederum zogen sich meine Freunde mit einem aus Alufolie gedrehten Röhrchen tief in ihre Lungen. Obendrauf pressten sie noch einen Zug von ihren Filterzigaretten und hielten so lange wie möglich die Luft an. Was zur Hölle machten die da?
Ich beobachtete den Jugo ganz genau dabei, während er den merkwürdigen Punkt auf der Folie mit seinem Röhrchen verfolgte und sich das Zeug reinzog. Sein Gesicht lief rot an und seine Halsschlagadern schienen fast zu platzen.
»Shore rauchen«, presste er mit angehaltener Luft hervor.
Ich legte den Kopf auf die Seite und starrte ihn fragend an. Dieses seltsame Wort hatte ich noch nie zuvor gehört.
Er schielte mich nur an, atmete schwer aus und sackte mit nach vorn hängenden Schultern in sich zusammen. Das Kinn auf der Brust und das Röhrchen noch im Mund. Gut, dass der Idiot schon saß.
Ich beugte mich zu ihm runter und schnippte ihm mit dem Zeigefinger gegen seine riesige Nase. »Was laberst du da, du Dichtschwein?«
Erschrocken zuckte er zusammen und stieß sich dabei den Hinterkopf an den Fliesen an.
»Du verdammter Wichser! Verpiss dich!«
Amüsiert wich ich einen Schritt zurück und wich seinem Tritt aus.
»Shore, aber wir nennen’s meistens Blech rauchen. Oder löten«, lallte Morena in kaum verständlicher Lautstärke und pennte dabei fast weg.
Ich konnte kaum glauben, wie dicht die alle waren. Shore? Was zum Teufel war Shore?! Von diesem Zeug hatte ich noch nie etwas gehört. Allem Anschein nach knallte es wie Sau. Sie alle hatten auffallend glasige Augen, mit winzig kleinen stecknadelkopfartigen Pupillen, wirkten absolut tiefenentspannt. Und obwohl es draußen noch ziemlich kalt war und wir alle in dicken Pullis und Jacken gekommen waren, saßen sie jetzt nur noch in ihren T-Shirts und mit hochgekrempelten Hosenbeinen auf dem kalten Fliesenboden. Der Julius hatte sogar seine Schuhe ausgezogen, weil ihm angeblich so warm war. Das Zeug musste ich definitiv auch probieren.
»Lass mich mal ziehen.« Ich ging vor dem Jugo in die Russenhocke und tippte ihn am Knie an. Aber außer dass er sich irgendwas zusammennuschelte und sich auf sein Shirt sabberte, kam nichts, keine Reaktion. »Hey, wach auf, du Ochse. Und lass mich mal ziehn an dem Ding.« Energisch rüttelte ich ihn, bis er grummelnd den Kopf hob und mich verwirrt ansah. Er verdrehte die Augen hinter den halb geschlossenen Lidern. Er wirkte völlig orientierungslos. Bis er das Stück Folie in seiner Hand erblickte.
Unglaublich langsam fingerte er nach dem Aluröhrchen, das er immer noch in seinem Mund hatte, und setzte, beinahe in Zeitlupe, zum nächsten Zug an und ignorierte mich einfach.
»Willste mich verarschen Alter? Lass mich endlich mal ziehen, du blöder Wichser!«
So langsam kam in mir das Gefühl auf, dass er mir nichts von seinem Stoff abgeben wollte. Und auch die anderen taten so, als ob sie mich nicht gehört hätten.
»Was seid ihr denn für geizige Fotzen? Was is los mit euch? Lasst mich mal ziehen, Mann.« Leicht ärgerlich drehte ich mich im Kreis und sah von einem zum anderen. Was sollte der Scheiß, verdammt? Das war was Neues für mich, denn bisher hatte jeder von ihnen alles mit mir geteilt. Und ich selbstverständlich mit ihnen. Selbst die kleinsten Krümel Dope rauchten wir gemeinschaftlich weg. Und jetzt so was.
»Mach das lieber nicht.« Der Pole war der Erste, der auf mich einging. Er schaute von seiner Folie auf, nahm einen Zug von seiner Kippe. »Das Zeug macht voll abhängig, Alter.«
Mit einem tiefen Stöhnen entließ er den Rauch aus seiner Lunge, nur um direkt wieder an seinem Blech zu ziehen. Was er sagte und was er tat, passte mal so gar nicht zusammen.
»Mensch, laber nich. Ihr raucht das doch auch alle. Los, lass mich mal ziehen.« Mittlerweile war ich total fickrig und ein Nein wollte und konnte ich nicht akzeptieren. Warum auch? Mein kompletter Freundeskreis saß hier und konsumierte dieses merkwürdige braune Zeug. Und ich wollte unter allen Umständen dazugehören. Also blieb ich hartnäckig.
»Is mir scheißegal, Junge, pisst euch mal nich so ein.« Ich hatte zwar gehört, was er gesagt hatte, aber wirklich angekommen war es nicht bei mir. Auch die Warnungen vom Rest der Truppe interessierten mich nicht und so nervte ich sie so lange ab, bis ich sie überredet hatte und sie mich schließlich mitrauchen ließen.
»Das is scheiße, Alter, mach’s lieber nicht.« Der Jugo hatte mir sein Röhrchen gereicht, während er das sagte, und erhob sich nun vom Boden.
»Ja, ja, quatsch nich. Gib mal her das Blech.«
Doch er schüttelte nur den Kopf. »Ich mach das für dich, du lässt nur alles verbrennen.«
In freudiger Erwartung stand ich zwischen den beiden Waschbecken und konnte es kaum abwarten, bis der Jugo in die Gänge kam. Er war super dicht und konnte kaum die Augen offen halten. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis er endlich Feuer unter der Folie machte und ich meinen ersten Zug von der Shore nehmen konnte.
»Bääh! Was is das denn?« Es kratzte im Hals und schmeckte ähnlich wie Lakritze.
»Du Trottel! Du musst die Luft anhalten, wenn du gezogen hast. So verschwendest du nur alles.«
Ich hustete und er nahm mir das Röhrchen aus der Hand und machte es mir noch einmal vor. Blech, Kippe, Luft anhalten. Ganz einfach.
Beim zweiten Versuch klappte es besser. Der Jugo trieb die Shore vorsichtig und mit kleiner Flamme über die Folie, während ich den aufsteigenden Qualm tief einsog. Angewidert zog ich an der Zigarette nach und hielt die Luft an. Der Geschmack war ekelhaft und gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem fand ich es irgendwie gut. Ich zog ein zweites Mal an der Kippe und presste mir den Rauch so lange in die Atemwege, bis mir leicht schwindelig wurde. Diesmal hatte ich alles richtig gemacht.
»Genau so, Alter. Noch mal?« Wieder hielt er mir das Blech unter die Nase.
»Klar, auf einem Bein kann man doch nich stehen.«
Erneut trieb er den braunen Punkt für mich über die Folie. Einmal hin und wieder zurück.
»Hier.« Der Jugo reichte mir seine Schachtel Marlboro. Ich zündete mir eine davon an und pumpte mir das Nikotin obendrauf. So langsam gefiel mir der Shoregeschmack, aber noch spürte ich keine Wirkung. Also direkt noch einen Zug hinterher.
Nachdem ich drei, vier, vielleicht fünf Mal von dem Blech gezogen hatte, fing es in meinem Kopf plötzlich an zu summen. Meine Ohren glühten auf einmal und von den Füßen aufwärtssteigend erfasste mich eine warme Welle und durchflutete meinen gesamten Körper.
Jetzt wusste ich, warum die anderen halb nackt auf dem kalten Fliesenboden rumlungerten. Wie geil war das denn!? Noch nie zuvor hatte ich mich so frei und unbeschwert gefühlt. Der Stress, den ich vorhin noch mit Maria gehabt hatte, war plötzlich unendlich weit weg und mit einem Schlag völlig unwichtig geworden. Dieses wohlig warme Gefühl drang in all meine Poren vor und meine Beine wurden weich. Mit verdrehten Augen sackte ich zwischen den Waschbecken zusammen und rutschte mit dem Rücken an der Wand herunter, bis ich auf dem vollgeaschten Boden saß. Ich zog die Knie an, verschränkte meine Arme darüber und vergrub mein Gesicht in den Ärmeln meiner Jacke. Es gab absolut nichts mehr, das mich belastete. Alles war gut!
Shore ist Heroin?
Hannover, Herbst 1988
Seit dem Abend in der Feuerwache war ein gutes halbes Jahr vergangen und die Shore war zu meinem täglichen Begleiter geworden. Ich konnte einfach nicht genug von dem Gefühl bekommen, das dieser Stoff mir verschaffte. Immer wenn ich den Drachen über die Folie jagte und sich dadurch dieser warme Mantel der Erlösung über meine Schultern legte, war ich frei von allen Ängsten und Sorgen, die ich im Unterbewusstsein mit mir herumschleppte. Die Streitigkeiten mit Maria und auch das Gefühl, zu Hause nicht geliebt zu werden, lösten sich jedes Mal und nach nur wenigen Zügen in Rauch auf.
Außerdem pushte die Shore mein Selbstvertrauen und es gab absolut nichts, was ich mir in diesem Zustand nicht zugetraut hätte. Jeder einzelne Turn verwandelte mich in einen Rebellen im Supermankostüm. Mit Stoff war einfach alles gut und nichts unmöglich.
Natürlich hatte ich in den letzten Wochen immer deutlicher wahrgenommen, dass ich nur noch funktionierte, wenn ich konsumierte. Aber ernsthaft Sorgen machte mir das noch nicht. Warum auch? Unser kleiner Pole schleppte bisher immer genug Stoff für uns alle an. Und das umsonst.
Sein älterer Bruder dealte im großen Stil mit dem Zeug und er beklaute ihn regelmäßig. Er stach mit einer Nadel kleine Löcher in die frisch gekauften Kilobeutel und schüttelte sie so lange über einer Zeitung, bis er die gewünschte Menge abgezweigt hatte. Seinem Bruder war das nie aufgefallen, da im Normalfall sowieso ein paar Gramm mehr in den Tüten drin war.
Erst vor Kurzem hatte ich ihm das erste Mal Geld dafür geben müssen. Denn inzwischen war unsere gesamte Bande so hoch dosiert, dass der gezockte Stoff nicht mehr für uns alle reichte und er immer geiziger damit wurde.