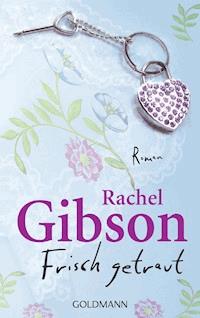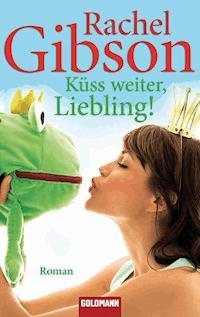7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Seattle Chinooks
- Sprache: Deutsch
Ein hinreißendes Lesevergnügen – witzig, romantisch und unglaublich sexy!
Die Journalistin Jane Alcott ist klein und ausgesprochen zierlich, ihr Outfit lässt sich allenfalls als praktisch oder dezent beschreiben, zudem ist sie mit mehr als nur einer Prise Schlagfertigkeit und Sturheit gesegnet. Also genau der Typ Frau, den der gefeierte Eishockeystar Luc Martineau normalerweise keines zweiten Blickes würdigt. Nun bekommt aber ausgerechnet Jane den Auftrag, eine Saison lang exklusiv über Lucs Team zu berichten. Und bald muss Luc erkennen, wie trügerisch der erste Eindruck sein kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Buch
Auf den ersten Blick könnte man die zierliche Reporterin Jane Alcott für ein unscheinbares Mauerblümchen halten. Doch wie trügerisch dieser erste Eindruck sein kann, muss Luc Martineau, der Star der Chinooks, Seattles Eishockeymannschaft, allzu bald am eigenen durchtrainierten Leib erfahren. Im Leben des 32-Jährigen gibt es nur den Sport (und hin und wieder ein blondes Busenwunder), und Luc liegt sehr viel daran, dass das so bleibt. Eine Journalistin mit ebenso viel Interesse an seinem Privatleben wie mangelnden Fachkenntnissen in Sachen Eishockey hat ihm da gerade noch gefehlt. Auch Jane hat sich ihre journalistische Karriere anders vorgestellt. Mit der Zeit lernt Jane jedoch hinter Lucs machohafte, aber zugegebenermaßen höllisch attraktive Fassade zu blicken, und auch Luc sieht in der jungen Frau zunehmend mehr als nur die lästige Journalistin. Als Jane dann eines Abends ihr übliches Grau in Grau durch ein atemberaubendes rotes Kleid ersetzt, ist es um Luc endgültig geschehen …
Autorin
Seit sie sechzehn ist, erfindet Rachel Gibson mit Begeisterung Geschichten. Damals allerdings brauchte sie ihre Ideen vor allem dazu, um sich alle möglichen Ausreden einfallen zu lassen, wenn sie wieder etwas ausgefressen hatte. Ihre Karriere als Autorin begann viel später, und mittlerweile hat sie nicht nur die Herzen ihrer Leserinnen erobert, sie wurde auch mit dem Golden Heart Award und dem National Readers’ Choice Award ausgezeichnet. Rachel Gibson lebt mit ihrem Ehemann, drei Kindern, zwei Katzen und einem Hund in Boise, Idaho. Weitere Titel der Autorin sind bei Goldmann in Vorbereitung.
Außerdem von Rachel Gibson bei Goldmann lieferbar:
Das muss Liebe sein. Roman Frühstück im Kornfeld. Roman Traumfrau ahoi. Roman
Inhaltsverzeichnis
Mit großer Dankbarkeit für die Männer und Frauen, die das coolste Spiel auf dem Eis spielen. Und natürlich für den Messias.
PROLOG
DAS LEBEN DER HONEY PIE
Von allen verräucherten Bars in Seattle musste er ausgerechnet die Lockere Schraube aufsuchen, die Kaschemme, in der ich fünf Nächte in der Woche arbeite, Bier zapfe und an Rauch ersticke. Eine schwarze Haarlocke fiel ihm lässig in die Stirn, als er ein Päckchen Camels und ein Zippo auf den Tresen legte.
»Ein Henry’s, bitte«, sagte er mit einer Stimme so rau wie Cordsamt, »und leg einen Zahn zu, Baby. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.«
Ich stand schon immer auf dunkle Typen mit schlechten Manieren. Ein Blick und ich wusste, dieser Mann ist so dunkel und so schlimm wie ein Gewittersturm. »Flasche oder vom Fass?«, fragte ich.
Er zündete sich eine Zigarette an und sah mich durch eine Rauchwolke hindurch an. Seine himmelblauen Augen waren randvoll mit Sünde, als er den Blick auf mein Top senkte. Angesichts meiner 75er Körbchengröße zog er wohlgefällig einen Mundwinkel hoch. »Flasche«, antwortete er.
Ich holte ein Henry’s aus dem Kühlschrank, öffnete die Flasche und schob sie über den Tresen. »Drei fünfzig.«
Er ergriff die Flasche mit seiner großen Hand und hob sie an die Lippen, und ohne mich aus den Augen zu lassen, trank er ein paar tiefe Züge. Schaum stieg im Flaschenhals auf, als er sie absetzte, und er leckte einen Tropfen Bier von seiner Unterlippe. Ich spürte es in den Kniekehlen.
»Wie heißt du?«, fragte er, griff in die Gesäßtasche seiner abgetragenen Jeans und zückte seine Brieftasche.
»Honey«, antwortete ich. »Honey Pie.«
Er zog auch den anderen Mundwinkel hoch und reichte mir einen Fünfer. »Bist du Stripperin?«
Das höre ich ziemlich oft. »Kommt darauf an.«
»Worauf?«
Ich händigte ihm das Rückgeld aus und strich dabei mit den Fingern über seine warme Handfläche. Ein Schaudern kitzelte den Puls an meinem Handgelenk, und ich lächelte. Ich ließ den Blick an seinen kräftigen Armen und seiner Brust hinauf zu seinen Schultern wandern. Wer mich kennt, weiß auch, dass ich mich in Bezug auf Männer nur an sehr wenige Regeln halte. Ich mag sie groß und schlecht, und sie müssen saubere Zähne und Hände haben. Das ist schon beinahe alles. Oh, ja, und ich bevorzuge eine schmutzige Fantasie, wenngleich die nicht unbedingt Voraussetzung ist, denn meine eigene reicht für zwei. Immer schon. Selbst als Kind hat sich in meinem Kopf alles um Sex gedreht. Während die Barbie-Puppen der anderen Mädchen Schule spielten, spielte meine Barbie Doktor. Und zwar so, dass Dr. Barbie Kens Gemächt untersuchte, um ihn dann in ein schweißnasses Koma zu versetzen.
Jetzt, im Alter von achtundzwanzig, während andere Frauen Golf spielen oder töpfern, sind Männer mein Hobby, und ich sammle sie wie billige Elvis-Souvenirs. Als ich in die sexy blauen Augen von Mr. Unmanierlich blickte, beschloss ich unter Berücksichtung meines rasenden Pulses und des Pochens zwischen meinen Schenkeln, vielleicht auch ihn in meine Sammlung aufzunehmen. Vielleicht würde ich ihn mit zu mir nach Hause nehmen. Oder ich nahm ihn auf dem Rücksitz meines Wagens oder in einer Kabine der Damentoilette.
»Was du dir so vorstellst«, antwortete ich schließlich, verschränkte die Arme auf dem Tresen und beugte mich vor, um ihm den Anblick meiner perfekten Brüste zu gewähren.
Er hob den Blick aus meinem Dekolleté, und seine Augen waren heiß und hungrig. Dann klappte er seine Brieftasche auf und zeigte mir seine Dienstmarke. »Ich suche Eddie Cordova. Ich habe gehört, dass du ihn kennst.«
Persönliches Pech. Ein Bulle. »Ja, ich kenne Eddie. « Ich war einmal mit ihm ausgegangen, wenn man das, was wir getrieben haben, so umschreiben möchte. Als ich Eddie das letzte Mal sah, lag er in der Toilette bei Jimmy Woo im Koma. Ich musste auf sein Handgelenk treten, damit er endlich meinen Knöchel losließ.
»Weißt du, wo ich ihn finden kann?«
Eddie war ein drittklassiger Dieb, und schlimmer noch, im Bett war er miserabel, und ich hatte nicht die Spur eines schlechten Gewissens, als ich sagte: »Kann sein.« Ja, vielleicht würde ich diesem Typen helfen, und so, wie er mich ansah, war klar, dass er mehr wollte, als …
Das Telefon neben Jane Alcotts Computer klingelte und lenkte ihre Aufmerksamkeit vom Bildschirm und von der neuesten Episode aus dem Leben der Honey Pie ab.
»Verdammt«, fluchte sie. Sie schob die Finger unter ihre Brillengläser und rieb sich die müden Augen. Zwischen den Fingern hindurch spähte sie auf die Nummer auf dem Display und hob ab.
»Jane«, begann der Chefredakteur der Seattle Times, Leonard Callaway, ohne ein Wort der Begrüßung. »Virgil Duffy redet heute Abend mit den Trainern und dem Geschäftsführer. Du hast den Job jetzt offiziell.«
Virgil Duffys Unternehmen war Mitglied der Fortune 500, und ihm gehörte das Hockeyteam der Seattle Chinooks. »Wann fange ich an?«, fragte Jane und erhob sich. Sie griff nach ihrem Kaffee und verschüttete etwas auf ihren alten Flanellpyjama, als sie den Becher an die Lippen hob.
»Am Ersten.«
Am ersten Januar. Dann blieben ihr nur noch zwei Wochen für die Vorbereitung. Vor zwei Tagen war Leonard mit der Frage an sie herangetreten, ob sie Lust hätte, den Sportreporter Chris Evans, der sich der Behandlung eines Non-Hodgkin-Lymphoms unterzog, zu vertreten. Chris’ Prognose war gut, aber für die Zeit seiner Abwesenheit brauchte die Zeitung jemanden, der über das Hockeyteam der Seattle Chinooks berichtete. Jane hatte sich nie träumen lassen, dass sie dieser Jemand sein würde.
Unter anderem schrieb sie Artikel für die Seattle Times und war bekannt für ihre monatliche Kolumne Als Singlefrau in der Stadt. Von Hockey hatte sie nicht die geringste Ahnung.
»Am Zweiten gehst du mit ihnen auf Tour«, fuhr Leonard fort. »Virgil will die Einzelheiten noch mit den Trainern absprechen, und am Montag vor der Abreise stellt er dich dann dem Team vor.«
Als man ihr in der vergangenen Woche den Job angeboten hatte, war sie erschrocken und ziemlich verdutzt gewesen. Mr. Duffy würde doch sicher verlangen, dass ein anderer Sportreporter über die Spiele berichtete. Doch wie sich herausstellte, war das Angebot die Idee des Besitzers selbst gewesen.
»Wie finden die Trainer das denn?« Sie stellte den Becher neben einem mit Post-it-Zetteln in verschiedenen Farben gespickten Terminplaner auf dem Schreibtisch ab.
»Das ist relativ unwichtig. Seit John Kowalsky und Hugh Miner sich zur Ruhe gesetzt haben, hat die Arena kein nennenswertes Publikum mehr gesehen. Duffy muss diesen Spitzentorwart bezahlen, den er letztes Jahr eingekauft hat. Virgil ist ein glühender Hockeyfan, aber in erster Linie ist er Geschäftsmann. Er tut, was er kann, um die Fans auf die Tribüne zu holen. Das ist auch der Hauptgrund dafür, dass er auf dich verfallen ist. Er will mehr Frauen zu den Spielen locken. «
Leonard Callaway sagte jedoch nichts darüber, dass Duffy glaubte, sie würde locker-flockigen Frauenkram schreiben. Was Jane nicht störte; immerhin half dieser Frauenkram ihr, ihre Rechnungen zu bezahlen, und war außerdem hochgradig beliebt bei den Leserinnen der Seattle Times. Aber Frauenkram reichte nicht für sämtliche Rechnungen. Nicht einmal annähernd. Die meisten bezahlte sie mithilfe von Pornos. Und die Pornoserie Das Leben der Honey Pie, die sie für die Zeitschrift Him schrieb, war hochgradig beliebt bei Männern.
Während Leonard über Duffy und sein Hockeyteam berichtete, griff Jane nach einem Kuli und kritzelte auf einen pinkfarbenen Zettel: Bücher über Hockey kaufen. Sie riss das Zettelchen vom Block, schlug eine Seite im Terminplaner um und klebte es unter einigen anderen ein.
»… und du darfst nie vergessen, dass du es mit Hockeyspielern zu tun hast. Weißt du, die sind manchmal furchtbar abergläubisch. Wenn die Chinooks anfangen, Spiele zu verlieren, geben sie dir die Schuld und jagen dich zum Teufel.«
Prima. Ihr Job war abhängig von abergläubischen Machos. Sie riss eine alte Notiz mit der Aufschrift »Termin Honey« aus dem Planer und warf sie in den Papierkorb.
Nach ein paar Gesprächsminuten legte sie den Hörer auf und griff nach ihrem Kaffeebecher. Wie die meisten Einwohner von Seattle kannte auch sie die Namen und sogar ein paar Gesichter von Hockeyspielern. Die Saison war lang, und beinahe jeden Abend wurde Hockey in den King-5-Nachrichten erwähnt, aber wirklich kennen gelernt hatte sie bisher nur einen von den Chinooks, den Torhüter, den Leonard erwähnt hatte, Luc Martineau.
Sie war dem Mann mit dem Dreiunddreißig-Millionen-Dollar-Vertrag kurz nach seinem Wechsel zu den Chinooks im letzten Sommer auf einer Party des Presseclubs vorgestellt worden. Wie der Inbegriff kraftstrotzender Gesundheit stand er in der Mitte des Raums, ein König, der Hof hielt. Er war kleiner, als Jane ihn sich vorgestellt hatte. Etwa einsachtzig, aber Muskeln pur. Dunkelblondes Haar wuchs ihm über die Ohren und in den Hemdkragen, leicht zerzaust und wie mit den Fingern gekämmt.
Er hatte eine kleine, weiße Narbe auf dem linken Wangenknochen und eine weitere am Kinn. Sie schmälerten allerdings nicht den ungeheuren Eindruck, den er machte. Sie ließen ihn vielmehr so gefährlich erscheinen, dass wohl keine einzige Frau im Raum sich nicht fragte, wie gefährlich er wirklich werden konnte.
Zum unauffälligen anthrazitfarbenen Anzug trug er eine rote Seidenkrawatte. Das Handgelenk zierte eine goldene Rolex, und an seiner Seite klebte wie ein Saugnapf eine verblühte Blondine.
Der Mann legte eindeutig Wert auf Accessoires.
Jane und der Torhüter hatten Begrüßungsfloskeln und einen Handschlag ausgetauscht. Der Blick seiner blauen Augen hatte sie kaum gestreift, bevor er mit seiner Blondine weiterging. In weniger als einer Sekunde fand sie sich gewogen und für zu leicht befunden. Doch daran war sie gewöhnt. Männer wie Luc beachteten Frauen wie Jane gewöhnlich nicht. Kaum größer als einssechzig, dunkelbraunes Haar, grüne Augen und A-Körbchen. Solche Männer blieben nicht stehen, um zu hören, ob sie vielleicht etwas Interessantes zu sagen hatte.
Falls die übrigen Chinooks sie genauso rasch abtaten wie Luc Martineau, standen ihr ein paar beschwerliche Monate bevor, aber die Gelegenheit, mit dem Team von Spiel zu Spiel zu reisen, war zu gut, als dass sie darauf hätte verzichten mögen. Sie würde ihre Artikel über den Hockeysport aus dem Blickwinkel einer Frau verfassen. Sie würde natürlich über die Höhepunkte des Spiels berichten, aber ihr Hauptaugenmerk wollte sie auf das lenken, was im Umkleideraum geschah. Nicht auf Penisgröße und sexuelle Vorlieben – das war ihr gleichgültig. Sie wollte in Erfahrung bringen, ob Frauen auch im einundzwanzigsten Jahrhundert noch diskriminiert wurden.
Jane nahm den Platz vor ihrem Laptop wieder ein und widmete sich wieder der Honey-Pie-Episode, die sie morgen abliefern müsste, wenn sie noch im Februar erscheinen sollte. Während viele Männer ihre Singlefrau-Kolumne für einen Schmachtfetzen hielten und nicht zugaben, dass sie sie lasen, fanden doch viele von ebendiesen Männern an Janes Honey-Pie- Serie großen Gefallen. Niemand außer Eddie Goldman, der Chefredakteur der Zeitschrift, und Caroline Mason, ihre beste Freundin seit der dritten Klasse, wusste, dass sie diese lukrativen monatlichen Artikel schrieb. Und so sollte es auch bleiben.
Honey war Janes Alter Ego. Umwerfend. Hemmungslos. Der Traum eines jeden Mannes. Eine Hedonistin, die Männer in ganz Seattle in ein verschwitztes Koma versetzte, ausgelaugt und der Sprache beraubt, was sie aber nicht daran hinderte, um mehr zu betteln. Honey hatte einen riesigen Fan-Club, und auch im Internet waren ihr ein halbes Dutzend Fan-Sites gewidmet. Einige waren traurig, andere witzig. Auf einer dieser Websites wurde spekuliert, dass der Autor von Honey Pie in Wahrheit ein Mann sei.
Dieses Gerücht gefiel Jane am besten. Ein Lächeln spielte um ihre Lippen, als sie die letzten Zeilen las, die sie vor Leonards Anruf geschrieben hatte. Dann machte sie sich wieder an ihre Arbeit – Männer zum Betteln zu bringen.
1. KAPITEL
Die Rasur: Einführung der Anfänger
Der Umkleideraum hallte wider von Blödeleien, als Luc »Lucky« Martineau seine Montur anlegte. Die meisten seiner Teamkameraden scharten sich um Daniel Holstrom, den Neuling aus Schweden, und boten ihm zwei verschiedene Möglichkeiten der Initiation an. Daniel konnte sich entweder von den Jungs einen Irokesen rasieren lassen, oder er musste das gesamte Team zum Essen einladen. Da Neulingsgelage zwischen zehn- und zwölftausend Dollar kosteten, vermutete Luc, dass der junge Verteidiger wohl eine Zeit lang wie ein Punker herumlaufen würde.
Daniel suchte mit großen, blauen Augen den Raum nach einem Hinweis darauf ab, dass die Jungs ihn hochnahmen. Er fand keinen. Alle waren einmal Anfänger gewesen, und jeder hatte irgendwelche Schikanen über sich ergehen lassen müssen. In Lucs Anfängersaison waren öfter mal die Schnürsenkel seiner Schlittschuhe verschwunden, und oft genug waren die Laken in seinem Hotelzimmer gekürzt worden.
Luc ergriff seinen Schläger und machte sich auf den Weg zum Tunnel. Er kam an ein paar Jungs vorüber, die ihre Schläger mit Schweißgeräten bearbeiteten. Kurz vor dem Tunnel standen Coach Larry Nystrom und Geschäftsführer Clark Gamache und sprachen mit einer kleinen, ganz in Schwarz gekleideten Frau. Die Männer hatten die Arme vor der Brust verschränkt und blickten finster auf die Frau, die auf sie einredete. Ihr dunkles Haar war am Hinterkopf mit einem dieser komischen Gummiteile zusammengefasst, die auch seine Schwester benutzte.
Luc nahm kaum Notiz von ihr und hatte sie bereits vergessen, als er zum Trainieren aufs Eis glitt. Er horchte auf das erfrischende Sch-sch, das er nach stundenlangem Schleifen der Kufen freudig erwartet hatte. Durch das Gitter seiner Maske streifte kühle Luft seine Wangen und füllte seine Lungen, während er verschiedene Aufwärmübungen absolvierte.
Wie alle Torhüter war er zwar Mitglied des Teams, trotzdem durch die typische Einsamkeit seines Jobs ein Außenseiter. Für Männer wie Luc gab es niemanden, hinter dem sie sich verstecken konnten. Wenn er einen Puck durchgehen ließ, blinkten die Alarmzeichen wie riesige in Neon geschriebene Versager-Zeichen, und es bedurfte immer wieder aller Entschlossenheit und großen Muts, sich für ein neues Spiel zwischen die Pfosten zu stellen. Ein Torhüter musste ein Mann sein, der ehrgeizig und arrogant genug war, sich selbst für unbesiegbar zu halten.
Der Torhüter-Coach, Don Boclair, schob einen Behälter voller Pucks aufs Eis, während Luc das gleiche Ritual wie seit elf Jahren absolvierte, sei es vor einem Spiel oder zum Training. Er lief dreimal im Uhrzeigersinn um das Tor herum und einmal in der Gegenrichtung. Er nahm seinen Platz zwischen den Pfosten ein und haute mit seinem Schläger links und rechts dagegen. Dann bekreuzigte er sich wie ein Priester und blickte Don, der an der blauen Linie stand, fest in die Augen. In der folgenden halben Stunde schlitterte der Coach um ihn herum, schoss wie ein Scharfschütze auf alle sieben Löcher und feuerte vom Punkt aus.
Luc war zufrieden. Zufrieden mit dem Spiel, zufrieden mit seiner körperlichen Kondition. Inzwischen war er einigermaßen schmerzfrei und nahm keine Tabletten, die stärker waren als Advil. Er erlebte die beste Saison seiner Karriere, und jetzt, da es aufs Finale der Sportvereinigung zuging, war er mit seinen zweiunddreißig Jahren in Höchstform. Sein Berufsleben hätte nicht besser aussehen können.
Schade nur, dass sein Privatleben schwer zu wünschen übrig ließ.
Der Torhüter-Coach feuerte einen Puck ins obere Drittel, und Luc fing ihn mit einem dumpfen »Pock« im Handschuh. Durch die dicke Polsterung hindurch brannte das halbe Pfund vulkanisierten Gummis in seiner Handfläche. Er ließ sich auf die Knie fallen, als der nächste Puck sein Fünfer-Loch bedrohte und gegen seine Beinschützer knallte. Er spürte den vertrauten, stechenden Schmerz in den Sehnen und Bändern, aber es war nichts, was er nicht hätte verkraften können. Nichts, was er nicht verkraftet hätte, und nichts, von dem er je laut zugegeben hätte, dass er es überhaupt spürte.
Manch einer hatte ihn schon abgeschrieben. Einen Strich unter seine Karriere gezogen. Vor zwei Jahren, als er noch für die Red Wings spielte, hatte er sich beide Knie kaputtgemacht. Nach mehreren Operationen, zahllosen Stunden Krankengymnastik, einer Stippvisite in der Betty-Ford-Stiftung, um die Abhängigkeit von Schmerzmitteln loszuwerden, und einem Wechsel zu den Seattle Chinooks war Luc wieder da und spielte besser denn je.
In dieser Saison musste er etwas beweisen. Sich selbst. Denen, die ihn abgeschrieben hatten. Er hatte die Eigenschaften wiedererlangt, die ihn immer zu einem der Besten gemacht hatten. Luc hatte einen unheimlichen Puckverstand und konnte einen Spielverlauf geradezu voraussehen. Und wenn er die Gefahr nicht mit einer flinken Parade abwehren konnte, hatte er immer noch rohe Gewalt und einen gefährlichen Haken in Reserve.
Nach dem Training zog Luc Shorts und ein T-Shirt an und ging zum Übungsraum. Er strampelte sich eine Dreiviertelstunde auf dem Trainingsfahrrad ab, bevor er zu den Gewichten wechselte. Anderthalb Stunden lang trainierte er Arm-, Brust- und Bauchmuskeln. Die Muskeln an Beinen und Rücken brannten, und der Schweiß tropfte ihm von den Schläfen, während er die Schmerzen wegatmete.
Er duschte ausgiebig, schlang ein Handtuch um seine Hüften und ging zum Umkleideraum. Die anderen Jungs waren schon dort, lümmelten auf Stühlen und Bänken und lauschten auf das, was Gamache von sich gab. Virgil Duffy stand ebenfalls mitten im Raum und redete über Kartenverkäufe. Kartenverkäufe waren nicht Lucs Angelegenheit. Er hatte Tore zu halten und Spiele zu gewinnen. Bisher machte er seinen Job gut.
Luc lehnte sich mit einer bloßen Schulter an den Türrahmen. Er verschränkte die Arme vor der Brust, und sein Blick fiel auf die kleine Frau, die er schon vor Trainingsbeginn gesehen hatte. Sie stand neben Duffy, und Luc hatte Muße, sie eingehender zu betrachten. Sie war eine von diesen naturbelassenen Frauen, die keine Spur von Make-up tragen. Die beiden Striche ihrer Augenbrauen waren die einzige Farbe in ihrem blassen Gesicht. Die schwarze Jacke und die schwarze Hose waren unförmig und verbargen jeden noch so kleinen Hinweis auf Kurven. Über einer Schulter hing eine Ledertasche, in der Hand hielt sie einen Pappbecher.
Sie war nicht hässlich – nur nichts sagend. Manche Männer mochten die naturbelassene Sorte Frau. Luc nicht. Ihm gefielen Frauen, die roten Lippenstift trugen, nach Puder dufteten und ihre Beine rasierten. Ihm gefielen Frauen, die sich Mühe gaben, gut auszusehen. Diese Frau gab sich eindeutig nicht die geringste Mühe.
»Ihr wisst sicher alle längst, dass Chris Evans wegen Krankheit für eine Weile ausfällt. An seiner Stelle wird Jane Alcott über unsere Spiele berichten«, erklärte der Besitzer. »Sie wird uns während der restlichen Saison begleiten und mit uns reisen.«
Die Spieler saßen in verblüfftem Schweigen da. Keiner sagte etwas, doch Luc wusste, was sie dachten. Sie dachten das Gleiche wie er, nämlich, dass er lieber einen Puck an den Schädel bekam, als mit einem Reporter, geschweige denn mit einer Reporterin zu reisen.
Die Spieler sahen den Mannschaftskapitän, Mark »der Hitman« Bressler, an, richteten dann ihre Aufmerksamkeit auf die Trainer, die ebenfalls in frostigem Schweigen verharrten. Sie warteten darauf, dass jemand etwas sagte. Sie vor dem zu klein geratenen, dunkelhaarigen Albtraum bewahrte, der ihnen aufgezwungen werden sollte.
»Tja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist«, hub der Hitman an, doch ein Blick aus Virgil Duffys eisigen, grauen Augen ließ den Kapitän verstummen. Niemand wagte es, noch einmal das Wort zu ergreifen.
Niemand außer Luc Martineau. Er hatte Respekt vor Virgil. Er mochte ihn sogar ein wenig. Aber Luc erlebte die beste Saison seines Lebens. Die Chinooks hatten wirklich gute Chancen auf den Pokal, und er wollte verflucht sein, wenn er nicht alles tat, um zu verhindern, dass irgendeine dahergelaufene Reporterin ihnen diese Chancen verdarb. Ihm diese Chance verdarb. Seiner Meinung nach war die Katastrophe vorprogrammiert.
»Bei allem Respekt, Mr. Duffy, haben Sie den Verstand verloren, verdammt noch mal?«, fragte er und stieß sich von der Wand ab. Auf Tour passierten nun mal Dinge, von denen der Rest des Landes nicht unbedingt beim Frühstück lesen musste. Luc war in der Beziehung diskreter als seine Teamkameraden, trotzdem war eine Reporterin, die sie auf ihren Reisen begleitete, das Letzte, was sie brauchen konnten.
Außerdem durfte man den Pechsträhnenfaktor nicht außer Acht lassen. Alles, was der Norm widersprach, konnte das Glück ganz schnell ins Gegenteil verkehren. Und eine Frau, die mit ihnen reiste, wich ganz eindeutig stark von der Norm ab.
»Wir haben ja durchaus Verständnis für eure Sorgen, Jungs«, entgegnete Duffy. »Aber nach gründlicher Überlegung und der Zusicherung seitens der Times und auch Ms. Alcotts können wir euch allen die Wahrung eurer Intimsphäre garantieren. Die Berichterstattung wird euer Privatleben in keiner Weise verletzen.«
Blödsinn, dachte Luc, doch er vergeudete keinen Atemzug für weiteren Widerstand. Luc sah die Entschlossenheit in der Miene des Besitzers und wusste, dass Einwände sinnlos waren. Virgil Duffy bezahlte die Rechnungen. Aber das bedeutete nicht, dass es Luc gefallen musste.
»Tja, dann sollten Sie sie schnellstens auf echt grobe Sprache vorbereiten«, warnte er.
Ms. Alcott wandte sich Luc zu. Ihr Blick war offen und fest. Sie zog einen Mundwinkel hoch, als wäre sie leicht amüsiert. »Ich bin Journalistin, Mr. Martineau«, sagte sie, und ihre Stimme war dezenter als ihr Blick, eine verblüffende Mischung aus weicher Weiblichkeit und scharfer Entschlossenheit. »Ihre Sprache kann mich nicht schockieren.«
Er schenkte ihr ein herausforderndes Lächeln und begab sich auf seinen Umkleideplatz am Ende des Raums.
»Ist sie die Frau, die schreibt Kolumne über Partnerfinden ?«, fragte Vlad »der Pfähler« Fetisov.
»Ich schreibe die Kolumne Als Singlefrau in der Stadt für die Times«, antwortete sie.
»Ich dachte, die Frau wäre Orientalin«, bemerkte Bruce Fish.
»Nein, der Eindruck entsteht nur durch ihren schlechten Lidstrich«, klärte ihn Ms. Alcott auf.
Himmel, sie war nicht mal eine richtige Sportreporterin. Luc hatte ihre Kolumne ein paarmal gelesen, das heißt, er hatte versucht, sie zu lesen. Sie war die Frau, die über ihre Männerprobleme und die ihrer Freundinnen schrieb. Sie gehörte zu den Frauen, die gern über »Beziehungskisten und Probleme« redeten, als ob das alles zu Tode analysiert werden müsste. Als ob die meisten Probleme zwischen Männern und Frauen nicht ohnehin reine Erfindung von Frauen wären.
»Mit wem teilt sie das Zimmer?«, fragte jemand von links her, und das darauf folgende Gelächter löste die Spannung ein wenig. Die Unterhaltung wechselte von Ms. Alcott zu den nächsten vier Spielen, die ihnen in einem Acht-Tage-Marathon bevorstanden.
Luc ließ sein Handtuch zu Boden fallen und kramte in seiner Sporttasche. Virgil Duffy ist inzwischen offenbar senil, dachte Luc und warf seine weiße Unterhose und das T-Shirt auf die Bank. Senil, oder die Scheidung, die er gerade durchstand, machte ihn verrückt. Diese Frau hatte nicht die geringste Ahnung von Hockey. Am Ende wollte sie nur über Gefühle und Beziehungsprobleme reden. Nun, sie konnte ihm Fragen stellen, bis sie schwarz wurde, von ihm würde sie keine einzige Antwort erhalten. Nach seinen Erfahrungen in den letzten Jahren redete Luc nicht mehr mit Reportern. Nie mehr. Daran änderte sich auch nichts, wenn eine Reporterin sie auf ihren Reisen begleitete.
Er zog sich die Unterhose übers Gesäß, warf einen Blick über die Schulter auf Ms. Alcott und schlüpfte in sein T-Shirt. Er sah, dass sie auf ihre Schuhe starrte. Weibliche Sportreporter im Umkleideraum waren nichts Neues. Falls eine Frau sich an einem Raum voller nacktärschiger Männer nicht störte, wurde sie seines Wissens kaum anders behandelt als ihre männlichen Gegenstücke. Doch Ms. Alcott wirkte so verklemmt wie eine altjüngferliche Tante. Was nicht hieß, dass Luc irgendetwas von Jungfrauen verstand.
Er komplettierte sein Outfit mit einer ausgebleichten Levi’s und einem blauen Rippenpullover. Dann stieg er in seine schwarzen Stiefel und schnallte sich die goldene Rolex ums Handgelenk. Die Uhr hatte er bei der Vertragsunterzeichnung von Virgil Duffy geschenkt bekommen. Ein kleiner Bonus zum Abschluss des Handels.
Luc schnappte sich seine lederne Bomberjacke und die Sporttasche und begab sich ins Büro. Dort holte er sich die Reiseroute für die nächsten acht Tage ab und überzeugte sich, dass nicht vergessen worden war, ihm ein Einzelzimmer zu geben. Beim letzten Mal war es in Toronto zu einer Panne gekommen, und sie hatten Rob Sutter zu ihm ins Zimmer gesteckt. Gewöhnlich schlief Luc ein, sobald sein Kopf das Kissen berührte, aber Rob hatte wie eine Motorsäge geschnarcht.
Es war kurz nach Mittag, als Luc das Gebäude verließ. Das dumpfe Knallen seiner Stiefelabsätze hallte auf dem Weg zum Ausgang von den Betonwänden wider. Als er hinaustrat, schlug ihm grauer Nebel ins Gesicht und sickerte in den Kragen seiner Jacke. Es war diese Art von Dunst, die noch nicht ganz Regen, aber trotzdem unheimlich melancholisch war. Die Art, an die er sich noch gewöhnen musste. Dieses Wetter war einer der Gründe, warum er gern reiste und die Stadt verließ, allerdings nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war die Ruhe, die er unterwegs fand. Doch er hatte so eine Vorahnung, dass diese Ruhe wohl von der Frau gestört werden würde, die jetzt ein paar Schritte entfernt von ihm stand und in ihrer Schultertasche kramte.
Ms. Alcott hatte sich in einen glänzenden Regenmantel gewickelt, der in der Taille gegürtet war. Er war lang und schwarz, und der Wind, der von der Bucht her wehte, blähte ihn auf, sodass es aussah, als hätte Ballast ihr Hinterteil aufgepolstert. In einer Hand hielt sie noch immer den Pappbecher.
»Der Flug nach Phoenix um sechs Uhr morgens ist die Härte«, sagte er, als er auf dem Weg zum Parkhaus auf sie zuging. »Kommen Sie nicht zu spät. Es wäre schade, wenn Sie ihn verpassen würden.«
»Ich werde pünktlich da sein«, versicherte sie, als er an ihr vorbeiging. »Sie wollen nicht, dass ich mit dem Team reise. Liegt es daran, dass ich eine Frau bin?«
Er blieb stehen und drehte sich zu ihr um. Eine frische Brise zerrte an den Aufschlägen ihres Mantels und blies ein paar Strähnen aus ihrem Pferdeschwanz über ihre rosigen Wangen. Auch bei näherer Betrachtung wurde sie nicht unbedingt schöner. »Nein. Ich kann Reporter nicht ausstehen.«
»Das ist angesichts Ihrer Vergangenheit nicht weiter verwunderlich, möchte ich meinen.« Sie hatte sich augenscheinlich über ihn informiert.
»Welcher Vergangenheit?« Er fragte sich, ob sie dieses Scheißbuch Die Schlimmen Finger des Hockeysports gelesen hatte, in dem ihm allein fünf Kapitel gewidmet waren, mit Fotos. Etwa die Hälfte von allem, was der Autor in diesem Buch behauptete, war Klatsch und pure Erfindung. Und der einzige Grund, warum Luc ihn nicht verklagt hatte, war der, dass er nicht noch mehr Medienrummel um sich haben wollte.
»Ihre Vergangenheit in der Presse.« Sie nahm einen Schluck aus ihrem Pappbecher und zuckte mit den Schultern. »Die allgegenwärtige Berichterstattung über Ihre Probleme mit Drogen und Frauen.«
Ja, sie hatte es gelesen. Und, zum Kuckuck, was für Leute waren das, die Wörter wie allgegenwärtig benutzten? Reporter, wer sonst. »Um eines klarzustellen: Ich hatte noch nie Probleme mit Frauen. Weder allgegenwärtig noch sonst wie. Sie sollten nicht alles glauben, was Sie lesen.«
Zumindest hängte sie ihm keine kriminelle Vergangenheit an. Und seine Abhängigkeit von Schmerzmitteln lag in der Vergangenheit. Wo sie auch bleiben sollte.
Er ließ den Blick von ihrem zurückgekämmten Haar über die makellose Haut ihres Gesichts und am Rest ihrer in diesen scheußlichen Mantel gewickelten Gestalt hinabwandern. Wenn sie ihr Haar offen trug, würde sie vielleicht nicht so furchtbar klemmärschig aussehen. »Ich habe Ihre Kolumne in der Zeitung gelesen«, sagte er und sah in ihre grünen Augen. »Sie sind die Singlefrau, die ständig über Beziehungen schwafelt und keinen Mann findet.« Sie zog die dunklen Brauen zusammen, ihr Blick wurde hart. »Nachdem ich Sie jetzt kennen gelernt habe, verstehe ich Ihr Problem.« Er hatte ihren wunden Punkt getroffen. Gut. Vielleicht ließ sie ihn jetzt in Ruhe.
»Sind Sie noch clean und trocken?«, fragte sie.
Er vermutete, dass sie, wenn er jetzt nicht antwortete, irgendwas erfinden würde. So machten sie es immer. »Absolut.«
»Tatsächlich?« Ihre zusammengezogenen Brauen hoben sich zu perfekten Bögen, als würde sie ihm nicht so recht glauben.
Er machte einen Schritt auf sie zu. »Soll ich in Ihren Becher pissen, Süße?«, fragte er die verklemmte Frau mit den harten Augen, die bestimmt seit fünf Jahren keinen Sex mehr gehabt hatte.
»Nein danke. Ich trinke meinen Kaffee schwarz.«
Er hätte sich vielleicht die Zeit genommen, ihre Retourkutsche gebührend zu würdigen, wäre sie nicht Reporterin gewesen und hätte er nicht das Gefühl gehabt, dass sie ihm aufgezwungen wurde. »Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie’s sich mal anders überlegen sollten. Und glauben Sie bloß nicht, die Tatsache, dass Duffy Sie den Jungs aufgehalst hat, könnte Ihnen den Job in irgendeiner Weise erleichtern.«
»Und das bedeutet?«
»Überlegen Sie doch mal«, sagte er und ging weiter.
Er legte das kurze Stück zum Parkhaus zurück und fand seine graue Ducati, die neben dem Behindertenparkplatz aufgebockt stand. Die Farbe des Motorrads entsprach haargenau der der düsteren Garage und den dicken Wolken, die über der Stadt hingen. Er klemmte seine Tasche auf den Gepäckträger und schwang ein Bein über den schwarzen Sitz. Mit dem Stiefelabsatz trat er den Ständer hoch, dann ließ er die Zwei-Zylinder-Maschine an. Er verschwendete keinen Gedanken mehr an Ms. Alcott, als er aus dem Parkhaus fuhr, das dumpfe Dröhnen des Motors hinter sich herziehend. Er passierte die Tini Bigs Bar, fuhr die Broad hinauf bis zur Second Avenue, bog nach ein paar Häuserblocks in die Gemeinschaftsgarage seines Wohnkomplexes ein und stellte das Motorrad neben seinem Landcruiser ab.
Mit zwei Fingern zog er die Manschette seiner Jacke zurück und warf einen Blick auf die Uhr. Er griff in seine Tasche und rechnete aus, dass ihm noch drei Stunden der Ruhe blieben. Er konnte eine Spielekassette in den Videorekorder schieben und vor seinem Großbildschirmfernseher entspannen. Oder er konnte eine Freundin anrufen und sie zum Mittagessen zu sich einladen. Eine gewisse langbeinige Rothaarige kam ihm in den Sinn.
Im neunzehnten Stock verließ Luc den Aufzug und ging den Flur entlang zu seinem nach Nordosten gelegenen Eckapartment. Er hatte es im letzten Sommer kurz nach seinem Wechsel zu den Chinooks gekauft. Von der Einrichtung – die ihn mit viel Chrom und Stein und abgerundeten Ecken an den alten Cartoon The Jetsons erinnerte – war er nicht sonderlich begeistert, aber die Aussicht … die Aussicht war umwerfend.
Er öffnete die Tür, und seine Pläne für den Tag fielen in sich zusammen, als er über einen blauen North-Face-Rucksack auf dem hellen Teppich stolperte. Eine rote Snowboarder-Jacke lag auf dem marineblauen Ledersofa, Ringe und Armreifen stapelten sich auf einem der Beistelltischchen aus Schmiedeeisen und Glas. Rap-Musik dröhnte aus seiner Stereoanlage, und auf dem Großbildschirm führte Shaggy seine Verrenkungen vor.
Marie. Marie war schon zu Hause.
Auf dem Weg durch den Flur warf Luc im Vorbeigehen den Rucksack und seine Tasche auf das Sofa. Er klopfte an eine der drei Schlafzimmertüren und öffnete sie einen Spalt. Marie lag auf ihrem Bett, das kurze, dunkle Haar wie einen gekappten schwarzen Flederwisch auf dem Kopf zusammengenommen. Die Wimperntusche war unter ihren Augen verlaufen, ihre Wangen waren blass. Sie drückte einen zottigen blauen Teddybär an ihre Brust.
»Wieso bist du zu Hause?«
»Die Schule hat versucht, dich anzurufen. Mir geht’s nicht gut.«
Luc trat näher, um seine sechzehnjährige Schwester, die zusammengerollt auf ihrer Spitzenbettdecke lag, genauer in Augenschein zu nehmen. Vermutlich weinte sie wieder einmal um ihre Mutter. Seit der Beerdigung war erst ein Monat vergangen, und er glaubte, etwas sagen zu müssen, um Marie zu trösten, wusste aber beim besten Willen nicht, was; er hatte es ein paarmal versucht, damit aber alles noch schlimmer gemacht.
»Hast du die Grippe?«, fragte er stattdessen. Sie sah ihrer Mutter so ähnlich, dass es schon unheimlich war. Oder zumindest sah sie ihrer Mutter, wie er sie in Erinnerung hatte, sehr ähnlich.
»Nein.«
»Brütest du eine Erkältung aus? Was fehlt dir denn?«
»Ich fühl mich einfach nicht gut.«
Luc selbst war sechzehn gewesen, als seine Schwester geboren wurde, als Kind seines Vaters und der vierten Frau seines Vaters. Abgesehen von ein paar Feiertagsbesuchen hatte Luc nie etwas mit Marie zu tun gehabt. Sie hatten in Los Angeles gewohnt; er lebte auf der anderen Seite des Landes. Er hatte mit seinem eigenen Leben zu tun gehabt, und bevor sie im vergangenen Monat bei ihm eingezogen war, hatte er sie zuletzt auf dem Begräbnis ihres Vaters vor zehn Jahren gesehen. Und jetzt trug er plötzlich die Verantwortung für eine Schwester, die er gar nicht kannte. Er war ihr einziger lebender Verwandter, der noch nicht das Rentenalter erreicht hatte. Er war Hockeyspieler. Junggeselle. Männlich. Und er hatte nicht die geringste Ahnung, was zum Teufel er mit ihr anfangen sollte.
»Möchtest du eine Suppe?«, fragte er.
Sie zuckte mit den Schultern, und wieder wurden ihre Augen nass. »Ja, vielleicht«, schniefte sie.
Erleichtert zog Luc sich zurück und ging in die Küche. Er holte eine große Dose Hühnersuppe mit Nudeln aus dem Schrank und schob sie unter den Büchsenöffner auf der Arbeitsplatte aus schwarzem Marmor. Ihm war bewusst, dass sie eine schwierige Phase durchlebte, aber, Herrgott, sie trieb ihn in den Wahnsinn. Wenn sie nicht heulte, dann schmollte sie. Wenn sie nicht schmollte, behandelte sie ihn wie einen Schwachsinnigen.
Luc füllte die Suppe in zwei Schalen und gab Wasser hinzu. Er hatte versucht, sie zu einer Therapie zu schicken, aber sie war während der Krankheit ihrer Mutter schon in einer Therapie gewesen und wehrte sich mit Händen und Füßen gegen eine weitere, war der Meinung, dass es genug sei.
Er schob sein und Maries Mittagessen in die Mikrowelle und stellte die Zeit ein. Abgesehen davon, dass es ihn in den Wahnsinn trieb, schränkte der Umstand, dass eine launische Sechzehnjährige bei ihm wohnte, auch sein gesellschaftliches Leben empfindlich ein. Er hatte nur noch Zeit für sich selbst, wenn er unterwegs war. Irgendetwas musste sich ändern. Die Situation, wie sie jetzt war, tat ihnen beiden nicht gut. Er hatte eine verantwortungsbewusste Frau eingestellt, die mit Marie in seiner Wohnung wohnte, wenn er nicht in der Stadt war. Sie hieß Gloria Jackson und war wahrscheinlich über sechzig Jahre alt. Marie mochte sie nicht, aber es gab offenbar kaum einen Menschen, den Marie mochte.
Das Beste, was er tun konnte, war wohl, ein gutes Internat für Marie zu finden. Dort wäre sie bestimmt glücklicher, unter lauter Mädchen in ihrem Alter, die sich mit Frisuren und Make-up auskannten und gern Rap-Musik hörten. Natürlich waren seine Gründe, Marie in ein Internat zu schicken, keineswegs selbstlos. Er wünschte sich sein altes Leben zurück. Vielleicht war er ein egoistischer Mistkerl, aber er hatte so hart für dieses Leben gearbeitet. Er hatte sich aus dem Chaos befreit, um ein gewisses Maß an Ruhe zu finden.
»Ich brauche Geld.«
Luc unterbrach die Beobachtung der Suppentassen, die sich in der Mikrowelle drehten, und wandte sich seiner Schwester an der Küchentür zu. Sie hatten bereits über ein eigenes Konto für Marie gesprochen. »Wenn wir das Haus deiner Mutter verkauft haben und deine Waisenrente kommt …«
»Ich brauche aber heute Geld«, fiel sie ihm ins Wort. »Jetzt gleich.«
Er griff nach dem Portemonnaie in seiner Gesäßtasche. »Wie viel brauchst du?«
Sie zog leicht die Stirn kraus. »Sieben oder acht Dollar, glaube ich.«
»Du weißt es nicht genau?«
»Gib mir sicherheitshalber zehn.«
Neugierig geworden und auch, weil er sich verpflichtet glaubte, fragen zu müssen, erkundigte er sich: »Wofür brauchst du das Geld?«
Ihre Wangen röteten sich. »Ich habe nicht die Grippe.«
»Was hast du dann?«
»Ich habe Krämpfe und nichts dagegen im Haus.« Sie senkte den Blick auf ihre bestrumpften Füße. »Ich kenne keine Mädchen, die ich fragen könnte, und als ich zur Schulsanitäterin kam, war es schon zu spät. Deswegen musste ich früher nach Hause gehen.«
»Wozu war es zu spät? Wovon redest du überhaupt?«
»Ich habe Krämpfe, und ich habe keine …« Sie wurde hochrot im Gesicht und platzte heraus: »Tampons. Ich habe im Bad nachgesehen, weil ich dachte, vielleicht hat eine von deinen Freundinnen welche hier gelassen. Aber da sind keine.«
In dem Moment, als Luc Maries Problem endlich begriff, klingelte die Mikrowelle. Er öffnete die Klappe und verbrannte sich die Daumen, als er die Suppentassen auf die Arbeitsplatte stellte. »Oh.« Einer Schublade entnahm er zwei Löffel, und weil er nicht wusste, was er sagen sollte, fragte er einfach: »Willst du Cracker dazu?«
»Ja.«
Irgendwie erschien sie ihm nicht alt genug dafür. Hatten Mädchen schon mit sechzehn ihre Periode? Anscheinend ja, aber Luc hatte sich noch nie Gedanken darüber gemacht. Er war als Einzelkind aufgewachsen und hatte nie etwas anderes als Hockey im Kopf gehabt.
»Möchtest du vielleicht ein Aspirin?« Eine seiner früheren Freundinnen hatte immer ein Schmerzmittel genommen, wenn sie Krämpfe hatte. Wenn er rückblickend darüber nachdachte, waren sein Geld und ihrer beider Abhängigkeit das Einzige, was sie gemeinsam gehabt hatten.
»Nein.«
»Nach dem Essen gehen wir einkaufen«, sagte er. »Ich brauche ein neues Deodorant.«
Schließlich hob sie den Blick, rührte sich jedoch nicht vom Fleck.
»Oder soll ich gleich gehen?«
»Ja.«
Er sah sie an, wie sie da stand, peinlich berührt und genauso verlegen wie er selbst. Das schlechte Gewissen, das ihn kurz vorher noch geplagt hatte, war wie weggeblasen. Es war bestimmt richtig, sie in ein Internat zu schicken, wo sie unter gleichaltrigen Mädchen lebte. In einem Mädcheninternat würde man über Krämpfe und andere Frauengeschichten Bescheid wissen.
»Ich hole meine Schlüssel«, sagte er. Jetzt musste er sich nur noch überlegen, wie er ihr seinen Entschluss beibrachte, ohne den Eindruck zu erwecken, dass er sie loswerden wollte.
2. KAPITEL
Austausch von Höflichkeitsfloskeln: Ein Kampf
»Sag das noch mal?« Caroline Masons Gabel verhielt auf halbem Weg zum Mund, ein Blättchen Salat und ein Stück Hühnchen blieben in der Schwebe.
»Ich berichte über die Spiele der Chinooks und begleite sie auf ihren Reisen«, wiederholte Jane ihrer Sandkastenfreundin zuliebe.
»Das Hockeyteam?« Caroline arbeitete bei Nordstrom und verkaufte ihre Lieblingssuchtmittel: Schuhe. Was ihr Äußeres betraf, bewegten sie und Jane sich an entgegengesetzten Enden der Skala. Sie war groß, blond und blauäugig, eine wandelnde Reklame für Schönheit und guten Geschmack. Und ihre Temperamente waren einander auch nicht ähnlicher. Jane war introvertiert, während Caroline jeden Gedanken und jedes Gefühl heraussprudeln musste. Jane bestellte aus Katalogen. Caroline hielt Kataloge für Werkzeuge des Satans.
»Ja, deshalb bin ich in der Gegend. Ich komme gerade von einem Treffen mit dem Besitzer und dem Team.« Die beiden Freundinnen waren wie Feuer und Eis, Nacht und Tag, waren jedoch durch Herkunft und Werdegang zusammengeschweißt.
Carolines Mutter war mit einem Brummifahrer durchgebrannt und hatte sich nur sporadisch blicken lassen. Jane war völlig ohne Mutter aufgewachsen. Sie hatten in Tacoma Tür an Tür gewohnt, im selben tristen Häuserblock. Arm. Die Habenichtse. Sie wussten beide, was es hieß, in Segeltuchturnschuhen zur Schule zu gehen, wenn fast alle anderen welche aus Leder trugen.
Als Erwachsene wurden sie auf unterschiedliche Weise mit der Vergangenheit fertig. Jane sparte ihr Geld, als wäre jede Gehaltsabrechnung die letzte, während Caroline enorme Summen für Designerschuhe ausgab, als wäre sie Imelda Marcos.
Caroline deponierte ihre Gabel auf dem Tellerrand und legte eine Hand auf die Brust. »Du darfst mit den Chinooks reisen und sie interviewen, wenn sie nackt sind?«
Jane nickte und hieb in ihr Spezialgericht, Makkaroni mit Käse und Räucherschinken, überbacken mit Croutons. Angesichts des Wetters, das draußen herrschte, war es eindeutig ein Makkaroni-Käse-Tag. »Ich kann nur hoffen, dass sie die Hosen erst runterlassen, wenn ich aus dem Umkleideraum raus bin.«
»Das soll ein Witz sein, oder? Welchen Grund hat man denn, einen stinkenden Umkleideraum zu betreten, wenn nicht den, nackte Männer zu sehen?«
»Zum Beispiel, um sie zu interviewen.« Nachdem sie alle an diesem Morgen kennen gelernt hatte, bekam sie es doch ein bisschen mit der Angst zu tun. Im Vergleich zu ihren knapp einssechzig waren sie riesig.
»Glaubst du, sie würden es merken, wenn du ein paar Schnappschüsse machst?«
»Könnte sein.« Jane lachte. »Sie wirkten gar nicht so dumm, wie man erwarten würde.«
»Schade. Ich hätte nicht übel Lust, ein paar nackte Hockeyspieler anzugucken.«
Nun, da Jane sie alle gesehen hatte, machte die Vorstellung, sie nackt zu sehen, ihr doch ein wenig Angst. Sie musste mit diesen Männern zusammen reisen. Mit ihnen im Flugzeug sitzen. Sie wollte nicht wissen, wie sie unbekleidet aussahen. Mit einem nackten Mann wollte sie nur dann zusammen sein, wenn sie selbst nackt war. Und wenn sie auch ausgefeilte Sexfantasien zur Sicherung ihres Lebensunterhalts schrieb, fühlte sie sich im wirklichen Leben beim Anblick unverhohlener Nacktheit doch ziemlich befangen. Sie war nicht wie die Frau, die in der Kolumne der Times über Dates und Beziehungen schrieb. Und wie Honey Pie war sie schon ganz und gar nicht.
Jane Alcott war eine Schwindlerin.
»Wenn du keine Fotos machen kannst«, sagte Caroline, griff wieder zur Gabel und pickte die Hühnchenstücke aus ihrem orientalischen Salat, »dann mach wenigstens Notizen für mich.«
»Das ist in vielerlei Hinsicht unethisch«, erklärte sie ihrer Freundin. Dann fiel ihr Luc Martineaus Angebot, in ihren Kaffee zu pissen, wieder ein, und sie entschied, dass sie in diesem Fall ein wenig von ihren Ethikbegriffen abweichen konnte. »Ich habe Luc Martineaus Hintern gesehen.«
»Au naturel?«
»Wie Gott ihn geschaffen hat.«
Caroline beugte sich vor. »Wie war er?«
»Gut.« Jane stellte sich Lucs muskulöse Schultern und seinen Rücken vor, die Rinne seiner Wirbelsäule und das Handtuch, das von seinen perfekt gerundeten Hinterbacken rutschte. »Wirklich schön.« Es ließ sich nicht leugnen, Luc war ein schöner Mann. Schade nur, dass sein Charakter schwer zu wünschen übrig ließ.
»Himmel«, seufzte Caroline, »warum habe ich keinen College-Abschluss gemacht und einen Job wie deinen gekriegt?«
»Zu viele Partys.«
»Oh, ja.« Caroline zögerte einen Moment, dann lächelte sie. »Du brauchst eine Assistentin. Nimm mich.«
»Die Zeitung bezahlt mir keine Assistentin.«
»Schade.« Ihr Lächeln erstarb, und ihr Blick senkte sich auf Janes Blazer. »Du solltest dir neue Klamotten besorgen.«
»Ich habe neue Klamotten«, sagte Jane, den Mund voll Schinken und Käse.
»Ich rede von neu, sprich: attraktiv. Du trägst zu viel Schwarz und Grau. Man wird sich fragen, ob du depressiv bist.«
»Ich bin nicht depressiv.«
»Vielleicht nicht, aber du solltest trotzdem Farben tragen. Besonders Rot- und Grüntöne. Du wirst die ganze Saison über mit großen, starken, testosterongesteuerten Männern auf Reisen sein. Das ist die perfekte Gelegenheit, das Interesse eines Kerls an dir zu wecken.«
Janes Reisen mit dem Team waren rein geschäftlicher Art. Sie hatte nicht die Absicht, das Interesse eines Mannes zu wecken. Schon gar nicht das eines Hockeyspielers. Schon gar nicht eines Hockeyspielers wie Luc Martineau. Als sie sein Angebot, ihren Kaffee betreffend, abgelehnt hatte, hätte er um ein Haar gelächelt. Um ein Haar. Stattdessen hatte er gesagt : Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie’s sich mal anders überlegen sollten. Und wie er es gesagt hatte. Er war ein Angeber, der noch nicht mal seinen kanadischen Akzent abgelegt hatte. Das Letzte, was sie wollte oder brauchte, war, das Interesse von Männern wie ihm zu wecken. Sie ließ den Blick über ihren schwarzen Blazer, ihre schwarze Hose und die graue Bluse gleiten. Ihrer Meinung nach war sie gut angezogen. »Das ist J. Crew.«
Caroline kniff die blauen Augen zusammen, und Jane wusste, was jetzt kommen würde. J. Crew war eben nicht Donna Karan. »Genau. Aus dem Katalog?«
»Natürlich.«
»Und schwarz.«
»Du weißt doch, dass ich nicht farbenblind bin.«
»Nein, farbenblind bist du nicht. Du siehst nur nicht, wenn Farben nicht harmonieren.«
»Stimmt.« Deswegen mochte sie Schwarz. Schwarz kleidete sie. Mit Schwarz konnte sie keinen Mode-Fauxpas begehen.
»Du hast so eine süße Figur, Jane. Die solltest du herzeigen. Komm mit mir zu Nordy, und wir suchen ein paar hübsche Sachen für dich aus.«
»Ausgeschlossen. Als ich mich das letzte Mal darauf eingelassen habe, sah ich hinterher aus wie Greg Brady. Nur nicht so groovy.«
»Das war in der sechsten Klasse, und da mussten wir zu Goodwill gehen. Jetzt sind wir älter und haben mehr Geld. Du zumindest.«
Ja, und so sollte es auch bleiben. Sie hatte Pläne für ihren Sparstrumpf. Sie würde sich ein Haus kaufen, keine Designerklamotten. »Mir gefällt mein Kleidungsstil«, sagte sie, als hätten sie dieses Gespräch nicht schon tausendmal geführt.
Caroline verdrehte die Augen und wechselte das Thema. »Ich habe einen Typen kennen gelernt.«
Natürlich. Seit sie beide im letzten Frühjahr dreißig geworden waren, tickte Carolines biologische Uhr, und sie konnte an nichts anderes mehr denken als daran, dass ihre Eierstöcke verschrumpelten. Es war Zeit zu heiraten, und da sie Jane von dem Spaß nicht ausschließen wollte, hatte sie beschlossen, es wäre an der Zeit, dass sie beide heirateten. Doch bei der Umsetzung des Plans gab es ein Problem. Jane war zu der Einsicht gelangt, dass sie nur Männer anzog, die ihr das Herz brachen und sie schlecht behandelten. Und da der gemeine Mistkerl so ziemlich der einzige Typ war, der sie schwach machte, überlegte sie, sich eine Katze anzuschaffen und zu Hause zu bleiben. Aber da saß sie in der Falle. Wenn sie zu Hause blieb, erhielt sie kein neues Material für ihre Singlefrau-Kolumne.
»Er hat einen Freund.«
»Der letzte ›Freund‹, den du mir angedreht hast, fuhr einen Serienmörder-Van mit einer Couch im Laderaum.«
»Ich weiß, und er war nicht sehr erfreut, als er in deiner Times-Kolumne über sich las.«
»Pech für ihn. Er war einer von den Typen, die wegen dieser Kolumne annehmen, ich wäre völlig verzweifelt und scharf auf jeden Typen.«
»Dieser ist anders.«
»Nein.«
»Vielleicht gefällt er dir ja.«
»Das ist ja das Problem. Wenn er mir gefällt, behandelt er mich wie ein Stück Dreck und lässt mich dann fallen.«
»Jane, du gibst doch einem Mann nicht einmal die Chance, dich fallen zu lassen. Du bist immer mit einem Fuß draußen und wartest auf einen Vorwand.«
Caroline hatte gut reden. Sie servierte Typen ab, weil sie ihr zu perfekt waren. »Du hast seit Vinny keinen Freund mehr gehabt«, bemerkte Caroline.
»Ja, und du weißt selbst, was daraus geworden ist.« Er hatte sich Geld von ihr geliehen, um anderen Frauen Geschenke zu machen. Vor allem billige Dessous. Jane hasste billige Dessous.
»Sieh es doch mal von der anderen Seite. Nachdem du ihn loshattest, warst du so betrübt, dass du dein Badezimmer renoviert hast.«
Es war eine der traurigen Tatsachen in Janes Leben, dass sie, wenn sie unter Depressionen und gebrochenem Herzen litt, wie eine Besessene putzte.
Nach dem Mittagessen setzte Jane Caroline bei Nordstrom ab und fuhr dann zur Seattle Times. Weil sie eine monatliche Kolumne schrieb, hatte sie kein eigenes Büro in der Redaktion. Im Grunde betrat sie das Gebäude nur äußerst selten.
Sie traf sich mit dem Sportredakteur Kirk Thornton, und er musste ihr nicht erst erklären, dass er keineswegs erfreut war, sie als Vertretung für Chris zu sehen. Er empfing sie mit einer solchen Kälte, dass er ein Glas an seiner Stirn hätte kühlen können. Er stellte sie den anderen drei Sportreportern vor, und deren Begrüßung fiel auch nicht wärmer aus als Kirks. Abgesehen von Jeff Noonan.
Obwohl Jane sich nur selten im Seattle-Times-Gebäude sehen ließ, hatte sie schon von Jeff Noonan gehört. Die gesamte weibliche Belegschaft konnte ein Lied von ihm singen; er war die wandelnde Klage wegen sexueller Belästigung, die nur noch auf ihren Gerichtstermin wartete. Er glaubte nicht nur, dass Frauen in die Küche gehörten, sondern vielmehr, dass sie auf dem Rücken liegend auf den Küchentisch gehörten. Der Blick, mit dem er sie maß, verriet, dass er sie sich nackt vorstellte, und er lächelte, als müsste sie sich deswegen geschmeichelt fühlen oder so.
Der Blick, mit dem sie ihm antwortete, verriet, dass sie lieber Rattengift nehmen würde.
Die BAC-111 hob um 6:23 Uhr vom Flughafen Seattle ab. Binnen Minuten durchbrach der Jet die Wolkendecke und neigte sich nach links. Die Morgensonne schoss durch die ovalen Fenster wie Spotlight. Beinahe gleichzeitig wurden sämtliche Fensterklappen zum Schutz vor dem erbarmungslos grellen Licht geschlossen, und eine ganze Reihe von Hockeyspielern klappte die Sitze zurück, um zu schlafen. Eine Mischung aus Aftershave und Parfüm füllte die Kabine, als der Jet den Aufstieg beendete und seine Flughöhe erreichte.
Ohne den Blick zu heben, streckte Jane die Hand nach oben und schaltete die Lüftung ein. Sie richtete das Gebläse auf ihr Gesicht und studierte den Zeitplan des Teams. Ihr fiel auf, dass einige Flüge direkt nach einem Spiel starteten, andere erst am darauf folgenden Morgen. Doch abgesehen von den Flugzeiten war die Tagesplanung immer die gleiche. Das Team trainierte am Tag vor dem Spiel und absolvierte eine »Light«-Version des Trainingsprogramms am Spieltag selbst. Abweichungen gab es nicht.
Sie legte den Zeitplan zur Seite und griff nach den Hockey News. Die Morgensonne fiel auf einen NHL-Team-Artikel. Der Untertitel lautete: »Chinooks’ Torhüter – der Schlüssel zum Erfolg«.
In den letzten Wochen hatte Jane sich den Kopf voll gestopft mit NHL-Statistiken. Sie hatte die Namen der Chinooks auswendig gelernt und ihre Spielpositionen. Sie hatte alle Zeitungsartikel über das Team gelesen, die sie nur finden konnte, doch sie hatte das Spiel selbst und auch die Spieler noch immer nicht richtig im Kopf. Sie würde ins kalte Wasser springen müssen und hoffen, dass sie nicht unterging. Dazu brauchte sie die Achtung und das Vertrauen dieser Männer. Sie sollten sie genauso behandeln wie jeden anderen – männlichen – Sportjournalisten.
In ihrer Aktentasche befanden sich zwei unverzichtbare Bücher: Hockey für Dumme und Die Schlimmen Finger des Hockeysports. Das erste vermittelte die rudimentären Begriffe und die Spielregeln, während das zweite über die dunklen Seiten des Spiels und der Spieler informierte.
Ohne den Kopf zu heben, spähte sie über den Gang hinweg und die Sitzreihe entlang. Ihr Blick folgte der Notbeleuchtung längs des blauen Teppichbodens und blieb an Luc Martineaus polierten Slippern und anthrazitfarbenen Hosenbeinen hängen. Seit ihrem Gespräch vor der Key Arena hatte sie über ihn bedeutend mehr Informationen eingeholt als über die restlichen Spieler.
Geboren und aufgewachsen war er in Edmonton, Alberta, in Kanada. Sein Vater war Frankokanadier und hatte sich von Lucs Mutter scheiden lassen, als der Junge fünf Jahre alt war. Mit neunzehn war Luc von den Oilers in die NHL geholt worden. Er war nach Detroit und schließlich nach Seattle ausgewechselt worden. Das interessanteste Lesefutter bot Die Schlimmen Finger des Hockeysports; das Buch widmete Luc fünf ganze Kapitel. Detailliert wurde über das schwarze Schaf unter den Torhütern berichtet und behauptet, er hätte die flinksten Hände, nicht nur auf dem Eis. Die Fotos zeigten eine Reihe von Schauspielerinnen und Models an seinem Arm, und wenn auch keine von ihnen öffentlich behauptete, mit ihm geschlafen zu haben, hatte es doch auch keine geleugnet.
Janes Blick wanderte zu seinen großen Händen und langen Fingern, die auf die Armlehne trommelten. Unter der Manschette seines blauweiß gestreiften Hemdes war ein Schimmer seiner goldenen Rolex zu sehen. Sie betrachtete seine Schultern, sein Profil mit den hohen Wangenknochen und der geraden Nase. Sein Haar war kurz geschnitten wie das eines kampfbereiten Gladiators. Vorausgesetzt, die saftigen Einzelheiten aus dem Schlimme-Finger-Buch entsprachen der Wahrheit, hatte Luc Martineau in jeder Stadt, die das Team besuchte, eine Frau. Jane wunderte sich, dass er nicht vor Erschöpfung auf dem Zahnfleisch kroch.
Wie alle Spieler sah auch Luc an diesem Morgen eher wie ein Geschäftsmann oder Investmentbanker aus, nicht wie ein Hockeyspieler. Schon am Flughafen war Jane überrascht gewesen, dass sämtliche Spieler in Anzug und Krawatte auftauchten, als wären sie auf dem Weg ins Büro.
Plötzlich war ihr die Sicht verstellt; Jane hob den Blick und sah in das verwitterte Gesicht des Außenstürmers Rob »der Hammer« Sutter. Vornübergebeugt aufgrund der niedrigen Decke wirkte er noch furchteinflößender als gewöhnlich. Sie kannte noch nicht alle Gesichter der Chinooks, aber Rob gehörte zu den Typen, die man sich leicht merken konnte. Er war etwa einsneunzig groß, ein einschüchterndes Muskelpaket von 115 Kilogramm. Zurzeit trug er einen ausgefransten Ziegenbart am Kinn und ein herrliches Veilchen unter einem grünen Auge. Er hatte sein Jackett ausgezogen, die Hemdsärmel hochgekrempelt und die Krawatte gelockert. Sein braunes Haar schrie nach einem Friseur, über seiner Nasenwurzel klebte ein weißes Pflaster. Er warf einen Blick auf die Aktentasche in dem Sitz neben Jane.
»Darf ich mich einen Moment zu dir setzen?«
Jane gab es nur äußerst ungern zu, aber große, kräftige Kerle machten sie schon immer ein bisschen nervös. Sie nahmen so viel Platz ein und gaben ihr das Gefühl, klein und verletzlich zu sein. »Äh, klar.« Sie griff nach den Lederriemen ihrer Tasche und stellte sie vor ihre Füße.
Rob rammte seinen mächtigen Körper in den Sitz neben ihr und deutete auf die Zeitung in ihrer Hand. »Hast du den Artikel gelesen, den ich geschrieben habe? Auf Seite sechs.«
»Noch nicht.« Jane fühlte sich ein wenig beengt, als sie Seite sechs aufschlug. Ein Foto von Rob Sutter sprang ihr ins Auge. Er hielt irgendeinen Typen im Schwitzkasten und boxte ihn ins Gesicht.
»Das bin ich, wie ich Rasmussen in seiner ersten Saison die Fresse poliere.«
Sie warf Rob einen Seitenblick zu und betrachtete sein Veilchen und seine gebrochene Nase. »Warum?«
»Hatte ’nen Hattrick gemacht.«
»Ist das denn nicht seine Aufgabe?«
»Klar, aber meine Aufgabe ist es, ihm das Leben schwer zu machen.« Rob zuckte mit den Schultern. »Damit er ein bisschen nervös wird, wenn er mich kommen sieht.«
Jane hielt es für klüger, ihre Meinung über seine Aufgabe für sich zu behalten. »Was ist mit deiner Nase?«
»Bin einem Hockeyschläger zu nahe gekommen.« Er wies auf die Zeitung. »Was sagst du dazu?«
Sie überflog den Artikel, der gar nicht schlecht geschrieben war.
»Meinst du, ich hab im ersten Graf das Leserinteresse geweckt ?«
»Graf?«
»Das ist Journalistensprache für Paragraf oder Absatz.«
Sie kannte die Journalistensprache. »›Ich bin nicht nur der Punching Ball‹«, las sie laut vor. »Das hat mein Interesse geweckt. «
Rob lächelte und zeigte dabei eine Reihe schöner weißer Zähne. Jane hätte gern gewusst, wie oft sie ihm schon ausgeschlagen und neu eingesetzt worden waren. »Hat mir großen Spaß gemacht, das zu schreiben«, sagte er. »Wenn ich mich zur Ruhe setze, schreibe ich vielleicht hauptberuflich Zeitungsartikel. Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben.«
Einen Fuß in die Tür zu kriegen war leichter gesagt als getan. Ihr eigener Einfluss war alles andere als groß, aber sie wollte Rob nicht den Spaß verderben, indem sie ihm die Wahrheit sagte. »Wenn ich kann, helfe ich dir gerne.«
»Danke.« Er zog eine Brieftasche aus der Gesäßtasche, öffnete sie und zog ein Foto heraus. »Das ist Amelia«, sagte er und gab ihr die Aufnahme, die ein an seiner Brust ruhendes Baby zeigte.
»Sie ist ja winzig! Wie alt ist sie?«
»Einen Monat. Ist sie nicht das süßeste Ding, das du je gesehen hast?«
Jane dachte nicht daran, dem Hammer zu widersprechen. »Sie ist hinreißend.«
»Lassen wir wieder mal Babyfotos herumgehen?«
Jane hob den Kopf und blickte in ein Paar brauner Augen, das sie über die Sitzlehne vor ihnen beobachtete. Der Mann reichte ihr ebenfalls ein Foto. »Das ist Taylor Lee«, sagte er. »Sie ist zwei Jahre alt.«
Jane betrachtete das Bild eines Kleinkinds, so kahlköpfig wie der Typ, der es ihr gegeben hatte, und sie fragte sich, wieso manche Leute glaubten, alle Welt wäre ganz versessen darauf, Bilder von ihren Kindern zu betrachten. Die Augen, die sie über den Sitz hinweg musterten, erkannte sie erst, als Rob ihr einen Hinweis zukommen ließ.
»Sie hat eine entsetzliche Glatze, Fishy. Wann kriegt sie denn endlich Haare?«
Bruce Fish, der zweite Verteidiger, erhob sich halb und nahm sein Foto wieder an sich. Auf seiner Glatze spiegelte sich das Licht, während ein zottiger Bart seine untere Gesichtshälfte bedeckte. »Ich war bis zu meinem fünften Lebensjahr glatzköpfig und bin dann doch noch ganz süß geworden. «
Jane schaffte es, keine Miene zu verziehen. Bruce Fish war vielleicht ein geschickter Puckschießer, aber kein schöner Mann.
»Hast du Kinder?«, fragte er sie.
»Nein, ich bin nicht verheiratet«, antwortete sie, und dann drehte sich die Unterhaltung darum, welcher von den Chinooks verheiratet war und wer wie viele Kinder hatte. Es war nicht unbedingt ein anregendes Gespräch, aber es nahm Jane die Angst, dass die Spieler sie schneiden könnten.
Sie gab Rob das Foto zurück und beschloss, Ernst zu machen. Sie mit den Ergebnissen ihrer Recherche zu blenden oder ihnen wenigstens zu zeigen, dass sie nicht völlig orientierungslos war. »Angesichts ihres Alters und ihres Mangels an konzessionierten Spielern spielen die Coyotes dieses Jahr besser als erwartet«, rezitierte sie, was sie gerade gelesen hatte. »Was sind eure größten Sorgen im Hinblick auf das Spiel am Mittwoch?«
Beide starrten sie an, als hätte sie in einer Fremdsprache mit ihnen geredet. Lateinisch vielleicht.
Bruce Fish drehte sich um und verschwand hinter seiner Sitzlehne. Rob verstaute das Babyfoto in seiner Brieftasche. »Hier kommt unser Frühstück«, sagte er und stand auf. Der Hammer verabschiedete sich eilig und ließ deutlich durchscheinen, dass er zwar gerne mit ihr über Journalismus und Babys redete, aber nicht über Hockey. Im weiteren Verlauf des vierstündigen Flugs wurde Jane immer deutlicher bewusst, dass die Spieler sie jetzt ignorierten. Abgesehen von ihrem kurzen Gespräch mit Bruce und Rob ergab sich keine weitere Unterhaltung mehr. Niemand sprach mit ihr. Nun, sie konnten sie nicht auf ewig ignorieren. Sie mussten ihr Zugang zum Umkleideraum gewähren und ihre Fragen beantworten. Dann mussten sie mit ihr reden oder sich wegen Diskriminierung vor Gericht verantworten.
Sie lehnte Muffins und Orangensaft ab und stellte die Armlehne zwischen den Sitzen hoch. Sie rückte auf den Sitzplatz neben dem Gang, breitete ihre Artikel und Bücher aus und entledigte sich ihres grauen Wollblazers. So machte sie sich an die Arbeit und versuchte zu verstehen, was Punkte waren und was Tore. Welche Strafe für welche Regelverletzung verhängt wurde und was es mit dem unverständlichen unerlaubten Weitschuss auf sich hatte. Sie kramte ein Blöckchen Haftnotizen aus ihrer Tasche, kritzelte ein paar Stichpunkte und klebte sie in ihre Bücher.