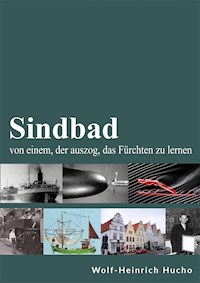
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Manager-Karrieren werden bevorzugt dann beschrieben, wenn etwas schiefgegangen ist: in Zeitungen und Magazinen, auch in Büchern, ja sogar in Sammelbänden. Dabei erfolgt in der Regel die Betrachtung von außen. Nicht die Beteiligten selbst erzählen, sondern Beobachter, Journalisten, oft nur punktuell recherchiert. Im Gegensatz dazu wird in dem hier vorgelegten Bericht ein Bild aus der Sicht von innen gezeichnet. Nicht vom Ende her. Vielmehr beschreibt der Autor seinen beruflichen Werdegang in dessen großen Vielfalt: Er nimmt den Leser mit; hinein in sein Umfeld: in seine Kindheit, die Schulen, das Praktikum, die Universität, auf die Dampfer, ins Institut und in die Firmen. Ohne Umschweife wird man mit den dort aktuellen Problemen und den handelnden Personen vertraut gemacht, so, als gehöre man selbst dazu. Die Konflikte zwischen fachlicher Arbeit und der "Politik" drum herum werden dargestellt: mit Lehrern, Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern, natürlich auch -innen, sowie, besonders spannend, mit der verehrten Kundschaft. Das Geschehen ist sehr persönlich; in seiner Mannigfaltigkeit ist es nicht planbar. Allgemeingültige Regeln sind daraus nicht abzuleiten. Aber doch so viel: die Herausforderungen konstruktiv angehen; Kreativität ist gefordert!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sindbad
von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen
Wolf-Heinrich Hucho
Selbstverlag des Autors
Impressum
Sindbad, von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen Wolf-Heinrich Hucho
Dr.-Ing. Wolf Heinrich Hucho Gärtnereiweg 3 86938 Schondorf am Ammersee [email protected]
Alle Rechte vorbehalten Selbstverlag des Autors, Schondorf am Ammersee 2017
ISBN: 978-3-745001-75-4
Konvertierung: Sabine Abels
© Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt
Prolog
Was werden? Und wie? Man kann sich gar nicht früh genug damit beschäftigen, welchen Beruf man ergreifen will, wie man ihn erlernen und was man damit anfangen kann. Anfangs eher spielerisch; später wird’s ernst. Die Antworten prägen den Lebenslauf; sie sind maßgeblich für den Erfolg, die Lebensfreude und den Lebensstil. Die Ausbildung, der Einstieg in den Beruf, die einzelnen Abschnitte bei seiner Ausübung und, last not least, der Abschied von der aktiven Tätigkeit bestimmen das Lebensglück. Natürlich nicht sie allein. Die Partnerin, die Familie, der Wohnort und dessen Umfeld sowie die Hobbies, sie alle tragen dazu bei. Die Akzente setzt jeder auf seine Art, sehr unterschiedlich. Bei dem, was folgt, geht es allein um den Beruf.
Zu Antworten auf die Fragen „Was“ und „Wie“ kommt man – zumindest hypothetisch - auf zwei ganz unterschiedlichen, ja konträren Wegen:
Zum einen trifft man die Auswahl aus der Fülle von Möglichkeiten rein emotional. Mehr oder weniger zufällig ist einem ein Beruf aufgefallen, der einen besonders beeindruckt . Den möchte man ergreifen, selbst wenn man kaum Einzelheiten über ihn weiß. Ein Sprung ins Ungewisse. Wie man diesen Beruf erlernt - Lehre oder Studium – ist durch die Wahl vorgegeben.
Dieser erste Weg kann auch anders herum beschritten werden: Erst einmal studieren; dann sieht man weiter. „Globales“ Ziel: Im Beruf möglichst weit nach oben kommen, Führungskraft werden, andere für sich arbeiten lassen, ihnen zeigen, wo es langgeht und gutes Geld verdienen. Wie man aus dem Erlernten einen Beruf macht, das wird sich schon finden. Die Wirtschaft bietet eine Vielfalt von Einstiegsmöglichkeiten; der Durchstieg zum Management, gar zum Geschäftsführer, sollte mit einer soliden akademischen Basis schon „drin“ sein. Während des Studiums orientiert man sich durch begleitende Praktika. Das um herauszufinden, in welchem Anwendungsbereich, in welcher Branche man nach erfolgreichem Abschluss des Studiums beginnen möchte.
Dieser erste Ansatz führt fast zwangsläufig auf ein Fach wie Betriebswirtschaftslehre, BWL, gleichermaßen bei Frauen wie Männern. Das legt einen nicht auf eine bestimmte Branche fest; überall ist man einsetzbar. Jedoch, schon der Besuch der ersten Vorlesung ist ernüchternd: Der Hörsaal quillt über; viele andere haben sich von den gleichen Vorstellungen leiten lassen. Das Resultat: heftige Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und später im Betrieb.
Auf dem zweiten Weg geht man die Frage nach dem Beruf analytisch an. Die wesentlichen Kriterien werden definiert und in einer Matrix angeordnet. Zuerst natürlich solche, die den Beruf selbst betreffen: Was will man am liebsten machen?
Recht sprechen, Menschen unterrichten, beraten oder kurieren? Häuser oder Brücken bauen, Straßen anlegen, Tunnel bohren, das Wetter vorhersagen, Maschinen oder Computer bauen? Hard- oder Software? Und weiter: Wie sieht das Machen im konkreten Fall aus? Rechnen, Programmieren, Konstruieren, Experimentieren?
Schließlich, wie lässt sich der Beruf ausüben: als Selbständiger, Angestellter oder gar als Beamter? Und in welchem Umfeld möchte man arbeiten, in einem kleinen oder einem großen Betrieb? In welcher Branche? Wie innovativ ist diese? Wie kompetitiv? Welche Zukunftschancen, bietet sie? Letztlich auch die Frage, wie lange man den Beruf ausüben kann? Das sollte nicht nur Dachdecker, Sportler, Artisten, oder andere „Exoten“ interessieren.
Natürlich sind auch die berufsfernen Kategorien zu beachten; sie seien hier nur schlagwortartig zusammengefasst: Anliegen der Familie? Der mögliche Wohnort, seine soziale Infrastruktur, Gesellschaft, Kultur, Schulen? Freizeitwert? Kann man dort seinen Hobbies nachgehen, Rad fahren, segeln, bergsteigen, fliegen? Lebensqualität und auch das Klima sind nicht zu vergessen? Alle diese Kategorien werden bewertet und damit gewichtet; die Matrix wird mit konkreten Fakten vervollständigt. Der Prozess führt zu einem Entschluss.
Graue Theorie! Denn um die Matrix auszufüllen, müsste man von der Berufswelt viel mehr wissen, als einem „normalen“ Heranwachsenden zugängig ist. Das zwei- bis dreiwöchige Praktikum während der Schulzeit – zu meiner Zeit gab es nicht einmal das - reicht dafür nicht annähernd aus. War es damals so, dass einem so gut wie alle Informationen zu den obigen Kriterien fehlten, so ist es heutzutage genau umgekehrt: Man wird von Informationen zum Thema Beruf und von Vorschlägen zu einem Weg dahin geradezu überflutet, in Zeitungen mit Serien wie „Beruf und Chance“, „Bildung und Karriere“, mit Magazinen und im Internet, auf Veranstaltungen, die sich „Jobbörse“ oder ähnlich nennen.
Die Wirklichkeit spielt sich irgendwo zwischen den beiden skizzierten Extremen ab, meist wohl näher an ersterem, dem Emotionalen, Empirischen, mehr oder weniger nahe der Zufälligkeit.
Einer der wenigen Ratschläge, die man in dieser Phase des Suchens aus der Generation der Älteren überhaupt zu hören bekommt, lautet: Bei der Berufswahl solle man allein seiner Neigung folgen und keinesfalls sogleich nach dem Geld fragen, das man damit verdient. Das sei nicht so wichtig. Ersteres setzt voraus, dass man sich über seine Neigungen im Klaren ist; aber oft ist nicht einmal das der Fall. Jedoch, letzteres, ist ein widersinniger, ja ein absurder Rat! Besteht doch der primäre Zweck des Berufes darin, seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Und das bei Lebensbedingungen, die man als angenehm und motivierend empfindet.
Bei den Glücklichen, die über eine spezielle Begabung verfügen, wie z.B. für Musik oder darstellende Kunst, ist die Berufswahl so gut wie vorbestimmt – zumeist von den Eltern. Vor allem dann, wenn diese das Talent früh erkannt und unerbittlich „gepflegt“ haben. Alle übrigen Suchenden, die Allrounder, müssen sich selbst genauer unter die Lupe nehmen, siehe oben.
Hat man sich durch das Dickicht aus Informationen und Ratschlägen durchgekämpft und sich für einen Beruf entschieden, dann gilt es herauszufinden, wie man die dazu nötigen Fähigkeiten erwirbt: Lehre oder Studium?
Die Lehre – heute spricht man lieber von der dualen Ausbildung – ist ganz eindeutig auf einen bestimmten Beruf zugeschnitten. Beispielhaft sind die klassischen Handwerke: Schlosser, Schmied, Mechaniker, Elektriker, Tischler, Maurer, Friseur, Bäcker,… Wie man das in drei Jahren Erlernte anwendet, hängt von dem Betrieb ab, in dem man seine Tätigkeit aufnimmt. Immer weniger junge Leute entscheiden sich für diese Diretissima; im Jahr 2015 blieben ca. 300.000 Lehrstellen unbesetzt. Die Erklärung dafür: Ein gewerblicher Beruf gilt als nicht sonderlich attraktiv; nicht selten ist das Einkommen zu gering, um davon eine Familie ernähren zu können. Und trotz überwundener Differenzierung von Arbeitern und Angestellten ist das gesellschaftliche Ansehen eher mäßig.
Fast 60% der Schüler erreichen derzeit (Mitte 2017) einen Abschluss mit Zugangsberechtigung zur Fachhochschule oder zur Universität. Etwa drei Viertel macht davon Gebrauch und studiert, Tendenz steigend. Der Arbeitsmarkt nimmt sie alle auf. Einmal wohl deshalb, weil eine wachsende Zahl von Berufsfeldern akademisiert wird: die Kindergärtnerin wird durch ein Studium zur Erzieherin; in Norwegen studiert man sogar Krankenschwester. Zum anderen aber auch, weil Stellen mit Studierten besetzt werden, bei denen eine akademische Vorbildung gar nicht erforderlich ist.
Das Studium selbst hat sich seit „Bologna“ vollkommen verändert, bei beiden, Fachhochschule (FH) und Universität (Uni). Wie, das lässt sich gut am Beispiel des Ingenieurstudiums demonstrieren: Früher bestand es aus zwei Abschnitten: Im ersten ging es um die Grundlagen: Mathematik, Mechanik und Festigkeit, Thermodynamik, Physik, Elektrotechnik, Werkstoffe, Maschinen- oder Bauelemente. Das Vorexamen war nach dem 5. oder 6. Semester abzulegen. Eine Befähigung zur Ausübung eines Berufs war damit nicht verbunden. Etwa 50% der Studenten scheiterten bis dahin. Zwischenprüfungen sorgten dafür, dass sie das nicht erst nach acht oder mehr Semestern erkannten.
Erst im zweiten Abschnitt erfolgte die Spezialisierung. Angeboten wurde eine begrenzte Anzahl von Fachrichtungen; nicht bei jeder Uni gab es alles. Wichtig für die Wahl der Fachrichtung war – außer der Neigung - auch, wer die Inhaber der Lehrstühle waren. Nur von den Koryphäen ihres Fachs konnte man erwarten, an den aktuellen Stand der Technik herangeführt zu werden. Die große Zahl der Studienarbeiten, Entwürfe und Labore hatte eine dämpfende Wirkung; man richtete sich auf eine längere Verweildauer ein. Ein ungeschriebenes Gesetz wirkte beruhigend: Wer das Vorexamen bestanden hat, für den führt „auf Dauer“ kein Weg am Diplom vorbei. Die Regelstudienzeit von acht Semestern war illusionär; erst nach 12 bis 13 Semestern – oder mehr - war man Dipl.-Ing.
Einige Unis, so die Alma Mater des Autors, bieten noch heute diesen Studiengang an; er führt zum Titel Diplomingenieur (Dipl.-Ing.). Ein Titel, der weltweit noch immer hohes Ansehen genießt.
Heute, „nach Bologna“, ist ein Studium völlig anders angelegt. Bereits nach sechs (oder sind es schon sieben?) Semestern macht man den Bachelor und erwirbt damit die Berufsbefähigung. Die Spezialisierung erfolgt schon im Bachelor-Studiengang: Über 6700 Studiengänge werden angeboten; sie werden von einer bürokratischen Instanz akkreditiert. Wie man da den „richtigen“ herausfindet, bleibt schleierhaft. Offenbar auch den Studenten: 30% brechen das Studium vor dem Bachelor ab; in den Technikfächern sollen es sogar 50% sein – wie gehabt!
Unsere Schulen sind ausschließlich auf den Abschluss fixiert. Ganz im Gegensatz zu Senecas „non scholae sed vitae discimus“ werden ihre Schüler überhaupt nicht auf den Anschluss an das Leben vorbereitet, nämlich auf die Wahl des Berufes und die dorthin führende Ausbildung. Jedoch, hier Hilfe von der Schule zu verlangen, hieße, sie völlig zu überfordern. Lehrer sind keine Berufsberater. Sie können und wollen das auch gar nicht sein, kennen sie doch nur einen Beruf: den ihren.
Die große Zahl derer, die - auch nach Bologna - ihr Studium abbrechen, legt eine klaffende Lücke in unserem Bildungssystem bloß. Man sollte nicht länger versuchen, sich an dieser Erkenntnis vorbei zu mogeln. Die Lücke zu schließen ist Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit. Berufsberatung, das ist doch eine ihrer Kernkompetenzen. Jedoch, eine Beratungsstunde vor der Klasse, so war das zu meiner Zeit, und heute die homepage mit „Jobbörse“, so billig geht das nicht! Die Agentur muss Programme für die Abschlussklassen der einzelnen Schultypen entwickeln, das Abschlussjahr begleitende Kurse, Betriebsbesichtigungen, gut ausgewählt und vorbereitet. Berufsverbände wie z.B. der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) sollten daran beteiligt sein. Einrichtungen wie das Schoollab des DLR sind dabei hilfreich.
Nach dem Bachelor kann man das Studium fortsetzen, um den Master zu erwerben. Bei den Ingenieuren machen etwa 30% davon Gebrauch. Eine (nicht zu lange) Pause, in der eine berufliche Tätigkeit ausgeübt wird, ist für eine Orientierung bei der Wahl der Fachrichtung nützlich. Auch dieser Studienabschnitt wird mit einer Abschlussarbeit beendet. Gut macht es sich, wenn diese als ein Projekt in Zusammenarbeit mit einer Firma durchgeführt wird, z.B. im Rahmen eines Auftrags, den das betreuende Institut aus der Industrie erhalten hat. So bekommt man einen Einblick in die Arbeitswelt, und möglicherweise ergibt sich dabei ein gleitender Übergang vom Studium in die erste Anstellung.
Eine „alte Weisheit“ lautet: Der Ingenieur beginnt seine berufliche Laufbahn in einem Großbetrieb. Dieser Rat ist meist mit der Aufforderung gekoppelt, nach ca. drei Jahren zu prüfen, ob man auf dem richtigen Pfad sei. Für andere Massenfächer, wie z.B. BWL, dürfte das Gleiche gelten. In einem Großbetrieb lebt man sich schnell ein. Dort sind alle daran gewöhnt, täglich auf Kollegen zu treffen und mit ihnen zu arbeiten, die sie vorher noch nie gesehen haben, die sie allenfalls vom Telefon her kennen. In diesem Umfeld fällt man als Neuer sehr bald nicht mehr auf und wird schnell integriert.
Ganz anders ist das in einem kleinen Unternehmen, besonders, wenn es sich als Familienbetrieb versteht. Da kann es einem passieren, dass man auch nach Jahren noch als ein Fremder angesehen wird, vor allem in kritischen Situationen. Man wird nicht so schnell Teil des unsichtbaren internen Beziehungsgeflechts.
Gleichviel, ob groß oder klein, wichtig ist, dass die Firma komplette Produkte herstellt, zu denen man einen persönlichen Bezug aufbauen kann und die direkt auf den Markt kommen. Systemlieferant, das geht auch noch; aber die Produktion von „dummen“ Kleinteilen, Haken und Ösen, schon weniger. Ausnahmen mögen die Regel bestätigen. Nach dem Start sollte man damit beginnen, ein berufliches Netzwerk zu knüpfen. Zuerst innerhalb des Betriebs – beispielhaft ist die „Volontärs Mafia“. Dann in der Branche; das Medium dazu bieten Fachtagungen. Und mit Bedacht in den sozialen Netzwerken sowie, äußerst behutsam, mit Personalberatern.
Schon während der Einarbeitung zeigt sich, was einem eher liegt: die Lösung konkreter Probleme im Detail; man wird zum Spezialist, zum Einzelkämpfer. Wer Freude an seinem Fach hat, es beherrscht und mit seiner Entwicklung Schritt hält, kann es weit damit bringen. Oder man strebt eine Führungsaufgabe an. Sei es, um das fachliche Wissen zu erweitern, eine breitere Basis zur Verwirklichung eigener Ideen zu haben und damit die nächste Sprosse auf der Karriereleiter zu erklimmen. Dabei sollte man sich immer voll und ganz der Sache widmen. Nicht ständig an die Karriere denken und nach einer Alternative Ausschau halten. Das hält man nicht lange durch. Ratsam ist, von Zeit zu Zeit innezuhalten, die Lage kritisch zu betrachten, zu beurteilen und dann ggf. zu handeln.
Management-Karrieren werden besonders gern beschrieben, wenn etwas schiefgegangen ist: in Zeitungen und Magazinen, auch in Büchern und sogar in Sammelbänden. Dabei erfolgt in der Regel die Betrachtung von außen, nicht von den Beteiligten selbst, sondern von Beobachtern, von Journalisten, nach mehr oder weniger intensiver Recherche. In der hier vorgelegten Erzählung wird dagegen ein Bild aus der Sicht von innen gezeichnet. Beschrieben wird der berufliche Werdegang des Autors. Mit der Kindheit beginnend, über Schule, Studium und bei der Ausübung des Berufs. Immer geht es um das persönlich Erlebte.
Erzählt wird aus dem Gedächtnis; ein Tagebuch liegt nicht vor. Soweit Zeiten genannt werden, sind sie aus verschiedenen Unterlagen rekonstruiert: Anhand von Zeugnissen, nach dem Studienbuch, aus dem Seefahrtbuch, nach persönlichen Veröffentlichungen in Zeitschriften und Büchern, und, soweit noch vorhanden, mit Hilfe der Terminkalender der letzten 30 Jahre. Beim Lesen der ersten Kapitel könnte man meinen, sie seien Teil einer Autobiografie. Genau das sind sie aber nicht. Sie beschreiben vielmehr die prägenden Erlebnisse und die daraus folgende Entwicklung von Eigenschaften und Eigenarten, die zu dem beruflichen Leben des Autors geführt haben.
Schondorf am Ammersee im Sommer 2017
Wolf-Heinrich Hucho
Sindbad -
von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen
Inhalt
1 Leipzig, Berlin, Kipsdorf
Der 20. Oktober 1935, der Tag, an dem ich in Leipzig das Licht der Welt erblickte, war ein Sonntag. Meine beiden Schwestern, Ellen und Christa, so wurde mir später berichtet, liefen auf die Straße und hüpften vor Freude umher. Ein Herr, der des Weges kam, fragte sie: „Warum seid ihr denn so fröhlich?“ „Wir haben ein Brüderchen bekommen“ jubelten die Schwestern. Darauf der Herr: „Na, ihr werdet euch noch umgucken“. Was sie dann auch so manches Mal getan haben! Denn nach alter bäuerlicher Tradition wurde ich als der Stammhalter statusgemäß vorgezogen. Von meinem Vater. Meine Mutter, aus einer preußischen Gelehrtenfamilie stammend, ließ diesen Atavismus nicht gelten, ohne große Worte darüber zu verlieren.
Man sagt – und Fotos aus dieser Zeit bestätigen das schonungslos – ich sei von hinreißender Schönheit gewesen. Ein großer, runder Kopf, der sich dem Bewuchs mit Haaren widersetzte. „Dickus“ wurde ich gerufen. Es könnte Christa gewesen sein, die sich diesen Namen ausgedacht hatte; als kleines Mädchen konnte sie recht spitz sein. Dieses Pseudonym hat mich lange Zeit begleitet. Zuerst habe ich mich darüber fürchterlich geärgert; dann aber gewöhnte ich mich daran, und noch heute unterschreibe ich Karten und Briefe mit „alias Dickus“, wenn ich an ein ehemaliges Kind aus der „Bergwiese“, dem Kinderheim meiner Tante Thea, schreibe.
Mit Ellen und Christa vor dem Völkerschlachtdenkmal
Weitere Vorzüge, die mich auszeichneten, waren eine laute Stimme und ein ungestümer Bewegungsdrang. So war ich jederzeit leicht zu orten, wenn ich mit dem Nachttopf durch die Wohnung rutschte – und dabei dessen Boden durchscheuerte.
Aus dem Foto, das mich zusammen mit meinen beiden Schwestern vor dem Völkerschlachtdenkmal zeigt, schließe ich, dass wir bis 1937 in Leipzig geblieben sind. Nachdem mein Vater in ein Ministerium in Berlinversetzt worden war, zogen wir dorthin. So ganz allmählich fand ich zu mir selbst. Erste Ereignisse, noch nicht zusammenhängend, an die ich mich erinnern kann, lassen sich auf die Zeit unmittelbar vor Ausbruch des Krieges datieren. Mit Beginn des Krieges, 1939, wuchsen sie zu einem stetigen Strom zusammen. Aber es ist im Rückblick nicht immer möglich, genau zu trennen, was daran echte Erinnerung ist und was von den Fotos oder Erzählungen als solche suggeriert wird.
In Berlin hatten die Eltern ein kleines Haus am Hasselfelder Weg in Lichterfelde-Ost gemietet, dort, wo die Stadt ins ländliche überging. Unserem Haus schräg gegenüber lag ein Kornfeld. Im Spätsommer, wenn Erntezeit war, warteten wir schon auf den Schnitter. Der kam und mähte mit seiner Sense einen Schwad frei. Anderntags rückte der Bauer mit dem Bindemäher an, gezogen von drei kräftigen Rössern. Mittags waren sie fertig; Helfer kamen, die gebundenen Garben zu Hocken aufzustellen. Nach ein paar Tagen wurden sie eingefahren, und wir konnten das leere Feld in Besitz nehmen, um unsere Drachen steigen zu lassen – bis es umgebrochen wurde; damit die Kapillarwirkung unterbrochen wird und der Boden nicht austrocknet, wie uns unser Vater erklärte, war er doch gelernter Landwirt.
Im Erdgeschoss hatte unser Haus drei Zimmer: Herren-, Damen- und Esszimmer. Die beiden ersteren waren mit einer Flügeltür verbunden, die zu hohen Feiertagen wie Weihnachten geöffnet wurde. Und natürlich gab es eine Küche und ein WC. Auch im Obergeschoss gab es drei Zimmer und dazu ein Bad mit einer Badewanne auf Dackelbeinen. Mein Bett stand im Elternschlafzimmer; später, als wir kein Mädchen mehr hatten, bekam ich deren Zimmer. Den dritten Raum bewohnten meine beiden Schwestern. Als 1939 mein Bruder Ferdinand hinzukam, nahm er meinen Platz im Elternzimmer ein. Beide Stockwerke waren mit einem geräumigen Treppenhaus verbunden, das oben zu einer umlaufenden Galerie führte. Sehr zweckmäßig. Die Zimmer waren ganz einfach möbliert. Vaters mit dunkeln Möbeln, die er wohl von seinen Eltern geerbt hatte. Einzig das Damenzimmer strahlte eine gewisse Eleganz aus: helle Möbel; Mutter schätzte Biedermeier.
Um das Haus herum war ein Garten, den mein Vater mit Hingabe pflegte. Mir stand eine Sandkiste zur Verfügung; eine große Trauerweide rundete das Bild ab. Auf der anderen Straßenseite hatten wir ein kleines Stück Land, den „Nutzgarten“, in dem Vater alle gängigen Gemüsesorten, Radieschen und Salat anbaute. Gern half ich ihm dabei. Vielmehr als Gießen konnte ich aber noch nicht.
ohne Worte
Die Zeit vor dem Kriegsausbruch habe ich als „die gute, alte“ in Erinnerung. Vater ging täglich ins Amt. Zum Mittagessen kam er nach Hause, und abends kam er auch nicht so spät. Mittwoch und Sonnabend hatte er nachmittags frei. Was er im Amt machte, davon hatte ich keine Vorstellung. Einmal haben wir ihn dort besucht, am Alex. Die Fahrt im Paternoster war unheimlich aufregend.
Häufig musste Vater verreisen, auch per Flugzeug, nach Italien, Spanien, in die Tschechoslowakei. Ich erinnere mich an einen Abend, als seine Maschine aus Madrid überfällig war; es war schon stockdunkel. Mutter war schrecklich aufgeregt und rief mehrmals einen Herrn Schott an, der wohl im Flughafen Tempelhof etwas zu sagen hatte. Schließlich landete das Flugzeug. Wie das in der stockdunklen Nacht möglich war, darüber zerbrach ich mir den Kopf.
Große Spannung herrschte, ob Vater uns von einer Reise etwas mitgebracht hatte. Unsere Frage war: „dürfen wir antreten?“. Wenn ja, dann stellten wir uns in Reih’ und Glied auf, und ich kleiner Knirps musste Meldung machen. Meine Schwestern nahmen diese Zurücksetzung wortlos hin. Das Mitgebringe war ihnen wichtiger als die Rangordnung – über die sie ohnehin ihre eigenen Vorstellungen hatten.
Manchmal hatten die Eltern Gesellschaft. Alle möglichen Leute kamen, vornehm angezogen, die Damen parfümiert und mit roten Lippen. Ich wurde aus dem Verkehr gezogen, ehe ich irgendeine Unart loswerden konnte. Das größte Ereignis, an das ich mich erinnern kann, war die Taufe meines Bruders Ferdinand, eine Haustaufe. Auch an der durfte ich nicht teilnehmen. Das nagte schwer an mir. Ein Trick, mit dem ich Aufsehen erregen konnte, bestand darin, dass ich mit der Stirn an der Tür meines Zimmers von oben nach unten rutschte. Dabei entstand ein kräftiges Wummern, das meine Eltern zunächst beunruhigte und dann meinen Vater, nachdem er die Ursache herausgefunden hatte, zu einer Tracht Prügel veranlasste, die ich mit lautem Gebrüll quittierte. Die Schwestern jubilierten. Dafür habe ich mich später an Ihnen gerächt.
Einmal, als Vater noch nicht so bald zuhause erwartet wurde, habe ich, nachdem sie mich nicht in ihr Zimmer hereinlassen wollten, einen großen, rostigen Nagel in ihr Türschloss gesteckt. Sie waren gefangen, und auch von ihrem größten Flehen, unterstrichen mit der Warnung, sie müssten aufs Klo, habe ich mich nicht erweichen lassen. Mutter brachte den Nagel nicht heraus, und so mussten die „Gänse“ so lange warten, bis Vater nach Hause kam. Der löste das Problem, und ob ich dann wieder eine Abreibung bekommen habe, daran kann ich mich nicht erinnern.
Vor allem mit Christa lag ich ständig im Streit, bei dem ich natürlich immer den Kürzeren zog. Weniger mit Ellen, die schon groß war und „über den Dingen“ stand. Einer von Christas Lieblingssprüchen war: „Dickus der doofe, macht sich in die Hose“. Und regelmäßig, wenn beim Abendessen die Käseglocke angehoben wurde, bemerkte sie: „Wolf-Heinrich, Du hast einen Pups gelassen“. Jedes mal fiel ich darauf herein, schrie ich wütend heulend, dass ich das nicht gewesen sei. Zank gab es auch, wenn es Pudding gab. Wir hatten eine Puddingform, die einen sitzenden Hasen darstellte. Groß war die Spannung, ob er das Stürzen heil überstand. Und dann ging es los: Jeder wollte die Ohren oder die Pfoten; die unteren Körperteile, vor allem der Schwanz, waren weniger beliebt. Aber meist waren wir doch ganz friedlich.
Das Ereignis eines jeden Jahres war die Zinnsoldatenschlacht. Am Abend zuvor entwarf Vater den Schlachtplan, irgend ein „Treffen“ der Blauen gegen die Roten wurde nachgestellt. Das Esszimmer wurde gesperrt, Mädchen hatten keinen Zutritt, der Tisch wurde ausgezogen, das Dorf aufgebaut und die Schlachtreihen aufgestellt. Infanterie, Kavallerie, Artillerie. Vater hatte über 1000 Zinnsoldaten, die regimentweise in Spanschachteln verpackt waren. Möglichst viele davon mussten in Stellung gebracht werden. Wenn das geschafft war, wurde der große Bleisoldat hervorgeholt. Der hielt ein Gewehr im Anschlag. Man konnte es Spannen und damit Streichhölzer verschießen. Jeder, mein Vater und ich, hatte eine bestimmte Anzahl von Schüssen; danach wurde Manöverkritik geübt, wurden die Truppen zu neuem Leben erweckt und neu formiert. War das nun Militarismus? Oder Interesse an Geschichte? Natürlich sind mir damals solche Fragen nicht in den Sinn gekommen. Aber, als nach der katastrophalen Niederlage Deutschlands immer wieder die Anklage erhoben wurde, wir „Bürgerlichen“ wären militaristisch erzogen worden, sind mir doch Bedenken gekommen. Und so sehr ich Zinnsoldaten noch heute liebe, ich habe keine jemals wieder angerührt, und meine Kinder wissen nichts von meiner heimlichen Leidenschaft. Friedliche Zinnfiguren, Bergleute, Schiffe, die habe ich aber schon.
Dickus‘ erste Weihnachtsarbeit
Die Eltern legten großen Wert darauf, dass wir Kinder selbst etwas anfertigten: ausmalen [1], zeichnen, basteln, als Weihnachtsgeschenk. Der Anfang war ganz elementar. „Susi“, unser Kindermädchen, hat mir die Hand geführt. Noch in der „guten, alten Zeit“ bauten wir alle zusammen unter Vaters Anleitung ein schönes Haus, richtig mit Ziegelsteinen. Und etwas später baute er mit mir allein(!) ein Flugzeugmodell; die Teile schnitten wir aus einem der damals populären Modellbaubögen aus. Eine Heinkel He 111.
Im Sommer fuhren wir nach Heringsdorf an die Ostsee. Mit der Eisenbahn, ein Auto hatten wir nicht. Am Ziel fuhren wir mit der Kutsche zu unserem Quartier. Wir wohnten auf einem Bauernhof; dort gab es „echtes Brunnenwasser“. Gleich am ersten Tag ging Vater mit mir in den Ort, um ein Schiff zu kaufen. Ich erinnere mich an einen besonders schmucken Dampfer aus Blech, den man aufziehen musste. Er hatte einen Propeller und ein Ruder. Wir ließen ihn aber nur im Waschbecken schwimmen; den Wellen im Meer wäre er wohl nicht gewachsen gewesen.
Das Leben am Strand habe ich sehr genossen. Natürlich schaufelten wir die obligate Burg. Bald legte ich mich mit den Jungs in den benachbarten Strandburgen an. Wir bekriegten uns, zerstörten uns gegenseitig unsere Sandbauten. Irgendwann haben wir uns dann versöhnt, meist erst einen Tag vor der Abreise. Dann waren wir traurig, dass wir uns nicht schon eher vertragen hatten. Das letzte Mal waren wir im Sommer 1940 dort; da herrschte schon Krieg. Einmal fuhr ein Riesen-Kriegsschiff vorbei. Aber man versuchte, das Familienleben irgendwie weiterzuführen, wie bisher, man klammerte sich an die Normalität. Zuhause in Berlin ging alles seinen gewohnten Gang. Die Schwestern hatten Klavierunterricht. Die Kerzenhalter am Klavier, sie waren aus Messing, wurden abgeschraubt und als kriegswichtiges Material abgeliefert. Die Brötchen, pardon: die Schrippen, waren plötzlich aus Roggenmehl. Die schmeckten nicht; stattdessen gab es Graubrot.
Vater war Reserveoffizier bei der Luftwaffe. Er wurde eingezogen und mit einem Zug Flak auf einem Güterbahnhof stationiert. Einmal kam er abends mit einem offenen Wagen bei uns vorbei, mit Fahrer. Ich durfte einsteigen und war sehr aufgeregt. Einquartiert war er bei einem Pfarrer. Dessen Frau hatte ihm einmal Salz statt Zucker für den Kaffee auf den Tisch gestellt, „aus Versehen“, soll sie gesagt haben. Darüber haben wir viel gelacht. Soldat, das schien eine lustige Angelegenheit zu sein. Dann wurde Vater plötzlich entlassen. Die Eltern waren sehr nervös, redeten laut. Auf einer seiner früheren Reisen hatte er den Termin für die Verlängerung seiner UK-Stellung verstreichen lassen, um sich dem Druck der Partei zu entziehen. Jetzt forderte ihn sein Amt zurück.
Familie Hucho angetreten, 1939
Ich hatte eine Reihe von Freunden. Buddelkistenfreund war Fritz Herbst, „Fritzchen“; er wohnte ein paar Häuser weiter. Wir spielten viel zusammen: Bauklötze, Soldaten. Nach dem Spielen mussten wir immer aufräumen; Mütter waren damals noch sehr streng mit ihren Söhnen. Spielten wir bei mir, rannte Fritzchen davon, sowie meine Mutter uns aufforderte, Ordnung zu machen. Mir gelang es nie, ihm und seiner Mutter zu entkommen. Zusammen mit ein paar Jungs aus der Nachbarschaft bildeten wir eine Bande. Meist bekamen wir von den anderen Banden Prügel. Vor allem deshalb, weil Fritzchen stiften ging, wenn er sah, dass wir wohl etwas abkriegen würden.
Unser Angstgegner war Adolf Hufnagel. Der war riesengroß, hatte ein Luftgewehr, mit dem er uns Bange machen wollte. Einmal schoss er, nur mit Luft, in einen Eimer, in dem ich Beppermampe angerührt hatte. Der Dreck spritzte auf meine Kleidung. Meine Mutter war wütend; damals gab es ja noch keine Waschmaschine. Ein Junge aus einem anderen Viertel musste als Prügelknabe herhalten. Wenn er sich blicken ließ – sein Aufzug war „proletarisch“; das Wort kannten wir natürlich nicht – fielen wir über ihn her, meist allerdings nur mit Schmähungen: „Dreht euch nicht um, der Pupsack geht um“. Einmal führten wir uns so schlimm auf, dass unsere Mütter zusammenliefen und uns auf offener Straße laut ausschimpften.
Früher war es üblich, Kinder mit allen möglichen Geschichten zu foppen, zu „verkohlen“, wie das in Sachsen hieß. Einer der Bären, den mein Vater mir aufgebunden hatte, war der, dass er, immer wenn es donnerte und blitzte sagte, da sei jemand unartig gewesen. Merkwürdigerweise behielt er damit immer recht, denn mir fiel sogleich ein, wann und wo Fritzchen wieder „unnütz“ (das war das Wort, das seine Mutter dafür gebrauchte) gewesen war. An meine eigenen Schandtaten dachte ich dabei nie. Noch heute sagen wir, wenn ein Gewitter heraufzieht: „Fritzchen war unnütz“. Wenn er das wüsste!
Fritzchen war etwas älter als ich und kam ein Jahr vor mir in die Schule. Unsere Beziehung lockerte sich. Mein „großer“ Freund war Lothar Frenzel; der ging schon aufs Gymnasium. Er hatte zwei größere Brüder und war froh, in mir so etwas wie einen kleinen Bruder zu haben. Er hatte viel mehr Soldaten als ich, und er besaß ein Filmvorführgerät und einen Film: „Krieg gegen Frankreich“. Den sahen wir uns immer wieder an. Siegen war eine tolle Sache! Lothar nahm mich mitunter auf einer seiner Spritztouren durch die Stadt mit. Er hatte eine Monatskarte, und ich war klein genug, um umsonst durchzukommen. Meine Eltern schätzten diese Ausflüge überhaupt nicht und verboten sie.
„Als ich ein kleiner Junge war [2]“, wurde ich öfter gefragt, was ich denn einmal werden wolle. Das war damals in der bürgerlichen Gesellschaft eine Standardfrage, die man kleinen Jungs stellte. Indianer war meine erste Antwort. Mutter las mir aus Fritz Steubens „Tecumseh“ vor: Die Rothäute führten ein abenteuerliches Leben; deren Häuptling zu sein, das faszinierte mich [3]. Jedoch, als ich mitbekam, dass man dabei seinen Skalp verlieren könne, wurde es mir mulmig, und ich verabschiedete mich von diesem Berufswunsch. Lokomotivführer war das nächste Ziel. Die unweit unseres Hauses vorbeischnaufenden Dampfrösser machten mir großen Eindruck. Und im Bahnhof lehnte sich der Lokführer so lässig aus dem Fenster und verströmte Autorität. So einen Koloss zu bewegen, das musste ein wahres Vergnügen sein, weit mehr, als das Spielen mit meiner Eisenbahn, die ich von Vater geerbt hatte. Von der harten Ausbildung bis zum Lokführer – Maschinenschlosser lernen und einige Jahre als Heizer Kohlen schaufeln – davon hatte ich natürlich nicht die geringste Ahnung. Später, nach der Einschulung, geriet das Thema Beruf gänzlich aus dem Blick.
Kinderheim „Bergwiese“, 1932(?) erbaut von meiner Tante Thea Hucho
Im August 1939 kam mein Bruder Ferdinand auf die Welt. Vater und ich besuchten Mutter und ihn in der Klinik. Vater in voller Leutnantmontour, die Mütze leicht schräg aufgesetzt, wie das bei der Luftwaffe üblich war. Ich mit einem großen Panzer unter dem Arm, damit ich etwas zum Spielen mit dem Bruder dabei hatte. Meine Enttäuschung war riesengroß und klang auch dann nicht ab, als Mutter mit dem Bruder auf dem Arm eine Woche später nach Hause kam. Mutter bekam das Mutterkreuz, das sie mit Stolz trug. Vater schenkte ihr eine Ausführung in echtem Gold.
Im Herbst 1942 kam ich in die Schule – in die Volksschule an der Kastanienallee. Unser Lehrer hieß Herr Tamm. Ein schon etwas älterer, sehr netter und geduldiger Mann. In meinem Zimmer wurde ein richtiges Schulpult aufgestellt, ein gebrauchtes natürlich. Unter strenger Aufsicht meiner Mutter machte ich daran meine Schularbeiten. Zuerst tatsächlich noch auf der Schiefertafel. Mein erstes Zeugnis enthielt die Bemerkung „W.-H. neigt zu Unaufmerksamkeit“. Was hatte das zu bedeuten? Vater erklärte es mir, nicht ohne mich zu ermahnen, ich möge mich bessern.
Die Fliegerangriffe nahmen zu, mitunter heulten die Sirenen am helllichten Tag. Dann rannten wir alle nach Hause; manche Kinder haben dabei laut geheult. Auf dem Kornfeld auf der anderen Straßenseite war ein Bunker gebaut worden. Wir hatten darin eine Kammer mit zwei dreifachen Stockbetten. Anfangs gingen wir dort nur dann hin, wenn Alarm war; oft erst, wenn die Flak schon feuerte. Spannend wurde es, wenn die Scheinwerfer einen feindlichen Bomber erfasst hatten; dann ballerten die Kanonen in diese Richtung und „holten ihn herunter“. Sehr bald gingen wir jeden Abend in den Bunker. Wenn er zuhause war, musste Vater raus, als Luftschutzwart. Nach der Entwarnung kam er zu uns in den Bunker, erschöpft und völlig fertig. Einmal explodierte ganz in unserer Nähe eine Bombe. Der Bunker hat trotz seiner dicken Wände stark gewackelt. Die Leute schrien. Ich fing an, mir meine Gedanken zu machen: Gewinnt man so einen Krieg?
Mit Sprüchen wie „der Führer wird‘s schon schaffen“ versuchten wir uns zu beruhigen. Jeden Morgen nach einem Angriff streiften wir durchs Viertel, um Granatsplitter zu sammeln, scharfkantige, bizarre Metallstücke. Im März 1943 wurde unser Haus bei einem Angriff stark mitgenommen; das Dach war abgedeckt und der Giebel hatte große Löcher; wir zogen in eine leerstehende Wohnung. Vater brachte es fertig, das Haus wieder in Stand setzen zu lassen. Aber kurz nach Abschluss der Reparatur schlug eine Bombe unmittelbar hinter dem Haus ein, und es war nicht wieder herzurichten.
Unsere Familie zog nach Kipsdorf, einem kleinen Dörfchen im Erzgebirge, etwa 30 km südlich von Dresden, an der (heutigen) B 171 gelegen, Endstation einer Schmalspurbahn, „Bimmelbahn“ genannt. Dort betrieb meine Tante Thea, Schwester meines Vaters, das Kinderheim „Bergwiese“. Das hatte sie Mitte der 30er Jahre nach eigenen Ideen selbst gebaut. Es lag am Rand des Ortsteils Oberkipsdorf, umgeben von großen Wiesen, nicht weit von zwei ausgedehnten Wäldern, dem vorderen und dem hinteren „Brandgebiet“. In dieses Kinderheim, in dem ich vorher schon einmal ein paar Wochen verbracht hatte, wurde ich ausgelagert. Die Familie zog in die Wohnung meiner Großmutter in Unterkipsdorf; und die „Strickomi“, wie sie allenthalben genannt wurde, übersiedelte zu meiner Tante ins Kinderheim.
Mit der Strickomi
Meine Kipsdorfer Omi, geborene Freiin v. Gregory, war eine ganz ungewöhnliche Frau; ich habe sie sehr geliebt. Sie war sehr fromm und verachtete die Nazis. Nie gebrauchte sie den „deutschen Gruß“. Regelmäßig, wenn sie sich von irgendjemandem verabschiedete, sagte sie zu aller Schrecken „à dieu“. Als sie hörte, dass im Dorf französische Kriegsgefangene zur Arbeit eingeteilt waren – sie setzten die Straße am Dorfberg instand – ging Omi zu ihnen, begrüßte sie mit „bonjour monsieurs“, plauderte mit ihnen und steckte jedem eine Packung Zigaretten zu. Wo sie die herhatte? War sie doch Nichtraucherin. Die Leute waren entsetzt, aber niemand im Dorf wagte es, meiner Omi Vorhaltungen zu machen. Sie liebte die französische Sprache, und ein paar Brocken habe ich von ihr gelernt: „Le beuf, der Ochs, la vace, die Kuh, fermet la port, die Tür mach zu“. Leider war ich aber nicht immer lieb zu ihr; das bedrückt mich noch heute. Aus purem Übermut, oder war es Verdruss? Frust, weil ich als echter berliner Steppke in einem so öden Kaff wie Kipsdorf leben musste.
Ich musste in die Kipsdorfer Volkschule gehen, erste Klasse. Zwei kleine Episoden aus den ersten Tagen dort kommen mir in Erinnerung: Auf unserer Reise von Berlin nach Kipsdorf fuhren wir ab Dresden mit dem Bus. Mir wurde schrecklich schlecht. Bei jeder Haltestelle ließ mich der Schaffner aussteigen; ich sollte versuchen zu brechen; das gelang mir aber nicht. Erst als der Bus wieder einmal anfuhr, musste ich Spucken; ein Schwall ergoss sich über den armen Kerl; er schimpfte schrecklich. Anderntags, als der Schulleiter mich meiner Klasse vorstellte, hatte der nichts Besseres zu tun, als dieses mein Missgeschick lauthals zu verkünden; er hatte in demselben Bus gesessen. Großes Gelächter – auf meine Kosten. Die andere Episode: Unser Klassenlehrer, ich glaube er hieß Klaus, ein junger, sehr netter Mann, pflegte meist an seinem Tisch vor der Klasse zu sitzen, also mit dem Rücken zur Tafel. Gern ließ er uns an der Tafel schreiben. Damit er sich nicht jedes Mal umdrehen musste, zog er dann einen kleinen Spiegel aus der Tasche. Fehler entgingen ihm nicht; er war perfekt in Spiegelschrift. Er wurde bald eingezogen. Kurz darauf kam die Nachricht, er sei gefallen.
Dependence des Hotels „Halali“, 2015
Die Volksschule von Kipsdorf war klein, hatte nur drei Klassenräume. Zwei Jahrgänge wurden immer gleichzeitig in einem Raum unterrichtet. Während wir von der ersten noch schreiben und lesen übten, versuchten sich die in der dritten mit den Feinheiten der Rechtschreibung. Das Wort Geburtstag kam in jedem Diktat dran und wurde immer wieder falsch geschrieben. Der Lehrer war verzweifelt. In der zweiten Klasse waren wir so zahlreich, dass wir einen ganzen Raum allein füllten. Der Unterricht bekam dadurch eine etwas persönlichere Note. Ein Fräulein Kuska war unsere Lehrerin. Sie sprach mit leicht östlichem Akzent, war sehr engagiert. Ihr muss aufgefallen sein, dass ich den anderen etwas voraus war, nur die schöne Rosemarie war wohl noch vor mir. Fräulein Kuska kam wohl auf die Idee, ich solle doch springen.
Und der Sprung müsse jetzt erfolgen, von der zweiten in die dritte Klasse; später wäre er zeitlich zu nahe an der Prüfung zum Gymnasium gewesen, hätte diese gefährdet. Ich bekam Nachhilfeunterreicht, bei Fräulein Böhme, einer pensionierten Lehrerin. Sie war humorlos und streng. Ein Diktat folgte dem anderen, die „Fähler“ nahmen nicht ab. Eines Tages war es so weit; ich musste in der Schule eine Prüfung ablegen, in Schreiben und Rechnen. Der Lehrer am Pult mir gegenüber; in dem großen Klassenzimmer kam ich mir verloren vor. Im Rechnen hatte es wohl gereicht, im Schreiben weniger. Aber ich wurde versetzt, wohl mit Rücksicht auf das große Ansehen, das meine Omi und Tante Thea im Ort genossen.
In der dritten Klasse waren sie schon beim großen Einmaleins, das die Lehrerin, Fräulein Werner, mit schriller Stimme einforderte. Ich habe es nie gelernt, bin aber trotzdem durchgeschlüpft und kam ganz gut mit. Ein Problem hatte ich mit der Heimatkunde. Wir nahmen den Deich durch, Hochwasserschutz. Der Lehrer zeichnete eine Linie an die Tafel, die ich heute wohl als das Profil eines Deiches, seinen Querschnitt interpretieren würde. Deich, das war für mich aber ein Teich; den hätte man doch mit einer geschlossenen Linie umranden müssen. Wie ein Deich in Wirklichkeit aussieht, das sollte ich erst ein paar Jahre später erleben, in der Marsch von Eiderstedt.
Bald kamen auch Fritzchen und zwei weitere Jungs aus Berlin ins Kinderheim, Dieter Hänsel, ein schüchterner kleiner Knabe und Jürgen Röhnspieß, kurz „Spieß“ genannt, der besonders schneidig Ski fuhr. Wir bildeten, nein, keine Bande, sondern eine Kompanie, und ohne viel zu fragen, schwang ich mich zu deren Hauptmann auf.
Tante Thea nahm zu dieser Zeit vorwiegend kleine Kinder auf, die noch nicht zur Schule gingen. Wir waren die „Großen“, wurden in eines der beliebten Viererzimmer einquartiert, und beim Essen hatten wir einen Tisch für uns, brauchten uns nicht um das „kleine Gemüse“ zu kümmern. Trotz alledem haben wir uns oft schrecklich gelangweilt. Als waschechte Berliner waren wir es gewöhnt, dass sich ständig etwas rührt. In Kipsdorf ging es aber eher gemächlich zu. Mein Interesse galt den Schiffen; Vater hatte mir aus Ungarn ein schönes Segelboot mitgebracht. Aber, wo sollte ich das schwimmen lassen. Einzige Gelegenheit: der Teich des Sägewerks im vorderen Pöbeltal. Aber der lag fast eine Stunde Fußmarsch entfernt, und ohne Aufsicht durften wir dort nicht hin. So saßen wir buchstäblich auf dem Trockenen.
Das kleine Sägewerk hatte es mir angetan. Es lag unmittelbar an der Brücke, die über den Pöbelbach führte. Ein großes Wasserrad hielt die Gattersäge in Gang, die mit zischendem Geräusch in einem Arbeitsgang einen ganzen Baumstamm in Bretter zerlegte. Die Bretter wurden dringend gebraucht: zum Bau der Kisten, in denen die Russen demontierte Maschinen abtransportierten. Ganze Wälder wurden dazu abgeholzt. Inzwischen sind sie wieder nachgewachsen.
Winter 1944
Wir gingen brav zur Schule und erledigten unsere Hausaufgaben. Ansonsten genossen wir alle nur erdenklichen Freiheiten. Besonders gern stromerten wir in den Wäldern herum. Da kannten wir uns weit besser aus, als die Erzieherinnen, damals sagte man noch Kindergärtnerin; oft hängten wir sie ab. An eine von ihnen kann ich mich noch gut erinnern: an Inge Ebert, „Fräulein Inge“ gerufen. Sie war ungeheuer kreativ, bastelte mit uns in Pappe und Sperrholz, die Beschaffung geeigneten Materials war schon nicht mehr einfach. Uhu wurde knapp, Ölfarben gab es überhaupt nicht mehr. Wir behalfen uns mit Wasserfarben und Firnis. Fräulein Inge hatte viele Geschichten drauf, die sie uns erzählte, wenn wir auf längeren Märschen unterwegs waren, meist um etwas abzuholen. Sie war künstlerisch begabt. Für mich zeichnete sie ein ganzes Quartett mit Ritterwappen. Leider ist es verloren gegangen. Einmal haben wir sie an einen Baum gefesselt, Marterpfahl, ihr Dress war mit Harz verklebt. Wir haben Fräulein Inge sehr geliebt, und ich glaube, wir haben ihr keine größeren Schwierigkeiten bereitet.
Erst Mitte der 60er Jahre sah ich sie wieder, in Freiburg im Breisgau. Da habe ich gestaunt, wie klein und zierlich sie war. In Kipsdorf war mir das gar nicht aufgefallen; damals war ich halt noch kleiner. Deshalb aber wohl nicht weniger autoritär. Auch dazu eine kleine Episode. Kurzzeitig war ein Junge im Heim, schon älter als ich, der unglaublich gut zeichnen konnte. Ich war ständig an ihm dran und bat ihn, mir doch bitte dieses oder jenes zu malen. Als er nicht mehr so recht wollte, versuchte ich, ihn unter Druck zu setzen. Einmal, als wir uns stritten, kam Tante Thea dazu; genervt sagte er zu ihr: „Fräulein Hucho, ihr Neffe ist ein fürchterlicher Tyrann“. Wieder so ein Fremdwort; Tante Thea erklärte mir seine Bedeutung, nicht, ohne dem Typen recht zu geben. Ich war sauer, aber ich gestand mir ein: er hatte recht.
Tante Thea hat dann aber doch etwas aus der kleinen Episode gemacht: Ich bekam Zeichenunterricht bei Frau Wallrodt, die in der Nähe des Dorfteichs wohnte. Von ihr habe die Perspektive gelernt. Nach hinten hin wird alles kleiner. Je nach Höhe des Augpunktes ergab sich ein anderes Bild. Genau hinschauen. Aber, um die Wirklichkeit aufs Papier zu bringen, bedurfte es mehr als das. Die Kunst bestand darin, Unwesentliches wegzulassen, sonst verlor man sich im Ungewissen. Herr Wallrodt, von dem nichts zu sehen war, er war wohl im Krieg, hatte ein großes Schiffsmodell gebaut, einen frühen englischen Flugzeugträger im Dock. Winzig kleine Flugzeuge, Doppeldecker, alles ganz akkurat hergestellt. Dieses Schiff machte mir großen Eindruck Mein selbstgebauten Modelle nahmen sich dagegen ganz primitiv aus, waren kein Abbild der Wirklichkeit. Wo mag das schöne Schiff geblieben sein? Ich habe es abgezeichnet; eine Heidenarbeit, die ich wohl nie vollendet habe.
In Oberkipsdorf residierte die Familie Körner. Den Vater sah man nie; er sei Arzt in Dresden, hieß es. Und die Mutter habe ich auch nie zu Gesicht bekommen. Aber den Sohn Jens schon; der war ein großer Angeber. „Groß“, das war wörtlich zu nehmen. Er muss schon ein paar Jahre älter gewesen sein als ich, vielleicht 13 oder 14. Meist lief er in einer richtigen Uniform herum. Einmal trieb er es soweit, diese mit der Schleife des EK II zu schmücken. Da hat ihm Tante Thea den Kopf gewaschen, er solle das Band schleunigst entfernen, was er denn auch tat. Er war immer von einem Schwarm von kleineren Jungs umgeben. Eines Tages erklärte er mir und meiner Kompanie den Krieg. Das Treffen sollte im vorderen Brandgebiet stattfinden. Wir verschanzten uns dort und hielten nach seiner „Armee“ Ausschau. Plötzlich tauchte diese in unserm Rücken auf. Sie hatten einen Weg über das Körnersche Grundstück genommen – was gegen die Spielregeln war, denn das war nicht öffentlich zugängig. Sie überrumpelten uns und haben uns fürchterlich verdroschen, vor allem mich. Tante Thea erklärte daraufhin, ich hätte völlig versagt und sei als Hauptmann abgesetzt. Das aber habe ich einfach ignoriert, habe das Kommando nicht aus der Hand gegeben.
Im Winter versuchte ich, mich mit Jens gut zu stellen; er hatte nämlich einen richtigen Bob mit einem Lenkrad und elastischen Kufen, ein wunderschönes Stück aus Lindenholz, das vier Mann Platz bot. Auf dem war das Fahren viel aufregender, als auf einem Rodelschlitten. Natürlich ließ Jens niemanden ans Steuer, aber mehrmals durfte ich den Bremser machen. Das machte Riesenspaß; alle wurden von dem aufgewirbelten Schnee ganz weiß, wie mit Staubzucker gepudert. Das schon erwähnte Körnersche Grundstück war riesengroß, und mittendrin, auf einer Wiese, stand ein zünftiges Blockhaus, das unsere Fantasie enorm anregte. Irgendwie gelang es uns, in das Haus einzudringen. Große Enttäuschung, es war vollkommen leer und roch muffig.
Kipsdorf, eigentlich „Kurort Kipsdorf“, wurde im Lauf des Krieges in ein großes Lazarett verwandelt. Hotels und Pensionen wurden umfunktioniert; es wimmelte von Soldaten. Wenn einer der Soldaten starb, wurde er auf dem Friedhof neben der Kirche beerdigt, und über dem Grab wurde Salut geschossen. Gegen Ende des Krieges häuften sich die Salven. Sonntags lud Tante Thea Soldaten aus den Lazaretten zu Kaffee und Kuchen ins Kinderheim ein. Sie erzählten von der Front.
Zum Schluss standen sie mit Tante Thea vor einer großen Karte, in die der Verlauf der Ostfront eingetragen wurde. Nach Stalingrad, Januar 1943, ging es rückwärts. Wir redeten uns ein, dass sei ein taktischer Trick des Führers; bald würde es wieder vorwärts gehen, vor allem, wenn die V-Waffen einsatzbereit seien. Einmal rief mich Tante Thea in ihr Büro, um einen ihrer Zöglinge aus der Zeit zu begrüßen, als sie noch „Große“ nahm. Es war der „Große Hans“. Er war Unteroffizier und hatte einen Marschbefehl nach Osten erhalten. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er ging. Ein winterlicher Tag, Schneegestöber, mit zwei kleinen Köfferchen entfernte er sich. Kurz darauf kam die Nachricht, er sei gefallen.
Der Proviant musste zum großen Teil zur „Bergwiese“ herangetragen werden; Lieferwagen gab es keine mehr. Das Schleppen wurde mit einer Wanderung der Kinder kombiniert. Die Milch holten wir täglich beim Bauer Hickmann, dem kleinsten der drei Bauern im Dorf. Sein Hof, das „Schwalbennest“, stand am Eingang zu Oberkipsdorf, am Ende der steilen Steigung; die Straße ging mittendurch. Auf der einen Seite Wohnhaus und Stall, auf der anderen die Scheune. Heute ist der Hof verschwunden. Die Stelle, wo er stand, ist so eng, dass man viel Fantasie braucht, um sich vorstellen zu können, dass hier einmal ein kleiner Bauernhof Platz gefunden hat. Hickmanns hatten drei Kühe, „Liese“, „Schwalbe“, den Namen der dritten habe ich vergessen. Tagsüber wurden die Kühe eingespannt, mussten arbeiten: beim Pflügen, Eggen, Kartoffeln roden, Wagen ziehen. Abends und wohl auch morgens wurden sie gemolken. Herr Hickmann, so hieß es, sei Zuckerkrank. Er musste immerzu Sauerkraut essen; das ganze Haus roch danach. Frau Hickmann war eine fröhliche Natur; trotz der schweren Arbeit, die sie täglich verrichten musste, war sie immer guter Laune. Wir „Großen“ halfen Hickmanns bei der Ernte, im Heu, bei den Kartoffeln. Das Schönste an diesen Einsätzen waren die Brote – auf gut sächsisch „Bemmen“ – die es in den Pausen gab. Hickmanns hatten einen Sohn, den „Großen Heinz“. Während des Krieges war er eingezogen; nach dem Zusammenbruch ist er in den Westen gegangen. Er war es, der den Lastwagen fuhr, der uns vom Lager Friedland nach Hamburg Altona brachte.
Ein paar Mal unternahm Tante Thea mit mir Ausflüge in die Umgebung. Erinnern kann ich mich an einen Besuch in Dresden. Großen Eindruck machte mir die Standseilbahn von Loschwitz hinauf zum weißen Hirsch. Die der Hangneigung angepassten schrägen Wagen. Der zu Tal fahrende zog den bergaufgehenden, auf halbem Weg die Ausweichstelle. Aufregend. Wir besuchten auch die Mieter unseres Hauses in der Böhmertstraße. Über den Eingang und die „Halle“ kamen wir jedoch nicht hinaus. Das Verhältnis zu den Mietern, ich glaube, sie hießen Kanitz – Kanis der Hund, so habe ich mir das all’ die Jahre gemerkt – war wohl nicht das beste. Das Haus machte einen düsteren Eindruck, wohl wegen des dunklen Holzes der Vertäfelung, der Treppe und der Galerie. Wir fuhren auch, alles mit der Straßenbahn, nach Radebeul, besichtigten Karl Mays Villa „Shatterhand“ und gingen zum Schlösschen „Sorgenfrei“, dem Elternhaus meiner Omi; das Anwesen war damals schon verkauft. Das Haus schien verlassen, der Saal und die anderen Gebäude auch. Der Park war verwildert, der Brunnen hinter dem Haus tot, die Figuren geköpft. Triste.
Absoluter Höhepunkt war der letzte Ausflug nach Dresden, den Tante Thea mit uns, den „Großen“, unternahm. Das muss 1944 gewesen sein. Traumhaftes Spätsommerwetter. Die schöne Stadt war damals noch vollkommen unversehrt.
Mit der Bimmelbahn ging es bis nach Hainsberg – heute ein Stadtteil von Freital – vorbei an der Talsperre Malter und durch den Rabenauer Grund. Von Hainsberg weiter mit der großen Eisenbahn bis zum Hauptbahnhof in Dresden. Schließlich mit der Straßenbahn bis zum Postplatz. Die Leute staunten: eine ziemlich kleine Frau mit sechs Kindern, alles Jungs – der Führer braucht Soldaten – und rätselten, ob das wohl alles die ihren wären. Wir haben sehr gelacht. Wir besichtigten die Zinnsoldatenausstellung in einem Palais nahe der Brühlschen Terrasse. Eindrucksvolle Dioramen; manche hätte ich am liebsten gleich mitgenommen. Auf der Terrasse wimmelte es von Soldaten.
Zu meinem 9. Geburtstag bekam ich ein Zimmer für mich allein. Tante Thea hatte ihr kleines Schlafzimmer für mich geräumt. Als sie mir gratulierte, sagte sie, deine Geschenke sind in deinem Zimmer. Dort fand ich aber nichts. Schließlich lenkte sie meine Aufmerksamkeit auf ihr – jetzt ehemaliges – Zimmer. Ich war sprachlos – ja, auch das kam manchmal vor – und überglücklich. Ein kleiner, weiß lackierter Schreibtisch mit einer bordartigen Ablage. An der Wand darüber die zwei Vorderlader-Pistolen und die Pulvertasche mit dem Sachsenwappen und der große Schildpatt, den Onkel Hermann Hucho aus Australien mitgebracht hatte. Ich genoss dieses Refugium sehr, konnte ich mich doch endlich mal von der „Meute“ absetzen und etwas tun, was nicht sogleich von allen kommentiert wurde.
Als nächstes stand die Entscheidung bevor: Wer kommt auf welche Schule? Dazu war eine Prüfung zu bestehen. Für die Oberschule in Altenberg, ein kleines Städtchen auf dem Kamm des Erzgebirges und für die Mittelschule in der Kreisstadt Dippoldiswalde, noch heute nur „Dipps“ genannt. Nach welchen Kriterien der eine hierhin und die andere dorthin geschickt wurde, blieb im Dunkeln, hat mich auch nicht beschäftigt. Auch nicht, dass unsere Klasse auseinandergerissen wurde. Erinnern kann ich mich aber noch an ein Mädchen, an Ruth Forker, eine aufgeweckte Person; sie kam nach Dipps. Sicher hätte es bei ihr auch für Altenberg gereicht. Ein Problem, das die Politik bis heute nicht bewältigt hat. Jahre später hörte ich, dass es einem anderer Schulkumpel gelungen war, die Klassenschranken zu überwinden: Der Hausding Mannl, Sohn eines Eisenbahners, der bei der Bimmelbahn in Kipsdorf arbeitete und, zusammen mit seinen Kollegen, in einer kleinen Siedlung am Ortseingang wohnte. Mannl, so hörte ich, sei Arzt geworden, hätte sogar in Moskau studiert. Der Sozialismus hatte das möglich gemacht.
Dass ich zur Oberschule gehen sollte, darüber haben meine Eltern wohl kaum diskutiert. Im Herbst 1944, an einem sonnigen Tag, fuhr uns Herr Wünsche, der örtliche Gemüsehändler, mit seinem Opel Blitz nach Altenberg. Busse verkehrten offenbar nicht mehr. Wir saßen zusammengedrängt auf der Ladefläche, sicher alle mit einem Grummeln im Bauch. Wer mich begleitet hat, Mutter oder Ellen, das weiß ich nicht mehr. Aber ohne „Geleitschutz“ wäre ich in dem Gewusel vor der Schule wohl untergegangen. Vier Prüfungen waren zu meistern: Aufsatz, Diktat, Rechnen und abschließend eine mündliche Prüfung „quer Beet“. Probleme gab es mit meinem Namen. In Berlin war es üblich, zuerst den Vornamen zu nennen, dann den Nachnahmen. In Sachsen war das umgekehrt; hier war ich der Hucho Wolf. Im Mündlichen sprach mich der Lehrer, ein schon ergrauter Herr, immer mit Wolf an. Hielt er den für meinen Nachnamen? Das blieb mir verborgen. Am Ende hatte ich bestanden, alles Übrige war unerheblich und vergessen. Glücklich machten wir uns auf den Heimweg, über die Böhmische Landstraße, gut 10 km, aber bergab.
Die „Binge“ bei Altenberg, 2014
Und ich wurde in Altenberg sogar auch noch eingeschult; wann das war, habe ich vergessen. Dafür weiß ich genau, dass Ellen mit von der Partie war, schließlich war sie dort ja Schülerin. Irgend ein alter Herr, sicher der Direktor, hielt eine Rede, das Schulorchester spielte; es war wohl das erste mal in meinem Leben, dass ich jemanden Geige spielen sah und hörte. Damit war ich Schüler der Altenberger Oberschule, habe dort aber nicht eine einzige Stunde Unterricht erhalten. Auf dem Rückweg kamen wir in einen sintflutartigen Regen. Wir überholten ein paar Schüler, die um ein Fahrrad herumstanden, Reifenpanne. Ellen erklärte mir: Da kannst Du sehen, was Kameradschaft bedeutet. Die anderen Schüler halfen ihrem Kameraden, die Panne zu beheben, machten sich nicht davon, ließen ihn nicht im Regen stehen. Das hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Der Krieg kam näher, zunächst ganz geräuschlos. Der erste Flüchtling, der im Kinderheim um Aufnahme bat, war Irmgard v. Gregory, Tante „Irm“ gerufen. Sie stammte aus der schlesischen Linie der Gregorys. Ich sehe Sie noch vor mir, wie sie vor dem Haus aus dem Schneegestöber auftauchte, eine winzig kleine Person in einen Pelz gehüllt, mit zwei kleinen Köfferchen. Ich musste mein Zimmer für sie freimachen. Darüber war ich natürlich nicht sehr glücklich. Aber, ob das diffiziles Verhältnis zwischen ihr und mir darauf zurückzuführen war, glaube ich nicht. Tante Irm war nicht ganz einfach zu haben, auch für die großen Leute nicht. Sie war fromm bis zur Bigotterie, eilte jeden Sonntag den weiten Weg in die Kirche und schrieb eifrig mit, was der Pastor predigte. Gern hätte sie mit jemandem darüber gesprochen, aber niemand hatte Zeit für sie.
Vom Bombenangriff auf Dresden in der Nacht vom 13. Februar haben wir im Kinderheim zunächst nichts mitbekommen. Nur Tante Thea hatte den Feuerschein am Himmel beobachtet und die Befürchtung geäußert, es müsse etwas Schlimmes passiert sein. Und am nächsten Vormittag brachte die Bimmelbahn Massen von Überlebenden nach Kipsdorf. Einige waren den Flammen nur mit dem Nachthemd bekleidet entkommen. Tante Thea nahm einige Leute auf. Erinnern kann ich mich an einen Jungen meines Alters, der mit seiner Mutter kam: Jürgen Fischer-Dorp. Er war vollkommen durcheinander und hat sich erst nach Tagen beruhigt. Unentwegt sagte er „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“. Ich muss gestehen, damit ging er uns gehörig auf die Nerven.
Allmählich wurde der Krieg auch in Kipsdorf hörbar. Der Donner der Kanonen wurde jeden Tag lauter, die Front kam näher. Mir wurde mulmig. Wann, wenn nicht jetzt, müsste der Führer seine Vergeltungswaffen einsetzen. Wir Jungs glaubten immer noch an den Endsieg. Und Flüchtlinge kamen, aus Schlesien und aus Böhmen und Mähren. Tante Thea hat sie im großen Spielzimmer in der Veranda untergebracht. Alle verfügbaren Matratzen wurden zusammengetragen.
Kurz vor Ende des Krieges, im April 1945, kam Vater aus Budapest zurück. Diesen etwas unscharfen Zeitpunkt habe ich nach einer Nachricht rekonstruiert, an die ich mich erinnern kann. Wenige Tage bevor er kam, war der Panzerkreuzer „Admiral Scheer“ bei einem Bombenagriff in Kiel versenkt worden, und das war am 9.4.1945. Ich berichtete Vater davon. Er hatte geschrieben, dass er mit dem Zug von Dresden nach Altenberg fahren würde; wir sollten ihn dort abholen. Mutter, Ellen und ich machten uns auf den Weg. Vaters Zug kam tatsächlich an, wenn auch mit großer Verspätung. Wegen Beschuss’ durch amerikanische Jagdbomber, „Jabos“, musste er sich mehrmals in einem Tunnel verstecken. Auch uns haben die Jabos überflogen; sie schossen auf alles, was sich bewegte, auch auf Kühe. Wenn ihr lautes Motorengeheul näher kam, haben wir uns in den Graben am Wegrand geworfen.
Unten im Dorf rollten die Wagenkolonnen der Wehrmacht in Richtung Dresden; es sah wir ein geordneter Rückzug aus, aber schwere Waffen waren nicht zusehen. Am Abend des 7. Mai setzte ganz in der Nähe heftiges Artilleriefeuer ein. Die Granaten pfiffen über das Kinderheim hinweg. Jens Körner kam mit der Aufforderung, das Kinderheim sei zu evakuieren. Tante Thea ignorierte seine Sprüche und schickte alle Kinder ins Bett. Dann hörte der Geschützdonner plötzlich auf. Im Radio hieß es, um Mitternacht werde kapituliert. In Bärenfels wurde Munition gesprengt, dem Geknatter nach eher kleines Kaliber. Dann wurde es still.
Am Morgen des 8. Mai herrschte strahlender Sonnenschein. Frühstück gab es wie üblich. Dann ging Tante Thea zum Dorfplatz; ich durfte sie begleiten. Von dort konnte man einen Blick auf die Chaussee im Unterdorf werfen: Die Russen zogen ein, mit Pferdewagen. Am Dorfplatz standen ein paar Männer mit roten Armbinden herum; ich fand es befremdlich, dass sie sich auf diese Weise dem Feind anbiedern wollten. Erinnern kann ich mich an einen, den Brückner. Er war Häusler, hatte ein kleines Anwesen oberhalb des steilen Dorfberges, ein adrett aussehendes weißes Häuschen mit braunem Fachwerk, einen Hang mit Apfelbäumen, ein paar Ziegen, Federvieh. Er gehörte offenbar zu den Kommunisten. Tante Thea, Altmitglied der NSDAP, unterhielt sich mit ihm, friedlich wie immer. Wie würde es weitergehen? Achselzucken.
Die Eltern in Omis Wohnung bekamen Einquartierung. Ein junger russischer Leutnant war mit einem T 34 unterwegs, einen weiteren Panzer dieses Typs, jedoch ohne Turm, im Schlepptau. Vater spielte mit dem Offizier Schach. Der kleine Trupp blieb ein, zwei Tage und fuhr dann unter fürchterlichem Lärm von dannen. Dann mussten die Eltern zwei Amerikaner beherbergen, einen Offizier und seinen Fahrer. Sie kamen im offenen Jeep, mit einem kleinen Anhänger. Sie sahen aus, wie von einem anderen Stern. Tolle Uniformen, helles Tuch, super geschnitten und gebügelt, und sie hatten schneidige Käppis auf. Sie suchten nach den Gräbern von der Besatzung eines Bombers, der kurz vor Kriegsende nach einem Treffer unweit von Kipsdorf abgestürzt war. Ich hatte diesen Absturz beobachtet.
Derweil bahnte sich im Kinderheim eine Tragödie an. Dort hatten auch mein Onkel Otto v. Schröter und seine Frau, Tante Ehri, Zuflucht gefunden. Sie wohnten in Tante Theas großem Zimmer, in dem inzwischen auch mein Bett einen neuen Standort gefunden hatte. Eines Abends war Onkel Otto verschwunden und mit ihm seine Pistole, die er im Nachtkästchen verwahrt hatte. Tante Ehri war verzweifelt und hat laut geweint, ahnte sie doch, was passieren würde. Einige Tage später wurde die Leiche von Onkel Otto gefunden; er hatte sich erschossen. Tante Thea machte sich zusammen mit Herrn Brückner auf, die Leiche zu bergen. Ich sehe es noch, wie sie beide Brückners großen Leiterwagen zogen. Die Füße vom Onkel, der riesengroß war, standen hinten heraus; die Decke war nicht lang genug um sie zu bedecken.
Das Leben im Kinderheim lief für uns Kinder zunächst weiter, als sei nichts geschehen. Tagesablauf wie gehabt. Zu Essen gab es genug. Tante Thea hatte offenbar vor Toresschluss gut eingekauft, aus Heeresbeständen, wie es hieß. Die Flüchtlinge, soweit sie nicht mit uns verwandt oder bekannt waren, zogen weiter, meine Berliner Freunde waren von der Bildfläche verschwunden. Was blieb war kleines Gemüse; ich war mir weitgehend selbst überlassen. Ich versuchte, Radfahren zu lernen; nach einigen Stürzen gab ich auf. Ab und zu schauten Russen vorbei, einzeln oder in Gruppen. Tante Irm wurde ein Schmuckstück geklaut. Sie hatte es auf dem Nachtkästchen liegen lassen und kommentierte den Verlust damit, dass die Russen doch irgend etwas finden müssten, sonst würden sie womöglich „alles“ mitnehmen. Ein Soldat mit mongolischem Gesichtsschnitt, der furchterregend dreinschaute, ging mit aufgepflanztem Bajonett durchs ganze Haus, stach in jeden Hohlraum und verschwand wieder. Abends, wenn es dämmrig wurde, kamen deutsche Soldaten ans Haus. Eine Baumreihe am Rand des Grundstücks bot ihnen Deckung. Tante Thea versorgte über hundert Mann mit einer Mahlzeit; die zivilen Klamotten gingen ihr schnell aus.
Eines Tages kam Hans-Karl Lübbe ins Kinderheim; „Hanka“ wurde er genannt, was ihn – auch später noch – in Rage brachte. Er und seine Mutter waren aus Olmütz in Böhmen entkommen; der Vater, ein General, war in russische Gefangenschaft geraten und kam erst spät frei. Ich zeigte Hanka unser Terrain. In den ersten Tagen trauten wir uns noch nicht, in den Wald zugehen, aber nach und nach erweiterten wir unseren Aktionsradius. Oft waren wir stundenlang unterwegs, niemand schien uns zu vermissen. Schule fand nicht statt. Damit wir nicht gar zu übermütig wurden, setzte Tante Thea Unterricht an. Den Lehrer machte Herr Hirzel, der mit Frau und drei Kindern in der Bergwiese logierte. Herr Hirzel, eigentlich ein Künstler, der später zum Direktor des Kunstmuseums in Kassel avancierte, machte sich mit unerbittlicher Strenge unbeliebt. Hanka gefiel sich darin, mich aufzuklären und zu allen möglichen Unarten anzustiften. Zu Letzterem hätte es wirklich nicht bedurft.
Schließlich kam eine Schulkameradin aus dem Dorf zu uns herauf und verkündete, dass die Schule wieder angefangen habe; auch wir, die wir doch eigentlich schon Gymnasiasten waren, mussten zurück in die Volksschule: acht Jahre Volksschule für alle. Hanka, der ein Jahr älter war als ich, kam in die sechste Klasse, ich in die fünfte. Wir saßen nebeneinander. Die „alten“ Lehrer waren verschwunden – Herrn Keller sah ich nach Jahren in Kipsdorf wieder – wir bekamen neue. Erinnern kann ich mich an eine junge Lehrerin, die wir, Hankas Idee folgend, wegen ihrer schlanken Taille die „Wespe“ nannten. Sie war leicht aus der Ruhe zu bringen. Und natürlich an unseren Russischlehrer, Herrn Tempel. Er war schon etwas älter und war sehr distanziert. Auch wenn wir manchmal unruhig waren, er ließ sich nicht aus dem Konzept bringen, war offensichtlich ein Profi, wie man heute sagen würde. Nur eines brachte ihn aus der Ruhe: Es verging fast keine Stunde, in der nicht ein Schüler oder eine Schülerin nach der Bedeutung eines der bei den Russen so beliebten, meist recht deftigen oder gar obszönen Flüche fragte. Da wurde er unglaublich wütend, schrie laut, wir sollten ihn mit derartigen Sauereien in Ruhe lassen. Das taten wir denn auch. Sein Unterricht war gut; zumindest machte ich schnell Fortschritte. Eines Tages bekamen wir sogar ein russisches Schulbuch; in dem habe ich viel gelesen, und ich muss gestehen: Russisch hat mir großen Spaß gemacht. Die kyrillische Schrift habe ich leicht gelernt, und auch mit der Grammatik bin ich gut zurecht gekommen. Leider habe ich alles total vergessen, wie ich Jahre später als „Hein Seemann“ bei meinem ersten Landgang in der Sowjet Union enttäuscht feststellen musste.





























