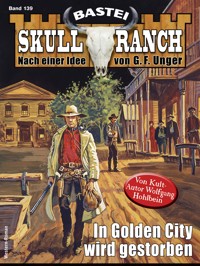
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Mann war tot. Man musste nicht unbedingt Arzt sein, um das zu erkennen. Er lag auf dem Rücken, die blicklosen Augen starr in den Himmel gerichtet. Seine Hände waren in einer letzten verzweifelten Bewegung in den Boden gekrallt. Unter ihm war die staubige Erde schwarz von geronnenem Blut.
In stummer Wut schüttelte George Rockwell, der Town Marshal von Golden City, den Kopf. Schon wieder war ein Mann ermordet worden. Wer würde der nächste sein?
George Rockwell starrte noch einmal nachdenklich auf die reglos daliegende Gestalt hinunter. Die schmale Seitenstraße hatte sich in den letzten Minuten rasch mit Neugierigen gefüllt - Männer, Frauen, Kinder; es gab nicht viele, die der Neugier widerstehen konnten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
In Golden City wird gestorben
Vorschau
Impressum
In Golden City wird gestorben
von Wolfgang Hohlbein
Der Mann war tot. Man musste nicht unbedingt Arzt sein, um das zu erkennen. Er lag auf dem Rücken, die blicklosen Augen starr in den Himmel gerichtet. Seine Hände waren in einer letzten verzweifelten Bewegung in den Boden gekrallt. Unter ihm war die staubige Erde schwarz von geronnenem Blut.
In stummer Wut schüttelte George Rockwell, der Town Marshal von Golden City, den Kopf. Schon wieder war ein Mann ermordet worden. Wer würde der nächste sein?
George Rockwell starrte noch einmal nachdenklich auf die reglos daliegende Gestalt hinunter. Die schmale Seitenstraße hatte sich in den letzten Minuten rasch mit Neugierigen gefüllt – Männer, Frauen, Kinder; es gab nicht viele, die der Neugier widerstehen konnten.
Rockwell seufzte, drehte sich um und musterte die zusammengelaufene Menge finster. »Geht auseinander, Leute«, sagte er halblaut. »Es gibt hier nichts Besonderes zu sehen.«
Niemand rührte sich, aber damit hatte der Town-Marshal auch nicht ernsthaft gerechnet. Golden City war, obwohl der Höhepunkt des Goldrausches fast überschritten war, noch immer eine typische Digger-Town; eine laute raue Stadt voller lauter rauer Menschen. Der Anblick eines Toten gehörte zwar nicht gerade zum Alltäglichen, aber er warf die Leute auch nicht aus den Stiefeln.
»Verschwindet«, sagte Rockwell, diesmal deutlich verärgert und mit mehr Nachdruck in der Stimme. »Das hier geht euch nichts an.«
»Das finde ich nicht«, sagte ein kleiner, stoppelbärtiger Mann. Er hatte schon geraume Zeit dagestanden und abwechselnd den Leichnam und Rockwell finster angestarrt. Nun schob er sich rüde nach vorne und baute sich in herausfordernder Haltung vor dem Marshal auf. »Das finde ich überhaupt nicht, Marshal«, wiederholte er. »Schließlich ist das nicht der erste Tote in den letzten Wochen, oder?«
Rockwell seufzte hörbar. Der Leichenfund hatte ihm den Tag eigentlich schon gründlich genug verdorben.
»Das stimmt«, sagte er sanft. »Aber es wird auch nicht besser dadurch, dass scheinbar jedermann glaubt, mir erzählen zu müssen, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Geht auseinander, Leute.«
Aber so schnell gab der Mann nicht auf. Er hatte einmal das Wort ergriffen, und er konnte nun nicht mehr zurück, ohne vor der Menge das Gesicht zu verlieren.
»Es wäre gut, wenn Sie Ihre Arbeit überhaupt tun würden, Marshal«, fuhr er böse fort. »Das ist jetzt der dritte Mord innerhalb von zwei Wochen. Und Sie haben nicht einmal einen Verdacht, wer der Täter sein könnte. Schließlich bezahlen wir dafür, dass Sie für unsere Sicherheit sorgen.«
Rockwells Mine verfinsterte sich. Er setzte zu einer scharfen Antwort an, überlegte es sich dann aber doch anders und schob sich mit einem stummen Achselzucken an dem Mann vorbei. Das Schlimme war, dass er im Grunde Recht hatte, überlegte Rockwell, während er sich grob durch die Menge zur Straße schob. Der Tote dort in der Gasse war der Dritte innerhalb von noch nicht einmal ganz zwei Wochen. Und er war während der ganzen Zeit nicht einen Schritt weitergekommen. So wie auch die beiden anderen Morde erschien auch dieser Dritte auf den ersten Blick sinnlos. Rockwell kannte das Opfer, Steve Bendix, einen Small-Rancher aus einem benachbarten Valley, schon seit Jahren. Bendix gehörte an sich zu dem Menschentyp, der überall beliebt war und keine Feinde zu haben schien; im Gegenteil. An sich hatte jeder den stillen, stets freundlich gestimmten Rancher gemocht. Er kam selten in die Stadt, aber er hatte jahrelang mit seiner Familie in Golden City gelebt, ehe er genug Geld zusammengespart hatte, um die winzige Farm auf der anderen Seite der Berge zu kaufen, und er hatte, auch nach all den Jahren, noch viele Freunde unter den Bürgern der Digger-Stadt. Nein, Rockwell konnte sich einfach niemanden vorstellen, der Bendix genug hasste, um ihn umzubringen.
Er überquerte die Straße, betrat sein Büro und ließ sich mit einem gemurmelten Fluch auf seinen Stuhl sinken.
Über die große Entfernung hinweg betrachtet, war der Reiter nicht mehr als ein winziger dunkler Punkt, der in der hitzeflimmernden Luft auf und ab zu tanzen schien. Es war heiß. Die Luft schmeckte bitter und metallisch und nach dem trockenen Staub, den der Wind aus dem Bluegrass Valley mit sich trug, und die Sonne schien seit Stunden unbeweglich am Himmel zu stehen und ihre Glut auf die ungeschützte Erde herabzusenken.
John Morgan lehnte sich auf dem Kutschbock des zweispännigen Wagens zurück, klaubte ein Taschentuch aus der Weste und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er seufzte, fuhr sich noch einmal mit dem Tuch über das Gesicht und sah seinen frischgebackenen Schwiegersohn tadelnd an.
»Ich hoffe nicht, dass du vorhast, hier zu übernachten«, sagte er schließlich, als Chet Quade keinerlei Anstalten machte, die Pferde weitergehen zu lassen. »Ich möchte wenigstens heute noch in Golden City ankommen. Ganz zu schweigen davon, dass wir auch noch zurückmüssen.«
Quade wandte für einen Moment den Blick, grinste flüchtig und starrte dann wieder den dunklen Punkt am Horizont an. Das Bluegrass Valley breitete sich weit und scheinbar unbewegt vor ihnen aus und erinnerte an einen riesigen flachen See, der direkt hinter den Felsen, in deren Schatten sie angehalten hatten, begann und irgendwo im Westen von den nur vage erkennbaren Gipfeln der Sawatch-Mountains begrenzt wurde.
»Einen Moment noch, John«, murmelte er, ohne den Blick zu wenden. »Ich möchte noch warten, bis er näher gekommen ist. Irgendetwas stimmt da nicht.«
Morgan runzelte missbilligend die Stirn, blickte aber selbst für Augenblicke in Richtung des langsam näherkommenden Reiters. »Ich kann nichts Auffälliges erkennen«, murrte er. »Entweder hast du bessere Augen als ich, oder...«
»Da stimmt was nicht«, wiederholte Quade, ohne auf Johns Worte zu achten. »Er bewegt sich ja kaum.« Er ließ sich zurücksinken, sah seinen Schwiegervater nachdenklich an und murmelte, mehr zu sich selbst als zu Morgan: »Bei dieser Affenhitze reitet doch kein halbwegs vernünftiger Mensch spazieren.« Er fuhr sich mit der Hand über das Kinn, starrte noch einmal sekundenlang den winzigen dunklen Punkt vor dem Horizont an und griff dann mit einer entschlossenen Bewegung nach den Zügeln, um den Wagen zu wenden. Die beiden Pferde schnaubten protestierend, gehorchten aber. Die Tiere schienen unter der Hitze noch mehr zu leiden als die Menschen. Ihr Fell glänzte vor weißem, flockigem Schaum, und ihr Atem ging hörbar und rasselnd. Aber sie zogen den schweren Wagen gehorsam herum und setzten sich langsam wieder in Richtung Bluegrass Valley in Bewegung.
»So«, machte Morgan. »Kein halbwegs vernünftiger Mensch fährt bei dieser Hitze spazieren, wie? Und was tust du gerade?«
Chet grinste. »Wir kommen noch früh genug nach Golden City«, meinte er. »Jetzt nehmen wir uns erst mal den Burschen dahinten vor, Dad«.
Der Reiter in der Ferne schien sich wirklich kaum zu bewegen. Obwohl sie in seine Richtung fuhren, war er nicht merklich näher gekommen, und auch in Morgan machte sich langsam ein beunruhigendes Gefühl breit. Er lebte lange genug hier draußen, um zu spüren, ob sich jemand normal verhielt oder nicht. Der Reiter dort vor ihnen war noch zu weit entfernt, um Einzelheiten zu erkennen, aber sie konnten zumindest sehen, dass sich das Pferd wahllos von rechts nach links und zurückbewegte und manchmal stehenblieb, um am Gras zu zupfen.
»Fahr schneller«, sagte er leise.
Chet nickte, ließ die Zügel abermals knallen und trieb die Pferde zu raschem Galopp an. Trotzdem schien die Zeit plötzlich quälend langsam zu vergehen. Der Wagen rumpelte über den unebenen Boden, und die starren, ungefederten Achsen gaben jeden Stoß und jede Erschütterung ungemildert an die beiden Männer weiter.
»Du hattest recht«, sagte Morgan plötzlich gepresst. »Da stimmt wirklich was nicht. Gut, dass wir umgekehrt sind.«
Chet nickte, schwieg aber. Sie waren jetzt nahe genug, um Einzelheiten ausmachen zu können. Das Pferd war mittlerweile stehengeblieben und blickte dem sich nähernden Wagen neugierig entgegen. Es wirkte heruntergekommen und müde. Seine Flanken waren staub- und schmutzverkrustet und zitterten so stark, als hätte es Mühe, sich überhaupt noch auf den Beinen zu halten. Der Reiter hing reglos und in seltsam starrer Haltung im Sattel, vornübergebeugt und halb auf den Hals des Tieres gestützt; ein Mann, der am Ende seiner Kräfte war und sich nur mehr durch einen bloßen Reflex halbwegs aufrecht hielt.
Chet zog langsam die Zügel straff und ließ den Wagen etwa zwanzig Meter vor dem Ziel anhalten. Das Pferd wirkte übernervös und ängstlich. Wenn sie es erschreckten und es durchging, würden sie es trotz seiner sichtlichen Erschöpfung mit dem schwerfälligen Wagen kaum noch einholen. Er zog die Bremse an, sprang vom Bock und ging, die rechte Hand ausgestreckt und beruhigende Worte murmelnd, auf das Pferd zu. Morgan folgte ihm in geringem Abstand.
Das Pferd tänzelte nervös auf der Stelle. Seine Ohren zuckten, und als sie näherkamen, konnte John Morgan den scharfen Schweißgeruch wahrnehmen, den es verströmte. Aber es blieb – wohl zu erschöpft, um noch zu flüchten – stehen, bis Chet heran war und die Hand nach dem Zaumzeug ausstreckte.
Der Mann im Sattel stöhnte leise. Er hob den Kopf, sah den beiden Ranchern aus verschleierten Augen entgegen und sank dann langsam vornüber. Seine Kraft hatte ausgereicht, bis jetzt durchzuhalten; jetzt, mit der Rettung vor Augen, verließ sie ihn. Er sank nach vorne, stieß einen seufzenden Klagelaut aus und wäre aus dem Sattel gestürzt, wenn John Morgan nicht gedankenschnell zugegriffen und ihn aufgefangen hätte.
Chet ließ hastig das Pferd los und sprang herbei, um ihm zu helfen. Das Tier wieherte erleichtert, während Chet und Morgan den reglosen Körper vorsichtig zu Boden legten.
Der Mann stöhnte erneut; ein gurgelnder, kaum noch menschlich zu nennender Laut, der den beiden Männern einen eisigen Schauer über den Rücken jagte. Er bewegte sich, griff mit blind tastenden Händen um sich und sank schließlich vollends zurück. Sein Gesicht war eingefallen und fiebrig, die Lippen spröde und aufgesprungen, und die Augäpfel hinter den geschlossenen Lidern bewegten sich hektisch hin und her.
»Wasser!«, befahl Morgan knapp. Chet stand auf und eilte zum Wagen, um wenige Augenblicke später mit einer gefüllten Feldflasche zurückzukehren. Morgan schraubte hastig den Verschluss ab, träufelte einige Tropfen Wasser auf die aufgerissenen Lippen des Bewusstlosen und zog dann sein Taschentuch aus der Weste. Er feuchtete es an, drehte es zusammen und legte es dann auf die Stirn des Bewusstlosen. Dann griff er mit spitzen Fingern nach der blutverkrusteten Weste und zog sie behutsam auseinander.
Chet sog scharf die Luft zwischen den Zähnen ein, als er die hässliche Wunde dicht über dem Herzen des Mannes sah. Das ehemals weiße Hemd war dunkel von eingetrocknetem Blut und Pulverschmauch. Die Wunde war ziemlich groß und befand sich nicht einmal eine Handbreit über dem Herzen. Sie war entzündet, und ihre Ränder waren schwarzverbrannt.
»Ein Gewehrschuss«, diagnostizierte Chet.
Morgan nickte. »Ja. Und zwar aus allernächster Nähe. Ein Wunder, dass er noch flüchten konnte.« Er schnüffelte, beugte sich dann tiefer über den Verletzten und zog vorsichtig das Hemd von der Wunde fort. »Brandig«, sagte er nach wenigen Sekunden. »Er muss den ganzen Tag damit herumgeirrt sein. Vielleicht sogar länger. Eigentlich dürfte er gar nicht mehr leben.« Er stand auf, schüttelte den Kopf und ballte in stummer Wut die Fäuste. »Er war schon immer ein harter Bursche, aber wenn er das überlebt, beginne ich an Wunder zu glauben.«
»Du kennst ihn?«, fragte Chet.
Morgan nickte. »Kennen ist zu viel gesagt. Wir waren einmal gute Bekannte, aber das ist länger her. Mittlerweile haben wir uns aus den Augen verloren. Paul Morresey. Er arbeitete als Vormann auf der Henderson-Ranch.« Er schwieg einen Moment, ging dann zum Wagen und führte die Pferde am Zaumzeug herüber. Gemeinsam betteten sie den schlaffen Körper auf der harten Ladefläche des Wagens und legten seinen Kopf auf eine zusammengerollte Decke. Chet leinte Morreseys Pferd mit dem Zügel am Wagen an, kletterte neben Morgan auf den Kutschbock und brachte die Tiere mit geduldigem Zurufen dazu, den Wagen abermals zuwenden und wieder in Richtung Golden City loszutraben.
»Wir sollten uns beeilen«, sagte John nach einem besorgten Blick auf Morresey. »Er sieht nicht gut aus. Ich möchte ungern mit einer Leiche auf dem Wagen in der Stadt einfahren.«
Quade nickte, ließ die Zügel knallen und lenkte den Wagen auf den ausgefahrenen Weg zwischen den Felsen zurück. Die Hitze war hier nicht ganz so mörderisch. Die Felsen warfen lange, wie mit Lineal und Zirkel abgegrenzte Schlagschatten auf den schmalen Trail, aber der Wind trug immer noch Wolken von Staub und schwüle, unangenehme Luft mit sich, und die Pferde schienen jetzt schon am Ende ihrer Kräfte angelangt zu sein. Trotzdem trieb Chet sie unbarmherzig weiter. Es waren noch gute zwei Stunden bis Golden City, und selbst, wenn sie nur zehn Minuten herausholten, konnte das schon ausreichen, um über Leben und Tod des Mannes auf ihrem Wagen zu entscheiden.
Nach der schwülen Hitze auf der Straße war es im Innern des Saloons angenehm kühl und schattig. An der langen, einfachen Holztheke standen nur ein paar Cowboys, die sich halblaut unterhielten und von Zeit zu Zeit an ihrem Bier nippten. Die Tische und Stühle, die in loser Unordnung im Inneren des großen, dunklen Raumes standen, waren noch verwaist. Es war noch zu früh für den normalen Saloonbetrieb. Aber das war George Rockwell in diesem Augenblick nur recht. Der Tag hatte genug Aufregung gebracht, und ihm begann allmählich der Schädel zu brummen. Er hatte mit Dutzenden von Leuten gesprochen, ohne auch nur die Spur einer Spur zu finden.
Er ging langsam zur Theke hinüber, stützte sich schwer mit den Ellenbogen darauf und bestellte sich lustlos ein Bier. Der Barkeeper schenkte ein, stellte das Glas vor Rockwell auf die Platte und lächelte berufsmäßig.
»Nun, Marshal, so früh schon hier? Schlecht geschlafen oder viel Arbeit?«
Rockwell lächelte gequält. »Beides«, antwortete er lustlos. Er trank an seinem Bier, wischte sich mit einer unbewussten Bewegung den Schaum von den Lippen und drehte das Glas nachdenklich in den Händen. »Aber das heißt, so ganz privat bin ich gar nicht hier.«
Der Barkeeper nickte. »Ich weiß«, murmelte er bekümmert. »Bendix.«
Rockwell sah verblüfft auf. »Schlechte Nachrichten sprechen sich schnell herum, wie?«
»Auch. Aber ich dachte mir, dass Sie kommen. Er war gestern Abend noch hier.«
»Hier?«, echote Rockwell verblüfft. Der Golden-Nugget-Saloon war nicht gerade die Umgebung, in der man einen Mann wie Bendix anzutreffen vermutete.
»Ziemlich spät sogar. Ich hab nicht darauf geachtet, aber ich denke, es war Mitternacht. Wenn nicht später. Aber er hat nicht viel getrunken.« Der Barkeeper grinste flüchtig. »Kein Gast, an dem man viel verdient.«
Rockwell fegte die Bemerkung mit einem unwilligen Kopfschütteln beiseite. »War er allein?«, hakte er nach.
»Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hab nicht darauf geachtet.«
Rockwell seufzte. »Aber man merkt doch, ob ein Gast allein oder in Begleitung ist.«
»Normalerweise schon. Aber wir hatten gestern Abend mächtig viel Betrieb hier. Ich hatte alle Hände voll zu tun und hab wirklich nicht darauf geachtet. Konnte ja auch keiner ahnen, was mit dem armen Kerl passiert. Aber vielleicht«, fügte er nach kurzem Überlegen hinzu, »fragen Sie einen von den Cowboys dort drüben. Sie waren gestern auch hier.«
Rockwell bedankte sich mit einem knappen Kopfnicken, nahm seinen Hut vom Tresen und ging mit eiligen Schritten auf die drei Männer am hinteren Ende der langen Theke zu. Die Cowboys unterbrachen ihre Unterhaltung, als sie seine Annäherung bemerkten.
»Marshal.«
Rockwell sah die drei der Reihe nach an und nickte dann grüßend. Er kannte sie, wenn auch nicht namentlich, so doch mindestens vom Ansehen.
»Ich glaube, ihr wisst, weshalb ich hier bin«, sagte er anstelle einer langwierigen Einleitung.





























