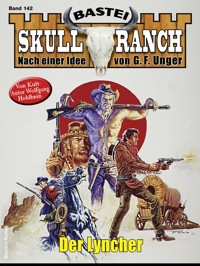
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Connors presste sich eng zwischen die Felsen und sah sich aus angstvoll geweiteten Augen um. Sein Atem ging rasch und stoßweise, und seine Hände zitterten so stark, dass der ehemalige Revolvermann Mühe hatte, den Fünfundvierziger zu halten.
Er hatte nicht mehr die Kraft, bis zur Skull zu kommen. Stantons Männer waren hinter ihm her. Nach allem, was er über Al Stanton, den man auch den Lyncher nannte, gehört hatte, würde er bald tot sein...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Lyncher
Vorschau
Impressum
Der Lyncher
von Starautor Wolfgang Hohlbein
Connors presste sich eng zwischen die Felsen und sah sich aus angstvoll geweiteten Augen um. Sein Atem ging rasch und stoßweise, und seine Hände zitterten so stark, dass der ehemalige Revolvermann Mühe hatte, den Fünfundvierziger zu halten. Er hatte nicht mehr die Kraft, bis zur Skull zu kommen.
Stantons Männer waren hinter ihm her. Nach allem, was er über Al Stanton, den man auch den Lyncher nannte, gehört hatte, würde er bald tot sein...
Irgendwo vor ihm bewegte sich etwas, nicht viel mehr als ein schemenhaftes Huschen in der undurchdringlichen Dunkelheit, deutlich, aber längst nicht nahe genug, um einen sicheren Schuss riskieren zu können.
Vorsichtig erhob er sich auf Hände und Knie und robbte ein Stück weit aus seiner Deckung hervor. Es war so dunkel, dass er kaum fünf Meter weit sehen konnte. Der Mond verbarg sich hinter tief hängenden, schwarzen Regenwolken, und das Rauschen des Windes, der durch das knietiefe Blaugras strich, verschluckte jedes andere Geräusch.
Irgendwo dort vor ihm lauerte der Tod.
Connors Finger strichen behutsam über das kalte Metall des Colts, tasteten über den Lauf und den Hahn und verweilten einen Herzschlag lang auf der Trommel.
Zwei Kugeln. Zwei ganze Kugeln hatten sie ihm gelassen. Zwei Geschosse gegen zwei Gegner, die Pferde und weitreichende Gewehre besaßen und die Landschaft im Gegenteil zu ihm wie ihre Westentasche kannten.
Sein Blick wanderte zu der schwarzen Silhouette der Berge hinüber. Wenn es ihm gelang, dorthin zu kommen, hatte er eine Chance. In dem unübersichtlichen Gelände dort oben mochte ein einzelner Mann schneller vorankommen als ein Reiter. Aber zwischen ihm und den ersten Ausläufern der Berge lagen mindestens drei Meilen offenen, deckungslosen Geländes. Das Gras, das jetzt, im schwachen Licht der Sterne und des Mondes, das ab und zu durch eine Lücke in den Wolken aufblitzte, beinahe schwarz schimmerte, war zwar hoch genug, um einen liegenden Menschen zu verbergen, aber er konnte unmöglich die ganze Strecke auf Händen und Knien kriechen. Und wenn er sich aus seiner Deckung hervorwagte und aufstand, hatte er wahrscheinlich keine zehn Sekunden mehr zu leben. Die beiden Killer warteten nur darauf, dass er sich zeigte.
Dabei zweifelte Connors keine Sekunde daran, dass sie ganz genau wussten, wo er war. Es wäre ein leichtes für sie gewesen, ihn mit ihren Gewehren in aller Ruhe zu erledigen, Versteck hin oder her. Aber das wollten sie gar nicht. Sie wollten, dass er lief, dass er glaubte, ihnen entkommen zu können. Es war ein Spiel, ein tödliches, brutales Spiel, in dem es nur einen Verlierer geben konnte – ihn.
Connors Gesicht verfinsterte sich. Er würde sein Leben so teuer wie möglich verkaufen. Noch lebte er, und noch hatte er eine Waffe, und wenn die beiden Burschen glaubten, leichtes Spiel mit ihm zu haben, würden sie eine unangenehme Überraschung erleben. Es war nicht das erste Mal, dass er in einer scheinbar aussichtslosen Situation stecke, aber bisher hatte er stets eine Möglichkeit gefunden, seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen.
Bisher...
Wieder bewegte sich etwas vor ihm, und dieses Mal war Connors sicher, sich nicht getäuscht zu haben. Ganz automatisch hob er die Waffe und krümmte den Finger um den Abzug. Aber er drückte nicht ab. Die Entfernung und das Licht ließen keinen sicheren Schuss zu, und wenn er nur ein einziges Mal vorbeischoss, konnte er sich die letzte Kugel genauso gut gleich selbst in den Schädel jagen.
Er kroch ein Stück weiter und richtete sich behutsam auf die Knie auf. Sein Körper hob sich als dunkler Schatten gegen die helle Oberfläche des Felsens ab – eine prächtige Zielscheibe, die für einen Mann mit einem Gewehr beinahe nicht zu verfehlen war. Aber dieses Risiko musste er eingehen.
Sekundenlang blieb er mit angehaltenem Atem reglos stehen und lauschte. Das Geräusch des Windes, der durch das Gras zu seinen Füßen strich, schien lauter zu werden, aber dazwischen glaubte er leises Hufgetrappel und etwas, das sich beinahe wie ein spöttisches Lachen anhörte, zu vernehmen.
Connors schüttelte ärgerlich den Kopf und stieß einen lautlosen Fluch aus. Er musste vor allem ruhig bleiben. Wenn er sich selbst verrückt machte, spielte er den beiden Killern nur in die Hände.
Die Wolkendecke riss für einen Moment auf, und die weite Fläche des Valleys schimmerte für Sekunden wie die Oberfläche eines bizarren, in Schwarz und Silber gefleckten Sees. Er presste sich enger gegen den Felsen und schob sich langsam daran empor. Wieder wanderte sein Blick nach Süden und tastete an der gezackten Silhouette der Berge entlang. Seine Hand spannte sich nervös um den Griff des Fünfundvierzigers.
Dann schoben sich die Wolken wieder vor den Mond, und um ihn herum war nichts als undurchdringliche Finsternis. Connors zögerte nicht mehr länger. Mit einer entschlossenen Bewegung stieß er sich von der rauen Oberfläche des Felsens ab, rannte vollends aus seiner Deckung hervor und lief mit weit ausholenden Schritten nach Norden. Die beiden Killer würden sich vielleicht täuschen lassen und ihn auf dem Weg in die Berge suchen; eine winzige Chance nur, aber die einzige, die er hatte.
Er rannte, so schnell er konnte, und warf sich mit einem verzweifelten Satz der Länge nach ins Gras, als die Wolkendecke abermals aufriss. Seine Lungen brannten, und seine misshandelten Muskeln protestierten mit scharfen, brennenden Schmerzen auf die Belastung.
Connors unterdrückte ein Stöhnen und versuchte, möglichst still zu liegen. Das Blut rauschte in seinen Ohren, und sein Herz hämmerte so schnell, dass er sich beinahe einbildete, die beiden Killer müssten die Schläge deutlich hören. Er hob den Kopf und spähte aufmerksam in die Runde. Ein dunkler, verschwommener Schatten hob sich im Süden, fast eine Meile von ihm entfernt, vor dem wogenden Blaugras ab. Zumindest einer der beiden war auf den Trick hereingefallen. Aber wo war der andere?
Connors blieb geduldig liegen, bis der Mond ein weiteres Mal hinter den Wolken verschwand. Dann sprang er auf und rannte geduckt weiter. Mit etwas Glück konnte er die beiden so abschütteln. Er wusste nicht, wie spät es war, aber Mitternacht musste längst vorüber sein. In drei, vier Stunden würde es hell werden. Wenn er so lange durchhielt...
Das helle Peitschen eines Gewehrschusses durchbrach die nächtliche Stille. Connors warf sich instinktiv nach rechts, prallte auf dem Boden auf und rollte sich verzweifelt zur Seite. Ein zweiter Schuss krachte, und das Erdreich dicht neben seinem Gesicht spritzte auseinander. Connors fluchte unbeherrscht, sprang auf die Füße und rannte im Zickzack weiter. Hinter ihm klang das dumpfe Wummern von Pferdehufen.
»Connors!«
Der Outlaw zuckte wie unter einem Peitschenhieb, zusammen. Die Stimme schien ganz dicht hinter ihm zu sein! Er sah sich im Laufen um, gewahrte einen riesigen, schwarzen Schatten und warf sich mit einem verzweifelten Satz zur Seite. Aber er war um eine Winzigkeit zu langsam. Ein Gewehrkolben sauste herunter, verfehlte seine Schläfe um Millimeter und krachte mit fürchterlicher Wucht auf seine linke Schulter. Er schrie auf, fiel zu Boden und blieb sekundenlang benommen liegen. Ein dumpfer, pulsierender Schmerz raste durch seine linke Körperhälfte. Sein Arm war gelähmt und taub. Er versuchte, auf die Knie zu kommen, und sank mit einem wimmernden Laut zurück.
»Nicht schlecht, Connors«, sagte eine Stimme direkt vor ihm.
Mühsam hob er den Kopf. Der Reiter hatte sein Tier einen halben Schritt vor ihm gezügelt und starrte finster zu ihm herab. Sein Gesicht war hinter einem schwarzen, bis dicht unter die Augen hinaufgezogenen Tuch verborgen, aber Connors glaubte trotz der Dunkelheit das fanatische Glitzern in den Pupillen des anderen zu erkennen.
Er stemmte sich hoch, tastete nach seinem Colt und erstarrte zur Bewegungslosigkeit, als der Reiter sein Gewehr hob und die Mündung auf seinen Brustkorb richtete.
»Versuch's«, sagte er leise.
Connors stöhnte. Die Schmerzen in seiner Schulter wichen allmählich einem dumpfen, lähmenden Gefühl, das sich wie eine unsichtbare Welle langsam durch seinen ganzen Körper ausbreitete.
»Jetzt hast du Angst, nicht?«, sagte der Killer spöttisch. Er lachte leise, aber es war ein Geräusch völlig ohne Humor, ein Laut, der Connors eine eisige Welle über den Rücken laufen ließ.
»Wie gefällt dir das Gefühl?«, fuhr der Mann nach einer Pause fort. »Es ist nicht schön, nicht? In einen Lauf zu sehen, ist niemals ein schönes Gefühl. Aber das weißt du sicher besser als ich.« Der Gewehrlauf schwankte für einen Moment, als der Reiter sich im Sattel herumdrehte und nach seinem Kumpan Ausschau hielt.
Connors Finger krochen durch das hohe Gras auf den Colt zu. Die Waffe lag wenige Zentimeter neben seiner rechten Hand.
»Der Trick war nicht schlecht, Connors«, fuhr der Killer fort. In seiner Stimme schien eine Spur widerwilliger Anerkennung mitzuschwingen. »Dein Pech, dass wir mit so was gerechnet haben. Immerhin erfreust du dich eines gewissen Rufes. Vielleicht«, fügte er mit einem leisen, glucksenden Lachen hinzu, »wird dich die Nachwelt als berühmten Revolvermann in Erinnerung behalten.«
Connors Hand hatte die Waffe erreicht. Der Griff schmiegte sich eng und kühl an seine Handfläche, während sein Zeigefinger Millimeter für Millimeter auf den Abzug zu kroch.
»Eigentlich ist es fast schade, dass wir dich so schnell erwischt haben, Connors. Ich dachte, du würdest einen besseren Kampf liefern. Aber wahrscheinlich haben wir dich überschätzt. Im Grunde bist du wohl nichts weiter als ein dreckiger kleiner Killer.«
»Halt endlich die Schnauze«, sagte Connors gepresst. »Wenn du mich umbringen willst, drück ab, aber hör auf zu quatschen.«
Der Reiter schüttelte den Kopf. »O nein, Connors. So leicht machen wir es dir nicht. Du sollst das Gleiche empfinden wie die Männer, die du auf dem Gewissen hast. Wie viele sind es? Acht? Zehn? Oder noch mehr?«
»Ich habe niemanden umgebracht«, sagte Connors. Die Ruhe, mit der er die Worte hervorbrachte, erstaunte ihn beinahe selbst.
»Ach, du hast niemanden umgebracht? Und was war mit diesem Jungen in Cripple Creek?«
»Das war Notwehr«, entgegnete Connors. »Ich wollte ihn nicht töten. Er hat zuerst gezogen!«
»Zuerst gezogen!« Der Reiter schnaubte wütend. »Ein halbes Kind gegen einen Revolvermann wie dich! Und du behauptest, es wäre Notwehr gewesen! Er hätte nicht einmal eine Chance gehabt, wenn er die Waffe bereits in der Hand gehabt hätte!« Er bewegte sich unruhig im Sattel, sah sich noch einmal zu seinem Kumpan um und winkte dann ungeduldig mit der freien Hand. »Und jetzt steh auf, Connors. Steh auf und lauf um dein Leben!«
»Ihr seid verrückt«, keuchte Connors. »Ich habe niemandem etwas getan, und...«
»Das entscheiden wir!«, fuhr ihm der Maskierte ins Wort. »Bild dir bloß nichts darauf ein, dass dich der Marshal von Cripple Creek laufen gelassen hat. Wenn unsere sogenannten Rechtsvertreter nichts gegen Subjekte wie dich unternehmen können, müssen wir eben selbst für Ordnung sorgen. Aber im Gegensatz zu dir geben wir unseren Opfern eine faire Chance. Steh auf und laufe!«
Connors erhob sich schwerfällig auf die Knie. Die Hand mit der Waffe war noch im hohen Gras verborgen.
Das Geräusch eines sich nähernden Pferdes ließ ihn aufsehen. Der zweite Killer näherte sich in scharfem Galopp. Auch der Reiter vor ihm war für den Bruchteil einer Sekunde abgelenkt.
Und der Outlaw nutzte seine Chance sofort! Er federte hoch, ließ sich zur Seite kippen und drückte noch im Hinfallen ab. Der Colt in seiner Hand und die Winchester des Reiters krachten fast zur gleichen Zeit. Connors schrie auf, als die Kugel seine Schulter streifte und ihn herumriss. Der Reiter stieß ein ersticktes Keuchen aus, griff sich an die Seite und kippte dann langsam aus dem Sattel. Die Winchester fiel mit einem dumpfen Poltern ins Gras.
Connors raffte sich mühsam auf und kroch auf Händen und Knien zu dem Gestürzten herüber. Seine Schulter brannte höllisch, aber er biss die Zähne zusammen und versuchte, den Schmerz nicht zu beachten.
Der Killer war noch bei Bewusstsein. Er stöhnte und versuchte, an den Colt in seinem Gürtel zu gelangen, aber Conners gab ihm keine Chance. Er schlug seine Hand beiseite, riss ihn an den Jackenaufschlägen hoch und schmetterte ihm eine fürchterliche Rechte vor die Schläfe. Der Bursche keuchte, verdrehte die Augen und erschlaffte dann.
Connors sprang hastig auf die Füße und war mit einem Satz bei dem Pferd des Bewusstlosen. Das Tier scheute. Connors griff verzweifelt nach dem Sattelknauf, klammerte sich daran fest und zog sich mit letzter Kraft auf den Rücken des Tieres. Sein Körper schmerzte, als wäre er mit Hämmern bearbeitet worden, und sein linker Arm war jetzt vollkommen taub und nutzlos. Er presste die Hand an die Brust, griff nach den Zügeln und zwang das Tier mit brutalem Schenkeldruck herum. Verzweifelt galoppierte er los.
Ein einzelner Schuss krachte – nicht das helle, peitschende Geräusch einer Winchester, sondern das trockene Wummern eines Schrotgewehres. Das Pferd kreischte vor Schmerz, stieg auf die Hinterläufe und warf Connors im hohen Bogen ins Gras.
Der Aufprall brachte ihn an den Rand der Bewusstlosigkeit. Sekundenlang blieb er benommen liegen und kämpfte gegen die schwarzen Wogen an, die sich vor seinen Augen ausbreiteten.
Das dumpfe Hämmern von Pferdehufen brachte ihn in die Wirklichkeit zurück. Er fuhr auf, wirbelte herum – und blickte genau in die Mündung einer doppelläufigen Schrotflinte.
Das Letzte, was er wahrnahm, war ein orangeroter Mündungsblitz. Dann hatte er das Gefühl, dass sein Körper gleichzeitig von hunderten winziger Messer getroffen wurde...
Dann nichts mehr.
Shorty rieb sich müde mit den Knöcheln über die Augen, unterdrückte ein Gähnen und blickte dann mit offenkundigem Missmut zu der kleinen Gruppe Longhorn-Rinder hinüber, die am Ufer des Sees graste. Er war vor Sonnenaufgang aufgebrochen, eigentlich nur ein gewohnheitsmäßiger Inspektionsritt, aber wie immer, wenn man nichts Böses ahnt, war er schon bald auf einen zerstörten Zaun gestoßen, und wahrscheinlich durfte er den Rest des Tages damit zubringen, entlaufene Rindviecher wieder einzufangen.
Er verzog das Gesicht, griff zum Lasso, das zusammengerollt an seinem Sattel hing, und ließ die Hand auf halbem Wege wieder sinken. Sein Kopf dröhnte. Er hatte in der vergangenen Nacht nur wenige Stunden Schlaf gefunden, und entsprechend zerschlagen und matt fühlte er sich. Gestern war Zahltag gewesen, und er hatte sich – eigentlich gegen seinen Willen – überreden lassen, zusammen mit Brazos, Smoky und ein paar der anderen Jungs hinüber zur Wells-Fargo-Station zu reiten und mit Will Shackelford ein Bier zu trinken. Aus dem einen waren dann eine ganze Menge geworden, und alles, was nach Mitternacht geschehen war, schien sich hinter einem dichten, verschwommenen Schleier zu verbergen. Irgendwann in den frühen Morgenstunden waren sie zur Skull zurückgekommen – alles andere als nüchtern und auch alles andere als leise. Wahrscheinlich hatten sie die halbe Ranch aufgeweckt; einer der Gründe, aus denen der kleinwüchsige Cowboy noch vor Sonnenaufgang wieder aus den Federn gekrochen war und die Ranch verlassen hatte. John Morgan verstand manchmal erstaunlich wenig Spaß – vor allem nachts um halb drei.
Shorty dirigierte Rosinante vorsichtig zum Seeufer hinüber und schwang sich steifbeinig aus dem Sattel. Das Pferd senkte den Kopf und begann geräuschvoll zu trinken, während Shorty sich neben ihm auf die Knie sinken ließ, vorsichtig die Fingerspitzen ins Wasser tauchte und sich dann damit das Gesicht betupfte. Es war alles andere als eine richtige Wäsche, aber die Kälte machte ihn doch wach und vertrieb wenigstens für einen Moment den dumpfen Druck aus seinem Schädel. Sekundenlang blieb er, vornübergebeugt und die Hände auf den Oberschenkeln aufgestützt sitzen, ehe er sich seufzend wieder hochstemmte und mit einem ergebenen Achselzucken das Lasso vom Sattelknauf klaubte. Natürlich konnte er unmöglich die ganze Horde – es waren mindestens fünfzehn oder sechzehn Tiere, darunter einige Kälber – mit dem Lasso einfangen und einzeln zur Weide zurückzuschleifen. Aber vielleicht gelang es ihm, sie wenigstens in die richtige Richtung zu treiben. Longhorn-Rinder waren, vorsichtig ausgedrückt, nicht sonderlich intelligent. Wenn sie sich einmal in Bewegung setzten, war es ganz gut möglich, dass sie geradewegs zur Weide zurückliefen und ihm nichts weiter zu tun übrig blieb, als ein paar Yards zerrissenen Zaunes zu flicken.
Aber seine Hoffnungen wurden beinahe sofort zunichtegemacht. In den Büschen hinter der Herde raschelte und knackte es, und dann taumelte eine Gestalt auf den See zu. Ein erschrockenes vielstimmiges Blöken erhob sich, dann fuhr die gesamte Herde wie auf ein gemeinsames Kommando herum und sprengte davon.
Shorty brachte sich im letzten Moment vor einem herangaloppierenden Rind in Sicherheit, hustete demonstrativ und starrte erst die davonpreschende Herde, dann den Fremden finster an.
»Prima gemacht, Mister«, maulte er. »Damit dürfte der Rest des Tages für mich gelaufen sein.«
Der Mann schien seine Worte überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen. Er torkelte weiter auf den See zu, fiel schwer auf Hände und Knie und kroch mühsam auf das Wasser zu.
Shorty blieb verblüfft stehen und runzelte die Stirn. Irgendetwas stimmte nicht mit dem Mann. Er warf der Herde, die in etwa fünfzig Metern Entfernung zum Stehen gekommen war und so friedlich vor sich hin graste, als sei überhaupt nichts geschehen, einen letzten, sehnsüchtigen Blick zu, ließ das Lasso fallen und lief mit raschen Schritte auf den Fremden zu.
Der Mann war wenige Zentimeter vor dem Wasser zu Boden gesunken. Er stöhnte leise, und seine Hände öffneten und schlossen sich unentwegt, als versuche er, nach irgendetwas zu greifen. Shorty sank neben ihn auf ein Knie, hob vorsichtig seinen Kopf an und betrachtete sein Gesicht. Der Fremde hatte dunkle, fiebrig glänzende Augen, deren stierer Blick mehr als alles andere sagten, wie erschöpft und am Ende seiner Kräfte er war. Seine Haut glänzte vor Schweiß, und seine Lippen waren rissig und aufgesprungen.
Shorty beugte sich vor, schöpfte eine Handvoll Wasser aus dem See und benetzte damit die Lippen des Verletzten. Der Mann stöhnte leise. Aber er schien von seiner Umgebung nicht viel wahrzunehmen. Shorty griff vorsichtig unter seine Achseln und drehte ihn auf den Rücken.
Ein erschrockenes Keuchen kam über seine Lippen, als er die Brust des Mannes sah. Hemd und Weste des Fremden waren zerfetzt und geschwärzt von Pulverschmauch und eingetrocknetem Blut. Auf den ersten Blick schien die gesamte Brust des Mannes eine einzige, schreckliche Wunde zu sein.





























