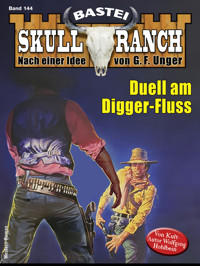
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf den Goldfeldern von Golden City herrscht die Angst, seit Barry Banyons Schlägertrupps die Digger terrorisieren und von ihren Claims zu vertreiben versuchen. So weit will der alte Goldgräber Fred Ransom es erst gar nicht kommen lassen: Eines Nachts verschwindet er heimlich mit seiner Nugget-Ausbeute. Aber Banyons Schläger sind schneller. Sie überwältigen den Oldtimer und richten ihre Revolvermündungen bereits auf sein Herz, als sie eine gefährliche Überraschung erleben: Lester Bouwman, der schwarze Hüne, mischt mit bei den Geiern von Golden City!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Duell am Digger-Fluss
Vorschau
Impressum
Duell amDigger-Fluss
von Starautor Wolfgang Hohlbein
Auf den Goldfeldern von Golden City herrscht die Angst, seit Barry Banyons Schlägertrupps die Digger terrorisieren und von ihren Claims zu vertreiben versuchen. So weit will der alte Goldgräber Fred Ransom es erst gar nicht kommen lassen: Eines Nachts verschwindet er heimlich mit seiner Nugget-Ausbeute. Aber Banyons Schläger sind schneller. Sie überwältigen den Oldtimer und richten ihre Revolvermündungen bereits auf sein Herz, als sie eine gefährliche Überraschung erleben: Lester Bouwman, der schwarze Hüne, mischt mit bei den Geiern von Golden City!
Irgendwo in den Bergen im Osten heulte ein Kojote. Frederick Ransom zuckte zusammen, fuhr hoch und blinzelte sekundenlang schuldbewusst ins schattige Zwielicht des Zeltes, ehe er aufstand und sich mit Daumen und Zeigefinger der Rechten die Müdigkeit aus den Augen rieb. Er war eingeschlafen, obwohl er sich fest vorgenommen hatte, wach zu bleiben. Aber die Zeiten, zu denen er nach Belieben ganze Nächte durchwachen konnte, waren schon lange vorbei. Heute spürte er jede Stunde, jeden Handgriff, jeden verdammten Schritt, den er tagsüber machte. Hastig trank er einen Schluck des nur mehr lauwarmen Kaffees, der in einer verbeulten Blechtasse auf dem Tisch vor ihm stand, ergriff sein Gewehr und schlurfte gebückt zum Ausgang. Er zögerte einen Moment, ehe er das Zelt verließ und auf den schlammigen Vorplatz hinaustrat.
Die Nacht war kühl und – wie er fand – ungewöhnlich still. Er fröstelte, schlug den Jackenkragen hoch und blickte nach oben. Der Mond war halb hinter tiefhängenden treibenden Wolken verborgen; eine silberne blasse Scheibe, die das Tal und die mächtige Gebirgskette im Osten mit bleichem Licht und pechschwarzen Schatten übergoss. Er versuchte, die Zeit zu schätzen. Mitternacht oder später – er musste mehr als drei Stunden geschlafen haben. Sein Rücken schmerzte von der unbequemen Haltung, in der er eingeduselt war, und die Müdigkeit steckte ihm noch immer in den Knochen. Aber er hatte jetzt keine Zeit mehr, auszuruhen. Er hatte schon zu viel Zeit verloren. Viel zu viel.
Er packte sein Gewehr fester und begann einen letzten Rundgang durch das Lager. Die beiden Maultiere waren bereits beladen und dösten mitsamt ihrer Last in dem kleinen Pferch hinter dem Zelt. Ransom spürte, wie sich in ihm etwas zusammenkrampfte. Es war schwerer, als er geglaubt hatte, hier wegzugehen, nach all den Jahren. Er hatte oft mit dem Gedanken gespielt, beinahe jeden Tag, jede Stunde, in der er mit gichtigen, schmerzenden Händen im Boden grub, von einer Hoffnung zur anderen, von einer Enttäuschung zur nächsten. Sehr, sehr oft hatte er sich vorgestellt, wie es sein musste, eines Tages seine wenigen Habseligkeiten zusammenzupacken und endgültig zu verschwinden, um irgendwo im Osten seine letzten paar Jahre zu verleben. Aber es war anders, ganz anders.
Sein Blick wanderte hinüber zu den Bergen. Vor fünfzehn Jahren, bevor er in dieses gottverdammte Nest gekommen war, hatte er dort drüben nach Gold gesucht, hatte sich mit Spitzhacke und Schaufel und Dynamit in die Berge gewühlt und so manches Grain Gold gefunden, aber er war schon lange zu alt für diese schwere Arbeit. Und er hatte es eigentlich gar nicht nötig. In der unauffälligen braunen Satteltasche des Maultieres war genug Goldstaub für den Rest seines Lebens. Keine Reichtümer, aber genug, um die paar Jahre, die ihm noch blieben, in einem bescheidenen Wohlstand und ohne Arbeit verbringen zu können.
Vielleicht, dachte er müde, war es gut, dass Banyon aufgetaucht war. Vielleicht hätte er sonst niemals den Mut gefunden, hier aufzuhören und wegzugehen.
Er vertrieb die düsteren Gedanken mit einem ärgerlichen Schnauben und setzte seinen Rundgang fort. Nicht, dass er nötig gewesen wäre – es gab in seinem Lager nichts zu stehlen, und jedermann im Umkreis von fünfzig Meilen glaubte, dass sein gesamter Reichtum aus einem Gewehr und zwei altersschwachen Mauleseln bestand.
Oder jedenfalls fast jedermann.
Aber er hatte diesen Rundgang an jedem Abend gemacht, und er dachte nicht daran, ausgerechnet heute darauf zu verzichten.
Nach einer Weile kehrte er zu seinem Zelt zurück, lehnte das Gewehr neben dem Eingang gegen die Plane und ging noch einmal hinein, um seine restlichen Besitztümer zu holen. Viel war es nicht. Die Einrichtung bestand aus einem niedrigen Tisch, einer einfachen, harten Liege und einer roh aus Holz zusammengezimmerten Kiste. Er nahm die Kaffeekanne vom Tisch, schüttete ihren Inhalt auf den Boden und kramte anschließend den Tabaksbeutel unter seinem Kopfkissen hervor. Dann schlurfte er wieder aus dem Zelt, befestigte Kanne, Tasse und Gewehr am Sattel des vorderen Mulis und führte das Tier am Zügel aus dem Pferch. Der zweite Maulesel folgte ihm mit hängendem Kopf. Er besaß die Tiere seit fast zehn Jahren, und sie waren oft über endlose Wochen und Monate seine einzige Gesellschaft gewesen. Es würde ihm nicht leicht fallen, sich von ihnen zu trennen. Aber es musste sein.
Er führte die beiden Tiere hundert Meter weit vom Lager fort und wandte sich dann nach Norden. Es war noch ein hübsches Stück Weg bis Golden City, aber er hatte die ganze Nacht Zeit. Es reichte, wenn er bei Sonnenaufgang in der Diggerstadt ankam. Er hatte es nicht eilig. Banyons Schläger würden erst im Laufe des folgenden Tages hier auftauchen. Und wenn sie merkten, dass er nicht da war, war es längst zu spät.
Es ärgerte Ransom, dass sie den Claim nun kampflos bekommen würden. Der Boden barg keine großen Reichtümer, aber es war ein gutes Stück Land, aus dem er noch so manchen Beutel Goldstaub hätte herausholen können. Vor fünfzehn oder zwanzig Jahren hätte er sich nicht so vertreiben lassen – nicht, ohne noch ein paar von diesen Halunken mitzunehmen!
Aber was vergangen war, war vergangen, und es hatte keinen Zweck, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Er schwang sich in den Sattel, presste dem Muli sanft die Schenkel in die Seite und ließ es den Hang hinabtraben. Das Lager verschwand langsam hinter ihm in der Dunkelheit.
Ein leises, metallisches Geräusch ließ ihn aufhorchen. Seine Hand glitt zum Gewehr, während er aus zusammengekniffenen Augen die Dunkelheit vor sich absuchte. Er sah nicht mehr sehr gut in letzter Zeit, und das Bild vor seinen Augen begann immer wieder zu verschwimmen.
Aber er war sicher, sich nicht getäuscht zu haben. Er war nicht allein!
Ransoms Herz begann rasch und hektisch zu schlagen. Plötzlich hatte er wieder Angst, die gleiche, quälende Angst, die er in den letzten Wochen ständig empfand, wenn er ein Geräusch hörte oder einen Fremden sah.
»Ist... ist da jemand?«, fragte er stockend. Seine Stimme klang brüchig und schwankte.
Das Geräusch wiederholte sich, und kurz darauf hörte er das leise Stampfen von Pferdehufen auf dem harten Boden. Zwei dunkle Schatten schoben sich von rechts und links auf den Weg. Reiter!
»N' Abend, Freddy«, sagte eine raue Stimme. Ransom zuckte zusammen. Seine Hand krampfte sich um den Gewehrgriff. Aber er zog die Waffe nicht hervor. Es wäre Selbstmord.
Die beiden Reiter kamen langsam näher. Er kannte sie. Charms und Janderbilt, zwei von Banyons Schlägern.
»Bisschen spät, um spazieren zu reiten, findest du nicht, Freddy?«, fragte Janderbilt. Er war ein großer, hässlicher Kerl mit schwarzem Haar und einer dünnen Narbe auf der rechten Wange, und seine Stimme klang ganz genauso, wie man sich die Stimme eines solchen Mannes vorstellte: hell, unangenehm und krächzend. Ransom hatte den Eindruck, dass Janderbilt diesen Klang sorgsam pflegte, um die Aura von Gefahr, mit der er sich gerne umgab, noch zu verstärken.
»Ich... ich wollte nur...«
»Du wolltest nur abhauen«, fiel ihm Janderbilt ruhig ins Wort. Er lenkte sein Tier dicht neben Ransoms Muli und beugte sich drohend zu dem alten Digger herab. »Ich glaube wirklich, du wolltest einfach abhauen und uns sitzen lassen. Das ist nicht nett von dir, Freddyboy.«
Ransom schluckte nervös. »Ich... wir... wir hatten eine Vereinbarung«, stotterte er. »Ihr wolltet mir bis morgen Abend Zeit lassen.«
Janderbilt grinste. »Sicher doch, Freddy. Aber wie ich die Sache sehe, wolltest du einfach abhauen und unsere Absprache brechen. Was glaubst du, was uns unser Boss erzählen würde, wenn wir morgen zu ihm kommen und ihm sagen müssen, dass du nicht mehr da bist? Ich schätze, er wäre sehr wütend. Wütend auf dich, Freddyboy.«
Ransom rutschte unruhig im Sattel hin und her. Sein Blick irrte verzweifelt über die Büsche und Felsen rechts und links des Weges. Aber es gab keinen Ausweg. Selbst wenn er ein Pferd gehabt hätte statt des langsamen Mulis, hätte er keine Chance gehabt, den beiden Gunslingern zu entkommen.
»Aber vielleicht ist es so auch einfacher«, sinnierte Janderbilt. »Was hast du in den Satteltaschen da?«
Ransom schrak zusammen. »Nichts...«, stotterte er. »Ein... ein paar Kleider, Tabak und Kaffee.«
Janderbilt lachte leise. »Soso, nur ein paar Kleider«, murmelte er. »Zeig sie uns!«
»Zeigen?«, ächzte Ransom. »Aber warum? Ich... ich gehe weg. Banyon kann den Claim haben, geschenkt. Ich will nichts dafür. Ich... ich bin sowieso zu alt für diese Arbeit. Ich will nichts dafür haben. Ich...«
»Du kannst deinen Dreck behalten, Alter«, fuhr ihm Janderbilt hart ins Wort. »Und jetzt steig ab und zeig uns, was du in den Taschen hast. Oder muss ich nachhelfen?«
Ransom schluckte trocken. Eine Sekunde lang hielt er dem Blick des Schlägers stand, dann schwang er sich mit zitternden Knien aus dem Sattel und begann umständlich, seine Gepäckstücke abzuladen. Janderbilt und Charms sahen wortlos zu, aber er spürte, dass ihren aufmerksamen Blicken nichts entging. Betont langsam packte er die Satteltaschen aus und breitete ihren Inhalt auf dem Boden aus.
»Das... das ist alles«, murmelte er.
Janderbilt schnaubte. »Mist«, sagte er. »Nichts als Dreck. Was hast du noch?«
»Nichts«, beteuerte Ransom. »Ich... ich habe nichts, wirklich!«
Janderbilt lachte hart. »Und das sollen wir dir glauben, wie? Hältst du uns für blöd? Du rückst das Gold raus, oder wir helfen dir suchen.«
Ransom zögerte einen Moment und bückte sich dann resignierend nach der braunen Tasche. Er griff hinein, löste den doppelten Boden und nahm einen der handgroßen Beutel hervor.
»Hier«, sagte er leise. »Und jetzt lasst mich in Frieden.«
Janderbilt riss ihm den Beutel aus der Hand, verstaute ihn achtlos in der Jackentasche und gab ihm gleichzeitig einen Stiefeltritt vor die Brust, der ihn zurücktaumeln und hintenüber zu Boden fallen ließ. Er schwang sich aus dem Sattel, riss die Tasche an sich und schüttelte sie kräftig. Sieben, acht der kleinen schweren Beutel fielen heraus und landeten mit dumpfem Geräusch im Sand.
»Siehst du!«, triumphierte Janderbilt. »Ich wusste doch, dass du noch mehr hast!«
»Nicht!«, keuchte Ransom verzweifelt. »Bitte nicht! Das... das ist alles, was ich habe!«
»Was du hattest, Alter«, verbesserte ihn Janderbilt grinsend. »Jetzt gehört es uns.«
»Aber das ist alles, was ich besitze!«, begehrte Ransom auf. »Ich habe mein Leben lang dafür gearbeitet!«
»Na und?«, fragte Janderbilt gleichmütig.
»Aber... aber Mr. Banyon hat... hat gesagt, er würde bezahlen... Er... er wollte mir den Claim abkaufen, und...«
»Das war, bevor du versucht hast, uns aufs Kreuz zu legen, Alter«, sagte Janderbilt hart. »Du bist selbst schuld.« Er bückte sich, sammelte die Beutel ein und verstaute sie in seinen eigenen Satteltaschen. Dann schwang er sich in den Sattel und griff nach den Zügeln.
»Wenn du zum Marshal rennst«, drohte er, »kannst du dich genauso gut gleich aufhängen. Ein Wort, und wir legen dich um.«
Ein helles, metallisches Klicken schnitt durch die Nacht. Janderbilt erstarrte, fuhr nach einer halben Sekunde herum und riss seine Winchester empor.
»Versuch es lieber nicht«, sagte eine Stimme hinter ihm. »Ich hab dich genau im Visier.«
Selbst bei der schlechten Beleuchtung konnte Ransom sehen, wie Janderbilt bleich wurde. Seine Hände begannen zu zittern, und sein Blick irrte unstet über die Büsche entlang des Weges.
»Schmeiß die Knarre weg«, fuhr die Stimme fort. »Und den Colt auch. Schön langsam, damit ich es sehen kann.«
Janderbilt zögerte sekundenlang, aber dann warf er gehorsam die Waffe zu Boden, zog mit zwei Fingern den Colt aus dem Gürtel und ließ ihn ebenfalls fallen.
»Das Gleiche gilt für deinen Kumpel, Freundchen!«
Auch Charms gehorchte, wenn auch mit deutlichem Widerwillen.
»Und jetzt steigt schön von den Gäulen. Und danach hebt ihr die Pfoten über den Kopf und geht fünf Schritt zurück. Und keine Tricks.«
Die beiden Gunslinger gehorchten zögernd. In den Büschen hinter ihnen raschelte es, und eine hünenhafte, schwarze Gestalt trat auf den Weg. Das Gewehr in ihren Händen war drohend auf die beiden Männer gerichtet.
»Ein Nigger*!«, keuchte Janderbilt überrascht, als der Mann näherkam. »Ein verdammter Nigger!«
»Der verdammte Nigger schlägt dir die Zähne in den Hals, wenn du das Wort noch einmal benutzt«, sagte der Schwarze sanft. Janderbilt erbleichte und schluckte die Bemerkung, die ihm auf der Zunge gelegen hatte, herunter.
»Sammeln Sie die Waffen ein, Mr. Ransom«, sagte der Schwarze ruhig. Ransom rappelte sich mühsam hoch, lief zu den beiden Pferden und hob Gewehre und Revolver auf.
»Und jetzt kommen Sie her!«
Der alte Digger gehorchte. Er kannte den Mann nicht, aber er hatte seinem Auftauchen vermutlich sein Leben zu verdanken. Gehorsam stellte er sich neben ihn und richtete ein Gewehr auf die beiden Gunslinger.
»Vielleicht wäre es das Einfachste, euch wie die Ratten abzuknallen«, sinnierte der Schwarze. »Oder euch Ransom zu überlassen.«
Janderbilt fuhr auf. Nachdem er den ersten Schrecken überwunden hatte, schien er seine gewohnte Selbstsicherheit wiederzufinden. »Was mischst du dich ein, Nigger?«, schnappte er. »Du hast mit dieser Sache nichts zu tun!«
»Vielleicht mag ich es nicht, wenn man einen wehrlosen alten Mann ausraubt«, antwortete der Schwarze ruhig. Er lächelte, gab Ransom sein Gewehr und trat rasch auf die beiden Outlaws zu. »Ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass ich das Wort Nigger nicht mag«, sagte er leise.
Janderbilt zuckte zusammen, aber seine Reaktion kam viel zu spät. Der schwarze Hüne schmetterte ihm die Faust unters Kinn, fuhr herum und rammte Charms eine rechte Gerade in den Magen. Die beiden Gunslinger fielen wie vom Blitz getroffen zu Boden und blieben reglos liegen.
Ransom betrachtete den schwarzen Riesen aus großen Augen, als er zurückkam und sein Gewehr wieder aufnahm.
»Ich... ich danke Ihnen«, sagte er schwach. »Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber...«
»Mein Name ist Bouwman«, lächelte der Schwarze. »Lester Bouwman. Aber Sie können mich Lester nennen, wenn Sie wollen.«
Ransom nickte schwach. »Warum... warum haben Sie das getan, Lester?«, fragte er.
Bouwman zuckte die Achseln. »Ich kann es nicht leiden, wenn man sich an Wehrlosen vergreift«, antwortete er. »Und ich kann Ratten wie die da nicht ausstehen.« Er deutete auf die beiden bewusstlosen Schläger. »Was meinen Sie, Fred? Binden wir sie zusammen und liefern sie beim Marshal ab?«
»Beim Marshal?« Ransom blinzelte nervös. »Ich... nein...«
Bouwman grinste. »Angst, Fred?«
Ransom schüttelte hastig den Kopf. »Nein... das heißt... ja«, gab er nach einer Weile zu.
»Hätte ich auch, an Ihrer Stelle«, nickte Bouwman. »Die beiden Burschen haben Ihnen gedroht, nicht wahr?«
Ransom nickte. »Ja. Und... die machen ernst, Lester. Ich kenne sie.«
»Wenn sie hinter Gittern sitzen, können sie Ihnen nichts mehr tun«, versetzte Bouwman.
»Sie sind nicht allein«, sagte Ransom. »Die beiden sind nur... nur Handlanger. Wenn ich sie anzeige, dann... dann schickt Banyon andere.«
»Banyon?« Bouwman wurde hellhörig. »Ich glaube, wir fesseln die beiden Galgenvögel jetzt erst einmal, und dann unterhalten wir uns in Ruhe.«
George Rockwell fuhr sich müde mit der Hand über die Augen, setzte sich auf und blieb noch einen Moment am Rand der schmalen Pritsche sitzen, ehe er mit einem entschlossenen Ruck die Decke zurückschlug und aufstand. Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass er weniger als drei Stunden geschlafen hatte. Der vergangene Abend war hart gewesen – er hatte fast den ganzen Tag im Sattel gesessen, um die Diggercamps, die Golden City in weitem Umkreis umgaben, abzureiten, und seine Heimkehr hatte sich mehr und mehr verzögert. Fast überall hatte er länger als geplant bleiben müssen; reden, hier und da einen Kaffee oder Whisky trinken und Erinnerungen auffrischen. Er war lange genug Marshal in Golden City, um die meisten Goldgräber im Umkreis von dreißig Meilen persönlich zu kennen, und so war es schließlich beinahe vier Uhr morgens gewesen, als er endlich ins Bett gekommen war.
Rockwell runzelte unwillig die Stirn, als sein Blick auf den mit Papieren und Steckbriefen übersäten Schreibtisch fiel. Eigentlich hatte er sich den gestrigen Tag freihalten wollen, um das alte Zeug endlich einmal durchzusehen und auszumisten. Aber es war natürlich wieder anders gekommen; wie immer, wenn man sich etwas ganz fest vornahm.
Er gähnte, trat an den Tisch und nahm den zerknitterten Brief zur Hand, der Schuld an seinem unplanmäßigen Ausflug war. Er war mit krakeliger Handschrift geschrieben, anonym und hatte fast mehr Fehler als richtige Buchstaben. Aber sein Inhalt hatte ihn trotzdem bewogen, sofort aufzubrechen und den Papierkram auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Er seufzte, legte den Brief aus der Hand und schlurfte müde zum Herd, um Kaffee aufzusetzen. Vielleicht würden zwei, drei Tassen starker Kaffee helfen, seine Müdigkeit zu vertreiben und Klarheit hinter seiner Stirn zu schaffen.
Er öffnete die Ofenklappe, verbrannte sich an dem heißen Metall die Finger und setzte fluchend die Kanne auf. Der Tag begann gut.
Es klopfte. Rockwell drehte sich um, blickte stirnrunzelnd zur Tür und überlegte einen Moment ernsthaft, ob er sich einfach schlafend stellen oder seinen morgendlichen Besucher hereinlassen sollte.
Das Klopfen wiederholte sich, dann wurde die Türklinke heruntergedrückt, und eine hochgewachsene, ganz in Schwarz gekleidete Gestalt betrat das Marshal's Office.
»Chet«, knurrte Rockwell in dem vergeblichen Versuch, freundlich zu erscheinen. »Was treibt dich Ehekrüppel um diese Zeit hierher? Bist du auf der Flucht vor deiner Familie?«





























