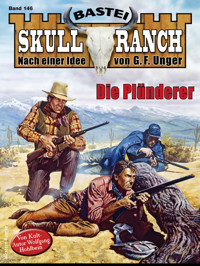
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es ist ein verwegener Haufen, der durch die unwegsame Wildnis der Rocky Mountains reitet. Einundzwanzig Männer, einige in zerschlissenen Uniformen der Südstaatenarmee, sind unter Führung von Major Rouben unterwegs zur Skull-Ranch.
Seit Ende des Bürgerkrieges schlägt sich der kleine Trupp plündernd und raubend durch. Beschlagnahmen nennt das der Major, für den der Krieg noch nicht zu Ende ist. Zur Skull treiben ihn aber nicht nur Hunger und Geldnot. Stanley Rouben sucht den ehemaligen Südstaatenmajor John Morgan, mit dem er noch eine alte Rechnung zu begleichen hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Plünderer
Vorschau
Impressum
Die Plünderer
von Starautor Wolfgang Hohlbein
Es ist ein verwegener Haufen, der durch die unwegsame Wildnis der Rocky Mountains reitet. Einundzwanzig Männer, einige in zerschlissenen Uniformen der Südstaatenarmee, sind unter Führung von Major Rouben unterwegs zur Skull-Ranch.
Seit Ende des Bürgerkrieges schlägt sich der kleine Trupp plündernd und raubend durch. Beschlagnahmen nennt das der Major, für den der Krieg noch nicht zu Ende ist. Zur Skull treiben ihn aber nicht nur Hunger und Geldnot. Stanley Rouben sucht den ehemaligen Südstaatenmajor John Morgan, mit dem er noch eine alte Rechnung zu begleichen hat...
Grauer Dunst lag über dem Tal. Die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen, sondern lohte als hellroter, an den Rändern seltsam zerfasert wirkender Halbkreis über den Bergen. Ihre Farbe suggerierte den Männern eine Wärme, die nicht da war. Die Luft war feucht; eine klamme Nässe, die beharrlich unter ihre Kleider und Decken kroch und ihnen das Mark in den Knochen gefrieren ließ. Die meisten von ihnen bewegten sich unruhig im Schlaf. Ab und zu stöhnte jemand; ein leiser, qualvoller Laut, wie ihn ein Mann von sich gibt, der völlig erschöpft und am Ende seiner Kräfte ist.
Rouben schlug den Kragen seiner zerschlissenen Uniformjacke hoch und ging so leise wie möglich zu seinem Beobachtungsposten zurück. Das Plateau wurde an drei Seiten von nahezu senkrecht emporstrebenden Felswänden begrenzt. Nur hier, zur Talseite hin, gab es eine vielleicht zwanzig Schritte durchmessende Öffnung, die freie Sicht auf das dahinterliegende Gelände gewährte. Er wechselte das Gewehr von der rechten in die linke Armbeuge, lehnte sich gegen den feuchtkalten Fels und kämpfte gegen die Müdigkeit an. Er war erschöpft, mindestens genauso wie seine Männer. In den letzten vier Tagen hatte keiner von ihnen mehr als zwei, vielleicht drei Stunden Schlaf pro Nacht bekommen.
Eine Windböe fauchte aus dem Tal hinauf, überschüttete ihn mit einem Schauer winziger Wassertröpfchen und Kälte und biss wie mit unzähligen winzigen Zähnen in sein Gesicht und die ungeschützten Hände. Er wich weiter in den Schutz des Felsens zurück und kauerte sich zusammen, um dem Wind eine möglichst kleine Angriffsfläche zu bieten. Seine Hände zitterten, und er biss die Zähne so fest aufeinander, dass seine Wangenmuskeln verspannt waren und schmerzten. Er hatte die Wache kurz nach Mitternacht übernommen, den Mann, der ihn nach zwei Stunden hatte ablösen sollen, aber weiterschlafen lassen. Er brauchte diese Zeit, Zeit um allein zu sein und in Ruhe nachdenken zu können. Er lehnte sich zurück, streckte die schmerzenden Beine aus und schloss für einen Moment die Augen. Aber er sah immer noch das Bild des Tales vor sich, wie es sich ihm von hier oben aus geboten hatte – eine gigantische, von zyklopischen Bergen eingefasste Schüssel, auf deren Boden sich ein Meer von fast blau schimmerndem Gras erstreckte.
Seltsamerweise fühlte er jetzt, wo er fast am Ziel war, keinen Triumph, nicht einmal ein Gefühl der Zufriedenheit – im Gegenteil. Wäre der Gedanke nicht so verrückt gewesen, dass er sich instinktiv mit aller Kraft dagegen wehrte, so hätte er sich eingestehen müssen, beinahe enttäuscht zu sein. Fast, als wäre nicht das Finden, sondern das Suchen seine eigentliche Aufgabe gewesen.
Rouben öffnete die Augen, drehte müde den Kopf und ließ den Blick über die schlafenden Männer gleiten. Sie hatten sich in einem engen Kreis dicht um die Feuerstelle herum zusammengedrängt, aber die Flammen waren längst niedergebrannt, und im Inneren des aufgeschichteten Steinkreises glomm nur noch ein Häufchen dunkelroter Glut. Selbst die Pferde, die im Schatten eines überhängenden Felsens am gegenüberliegenden Ende des Lagers angebunden waren, machten einen mitgenommenen Eindruck.
Er seufzte. Er führte den heruntergekommenen Haufen ehemaliger Soldaten jetzt schon sehr, sehr lange, aber in einem so schlechten Zustand wie im Moment war er noch nie gewesen. Es war nicht die Schuld der Männer; auch nicht die seine. Sie hatten Pech gehabt in letzter Zeit, das war alles.
Er bewegte sich, lehnte das Gewehr neben sich an den Fels und angelte nach dem Tabaksbeutel in seiner Tasche. Sekundenlang wog er ihn nachdenklich in der Hand – er war arg zusammengeschrumpft und enthielt nur noch ein paar armselige Krümel, genug für eine, allerhöchstens zwei Zigaretten – ehe er ihn mit einem resignierten Achselzucken wieder in die Tasche gleiten ließ. Nicht nur sein Tabak ging zu Ende. Sie hatten kaum noch Lebensmittel. Die Männer hatten während der letzten zwei Wochen beinahe ausschließlich von Bohnen gelebt, Bohnen und Kaffee, der im gleichen Maße, in dem ihre Vorräte zusammenschrumpften, dünner geworden war, bis sie schließlich nur noch dunkel gefärbtes warmes Wasser zu trinken hatten, und auch die Munition ging langsam, aber unbarmherzig, zu Ende.
Rouben schüttelte den Kopf. Er fragte sich, wie lange die Männer dieses Leben noch mitmachen würden, ohne aufzubegehren. Sie waren zu elenden Hungerleidern geworden, die sich nicht scheuten zu stehlen, wenn es ums Überleben ging. Wie die plündernden Horden, die nach dem Bürgerkrieg das Land unsicher gemacht hatten.
Ein leises Geräusch ließ ihn aufsehen. Einer der Männer regte sich. Die Decke wurde zurückgeschlagen, und ein verschlafenes, schmutziges Gesicht blinzelte zu Rouben hinüber.
Rouben, legte den Zeigefinger über die Lippen, deutete auf die schlafenden Männer und winkte. Richman blinzelte einen Moment verwirrt, nickte dann ebenfalls und befreite sich mühsam aus dem Gewirr von Decken, in das er sich gewickelt hatte. Er stand auf, stakste mit vorsichtigen Schritten zwischen den schlafenden Gestalten hindurch und kam zu Rouben hinüber.
»Major?«
Rouben lächelte flüchtig und machte eine einladende Geste. Richman zögerte einen Moment und ließ sich dann neben ihm nieder. Rouben konnte sehen, wie erschöpft er war. Er fror.
»Wieso sind Sie wach?«, fragte Richman. »Bellamy hatte die letzte Wache.«
Rouben zuckte die Achseln. »Ich weiß. Aber die Männer brauchen jede Minute Schlaf, die sie bekommen können. Sie haben in letzter Zeit mehr gegeben, als sie eigentlich können.«
»Sie aber auch, Major«, antwortete Richman.
Rouben lächelte. »Das Schicksal jedes Feldherren«, sagte er spöttisch. »Schließlich bin ich für die Leute verantwortlich.«
»Eben darum sollten Sie sich schonen«, gab Richman zurück. »Es nutzt uns nichts, wenn Sie vor Erschöpfung zusammenklappen.«
»So weit ist es noch nicht.« Rouben zögerte einen Moment und deutete dann mit einer Kopfbewegung ins Tal hinunter. »Wenn wir dort unten fertig sind, dann suchen wir uns irgendwo eine einsam gelegene Farm. Die Männer brauchen ein paar Wochen Ruhe.«
»Sie brauchen vor allem was zu essen«, sagte Richman. »Und mit der Munition sieht's auch nicht gerade zum Besten aus.«
»Schlimm?«
Richman zögerte einen Moment. »Wie man's nimmt«, sagte er ausweichend. »Ich schätze, dass wir noch zwanzig Schuss pro Mann haben. Vielleicht ein paar mehr.« Er wechselte abrupt das Thema. »Sind Sie sicher, dass dies das richtige Tal ist.«
Der Major nickte. »Hundertprozentig. Schließlich haben wir lange genug gesucht. Wenn der verdammte Nebel nicht wäre, dann müssten wir die Ranch sogar von hier aus sehen können.« Er richtete sich in eine halb hockende Stellung auf, zog den Feldstecher aus dem Gürtel und setzte ihn an.
»Sinnlos«, murmelte er. »Man sieht nichts. Aber sie muss dort unten irgendwo sein. Ziemlich in der Mitte des Tales. Wenn es heller wird, zeige ich sie Ihnen.«
Richman starrte sekundenlang schweigend in den grauen Dunst unterhalb des Lagers herab. Die Nebeldecke riss nur von Zeit zu Zeit auf, sodass er einen Blick auf das darunterliegende Tal werfen konnte. »Wann«, fragte er nach einer Weile, »wollen Sie den... Einsatz durchführen?«
Rouben fiel das unmerkliche Zögern in seinen Worten auf, aber er überging es. Richman war ein guter Mann, vielleicht sein Bester. Und solange er sich solche Entgleisungen nicht vor versammelter Mannschaft erlaubte, konnte er sie ihm durchgehen lassen.
»Nein«, antwortete er. »Die Truppe braucht Ruhe. Ich denke, wir werden den Tag über hierbleiben und bei Einbruch der Dämmerung hinunterreiten. Wir brauchen zuerst Lebensmittel. Und Munition. Die Ranch dort unten hat Hunderte von Longhorns. Wir werden eines davon beschlagnahmen. Ein kräftiges Stück Fleisch bringt uns alle wieder auf die Beine.«
Richman nickte. »Sicher. Aber wir brauchen mehr als Fleisch, Major. Ich... mache mir Sorgen um die Disziplin der Truppe.«
»So?«, machte Rouben.
»Sie hätten Lowman nicht erschießen lassen dürfen«, sagte Richman plötzlich.
Zwischen Roubens Brauen entstand eine steile Falte. »Er war ein Deserteur«, sagte er scharf. »Und Sie wissen, welche Strafe auf Fahnenflucht steht.«
»Natürlich«, murmelte Richman. »Aber die Leute haben in den letzten Jahren einfach zu viel mitgemacht. Besonders in den letzten Monaten. Ich glaube, viele fangen bereits an, sich als eine Art bessere Räuberbande zu fühlen. Wir reiten nur nachts, verstecken uns wie steckbrieflich gesuchte Verbrecher...«
»Sie wissen genau, dass wir nur Erfolg haben können, wenn wir im Geheimen operieren«, belehrte ihn Rouben. »Dieses Yankeegesindel würde uns...«
»Es ist nicht meine Meinung«, unterbrach ihn Richman sanft. »Aber ich dachte, ich sollte Sie warnen.«
Rouben schwieg einen Moment verwirrt. »Sie meinen, sie würden... meutern?«, fragte er ungläubig.
»Natürlich nicht«, sagte Richman hastig. »Aber es ist... sie haben sich ein anderes Leben vorgestellt, als sie sich Ihnen anschlossen.«
»O ja, ich weiß«, sagte Rouben sarkastisch. »Abenteuer und Heldentaten, wie? Sie werden sie bekommen, Sergeant, mehr, als ihnen lieb ist.«
Richman schüttelte den Kopf. »Das ist es nicht. Aber wir kriechen seit Wochen in den Bergen herum, hungern und frieren und was weiß ich noch alles. Die Männer brauchen einfach wieder ein weiches Bett, Essen, Whisky und Frauen. Es sind gute Soldaten, Major, aber es sind auch Männer. Sie gehen für Sie durch die Hölle, aber Sie dürfen sie nicht überfordern.«
»Und was«, fragte Rouben zögernd, »schlagen Sie vor, Sergeant?«
Richman zuckte unglücklich mit den Achseln. »Ich weiß es selbst nicht«, murmelte er. »Damals in Wisconsin oben waren sie zufriedener.«
Rouben schwieg lange, lange Zeit. In seinem Gesicht arbeitete es. Er drehte sich um, blickte auf das nebelverhangene Tal hinunter und fingerte nervös an seinem Gewehr herum.
»In Ordnung«, sagte er schließlich. »Wecken Sie die Männer. Wir reiten in dieses Diggernest.«
»Die Skull-Ranch«, fügte er nach sekundenlangem Zögern hinzu, »kann noch einen Tag warten.«
Die Schüsse hallten so schnell hintereinander durch den schmalen Canyon, dass sie kaum noch einzeln unterscheidbar waren. Ihr Echo wurde von den zerklüfteten Felswänden zurückgeworfen und verzerrt, und irgendwo löste sich eine winzige Steinlawine und polterte krachend zu Tal.
Leroy Spade hatte sich beim Krachen des ersten Schusses instinktiv über den Hals seines Pferdes gebeugt und die Hand nach seinem Gewehr ausgestreckt. Jetzt zog er die Finger wieder zurück und richtete sich langsam wieder auf. Die Schüsse galten nicht ihm. Der Canyon – eine schmale, V-förmige Schlucht, die wie eine mit einer gigantischen Axt gehauene Bresche durch die letzten Ausläufer der Sawatch-Mountains führte – endete wenige hundert Schritte vor ihm im Bluegrass Valley. Und von dort waren auch die Schüsse gekommen.
Spade sah sich aufmerksam nach allen Seiten um, stieg aus dem Sattel und führte sein Pferd am Zügel in den Schatten einer verkrüppelten Konifere, deren Samen von einer Laune des Windes in diese unwirtliche Landschaft getrieben worden war. Er band das Tier sorgfältig fest, zog sein Gewehr aus dem Scabbard und näherte sich zu Fuß dem Ende des Canyons. Im ersten Moment erkannte er nur eine scheinbar endlose, blaugrüne Fläche, als er aus dem schattigen Halbdunkel am Grunde des Canyons hinaustrat. Aber seine Augen gewöhnten sich rasch an das gleißende Sonnenlicht. Er blinzelte, beschattete das Gesicht mit der Linken und ließ sich, das Gewehr schussbereit in der Armbeuge, auf ein Knie sinken. Das Gewehrfeuer wiederholte sich nicht, aber er erkannte jetzt eine Anzahl Reiter – vier oder fünf, das konnte er im grellen Gegenlicht der Morgensonne nicht genau ausmachen – die hinter einem einzelnen Longhornrind herjagten.
Spade beobachtete sie eine Zeitlang. Die Männer waren keine Jäger, das begriff er schon nach wenigen Augenblicken. Longhornrinder konnten zwar ein erstaunliches Tempo entwickeln, waren aber im Allgemeinen nicht intelligent genug, sich einer Verfolgung lange zu entziehen. Aber die Männer dort draußen stellten sich wirklich äußerst ungeschickt an – sie versuchten, das Tier einzukreisen und zum Halten zu bringen, statt es mit dem Lasso zu fangen oder mit einem gezielten Schuss von den Beinen zu holen.
Spade unterdrückte ein Grinsen, als er sah, wie eine der Gestalten ihr Pferd im letzten Augenblick herumreißen konnte und prompt aus dem Sattel fiel, als das Longhorn wie eine außer Kontrolle geratene Dampflokomotive durch den Kreis der Reiter brach.
Die wilde Jagd verlagerte sich langsam in seine Richtung. Das Longhorn schlug einen Haken, blökte wütend und rannte dann auf den rettenden Canyon zu. Spade schlich geduckt zurück, suchte hinter einem Felsvorsprung Deckung und beobachtete gespannt, was weiter geschah.
Die Reiter kamen näher. Spades Augen weiteten sich erstaunt, als er ihre Kleidung erkannte. Er fuhr sich verwirrt mit der Hand über die Stirn, blinzelte und schüttelte ein paarmal den Kopf. Aber das unglaubliche Bild blieb. Die fünf Reiter trugen zerschlissene Uniformstücke der Südstaatenarmee!
Spade duckte sich tiefer hinter seine Deckung, als das Rind mit seinen Verfolgern im Schlepp näherkam. Das Tier hatte sich offenbar in blinder Panik dazu entschlossen, Rettung in der zerklüfteten Dunkelheit des Canyons zu suchen.
Die Männer schossen jetzt wieder. Die Kugeln rissen winzige Staubfontänen aus dem Boden rechts und links des flüchtenden Tieres, klatschten gegen die Felswände und jagten als wimmernde Querschläger davon. Spade schüttelte stumm den Kopf. Es war nicht gerade leicht, vom Rücken eines galoppierenden Pferdes aus zu schießen, aber ein ausgewachsenes Longhorn bot eigentlich ein genügend großes Ziel, selbst für einen ungeübten Schützen.
Das Rind jagte an Spades Versteck vorüber, walzte einen dürren Busch platt und stampfte in blinder Panik weiter. Spade presste sich eng in den Schatten des Felsens, als die Reiter an ihm vorübergaloppierten. Sie waren dicht genug, dass er nur den Arm hätte auszustrecken brauchen, um sie zu berühren, aber sie schienen so auf ihr flüchtendes Opfer konzentriert zu sein, dass keiner Notiz von ihm nahm.
Spade sah besorgt zu dem Baum zurück, an dem er sein Pferd angebunden hatte. Die Männer mussten schon taub und blind auf einmal sein, wenn sie das Tier übersehen wollten.
Wieder krachten Schüsse. Eine Kugel streifte die Flanke des Longhorns und riss es von den Füßen; eine zweite zerschmetterte eines der Hörner. Das Rind strampelte wild, wurde von zwei, drei weiteren Kugeln getroffen und lag dann still. Die Reiter sprengten heran, bildeten mit ihren Pferden einen weiten Halbkreis um das erlegte Longhorn und stiegen aus den Sätteln.
Spade entsicherte sein Gewehr und stand langsam auf. Es würde so oder so nur noch Sekunden dauern, bis einer der Burschen sein Pferd entdeckte.
»Hi, Jungs«, sagte er laut.
Die Männer zuckten zusammen. Zwei, drei Gewehrläufe richteten sich auf Spade.
Der Jäger lächelte – wenn auch nervös und nicht halb so selbstsicher, wie er es gerne getan hätte – deutete eine Bewegung an, als würde er die Hände heben, und ging langsam weiter.
»Ihr wart auf der Jagd?«, fragte er. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass man die meisten gefährlichen Situationen durch Reden entspannen konnte.
Einer der Männer trat aus dem Kreis heraus und kam auf ihn zu. Seine Uniformjacke und die Jeans waren zerschlissen und verdreckt wie die Kleider der anderen, Aber Spade konnte trotzdem die beiden goldenen Litzen an seinem Ärmel erkennen.
»Ich wüsste nicht, was Sie das angeht, Mister«, sagte er scharf.
»Spade«, half Spade aus. »Leroy Spade.« Plötzlich grinste er. »Kommt ihr von einem Maskenball?«
Sein Gegenüber schien für einen Moment nicht zu wissen, ob er ebenfalls lachen oder wütend werden sollte. »Mein Name ist Richman«, sagte er statt einer direkten Antwort. »Sergeant Stewart Richman von der dritten Armee der Konföderierten Staaten. Und wir kommen keineswegs von einem Maskenball, Mr. Spade.«
Spade zuckte gleichmütig die Achseln. »Tut mir leid, Sergeant«, sagte er. »Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Aber das Rind, das Sie da erlegt haben, gehört zur Skull-Ranch, wissen Sie? Es könnte sein, dass Sie Ärger kriegen, wenn Mr. Morgan erfährt, dass Sie sein Vieh abknallen.«
Ein Schatten flog über Richmans Gesicht. Spade sah, wie sich die anderen spannten. Irgendetwas hatte er falsch gemacht. Aber er wusste nicht, was.
»Wir haben das Tier nicht abgeknallt«,





























