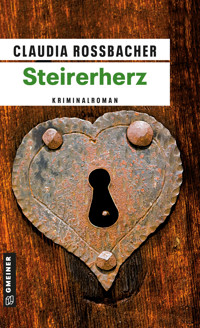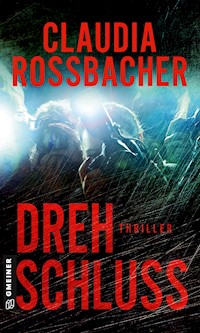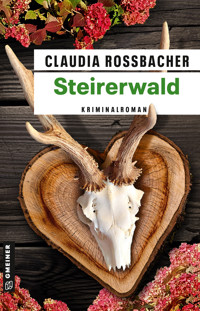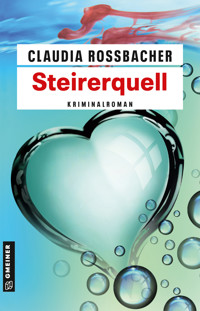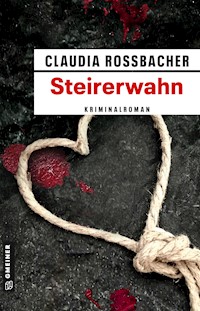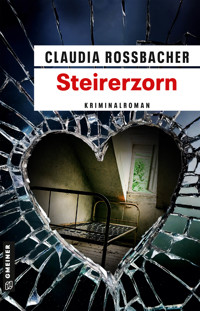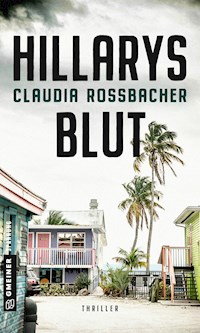Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Beschauliches Graz? Idyllische Steiermark? Das Böse ist bekanntlich immer und überall. Davon wusste schon die steirische Popgruppe EAV ein Lied zu singen. Und das gilt erst recht, wenn an die 200 Krimiautoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Graz einfallen, um dort die CRIMINALE 2017 zu veranstalten. Doch damit nicht genug. Ihre literarisch-kriminellen Spuren führen weiter durch die Steiermark, zu jenen Tatorten, die in spannenden Kurzkrimis verewigt wurden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudia Rossbacher (Hrsg.)
SOKO Graz – Steiermark
Kurzgeschichten zur Criminale 2017
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © dudlajzov / fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5398-4
Inhalt
Impressum
Vorwort
Annafest
Beate Maxian (Burgruine Gösting)
Im Herzen die Sonne
Alexander Pfeiffer (Gleisdorf)
»Aber der Wagen, der rollt«
Klaudia Blasl (Wiener Städtische)
Halloweenberg
Carsten Sebastian Henn (Wies)
Erinnerungen an Graz
Reinhard Kleindl (Theater am Lend)
Der laute Tod des Peppo Wimmer
Isabella Archan (Leibnitz)
Chefsache
Christine Brand (Kleine Zeitung)
Totgeglaubt
Claudia Rossbacher (Energie Steiermark)
Du entkommst mir nicht
Christiane Franke (Wohnpark Graz-Gösting)
Grafs Märchen
Robert Preis (Frohnleiten)
Agathe Bauer
Elke Pistor (Antenne Steiermark)
Nackt
Constanze Dennig (Gratwein-Straßengel)
Selbst die Verrückten
Günter Neuwirth (Stainz)
Leidfaden
Christiane Dieckerhoff (Stadtbibliothek Graz)
Reise mit Robert
Herbert Dutzler (Riegersburg/Zotter Schokoladen)
Herzlichen Dank!
Mit freundlicher Unterstützung der Criminale-Komplizen
Biografien SOKO Graz – Steiermark
Lesen Sie weiter …
Vorwort
Geschätzte Leserinnen und Leser!
Dass Sie dieses Buch gerade in Ihren Händen halten und es hoffentlich demnächst mit großem Vergnügen verschlingen werden, beweist einmal mehr, dass der Krimi aus der Literatur nicht mehr wegzudenken ist. Auch ein Blick auf die Büchertische der Buchhandlungen und in die Bestsellerlisten bestätigt eindrucksvoll, wie viele Leserinnen und Leser gar nicht genug von literarischem Mord und Totschlag bekommen können.
Besonders erfreulich für uns deutschsprachige Krimiautorinnen und -autoren, die wir uns zu Hunderten in der Autorengruppe »Syndikat« zusammengefunden haben, ist die steigende Beliebtheit heimischer Krimis. Vor übersetzten Titeln, etwa aus dem skandinavischen und englischsprachigen Raum, brauchen sich unsere Werke keineswegs zu verstecken. Dabei sind die Unterschiede in der deutschsprachigen Kriminalliteratur so groß wie die Regionen selbst, in denen die Tatorte angesiedelt sind. Gemeinsam ist den meisten eines: Immer mehr Leserinnen und Leser finden Gefallen an bekannten Schauplätzen, vertrauter Mentalität und authentischer Sprache.
Einen weiteren Beweis dafür, dass Verbrechen in der Heimat besonders spannend, unterhaltsam und abwechslungsreich sind, liefert die vorliegende Anthologie, die anlässlich der »Criminale Graz – Steiermark 2017«, dem größten Branchentreffen der deutschsprachigen Krimiszene, erschienen ist. Und nicht nur in der steirischen Landeshauptstadt wird munter gemordet, auch in den ach so idyllischen ländlichen Regionen lebt es sich gefährlich. Zumindest literarisch.
Die nachfolgenden 15 Kurzkrimis stammen von deutschen, österreichischen und Schweizer Autorinnen und Autoren, unter denen sich Preisträgerinnen und Preisträger sowie Nominierte des renommierten Friedrich-Glauser-Preises aus den letzten Jahren befinden. Außerdem Kolleginnen und Kollegen, die sich durch besonderes Engagement im »Syndikat« hervorgetan haben, und nicht zu vergessen: etliche Lokalmatadore, die Graz und die Steiermark bestens kennen. In ihrer aller Namen wünsche ich Ihnen spannende und vergnügliche Lesestunden!
Herzlich
Ihre Claudia Rossbacher
Autorin und Herausgeberin
Annafest
Beate Maxian (Burgruine Gösting)
Der Jungfernsprung war ihm zum Verhängnis geworden. In den Tod war er gestürzt, der Wirt vom Gasthaus »Sommerstein«. Wanderer hatten ihn entdeckt. Sie waren von der Burgruine Gösting kommend nach Raach gewandert, am Tag des Annafestes vor vier Jahren. Wie das Unglück passieren konnte, wurde nie aufgeklärt. Der Hobisch Alois kannte den Weg wie seine Westentasche. Ging er doch sonntags gerne zur Burgtaverne hoch, um den Blick über Graz zu genießen, wie er behauptete. Doch seine Frau, die Gerda, wusste, dass er in Wahrheit wegen dem Schweinsbraten oben war, den es dort einmal die Woche gab und der angeblich besser schmeckte als ihrer.
»Die weiße Frau wird’s g’wesn sein«, hatte Gerda gesagt, und niemand hatte ihr widersprochen. Obwohl das keine reale Gestalt war, sondern ein Wesen, das laut einer Sage um Mitternacht am Fels erscheint, sich drei Mal in die Tiefe neigt und danach händeringend in der Burgkapelle verschwindet. Man ließ der alten Wirtin vom »Sommerstein« jedoch den Glauben, denn die Vorstellung, dass der Alois dort gestorben war, wo sich die Tochter des letzten Burgbesitzers Wulfing von Gösting aus Liebeskummer in die Tiefe gestürzt hatte, gefiel ihr. Nachdem ihr Mann gefunden worden war, hatte Gerda ihre hellblaue Dirndlschürze der Grazer Alltagstracht ein Jahr lang gegen eine schwarze getauscht. Die Gastwirtschaft aber, die war keinen einzigen Tag geschlossen worden. Und natürlich war auch dem Alois sein Leichenschmaus im »Sommerstein«abgehalten worden. Mit eiserner Disziplin führte die Wirtin die Geschäfte fort. Obwohl der Gerda schon bewusst war, dass sie ohne die Mitarbeit ihrer Tochter Eva und ihres Schwiegersohns Anton die anstrengende Arbeit nicht mehr schaffen würde. Sie waren eine große Hilfe, und Gerda achtete darauf, dass alles, was den Gasthof betraf, in ihrem Sinne geschah. Die beiden hatten sich bewährt, und Eva würde bald die neue Chefin werden.
In einem Jahr.
Am Annafest.
Der Tag der Entscheidungen.
Unglück am Berg. Schicksal und Zukunft. Unterschrift beim Notar.
Gerdas Großvater hatte wichtige Entscheidungen stets an diesem Tag getroffen. Und auch ihr Vater hatte die Weichen für die Zukunft der Wirtschaft am Namenstag der Heiligen Anna gestellt. An diese familiäre Sitte hielt sich auch die Gerda.
Natürlich hatte der Tag mit den Gepflogenheiten im Gasthof »Sommerstein« nichts zu tun. Vielmehr ehrte man an diesem Tag die Mutter Marias, ergo Großmutter des Jesuskindes, beim Frühschoppen. Dennoch hielt die Gerda an der Tradition fest, an diesem Tag wichtige Entscheidungen zu treffen. Das war sie dem Andenken ihres Großvaters schuldig. Historische Tatsache hin oder her.
Ein Jahr ging schnell vorbei, doch bis dahin war noch sie die Wirtin, und sie war eine gute Wirtin. Genauso, wie sie eine gute Köchin war. Keine Nouvelle Cuisine, wo man nichts auf dem Teller hatte und viel zahlen musste. Hausmannskost war ihr Geheimnis. Steirisches Backhendl, Selchkäseknödel in Kürbiskernschrot, Ofenbratl und vieles mehr. Die Zutaten bekam Gerda ausschließlich von Bauern aus der Umgebung. Vor allem beim frischen Schweineblut für die Bluttommerl achtete sie mit Argusaugen auf die Qualität. Sie hielt nichts davon, Lebensmittel im Großhandel zu kaufen, bei denen man nicht genau wusste, woher sie kamen. Jede Sau, jedes Huhn und jedes Lamm, das sie ihren Gästen als Köstlichkeit servierte, kannte die »Sommerstein«-Wirtin sozusagen persönlich. Für Vegetarier gab’s Eierschwammerlsterz, Polentaknödel, Kürbiscremesuppe, Steirerkassuppe oder eine Kernöleierspeis.
Gerda Hobischs Kürbiskernschnitzel waren weit über die Grenzen von Graz hinaus bekannt und hatten den Gasthof zu dem gemacht, was er heute war.
So sollte es auch bleiben.
*
Eva band umständlich die Schürze über ihre Jeans. Sie brauchte Zeit, um das soeben Gehörte zu verdauen. Vor wenigen Augenblicken war ihre Welt noch in Ordnung gewesen. Sie hatte die Pfannen und Töpfe auf dem großen Herd platziert, hatte ihren Mann in die Kühlkammer geschickt, um die Lebensmittel zu holen, die sie fürs Kochen zum Annafest brauchte. Um elf Uhr ging’s los, dann wollten die Leute etwas zu essen auf den Tisch. Und dann hatte ihr Anton zwischen Kommen und Gehen mitgeteilt, dass er die Gastwirtschaft verkaufen wolle, sobald ihre Mutter sie ihr übergeben hatte. Einfach so. Noch dazu an den größten Konkurrenten ihrer Eltern, den Helmut Kovic vom »Steigerhof«.
Im Oberen Gösting gab es viele Lokale. Alt und Jung trafen sich dort. Die Wirte vertrugen sich. Doch der Kovic und der Hobisch waren sich nie grün gewesen.
»Schon dein Vater hat verkaufen wollen. Das hat mir der Kovic erst neulich g’sagt«, behauptete Anton. »Aber deine Mutter …«
»So ein Blödsinn. An den Kovic verkaufen«, unterbrach Eva scharf und tippte sich dabei an die Stirn. »Niemals. Der hat dich angelogen. Angebote hat er dem Vater wohl gemacht. Immerhin war er schon lange scharf auf die Wirtschaft, weil das »Sommerstein« die beste Lage in Gösting hat. Siehst ja!« Sie klopfte mit der Hand auf ein offenes Buch. »Auch heute sind wir ausgebucht. Wie jedes Jahr zum Annafest, und was ich gehört hab, sind beim Kovic nicht einmal zehn Tische voll. Also, warum hätten die Eltern verkaufen sollen? Die Wirtschaft läuft gut.«
»Nur weil wir am Annafest voll sind, heißt das noch lange nicht, dass die Wirtschaft gut läuft. Schau dir mal die Zahlen genauer an, Eva!«
»Ich kenn die Zahlen, und so schlecht, wie du tust, sind sie nicht. Gut, das G’schäft ist schon ein bisserl zurückgegangen. Aber mit den Feiertagen, den Touristen im Sommer, Weihnachten, Muttertag und dem Annafest gleichen wir das schon wieder irgendwie aus.« Sie sah Anton direkt in die Augen. »Und verkaufen, merk dir das, werden wir so und so auf gar keinen Fall.« Evas Stimme wurde lauter. »Der Gasthof ist der Mama ihr Ein und Alles. Schon ihr Großvater war hier Wirt, dann ihr Vater, jetzt sie, und in einem Jahr werde ich die Wirtin sein. Ein Verkauf bringt die Mama ins Grab.«
»Na, die Hebamme wäre daran nimmer schuld«, erwiderte Anton murmelnd. »In einem Jahr wird überschrieben, und danach wird an den Kovic verkauft. Das ist mein letztes Wort. Außerdem hab ich das schon mit ihm verhandelt. Ich hab nicht vor, mein Leben lang hinter einer Bar zu stehen, Wein auszuschenken und Bier zu zapfen. Ich habe Tischler gelernt, Eva. Ich will an den Wochenenden freihaben. Im Sommer in den Urlaub fahren. Und mich nicht krumm und bucklert arbeiten müssen, damit die anderen gut essen und saufen können.«
»Und was soll ich dann tun? Beim Kovic als Kellnerin arbeiten, oder was?«
»Du kannst auch zu Hause bleiben. Ich kann meinen alten Job in der Tischlerei wiederhaben. Mit meinem ehemaligen Chef hab ich schon g’redt.«
Eva schnappte nach Luft. »Du hast das alles schon besprochen? Ohne mir vorher etwas zu sagen? Sag einmal, spinnst du?«
»Ich bin kein Wirt, wollt auch nie einer sein, Eva. Das Ganze hier …«, er machte eine Handbewegung, die das gesamte Haus mit einbezog, »hab ich doch nur dir zuliebe mitgemacht. Und wenn in einem Jahr überschrieben wird, ist das unsere Chance.«
»Unsere Chance? Was für eine Chance?«
»Regelmäßige Arbeitszeiten. Urlaub. Freizeit, wenn die anderen auch freihaben. Davon rede ich doch die ganze Zeit.«
»Anton, das hier ist ein alter Familienbetrieb. Das hast du gewusst, bevor du mich geheiratet hast. Das ist nicht irgendein Job, das ist … das ›Sommerstein‹. Das steht für Tradition.«
»Pfeif auf die Tradition.«
»Anton! Sag, drehst du jetzt vollkommen durch? Das funktioniert so nicht. So nicht! Und außerdem: Wem, glaubst du, wird das Haus überschrieben? Mir! Ich entscheide hier, was getan wird und was nicht.«
»Was willst du damit sagen, Eva? Dass ich in Zukunft dein Hausmeister bin? Dann kannst du künftig auch gleich die ganze Arbeit machen, und damit meine ich nicht kochen oder die Gäste bewirten. Damit meine ich Reparaturarbeiten, Rasen mähen, mit den Bauern um den Preis verhandeln. Und weil wir gerade beim Reden sind: Das Fleisch habe ich diesmal woanders gekauft. Der Unger-Bauer hat mich zwar angerufen, aber ich hab ihm gesagt, dass wir ab sofort beim Großhändler einkaufen, weil’s billiger ist. Nur damit du’s weißt – Frau Chefin.«
Wütend schenkte Eva sich einen Gelben Muskateller ein und ließ den Wein ihre Kehle hinunterlaufen. Dann sagte sie mit einem gefährlichen Unterton in der Stimme: »Du gehst da jetzt hin und machst das rückgängig. Wenn das die Mama erfährt … du weißt, dass sie mit dem Unger-Bauern in die Schule gegangen ist, wir dort einen Freundschaftspreis bezahlen, und er immer beste Qualität liefert. Mein Großvater hat schon bei seinem Großvater die Sauen eingekauft. Wenn die Mama das erfährt, kannst du deinen tollen Plan, an den Kovic zu verkaufen, sowieso gleich begraben, dann gibt es nämlich kein Überschreiben. Verstanden?«
In diesem Moment ging die Tür auf, und Evas Mutter betrat die Küche. Sie trug ihr Grazer Alltagsdirndl mit weißer Bluse, dunkelblauem Leib, rot-weiß gemustertem Kittel und hellblauer Schürze. Gerda trug immer Tracht. Eva würde sich später, nach dem Kochen, auch ein Dirndl anziehen. Das gehörte zum Erscheinungsbild des »Sommersteins«.
Anton rauschte mit rotem Kopf und ohne ein Wort des Grußes an seiner Schwiegermutter vorbei.
»Was ist denn mit dem los?«
»Ach nichts«, sagte Eva und versuchte, eine gleichmütige Miene aufzusetzen. »Er hat nur das Fleisch gebracht.«
Ich bring ihn um. Ich bring diesen Scheißkerl um, dachte sie.
Annafest.
Der Tag der Entscheidungen.
Verantwortung übernehmen. Blut vergießen. Veränderung nutzen.
Die Sorgenfalten auf Evas Stirn entgingen der Mutter nicht.
»Können wir jetzt endlich anfangen? Die Gäste kommen bald«, sagte Eva gereizt.
»Es wird sich schon alles ausgehen.« Gerda Hobisch öffnete das Küchenfenster. Das Wetter versprach einen schönen Julitag. Die ersten Wanderer zogen vorbei, auf dem Weg zur 900 Jahre alten Burgruine. Lediglich 20 Minuten dauerte der steile Aufstieg. Am Ende wurde man mit einem atemberaubenden Blick auf Graz belohnt. Der Ortsteil Gösting lag über der Mur und hatte sich über die Jahrhunderte hinweg seine ländliche Struktur erhalten. Etwas, das nicht nur Gerda Hobisch schätzte, sondern auch die Grazer Bevölkerung.
Auf dem Rückweg würden sie in ihrem Gastgarten Platz nehmen, weil die Musik zum Annafest sie anlockte.
Gerda wandte sich um und betrachtete das Fleisch, das auf der Anrichte lag. »Der Unger hat aber auch schon mal bessere Qualität geliefert. Die Schwarte ist zu dünn. Das werd ich ihm von der Rechnung abziehen. Der Anton soll …«
»Die Schwarte ist eh ungesund«, unterbrach Eva.
»Aber wichtig für den Geschmack«, widersprach Gerda, und ihre Tochter wusste, dass sie recht hatte.
»Mama, am besten sag ich’s dir gleich, der Anton hat das Fleisch diesmal nicht beim Unger gekauft«, gab Eva zu.
Gerda Hobisch runzelte die Stirn. Das tat sie immer, wenn ihr etwas missfiel. Zu mehr Emotion ließ sie sich selten hinreißen. Die alte Wirtin wurde niemals laut. Wenn sie wütend war, klopfte sie Schnitzel, passierte Tomaten oder zerdrückte Kartoffeln für ein Püree.
»Und warum?«
»Der Anton meint, der Unger ist zu teuer. Er hat es beim Großhändler viel billiger bekommen.«
»Das ist aber nicht dasselbe«, protestierte die alte Wirtin in ruhigem Ton. »Wie wollt ihr die Qualität und damit den guten Namen erhalten, wenn ihr minderwertiges Zeug kauft?«
»Anton meint, wir müssen wirtschaftlich denken«, sagte Eva mit einem dünnen Lächeln auf den Lippen. Von dem Streit erzählte sie ihrer Mutter nichts. Sie würde weitere Verhandlungen zwischen Anton und Kovic zu verhindern wissen. In Gedanken begann sie, mehrere Möglichkeiten durchzuspielen. Erstaunlich. Alle endeten mit Antons Tod.
»Pah! Wirtschaftlich, dass ich nicht lache. Wenn das Essen schlecht schmeckt, bleiben die Gäste aus. Basta. Denk daran! Du bist die nächste Wirtin. Du entscheidest. Denn du hast ein Erbe zu tragen, und das heißt Qualität. Und dein Mann wird an deiner Seite stehen und es mittragen. Ich bin mir sicher, dass er es verstehen wird, wenn ich ihm den Unterschied zwischen dem hier«, sie hob das Fleisch in die Höhe, »und dem Fleisch vom Unger zeige. Es ist ähnlich wie beim Schnaps, da hat er es doch auch eingesehen.«
»Klar, weil der Greschnig ersoffen ist«, widersprach Eva.
Vergangenes Jahr hatte Anton die Idee gehabt, einen neuen Schnaps ins Sortiment aufzunehmen. Obwohl der Greschnig Otto dafür bekannt war, dass er seinen Schnaps streckte. Eva und Gerda hatten zwar protestiert, aber schließlich doch nachgegeben. Und eines Tages war dieses Problem im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gegangen.
Am Annafest.
Dem Tag der Entscheidungen.
Tiefer Fluss. Dunkle Nacht. Grausamer Fund.
Der gute Mann war in der Mur ertrunken. Er war nachts in den Fluss gefallen und untergegangen.
»Zu viel gestreckten Schnaps gesoffen«, hatte Gerda gemeint, zeitnah die Flaschen des Greschnig in den Ausguss geschüttet und die hochgeistigen Getränke wieder bei ihrem alten Schnapsbauern bestellt. Beim Greschnig im Keller hatte die Polizei dann jede Menge Frostschutzmittel gefunden. Seine Frau hatte sich das Ganze nicht erklären können. Aber das hatte auch niemand erwartet. Und der Leichenschmaus war wieder einmal im »Sommerstein«abgehalten worden.
»Den Unterschied schmeckt doch keiner.« Anton war, von den beiden unbemerkt, in die Küche getreten und hatte das Gespräch mitbekommen. Er wuchtete eine Kiste Kürbisse auf die Ablage.
»Glaubst du wirklich, dass die Gäste den Unterschied nicht schmecken?« Gerda griff nach dem Gemüse, hielt es ihrem Schwiegersohn vor die Augen. »Schau! Hier, der Kürbis zum Beispiel. Er muss auf der Zunge zergehen und trotzdem bissfest sein. Wenn wir den verarbeiten, etwa zu Kürbisgulasch, muss die Qualität ganz einfach schon vorher stimmen. Das ist wie mit der Schwarte beim Fleisch.«
Anton machte eine verächtliche Handbewegung und verließ die Küche wieder. Eva schaute ihm hasserfüllt nach.
Ohne ein weiteres Wort darüber zu verlieren, schaltete Gerda Radio Steiermark ein. Umberto Tozzi sang »Ti amo«.
Die alte Wirtin begann, den Schweinebauch in zwei Zentimeter dicke Streifen zu schneiden. Danach rieb sie die Stücke mit Salz und Knoblauch ein. Das Würzen übernahm sie immer höchstpersönlich, obwohl Eva das Kochen bei ihr gelernt hatte und darin fast genauso perfekt war. Das hatte schon öfter zu heftigen Diskussionen geführt, weil Anton meinte, Gerda solle noch vor dem Überschreiben nach und nach der Eva die Küchenleitung übergeben, und sie solle sich zurückziehen. »Wenn ihr mir das Kochen nehmt, kann ich gleich sterben«, hatte sie den beiden erklärt. Für sie war klar, dass sie auch nach der Übergabe noch in der Küche stehen würde.
Schweigend arbeiteten die beiden Frauen Hand in Hand. Ein eingespieltes Team. Eva schnitt währenddessen Karotten, Sellerie und Kartoffeln in grobe Würfel. In einer Pfanne röstete sie geviertelte Zwiebeln an, gab das Gemüse und ein wenig Tomatenmark dazu. Sie löschte mit drei Esslöffeln Wasser, goss danach mit dem restlichen Wasser auf, bis das Gemüse bedeckt war.
Das Würzen und das Belegen des Gemüses mit dem Fleisch übernahm wieder Gerda. Eva drehte indessen die Temperatur des Ofens auf 170 Grad Celsius. Ihre Mutter schob das Ofenbratl ins Rohr. »Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du die Wirtschaft führen wirst?«, fragte sie ihre Tochter.
Annafest.
Der Tag der Entscheidungen.
Plan erstellen. Problem lösen. Wirtin werden.
Unmerklich zuckte Eva zusammen. »Nein, habe ich nicht«, gab sie zu, während sie Topfen, Mehl, ein Ei, Butter und etwas Salz in eine Schüssel gab. Als Nächstes stand nämlich die Herstellung der Selchkäseknödel auf dem Kochplan.
Während ihre Tochter die Zutaten zu einem Teig verarbeitete, rieb Gerda den Selchkäse für die Füllung, der in Folge mit Topfen, Ei, Majoran, Pfeffer und Salz vermischt wurde. »Das solltest du aber, denn ein Jahr ist bald vorbei.«
»Was schlägst du vor?«, fragte Eva. Sie deckte den Teig mit einem Küchenhandtuch zu und stellte ihn in den Kühlschrank. Er musste nun eine halbe Stunde lang rasten.
»Ich würde dir raten, dass du keine wichtige Entscheidung aus der Hand gibst. Du bist jung, kannst verhandeln, kennst die Bauern und du bist die Wirtin vom ›Sommerstein‹«, sagte sie eindringlich. »Glaub mir, jeder will mit dir ins Geschäft kommen. Jeder.«
Einen Moment lang glaubte Eva, dass ihre Mutter den Streit mitbekommen hatte. Oder wusste sie gar von Antons Plänen? Der Grazer Ortsteil Gösting war wie ein Dorf. Viele kannten einander, und Gerüchte machten schnell die Runde. Aber wie Eva ihre Mutter kannte, hätte sie ihre Tochter schon längst darauf angesprochen, wenn ihr etwas zu Ohren gekommen wäre. Gerda Hobisch war immer für den geraden Weg.
Die alte Wirtin formte aus der Selchkäsemasse kleine Knödel und legte sie auf eine Platte ab, die sie danach kurz in die Tiefkühlung schob.
Eva formte den Topfenteig zur Rolle, von der sie kleine Stücke abschnitt. Darin wurden die kleinen Selchkäseknödel eingeschlagen. Gerda stellte einen großen Topf Salzwasser zu. Darin wurden die Knödel einige Minuten gekocht, bevor sie in gerösteten Kürbiskernen gewälzt wurden.
*
Am Abend war es spät geworden. Die Gäste hatten an diesem Tag oft gewechselt. Einige hatten sich so wohlgefühlt, dass sie den Frühschoppen ausgeweitet hatten und erst kurz vor Mitternacht satt und zufrieden nach Hause gegangen waren. Anton hatte unter dem Vorwand, noch Luft schnappen zu wollen, das Haus verlassen. Gerda war sich sicher, dass ihr Schwiegersohn direkt zum Kovic gegangen war. Eva und sie hatten gemeinsam die Küche aufgeräumt und sich danach in ihre Schlafzimmer zurückgezogen.
Um halb drei Uhr morgens saß Gerda Hobisch schweigend am geschlossenen Fenster und starrte auf die dunkle Straße hinaus. Sie konnte nicht schlafen, hatte kein Licht gemacht, wollte nachdenken. Der Streit, den sie heute belauscht hatte, erinnerte sie an den Streit, den sie selbst mit ihrem Mann oft geführt hatte. Sie hatte den Verkauf an den Kovic schon damals zu verhindern gewusst, und das musste sie jetzt auch wieder tun. Unter ihrer Matratze hatte sie ein kleines schwarzes Buch versteckt. Darin bewahrte sie ihr dunkelstes Geheimnis auf.
Annafest.
Der Tag der Entscheidungen.
Dringender Handlungsbedarf. Wichtige Eintragung. Schwarzes Buch.
Sie holte es hervor, schlug es auf.
»Alois Hobisch:Abgestürzt. Sechs.«
Bis dahin hatte sie gezählt, dann hatte sie ihn unten aufschlagen gehört.
»Otto Greschnig:Ertrunken nach übermäßigem Alkoholgenuss.«
Sie hob den Kopf, blickte noch einmal durch das geschlossene Fenster. Morgen würden neue Ausflügler kommen, hinauf zur Burgruine steigen, und einige von ihnen würden nicht in der Burgtaverne, sondern bei ihnen einkehren. So war das schon immer gewesen. In Gedanken setzte sie gebackene Hendlbrust in Kürbiskernpanier und als Dessert Weinstrauben auf die morgige Tagesmenükarte, danach malte sie in ihrer schönsten Schrift zwei weitere Namen in das schwarze Buch.
Den von ihrem SchwiegersohnAnton und jenen von Helmut Kovic.
Sicher war sicher. Den Todeszeitpunkt und die Todesursache würde sie in Kürze nachtragen. So wie sie es immer getan hatte.
Annafest.
Der Tag der Entscheidungen.
Nachdenken. Verbessern. Erledigen.
Im Herzen die Sonne
Alexander Pfeiffer (Gleisdorf)
Block hatte sich die Zeit im Flieger mit einem Kriminalroman vertrieben. Irgendwas über einen ständig betrunkenen Ex-Polizisten im New York der 70er-Jahre. Block war kein großer Leser, aber er hatte irgendwann herausgefunden, dass einen die Menschen in Zügen und Flugzeugen in Ruhe ließen, wenn man die Nase in einem Buch stecken hatte. Niemand versuchte, einen Lesenden in ein Gespräch zu verwickeln. Er hatte also die knapp anderthalb Stunden von Frankfurt bis Graz überstanden, ohne sich über Haustiere, Kinder oder ähnliche Plagen unterhalten zu müssen.
Am Flughafen Graz-Thalerhof stieg er in ein Taxi, und 20 Minuten später setzte ihn der Fahrer in Gleisdorf ab. Über der kleinen Stadt spannte sich ein makellos blauer Himmel mit einer Sonne, die man speziell für die Gleisdorfer und ihre Gäste dort hingehängt zu haben schien. Block schirmte seine Augen mit der Hand ab, drehte sich einmal um die eigene Achse und nahm die Umgebung in sich auf. Blitzende Fensterscheiben, eine überdimensionale Eistüte an der Hauswand über seinem Kopf, direkt an der Straße eine kleine Mauer, die mit Sonnenblumen bemalt war.
Block zog seinen Rollkoffer hinter sich her und betrat die Pension Messner. Die junge Frau an der Rezeption begrüßte ihn mit einem Lächeln, das weit über ihr Gesicht hinauszugehen schien. Block registrierte das Blau ihrer Augen. Fast wie ein weiteres Stück des Himmels draußen vor der Pension.
Block meldete sich unter dem Namen Johannes Keller an und zeigte eine Kreditkarte vor, die auf diesen Namen lautete. Er erhielt seinen Zimmerschlüssel und wandte sich bereits der Treppe zu, als ihre Frage ihn mitten in der Bewegung stoppte.
»Fahren Sie Rad?«
»Was?«
»Fahrrad«, lächelte die junge Frau. »Ob Sie gerne radeln, meine ich.«
Block sah sie an. Jetzt registrierte er auch ihre Haare. Blond. Wie Sonnenstrahlen, dachte er und schüttelte unwirsch den Kopf.
»Fahrrad?«, wiederholte er schwerfällig.
»Ja«, sagte sie, noch immer lächelnd. »Es lohnt sich. Hier in Gleisdorf, meine ich.«
»Ich bin geschäftlich hier«, sagte Block.
»Dann nehmen Sie sich doch zwischen Ihren Geschäften ein bisschen Freizeit.«
Wieder schüttelte Block den Kopf, wandte sich erneut der Treppe zu. »Ich habe überhaupt kein Fahrrad dabei.«
»Kein Problem«, sagte die junge Frau, und ihr Lächeln schien ihn festzuhalten. »Sie können in Gleisdorf offiziell leider keins leihen. Aber wir haben ein Rad hier im Haus. Ein Gast hat es zurückgelassen. Wenn Sie möchten, können Sie das benutzen, solange Sie hier sind.«
Block ließ die Schultern hängen, starrte die Frau an. Schließlich straffte er sich, griff nach seinem Koffer und schüttelte ein letztes und abschließendes Mal seinen Kopf.
»Nein danke«, murmelte er und machte sich auf den Weg zu seinem Zimmer, dessen Einrichtung in Rot und Orange gehalten war. Der Spiegel an der Wand hatte die Form einer Sonne. Block betrachte kurz sein bleiches Gesicht darin, dann packte er seinen Koffer aus.
Viel war nicht darin. Zwei Hemden zum Wechseln. Unterwäsche, Socken, eine schwarze Hose. Ein Kamm. Der Kriminalroman, den er im Flugzeug gelesen hatte. Ein sehr altes Nokia-Handy und eine neue SIM-Karte in einer Plastikfolie. Ein Foto, das Block vorsichtig nahm und auf das Kopfkissen des Hotelbetts legte. Darauf war das Gesicht eines Mannes zu sehen. Dünnes Haar und blasse Haut. Vielleicht 40 Jahre alt. Keine besonderen Merkmale – so hätte es wohl in einer Polizeiakte gestanden.
Block verstaute sein Hab und Gut im Kleiderschrank, dann verließ er die Pension, um sich ein Restaurant zu suchen. Er war noch nicht weit gegangen, als er am Hauptplatz auf ein Gebilde aus Stahl und Glas stieß, das in der Sonne funkelte und die ganze Stadt mit Licht zu überziehen schien. Wieder musste er seine Augen mit der Hand abschirmen. Die fünf massiven Äste dieses Stahlbaums ragten über seinen Kopf und schienen bis in den Himmel zu reichen. Fast wie die glitzernden Bankentürme in Frankfurt. Nur dass diese Skulptur hier Lebensenergie ausstrahlte und nicht absaugte. Eine seltsame Mischung aus Technik und Natur, die der Sonne entgegenwuchs und zugleich ihre Strahlen bis in jede Ritze der Stadt verlängerte.
Als er am nächsten Morgen auf dem Weg vom Frühstücksbüffet zu seinem Zimmer an der Rezeption vorbeikam, sprach ihn die Frau mit den Sonnenhaaren und den Himmelaugen wieder an.
»Haben Sie es sich überlegt?«
Block hielt in der Bewegung inne. Starrte die Frau an. »Überlegt?«
»Ja«, lächelte sie. »Das mit dem Fahrrad.«
»Oh«, sagte Block.
»Sie können es gerne benutzen.«
Block zögerte. Dann murmelte er: »Es wäre tatsächlich nicht schlecht, wenn ich mobil wäre, solange ich hier bin.«
»Soll ich Ihnen zeigen, wo es steht?«
Block zuckte mit den Schultern. Zehn Minuten später saß er im Sattel und radelte durch Gleisdorf. Von oben die Sonne, von vorne der Fahrtwind. Die steirische Luft schien so ganz anders als die in Frankfurt. Als würde sie sich in seinen Lungen ausbreiten und dort Platz schaffen. Einen Platz, den es vorher nicht gegeben hatte.
Er drehte eine Extrarunde durch die kleine Stadt, vorbei am Solarbaum, über den Rathausplatz und durch den Stadtpark, schließlich entlang der Gleise bis zum Bahnhof und von dort entlang des Flussufers der Raab, noch einmal vorbei an der Pension, bis er vor dem Modehaus Schabernig hielt und abstieg. Er ließ das Fahrrad vor dem Geschäft stehen und trat ein. Eine junge Frau mit dunklen Haaren und akkurat geschnittenem Pony nahm sich sofort seiner an.
»Kann ich Ihnen helfen?«
»Das will ich hoffen«, sagte Block und zog das Foto des Mannes ohne besondere Merkmale hervor. »Kennen Sie diesen Mann?«
Die Frau machte große Augen, trat einen Schritt von Block weg und hielt eine Hand vor ihren Mund.
»Das heißt, Sie kennen ihn«, konstatierte Block.
»Natürlich«, hauchte die Frau. »Das ist doch Herr Tanner. Von nebenan. Aus dem Bestattungsunternehmen, meine ich … Hat er was verbrochen?«
Block lachte. »Wie kommen Sie denn darauf?«
»Na, ist das denn nicht immer so in den Krimis? Dass die Polizei mit dem Foto von einem rumläuft, der gesucht wird? Von einem Verbrecher?«
»Keine Ahnung«, sagte Block. »Ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich glaube kaum, dass der Mann auf dem Foto hier von der Polizei gesucht wird. Herr Tanner, sagten Sie, ist sein Name?«
Die Frau nickte. »Er ist immer so freundlich. So hilfsbereit.«
Block lächelte sie an. »Seit wann arbeitet er denn nebenan?«
Die Frau legte den Kopf schief, dachte nach. »Etwa ein Jahr, würde ich sagen. Ich bin schon seit fünf Jahren hier beschäftigt, wissen Sie, und ich kenne alle unsere Kunden, die Nachbarn sowieso. Und der Herr Tanner, das ist ein ganz Netter. Noch nicht so lange hier, aber ein ganz Netter. Er hat doch keinen Ärger, oder?«
»Ach was.« Block winkte ab. »Wenn er je welchen gehabt haben sollte, ist der jetzt endgültig ausgestanden.«
»Da bin ich aber froh.«
»Und ich erst«, verabschiedete sich Block.
Draußen vor dem Geschäft griff er sich sein Fahrrad, schob es ein Stückchen, vorbei am Bestattungsunternehmen Eden. Schaute dort durch die Fensterfront. Und bekam auch den Mann zu sehen, den die Verkäuferin nebenan als Herrn Tanner bezeichnet hatte.
Block entschied sich für eine weitere Extrarunde. Umfuhr Gleisdorf einmal großzügig und atmete noch mehr von der würzigen steirischen Luft, bevor er in die Pension zurückkehrte, das Fahrrad abstellte und duschte.
Mit einem Handtuch um die Hüften kam er aus dem Badezimmer. Er ließ sich auf dem Bett nieder, holte das alte Nokia-Handy hervor, öffnete es an der Rückseite und setzte die SIM-Karte ein, die er mitgebracht hatte. Dann wählte er eine Nummer in Deutschland mit der Vorwahl von Frankfurt.
»Keller hier«, sagte er. »Ich soll Grüße ausrichten von Tante Simone aus Gleisdorf.«
»Das heißt, du hast sie gesehen?«
»Oh ja.«
»Wie schön«, sagte die blecherne Stimme aus dem Apparat. »Dann grüß sie bitte ganz herzlich zurück.«
»Werde ich machen. Aber ich soll doch wohl nicht mit leeren Händen bei ihr aufkreuzen?«
»Natürlich nicht. Ich habe jemanden vor Ort. Du triffst ihn morgen um 15 Uhr im Café Paradies. Das ist direkt neben deiner Pension.«
»Ich weiß«, sagte Block. »Ich hab die Eistüte gesehen.«
»Was?«
»An der Hauswand, meine ich. Da ist diese … Wie auch immer.«
»Morgen«, wiederholte die Stimme aus Frankfurt. »15 Uhr. Dann bekommst du mein Geschenk für Tante Simone.«
Block nickte dem Handy zu und beendete die Verbindung.
Es war die Sonne, die Block am nächsten Tag weckte. Er hatte die Vorhänge vor seinem Fenster nicht zugezogen, und das Fensterglas verlängerte ihre Strahlen bis in jede Ritze des Zimmers. Er kam ruckartig vom Bett hoch, stellte sich unter die Dusche und rubbelte sich anschließend im Licht der Sonne, das von draußen hereindrang, trocken. Im Spiegel an der Wand sah sein Gesicht überhaupt nicht mehr bleich aus.
Nach dem Frühstück schwang er sich auf das Fahrrad. Wählte dieselbe Route wie am Tag zuvor. Vorbei am Solarbaum, am Rathausplatz, am Bahnhof und der Raab bis zum Modehaus Schabernig, wo er abstieg und sein Fahrrad stehen ließ. Diesmal ging er nicht in das Geschäft. Stattdessen steuerte er den Eingang daneben an. Den des Bestattungsunternehmens Eden. Durch die Fensterfront konnte er den Mann ohne besondere Merkmale sehen. Herrn Tanner. Er trat ein und begrüßte ihn.
»Guten Tag, Herr Engelmann.«
Die blasse Haut des Mannes wurde noch ein bisschen blasser. Fast durchsichtig.
»Wer sind Sie?«, japste er.
»Keller«, stellte Block sich vor. »Johannes Keller.«
»Das ist nicht wirklich Ihr Name«, sagte der blasse Mann.
Block nickte. »So wie Tanner nicht Ihrer ist.«
Der blasse Mann stand zwischen zwei Särgen. Dunkles Holz. Ein Geruch nach Ewigkeit in der Luft. »Würdevoll Abschied nehmen«, stand auf einem Prospekt, den Block auf der Ladentheke sehen konnte.
Der Mann ohne besondere Merkmale, den die Verkäuferin nebenan Herr Tanner genannt hatte, schaute an Blocks Kopf vorbei zur Ladentür. Als müsste dort jeden Moment jemand auftauchen, der die Situation auflösen könnte.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte er.
»Ich soll Ihnen Grüße ausrichten. Von Ihrem ehemaligen Chef in Frankfurt.«
»Ich hatte nie einen Chef in Frankfurt.«
»Ich denke schon. Und er ist immer noch mein Chef.«
»Ach ja?«
»Ja«, sagte Block. »Ein wichtiger Mann im Frankfurter Bahnhofsviertel. Aber das wissen Sie ja. Schließlich haben Sie bis vor etwa einem Jahr noch die Kasse für ihn gemacht, die Buchhaltung und alles andere. Oder wurde die Erinnerung daran zusammen mit Ihrem Namen ausgelöscht, Herr Engelmann? Falls ja, würde ich wetten, das ist passiert, als Sie angefangen haben, mit diesem Staatsanwalt zu reden.«
Der Mann, den die Verkäuferin nebenan Herr Tanner genannt hatte und den Block als Engelmann kannte, sagte gar nichts mehr.
Block sah sich um, nickte anerkennend. »Er hat sie komfortabel untergebracht, Ihr Staatsanwalt. Das muss man ihm lassen. Sie sind ordentlich bezahlt worden für Ihre Kooperation. Neuer Name, neuer Job, neuer Wohnort. Bisschen weit weg von zu Hause, aber vom Feinsten … Dafür haben Sie ja auch erstklassiges Material geliefert. Was sich in der alten Heimat derzeit alle fragen: Werden Sie denn auch vor Gericht aussagen, wenn man Sie dazu auffordert?«
»Ich muss mit Ihnen nicht sprechen«, schnappte der Mann.
»Richtig«, sagte Block. »Müssen Sie nicht. Sollten Sie vielleicht auch besser gar nicht. Sie haben hier ja das große Los gezogen. Warum sollten Sie an Frankfurt überhaupt noch einen Gedanken verschwenden?«
»Sie können sich Ihren Zynismus sparen.«
»Von wegen Zynismus. Ich meine es ernst. Ich bin erst seit gestern hier und fühle mich bereits, als hätte jemand meinen Körper ausgetauscht.« Block verdrehte seinen Kopf, linste nach dem Fahrrad draußen vor dem Fenster. »Diese Luft hier. Die Sonne. Fahren Sie Rad?«
Engelmann starrte ihn an. »Was?«
»Ob Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, meine ich.«
»Manchmal«, murmelte Engelmann.
»Nur manchmal? Wenn ich hier leben würde, säße ich jeden Tag im Sattel.«
Blocks Stimme war lauter geworden. Euphorisch.
Engelmann musterte ihn wie ein Eichhörnchen, das sich einer Schlange gegenübersieht. »Was wollen Sie von mir?«, wiederholte er die Frage, die er schon einmal gestellt hatte.
»Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen«, sagte Block. »Ich werde Ihnen Ihr neues Zuhause nicht verleiden.«
Wieder sah er sich um. Als wollte er die ganze Stadt da draußen vor der Fensterfront mit seinem Blick erfassen.
»Sie haben alles richtig gemacht«, sagte er und nickte Engelmann zu. Oder vielleicht doch eher sich selbst. »Warum sollte man hier überhaupt noch einen Gedanken an Frankfurt verschwenden?«
Es war kurz nach 15 Uhr, als Block das Café Paradies betrat. Den Mann mit dem Geschenk auszumachen, war nicht schwer. Es lag vor ihm auf dem Tisch, das Geschenk. Verpackt in einer roten Schachtel mit kleinen weißen Herzen darauf. Verschnürt mit einem silbern glänzenden Band.
Block nahm den Stuhl auf der anderen Seite des Tisches und setzte sich. Der Mann mit dem Geschenk schaute ihn an. Auf seiner Nase saß eine Sonnenbrille, auf seiner Stirn war eine kleine Narbe, die senkrecht durch eine Reihe von Falten pflügte.
»Keller?«, fragte er.
Block nickte.
»Wie geht es Tante Simone?«
»Sie scheint sich Sorgen zu machen.«
»