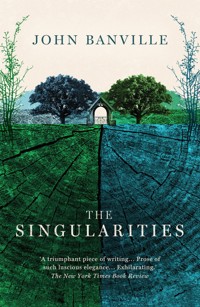18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine persönliche Ode an die faszinierende Stadt Dublin von Man Booker Prize-Träger John Banville. In Spaziergänge durch Dublin nimmt der große irische Schriftsteller John Banville den Leser mit auf eine sehr persönliche Reise zu besonderen Orten in der Sehnsuchtsstadt seiner Kindheit. Geboren und aufgewachsen in Wexford, durfte Banville als Kind an seinem Geburtstag die exzentrische Lieblingstante in Dublin besuchen – die Stadt wurde so für ihn zu einem Ort der Verheißungen. Auch nachdem er als Erwachsener dorthin gezogen war, blieb die Faszination, die Dublin schon auf den Siebenjährigen ausgeübt hatte. Banville führt zu bekannten und weniger bekannten Plätzen, verwebt dabei Erinnerungen an bestimmte Straßen und Gebäude mit seiner Kenntnis des Ortes und seiner Geschichte. Das Ergebnis ist eine eigenwillige Tour durch Dublin, eine zärtliche und imposante Ode an die Stadt und eine Fundgrube für alle Dublin-Reisenden. Ein Buch, genauso vielschichtig, reich, geistreich und überraschend wie die Romane des großen irischen Autors, der auch unter dem Pseudonym Benjamin Black bekannt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
John Banville
Spaziergänge durch Dublin
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über John Banville
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über John Banville
John Banville, geboren 1945 in Wexford, Irland, gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen literarischen Autoren. Sein umfangreiches Werk wurde mehrfach, auch international, ausgezeichnet, zuletzt mit dem Franz-Kafka-Literaturpreis, dem Man Booker Prize (für »Die See«) und 2013 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. John Banville lebt und arbeitet in Dublin und schreibt unter dem Pseudonym Benjamin Black Krimis und Thriller, die neben seinen Romanen ebenfalls bei Kiepenheuer & Witsch erschienen sind.
Christa Schuenke, geboren 1948, übersetzt Lyrik und Prosa aus dem Englischen, u.a. Werke von Banville, Melville, Singer, Shakespeare. Sie erhielt u.a. den Wielandpreis und den Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
John Banville zeigt uns sein Dublin und erinnert sich an die Stadt seiner Kindheit, die für ihn vor allem die große weite Welt bedeutete. Ein sehr persönlicher Stadtführer und zugleich eine autobiografische Reise des großen irischen Schriftstellers an ganz besondere Orte.
Geboren und aufgewachsen in Wexford durfte John Banville als Kind an seinem Geburtstag die exzentrische Lieblingstante in Dublin besuchen – das für ihn so zu einem Ort der Verheißungen wurde. Nachdem er als Erwachsener dorthin gezogen war, sah Banville Dublin zwar mit realistischeren Augen, und doch blieb die Faszination, die die Stadt schon auf den Siebenjährigen ausgeübt hatte. In diesem Buch führt Banville den Leser zu bekannten und weniger bekannten Plätzen. Dabei verwebt er die Erinnerungen, die sich an bestimmte Straßen und Gebäude knüpfen, mit einer großen Kenntnis des Orts und seiner Geschichte. Das Ergebnis ist eine wunderbar eigenwillige Tour durch Dublin und eine zärtliche und imposante Ode an die Stadt. Ein Buch, genauso vielschichtig, reich, geistreich und überraschend wie die Romane des großen irischen Romanciers und Krimiautors.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Time Pieces. A Dublin Memoir.
© 2016 by John Banville and Paul Joyce
All rights reserved
Aus dem Englischen von Christa Schuenke
© 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung Rudolf Linn, Köln
Covermotiv © Douglas Banville
ISBN978-3-462-31957-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Frontispiz
Widmung
John Banville
1 | Über Zeit
2 | Cicero, Vico und das Abbey
3 | Baggotonia
4 | Auf der Straße
5 | Ein Blick vom Pisga auf Palästina
6 | Das Mädchen im Park
7 | Die wiedergewonnene Zeit
Das Ende der Reise
Anhang I
Anhang II
Danksagungen
Literaturnachweise
John Banville
Merrion Square, Südseite
Für Harry Crosbie, Träger des »Order of the British Empire«
Grand Canal an der Percy Place
Georgianischer Hauseingang, Merrion Square
1Über Zeit
DUBLIN WAR NIE MEIN DUBLIN, was es nur umso reizvoller machte. Ich bin in Wexford geboren, einer kleinen Stadt, die zu jener Zeit noch kleiner und noch abgelegener war, im Abseits ihrer eigenen Vergangenheit. Mein Geburtstag fällt auf den achten Dezember, den Feiertag der Unbefleckten Empfängnis – für mich immer der Beleg dafür, wie lächerlich ungenau der Himmel sein kann und was für einen Pfusch er abliefert, wenn es um Geburtsdaten geht. Der Achte war sowohl ein kirchlicher als auch ein allgemeiner Feiertag – ein Tag, an dem die Leute aus der Provinz scharenweise in die Hauptstadt fuhren, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen und die weihnachtliche Festbeleuchtung zu bewundern. Und so bestand meine Geburtstagsüberraschung in der ersten Hälfte der Fünfziger über mehrere Jahre darin, dass wir mit der Bahn nach Dublin fuhren, worauf ich mich immer schon monatelang im Voraus freute – ja, es kommt mir tatsächlich so vor, als hätte ich mich jedes Mal, sobald der letzte Ausflug zu Ende war, schon wieder auf den nächsten im Jahr darauf gefreut.
Früh am Morgen fuhren wir bei winterlicher Dunkelheit vom Nordbahnhof der Stadt ab. Ich glaube, es gab damals noch Dampfzüge, obwohl Diesel bereits groß im Kommen war. Wie aufregend war es doch, noch ganz verschlafen durch die dunklen, menschenleeren Straßen zu gehen, vor mir all die Abenteuer eines langen Tages. Der Zug kam aus Rosslare Harbour und beförderte trübäugige Fahrgäste von der Nachtfähre aus Fishguard in Wales, wovon die eine Hälfte betrunken war, die andere noch gezeichnet von der eben überstandenen Seekrankheit. Dann ging es schnaufend los, das Fenster neben mir ein Spiegel aus schwarzem Glas, in dem ich mein bedrohlich verschattetes Abbild sah und mir vorstellte, ich wäre ein Agent in geheimer Mission, wie man die Spione in den Spionageromanen früher nannte, im Orientexpress, unterwegs zu einem Auftrag im finsteren, gefährlichen Osten.
Als wir irgendwo kurz vor Arklow waren, begann es hell zu werden, und das Weiß der mit Reif überzogenen Felder ging über in eine grell glitzernde Nuance von Glimmer-Pink.
Gewisse Augenblicke an gewissen Orten, beide scheinbar bedeutungslos, prägen sich dem Gedächtnis mit einer unfassbaren Lebhaftigkeit und Deutlichkeit ein – unfassbar, weil, so klar und so lebendig sie auch sind, dennoch der Verdacht aufkommt, sie müssten Erfindungen der eigenen Phantasie sein, wir hätten sie uns, kurz gesagt, nur ausgedacht. Woran ich mich bei diesen Dezemberfahrten noch erinnere oder überzeugt bin, dass ich mich daran erinnere, ist eine bestimmte Stelle, wo der Zug an der Biegung eines Flusses – der Fluss muss der Avoca gewesen sein – seine Fahrt verlangsamte; eine Stelle, die ich immer noch ganz deutlich vor meinem inneren Auge sehe und zu der ich in meinen Romanen wiederholt zurückgekehrt bin, zum Beispiel hier, in Newtons Brief:
Auf der anderen Flussseite zog sich ein flaches Feld bis an den Rand eines bewaldeten Hügels, und am Fuße dieses Hügels stand ein Haus, nicht sonderlich groß, doch einsam und wuchtig mit steilem Dach. Ich starrte auf das stumme Haus und fragte mich voll nagender Neugier, welche Leben dort gelebt wurden. Wer schichtete das Brennholz, hängte die Stechpalmkränze auf, hinterließ Spuren im Raureif auf dem Hügel? Ich kann das seltsam schmerzliche Vergnügen eines solchen Augenblicks nicht schildern. Doch wusste ich natürlich, dass dieses verborgene Leben sich kaum von meinem unterscheiden würde. Darum aber ging es gerade. Mich interessierte nicht das Exotische, sondern das Gewöhnliche, dieses merkwürdigste und flüchtigste aller Rätsel.
Dublin war natürlich alles andere als gewöhnlich; Dublin war für mich, was Moskau für Irina in Tschechows Drei Schwestern war: ein magischer, verheißungsvoller Ort, nach dem sich meine darbende junge Seele endlos verzehrte. Ich war glücklicher dran als Irina, denn die Reise von Wexford nach Dublin war vergleichsweise kurz, und ich konnte sie beliebig oft unternehmen. Dass die Stadt selbst, das wirkliche Dublin, in den von Armut gezeichneten fünfziger Jahren überwiegend grau und ohne jede Anmut war, konnte meinem Traum von ihm nichts anhaben – und ich träumte sogar dann von dieser Stadt, wenn ich mich in ihr aufhielt, sodass sich die banale Wirklichkeit fortwährend in etwas Hochromantisches verwandelte; niemand könnte romantischer sein als ein kleiner Junge, was wohl kaum einer besser wusste als Robert Louis Stevenson.
Wann wird die Vergangenheit zur Vergangenheit? Wie viel Zeit muss vergehen, bevor das, was einfach bloß geschehen ist, auf diese mysteriöse, numinose Weise zu leuchten beginnt, die das Merkmal wirklichen Vergangenseins ist? Die prächtigen Bilder, die wir in der Erinnerung mit uns herumtragen, waren einmal einfach bloß die Gegenwart, fade und alltäglich und ganz und gar nicht bemerkenswert, außer in manchen Momenten, wenn man, sagen wir mal gerade frisch verliebt war oder im Lotto gewonnen oder der Arzt einem eine schlechte Nachricht mitgeteilt hatte. Was ist das für ein Zauber, der auf die Erfahrung einwirkt, sobald sie ins Laboratorium der Gegenwart überführt wird, um dort geformt und poliert zu werden, bis sie ihren vollendeten Glanz hat? Diese Fragen, die alle nur eine einzige Frage sind, faszinieren mich, seit ich als Kind zum ersten Mal die ungeheure Entdeckung machte, dass die Schöpfung nicht nur aus mir selbst bestand, samt allem, was zu mir gehörte – Mutter, Hunger, lieber trocken sein als nass –, sondern auf der einen Seite aus mir und auf der anderen Seite aus der Welt: der Welt der anderen Menschen, anderen Phänomene, anderen Dinge.
Sagen wir so: Die Gegenwart ist das, worin wir leben, die Vergangenheit hingegen das, worin wir träumen. Wenn sie jedoch ein Traum ist, dann einer mit Substanz, ein tragender. Die Vergangenheit gibt uns Auftrieb, wie ein Heißluftballon, der stillsteht und sich immer weiter ausdehnt.
Und doch, ich frage noch einmal: Was ist sie? Welche Verwandlung muss die Gegenwart durchmachen, damit sie zur Vergangenheit wird? Die Alchimie der Zeit, sie wirkt in einem hellen Abgrund.
St Andrew’s Church, Westland Row
Der Bahnhof Westland Row Station – erst Jahre später wurde daraus Pearse Station – bestand im Wesentlichen aus einer rußgeschwärzten gläsernen Kuppel, ein paar trostlosen Bahnsteigen und einer Rampe, die hinunterführte zur Straße. Heute kommt es mir so vor, als ob es jedes Jahr am achten Dezember regnete, wenn wir dort aus dem Zug stiegen. Aber das war nicht der strömende, prasselnde Regen wie im Landesinneren, sondern eine ganz spezielle, großstädtische Variante, die Tropfen so fein und so durchdringend wie Neutrinos, diese Schauer, dieses Gewimmel von subatomaren oder sogar subsubatomaren Teilchen, die dich und mich und alle Dinge jeden Augenblick durchzucken. Das Pflaster wurde gar nicht richtig nass von diesem Regen, eher schmierig, sodass man vorsichtig laufen musste mit seinen glatten Ledersohlen.
Wandten wir uns draußen vor dem Bahnhof nach links zur Westland Row, dann sahen wir dort auch schon die Kirche St Andrew’s vor uns aufragen, die in meinen Augen so ziemlich den eigenartigsten Standort in der ganzen Stadt hat: Wie mit der himmlischen Dampframme hineingequetscht, klemmt sie mitten in einer Zeile unscheinbarer, entschieden säkularer Häuser aus dem achtzehnten Jahrhundert. Mir kam der Bau immer ein bisschen verrückt vor mit diesen zwei übergroßen pseudokorinthischen Säulen, der mächtigen, durchaus nicht einladenden Pforte und dem mäßig steilen Dach, an dessen höchster Stelle eine Statue des heiligen Andreas, des älteren Bruders des berühmteren Petrus, steht und in Frustration erstarrt den Arm erhoben hält, als warnte er, von niemandem beachtet, vor einer nahenden Apokalypse.[1]
Am Ende der Straße befand sich und befindet sich noch immer Kennedy’s Pub, die Stammkneipe von Samuel Beckett in seiner Zeit als Student am nahe gelegenen Trinity College. Wenden wir uns von dort nach links und dann gleich wieder nach rechts, kommen wir zum Merrion Square, wo im Haus Nummer eins, einem – zumindest äußerlich – schönen, typisch georgianischen Reihenhaus, Oscar Wilde geboren wurde, Sohn von William Wilde, der, wie es heißt, ein »ausgezeichneter Arzt« war. Oscars Mutter war die ebenso bemerkenswerte wie faszinierende Jane Francesca Wilde, geborene Elgee, die um 1840 herum unter dem Pseudonym Speranza patriotische Gedichte für die Zeitung The Nation verfasste, das Sprachrohr der Bewegung Young Ireland; ihre Verse waren so mitreißend, dass sie einmal in einer besonders turbulenten Phase um ein Haar wegen Volksverhetzung im Gefängnis gelandet wäre.
Unnötig zu sagen, dass ich zu der Zeit, über die ich hier schreibe, von alledem nicht die geringste Ahnung hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damals überhaupt schon einmal von dem armen Oscar gehört hatte, an den heute eine scheußlich bunt bemalte Statue erinnert, die ihn an der vis-à-vis von seinem Geburtshaus gelegenen Ecke des Platzes auf einem von einem Geländer umfassten Felsbrocken lümmelnd darstellt. Was für Demütigungen wir uns doch gegenüber den berühmten Toten herausnehmen! Nach Samuel Beckett, dem friedliebendsten Menschen weit und breit, haben wir einen Kampfhubschrauber benannt, und ein paar Fetzen Prosa aus dem Ulysses sind, eingraviert in kleine Messingplatten, ins Dubliner Straßenpflaster eingelassen, wo die Leute sie mit Füßen treten.
Hier halte ich inne, um mit Verwunderung darüber zu sinnieren, wie erstaunlich doch die Dinge miteinander zusammenklingen, sei es auch nur leise, und das durch die Jahrhunderte hindurch. Der Vater von Jane »Speranza« Wilde war in Wexford Anwalt gewesen, und erst kürzlich übernachtete ich in Paris in dem Hotelzimmer, in dem Oscar, ihr Sohn, unter der Last seiner Schulden, ächzend und die schreckliche Tapete beklagend, seinen letzten Atemzug getan hat. So groß sie ist, die Welt, mitunter kommt sie einem doch bedenklich klein vor.
Das Haus Merrion Square Nr. 1
Zur Zeit meiner ersten Geburtstagsausflüge bewohnte meine Tante Nan, die die Schwester meiner Mutter war und ihr ganzes Erwachsenenleben in Dublin verbracht hat, eine winzige Wohnung in der Percy Place.[2] Sie befand sich im Erdgeschoss eines Hauses, das es schon längst nicht mehr gibt; was ich dort noch am deutlichsten in Erinnerung habe, ist, dass man drinnen direkt an der Haustür eine hohe Stufe hinuntergehen musste, um vom Bürgersteig in den Hausflur zu kommen, ein Manöver, dass ich immer beängstigend fand, selbst noch, als ich schon groß genug war, um es mühelos zu bewältigen. Die Kindheit ist voller obskurer Ängste und Schrecken.
In der Wohnung im oberen Stockwerk lebte eine große, ungehobelte Familie, die auf den merkwürdigen und, wie ich fand, faszinierenden Namen Reck hörte. Eine ihrer Töchter, ein wilder Wirbelwind mit Ringellöckchen und knochigen rosa Knien, war die erste unerwiderte Liebe meines Lebens. In der Hoffnung, die unerreichbare Geliebte nur einmal kurz zu Gesicht zu bekommen, wenn sie in ihren großen Schulschuhen und mit hüpfenden Ringellöckchen die Treppen hinuntergepoltert kam, trödelte ich immer eine Ewigkeit in dem schäbigen Hausflur herum, der nach Tee und Nachttopf miefte. Kaum anzunehmen, dass sie mich überhaupt bemerkt hat, wie ich da lauerte, aschfahl im Gesicht vor unaussprechlicher Sehnsucht, ein reichlich frühreifes Opfer von Cupido.
Auf der anderen Straßenseite war eine Zeile von einem halben Dutzend Häusern, die wohl zu der Zeit gerade erst neu gebaut worden waren; Behausungen für den Mittelstand mit Erkerfenstern und blitzenden Messingtürklopfern. Norman Sherry erzählt in seiner gigantischen Graham-Greenes-Biographie eine kuriose Anekdote über diese ansonsten durchaus respektabel und ordentlich wirkende Häuserzeile. Irgendwann Anfang der fünfziger Jahre kam Greens Geliebte, die schöne, rassige Catherine Walston, eine gebürtige Amerikanerin und Ehefrau des märchenhaft reichen englischen Geschäftsmanns Lord Harry Walston, hierher, mietete sich vorübergehend in einem dieser Häuser ein und stopfte sich während ihres Aufenthalts ein Kissen unters Kleid, um den Eindruck zu erwecken, sie sei schwanger. Der Grund dafür war wohl, dass eine der Freundinnen ihres Mannes, die in Irland lebte, ein Kind erwartete, und als guter Kumpel, der sie war, hatte Catherine eingewilligt, das unerwünschte Baby als ihr eigenes auszugeben. Sie kam also nach Dublin rüber, stellte ihren markanten falschen Babybauch zur Schau und sollte dann heimlich bei der Geburt dabei sein, um den kleinen Jungen hinterher als ihren Sohn nach England mitzunehmen. Autres temps, autres mœurs.
Percy Place Nr. 2
Ich meine, das muss zu der Zeit gewesen sein, als Lady Walston, die nach Aussage eines ihrer Liebhaber »eine Schwäche für Priester« hatte, Father Donal O’Sullivan kennenlernte, einen schillernden Jesuiten, der später Direktor des Arts Council wurde und dem Greene, grün vor Eifersucht, den Spitznamen »Skunkburgh« verpasste. Catherine und der ehrwürdige Father hatten eine Affäre oder jedenfalls etwas, das dem sehr nahekam – über die Beschaffenheit der sexuellen Arrangements zu jener Zeit, als Verhütungsmittel in Irland gesetzlich verboten waren, lässt sich schwer spekulieren. Bekannt ist jedenfalls, dass das Paar Jahr für Jahr zusammen in Venedig Urlaub machte, und wie man sich erzählt, trafen sie sich auch des öfteren zu einem Stelldichein in Lady Walstons Dubliner Wohnung – in der Percy Place? Das will ich doch sehr hoffen.
Ich frage mich, ob die Lady hier seinerzeit auch noch einen anderen berüchtigten klerikalen Lebemann getroffen hat, nämlich Father Con Lee, damals Kurat an St Andrew’s, der turmlosen, aber dennoch nach Höherem strebenden Kirche in der Westland Row. Der Father war ein schneidiger Kerl, und seine priesterliche Garderobe war von ungewöhnlich gutem Sitz – mit vollem Namen hieß er Cornelius Frawley Lee, und seiner Familie gehörte das einstmals sehr beliebte und überaus erfolgreiche Kaufhaus Frawley’s. Meine Schwester kannte ihn; sie sagt, die Kinder in der Westland Row gaben ihm den Spitznamen Bat Masterson, wohl wegen seines düster-forschen Dandytums. Er hielt sich offenbar für einen Literaten oder so was Ähnliches – einen flüchtigen Auftritt hat er in den Memoiren des Dichters John Montague, der mit seiner Frau in der Herbert Place wohnte und berichtet, wie Unehrwürden eines Abends bei ihm zu Hause hereinschneite. Er war der erste katholische Kaplan am Dubliner Trinity College. Erzbischof John Charles McQuaid unseligen Angedenkens beorderte ihn in den erzbischöflichen Palast und informierte ihn über die Ernennung, wobei er drohend hinzufügte, dass dies eine inoffizielle Berufung sei und Father Lee »auf sich allein gestellt« wäre, falls es irgendwelchen nicht näher spezifizierten »Ärger« geben sollte. Con Lee war genau die Sorte, die Catherine Walston nur allzu gern in ihrer Sammlung von zweifelhaften Klerikern gehabt hätte.
Was für ein seltsamer Gedanke, dass ich irgendwann mal völlig ahnungslos einen Blick auf La Walston mit ihrem Kissen unterm Kleid hätte erhaschen können, wenn ich in der Percy Place gerade die steile Stufe zur Wohnung meiner Tante Nan hinunterstieg.
Wir trafen immer so am späteren Vormittag in der Percy Place ein, meine Mutter, meine Schwester und ich, angeschmuddelt von der Reise, durchgeweicht vom Regen und nach Schafen riechend – dass mein Vater uns auf diesen Geburtstagsausflügen begleitete, kommt mir eher unwahrscheinlich vor. Tante Nan hatte ein Geburtstagsüberraschungsfrühstück vorbereitet – das Wort »Brunch« war der Sprache noch nicht aufgedrängt worden – mit Würsten, ausgelassenem Speck, gebratenen Eiern, gebratenem Brot und zum Runterspülen reichlich teakfarbenem Tee, stark genug, dass eine Maus drauf trippeln könnt’, wie meine Mutter sagen würde. Es gab auch eine Schokosahnetorte von der Bäckerei Kylemore, auf die in weißem Zuckerguss mein Name gespritzt war.
Meine Tante war eine alte Jungfer – ein zu jener Zeit noch ganz alltäglicher Ausdruck; mir persönlich hat das Wort »Junggesellin« immer besser gefallen, weil es sich vornehmer anhört, und noch heute mag ich nicht oder wage es nicht, allzu viel darüber nachzudenken, dass es doch schwer und traurig für sie sein musste, so allein zu leben, und dass ich später, in den frühen Sechzigern, als ich gleich um die Ecke, in der Upper Mount Street, noch einmal eine Wohnung mit ihr teilte, nichts getan habe, um es ihr leichter zu machen. Tante Nans Auftreten war allerdings alles andere als traurig: Sie besaß einen subversiven Humor und hatte für die, denen es bestimmt war, über uns, die Masse der Geknechteten, zu herrschen, nichts als ein höhnisches Gekicher übrig. Besonders glühend, kann ich mich erinnern, war ihre Verachtung für unseren Taoiseach, unseren Premierminister, was seinerzeit Éamon de Valera, genannt »Dev«, war, einstmals Führer der stärksten Partei und Veteran des Aufstands von 1916, den seine amerikanische Staatsbürgerschaft, sehr zum Leidwesen nicht weniger seiner politischen Gegner, vor der standrechtlichen Erschießung bewahrt hatte. Womit genau sich Dev die Schmähungen meiner Tante verdient hatte, vermag ich nicht zu sagen, kann mich aber noch gut daran erinnern, wie sie jedes Mal verächtlich die Mundwinkel nach unten zog, wenn sie es beim besten Willen nicht vermeiden konnte, den Namen von »diesem langen Elend« über die Lippen zu bringen.
Spielzeugknarren. Ich hatte eine Leidenschaft für Spielzeugwaffen. Bei einer frühzeitigen Inventur meines Arsenals kam ich auf vierundzwanzig verschiedene Revolver, teils sechsschüssige, teils automatische, außerdem Strahlenpistolen, nachgemachte Smith&Wesson Saturday Night Specials, darüber hinaus Derringers, Steinschlosspistolen und, mein ausgemachter Liebling, eine in allen Einzelheiten nachgebaute Miniaturversion der berühmten Winchester M1873, mit der in den fünfziger Jahren Lin McAdam (James Stewart) in dem gleichnamigen Western »Dutch Henry« Brown (Stephen McNally) endlich zur Strecke brachte, bevor er mit seiner Herzliebsten, dem Saloonmädchen Lola (Shelley Winters, auch sie eine meiner ersten hoffnungslosen Lieben), einen Hausstand gründete. Nach zu viel Kylemore-Torte im Bauch war mir etwas flau, was meiner Aufregung freilich keinen Abbruch tat, und so riss ich hastig Tante Nans Geschenk auf, das – wie jedes Jahr – in einer Spielzeugwumme bestand; obwohl, einmal hatte sie mir ein Plastik-U-Boot geschenkt, das ich in der Badewanne schwimmen lassen konnte; das war zwar nicht die erhoffte Schusswaffe, aber dennoch ein Riesenerfolg.
Nach unserem späten Frühstück kam der Ausflug »in die Stadt« an die Reihe. Ich bilde mir ein, wir stiegen an der Haltestelle Baggot Street in den Bus der Linie 10 und fuhren ins Zentrum.
Ertappt, halte ich einen Moment inne, erinnere mich an die Baggot Street Bridge und den Blick nach Norden – nach Norden, stimmt das? –, den Grand Canal entlang bis zur Huband Bridge und darüber hinaus. Ich bilde mir ein, jeder von uns hat einen bestimmten Ort, der so was ist wie ein privates Paradies, wie der Himmel, in den wir nach dem Tod gern kommen würden, wenn sich’s denn nicht vermeiden lässt, dass wir irgendwohin kommen. Für mich sind diese stille Wasserfläche mit dem raschelnden Schilf und der dunkel umbrafarbene Treidelpfad von der Baggot Street hinab zur Lower Mount Street das schönste Stückchen Wasserlandschaft, das ich kenne; es übertrifft sogar den anderen Canale Grande, den mit den trällernden Gondolieri. Ich empfinde es als eine der glücklicheren Fügungen meines Lebens, dass ich diese Gegend schon kennenlernen durfte, als ich noch ganz klein war, dieses »Baggotonia«, wie seine Einwohner es zärtlich und mit Besitzerstolz nennen, und dass ich schließlich das Glück hatte, zeitweilig dort zu wohnen, nämlich während einer Reihe von Jahren, die ich wohl meine »prägenden« nennen muss.
Grand Canal an der Percy Place
Grand Canal an der Herbert Place
Ja, ich weiß, der Canal war Patrick Kavanaghs Domäne, was ich seinem Schatten mit Vergnügen konzediere. Eigentlich wollte ich hier nur den Anfang seines sehr berühmten Gedichts auf diesen Ort zitieren, aber als ich es wieder las, fand ich es so wunderschön, dass ich mich entschloss, es nun in voller Länge wiederzugeben.
Verse, geschrieben sitzend auf einer Bank am Grand Canal, Dublin, »Errichtet zum Andenken an Mrs O’Brien«
Ach, denkt an mich dort, wo’s Wasser gibt,
Am besten das vom Canal, still und grün
Im Mittsommer schimmernd, wie hab ich’s geliebt.
Bruder, so denkt an mich, so schön.
Wo an einer Schleuse niagarisch tosen
Die Fälle für jene, die sitzen dort
In der Mittjulistille, der unerhört großen.
Nie wieder Prosa – kein einziges Wort –,
Spricht, wer die Parnass’schen Inseln fand.
Schamvoll den Kopf gesenkt, zieht vorbei
Ein Schwan, und es scheint ein phantastisches Licht
In den Augen der Brücken! Ein Schiff aus Athy
Und noch ferneren Städten bringt Mythen herbei.
Ein Heldengrabmal, nein, das taugt für mich nicht,
Eine Bank am Canal, wo der Wandrer verweilt,
Nur solch eine Bank soll mein Denkmal sein.
Dieser ziemlich deutliche Wink mit dem Zaunpfahl kam an, dem Dichter wurde sein Wunsch tatsächlich erfüllt, und das sogar doppelt, denn es gibt am Canal nicht nur eine Bank, die seinem Andenken gewidmet ist, sondern gleich ihrer zwei, und das hätte der knorrige alte Knacker bestimmt mit einem zufriedenen Grinsen quittiert.
Die Idee, zur Erinnerung an eine bestimmte Persönlichkeit einen Gedenksitz aufzustellen, geht zurück auf das Jahr 1967 und den seligen John Ryan, seines Zeichens Künstler, Zeitschriftenherausgeber, Kritiker und, man glaubt es kaum, Gastwirt – ihm gehörte das Bailey in der Duke Street, eine damals höchst angesagte sogenannte Künstlerkneipe mit angeschlossenem Esslokal, die heute noch ganz gut läuft. John Ryan war zu seinen Lebzeiten eine ziemlich bedeutende Persönlichkeit. In seinen Dubliner Memoiren mit dem Titel Remembering How We Stood (Vergesst nicht, wie wir standen) – ein Witzbold meinte einmal, in Anbetracht der Trinkgewohnheiten der Leute, über die er dort schreibt, wäre Forgetting How We Staggered (Vergesst mal, wie wir schwankten) wohl der passendere Titel gewesen – berichtet Ryan, wie er und sein Freund Denis Dwyer eine Kommission für die Aufstellung einer Gedenkbank gründeten. Die Kommission traf sich immer sonntagvormittags mehr oder minder zufällig im Ormond, »dem Hotel der ebenso schillernden wie fugalen[3] Joyce’schen Erinnerungen«, wie Ryan es nannte. Aus Angst vor der unvermeidlichen »Spaltung«, wie Brendan Behan einmal sagte, bei den Iren stets Punkt eins auf der Tagesordnung einer jeden politischen oder gesellschaftlichen Bewegung, setzten Ryan und seine Mitstreiter sich den 17. März als Stichtag. »Die Iren brauchen immer einen festen Stichtag, wenn sie etwas zustande bringen wollen«, konstatierte Ryan. »In der schalen Leere unbegrenzter Zeit löst all ihr Hoffen und ihr Streben sich auf wie Frühnebel am Morgen.«
Grand Canal an der Clanwilliam Place
Die Bank wurde von dem Künstler Michael Farrell entworfen, »der sich bei seinem Entwurf auf eine grobe Skizze auf einem Bierdeckel stützte, die ich im Baily an der Theke gemacht hatte«, so Ryan. Gebaut wurde sie aus Eichenholz aus dem County Meath und Granit von den Dubliner Bergen, und in den Stein gravierte der Monumentalbildhauer John Cullen Verse aus Kavanaghs Gedicht. Material und Herstellung wurden durch Spenden finanziert, die unter anderem von dem englischen Dichter John Heath-Stubbs, dem späteren Präsidenten Irlands, Cearbhall Ó Dálaigh, und dem protestantischen Erzbischof von Dublin, Dr George Otto Simms, kamen. Woran man sehen kann, dass Kavanaghs Werk weithin Anklang fand.
Erstaunlicherweise wurde der Termin tatsächlich eingehalten, und am 17. März 1968, dem St Patrick’s Day, versammelte sich eine kleine Schar, um die auf dem Treidelpfad unterhalb der Baggot Street Bridge errichtete Bank festlich einzuweihen.[4] Schauspieler des Abbey Theatre lasen aus den Werken des Dichters, und wenn wir Ryan glauben dürfen, blieb bei den Anwesenden kein Auge trocken. Nicht weniger als drei Priester waren da – das war lange bevor die entsetzlichen Fakten über Kindesmissbrauch durch Geistliche bekannt wurden, seither scheuen die Kirchenmänner ja eher das Licht der Öffentlichkeit oder erscheinen zumindest in Zivil –, und so wurde die Bank, wie es sich gehörte, mit dem Segen des Herrn geweiht, der seines Amtes waltet und sie über all die Jahre hinweg getreulich beschützt hat, denn sie steht dort bis heute, schön verwittert und einladend wie eh und je. Wie hat John Ryan doch so schön gesagt:
Wenn der Sommer im Zenit steht, wenn der Himmel vollends überhäuft ist vom ungestümen Laub der Pappeln und Buchen, scheint es, als verschmölzen der Himmel, die Bäume und das Wasser zu einem zitternden Ganzen. Von seiner Bank aus sieht man das Wasser des Canal sich »niagarisch« in die Schleuse stürzen, und wenn man den Kopf hebt, wird der Blick wohl eine halbe Meile den Canal hinaufgelenkt, wo er auf das zwinkernde Auge der Eustace Bridge fällt. Dann ist das Herz berührt von der unermesslichen Schönheit all dessen. In solch einem Moment möchte man einräumen, dass ein parnassischer Gott (ein Freund des Dichters) über der Szene waltet.
Die andere Bank, auf der mit verwegener Miene und dabei zugleich entschieden gespenstisch eine von dem Bildhauer John Coll geschaffene lebensgroße Bronzestatue des bebrillten Dichters lümmelt, wurde im Sommer 1991 von der damaligen Präsidentin Mary Robinson enthüllt, sofern man eine Bank enthüllen kann. Man kann sich irgendwie schon denken, welcher dieser beiden Bänke Kavanagh den Vorzug gegeben hätte.
»Genie«, sagt Baudelaire, »ist nichts anderes als die deutlich ausformulierte Kindheit.« Ich glaube, dass der große französische Dekadente, der dies über den gleichermaßen dekadenten englischen Essayisten Thomas De Quincey, den Verfasser der Bekenntnisse eines englischen Opium-Essers,