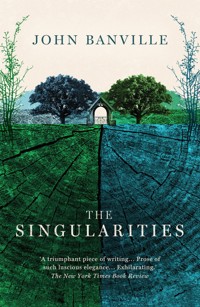10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man Booker Prize 2005 für den Roman Die See Der Kunsthistoriker Max Morden flieht in das Haus am Meer, wo er als Kind aufregende Ferientage verbrachte. Indem er sich die damaligen Erlebnisse vergegenwärtigt, um mit dem Verlust seiner Frau fertig zu werden, werden jedoch auch alte Wunden aufgerissen. Alles hängt miteinander zusammen. Anna und der Kunsthistoriker Max sind glücklich verheiratet, als sie erfahren, dass Anna unheilbar an Krebs erkrankt ist und nicht mehr lange leben wird. Nach ihrem Tod flüchtet Max ans Meer, in den Ort, in dem er als Kind aufregende Sommer verlebte. Damals lernte er die unkonventionelle Familie Grace kennen mit ihrem Zwillingspaar Myles und Chloe. Mrs. Grace zieht den jungen Max magisch an und erweckt eine große Sehnsucht in ihm. Indem sich Max fast manisch erinnert, an seine erwachende Sexualität in diesem Sommer, an seine erotischen Phantasien und die spätere Liebe zu Chloe, an seine glückliche Zeit mit Anna und ihre letzten Tage im Krankenhaus, versucht er, sich mit dem erlittenen Verlust zu versöhnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
John Banville
Die See
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über John Banville
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über John Banville
John Banville, 1945 geboren, gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Irlands. Sein umfangreiches literarisches Werk wurde mehrfach, auch international, ausgezeichnet. John Banville lebt und arbeitet in Dublin.
Christa Schuenke, geboren 1948, übersetzt Lyrik und Prosa aus dem Englischen, u.a. Werke von Banville, Melville, Singer, Shakespeare. Sie erhielt den Wielandpreis und den Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Anna und der Kunsthistoriker Max sind glücklich verheiratet, als sie erfahren, dass Anna unheilbar an Krebs erkrankt ist und nicht mehr lange leben wird. Nach ihrem Tod flüchtet Max ans Meer, in den Ort, in dem er als Kind aufregende Sommer verlebte. Damals lernte er die unkonventionelle Familie Grace kennen mit ihrem Zwillingspaar Myles und Chloe. Mrs. Grace zieht den jungen Max magisch an und erweckt eine große Sehnsucht in ihm. Indem sich Max fast manisch erinnert, an seine erwachende Sexualität in diesem Sommer, an seine erotischen Fantasien und die spätere Liebe zu Chloe, an seine glückliche Zeit mit Anna und ihre letzten Tage im Krankenhaus, versucht er, sich mit dem erlittenen Verlust zu versöhnen.
In einer poetischen Sprache und mit Anspielungen auf Literatur, Kunst und Mythologie zeigt dieser Roman, wie Erinnerung, Verlust und Identität zusammenhängen. Ein ehrlicher und dennoch hoffnungsvoller Roman, für den John Banville den Man Booker Prize 2005 erhielt und der zu seinen erfolgreichsten Romanen zählt.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
I. Kapitel
II. Kapitel
Für Colm, Douglas, Ellen, Alice
I
Sie sind gegangen, die Götter, am Tag dieser eigentümlichen Flut. Den ganzen Morgen, unterm milchigen Himmel, war das Wasser der Bucht immer weiter angeschwollen, zu unerhörter Höhe, und die kleinen Wellen krochen über den ausgedörrten Sand, der seit Jahren nicht mehr durchnässt worden war, außer vom Regen, bis an die Dünen krochen sie und leckten ihnen die Füße. Der rostige Koloss des Frachters, der vor langer Zeit, länger, als wir alle uns zurückerinnern können, am anderen Ende der Bucht gestrandet war, glaubte wohl gar, es wäre ihm vergönnt, noch einmal auszulaufen. Ich sollte nie mehr schwimmen gehen nach diesem Tag. Die Seevögel wimmerten und stießen herab, als hätten sie die Nerven verloren beim Anblick dieser riesigen Schale voll blasenartig sich blähenden, bleiblauen, böse glitzernden Wassers. Unnatürlich weiß sahen sie aus an diesem Tag, die Vögel. Am Ufer hinterließen die Wellen eine Spitzenborte von schmutzig gelbem Schaum. Kein Segel verschandelte den hohen Horizont. Ich sollte nie mehr schwimmen gehen, nein, nie mehr wieder.
Gerade schritt einer über mein Grab.
Irgendeiner.
Die Villa heißt Zu den Zedern, wie eh und je. Links davon blickt immer noch diese struppige, affenbraune, nach Teer stinkende Baumgruppe mit ihren gespenstisch ineinander verstrickten Stämmen über den ungepflegten Rasen hinweg auf das große Bogenfenster des einstigen Wohnzimmers, das Miss Vavasour im Vermieterinnenjargon freilich die Lounge zu nennen beliebt. Auf der anderen Seite befindet sich die Haustür und davor das ölfleckige Kieskarree hinter dem noch immer grün gestrichenen Eisentor, dessen Gestänge allerdings der Rost so weit zerfressen hat, dass davon nichts mehr übrig ist als nur ein leise zitterndes Filigran. Staunend registriere ich, wie wenig sich verändert hat in diesen mehr als fünfzig Jahren, die ins Land gegangen sind, seit ich zuletzt hier war. Staunend und enttäuscht, ja, ich würde so weit gehen zu sagen, erschrocken, und das aus Gründen, die mir selbst nicht klar sind, denn warum sollte ich mir wohl Veränderungen wünschen, ich, der zurückgekehrt ist mit der Absicht, hier in den Trümmern der Vergangenheit zu leben? Ich frage mich, weshalb man das Haus in dieser Form gebaut hat, mit der fensterlosen weißen, rau verputzten Stirnwand schräg zur Straße; vielleicht, weil die Straße früher, bevor die Eisenbahn da war, ganz anders verlief und direkt an der Haustür entlangführte, alles ist möglich. Miss V. möchte sich mit den Daten nicht festlegen, glaubt aber, dass man hier zuerst, Anfang des vorigen Jahrhunderts, ich meine, des vorvorigen Jahrhunderts, ich verliere allmählich die Übersicht bei den Jahrtausenden, ein kleines Bauernhaus errichtet hat, an das dann über die Jahre hinweg alle möglichen Anbauten drangepappt wurden. Das würde auch erklären, weshalb man den Eindruck hat, alles sei irgendwie zusammengewürfelt, diese kleinen Zimmer, hinter denen plötzlich größere liegen, die Fenster, die auf leere Wände blicken, die niedrigen Decken überall. Die Pitchpineböden geben dem Ganzen eine maritime Note, ebenso wie mein Drehstuhl mit der fragilen Rückenlehne. Ich stelle mir einen alten Seemann vor, der, endlich zur Landratte mutiert, am Kamin sitzt und vor sich hin döst, derweil draußen die Winterstürme an den Fenstern rütteln. Ach, wäre ich doch er. Gewesen.
Als ich vor all den Jahren hier war, damals, zu Zeiten der Götter, war die Pension Zu den Zedern eine Sommerfrische, die man jeweils für vierzehn Tage oder für vier Wochen mieten konnte. Jedes Jahr im Juni fiel ein reicher Arzt mit seiner großen, kreischenden Familie dort ein und blieb den ganzen Monat – wir konnten die Arztkinder mit ihren lauten Stimmen nicht leiden, sie lachten uns aus, standen auf der anderen Seite des Tors, jener unüberwindbaren Schranke, und bewarfen uns mit Steinen, und nach ihnen kam ein ominöses Paar mittleren Alters, das mit niemandem sprach und jeden Morgen um dieselbe Zeit grimmig schweigend seinen wurstförmigen Hund auf der Station Road spazieren führte, hinunter an den Strand. Aber der interessanteste Monat in der Pension Zu den Zedern war für uns der August. Da waren nämlich jedes Jahr andere Mieter da, Leute aus England oder vom Kontinent, hin und wieder auch ein Pärchen in den Flitterwochen, dem wir nachspionierten, und einmal sogar eine Schauspieltruppe von einer Wanderbühne, die in dem Zinkblechkino unten im Dorf eine Nachmittagsvorstellung auf die Beine stellte. Und dann kam damals in dem Jahr Familie Grace.
Das Erste, was ich von den Leuten sah, war ihr Auto, das drüben, jenseits des Tores, auf dem Kieskarree parkte. Ein ziemlich zerkratzter und zerbeulter schwarzer Wagen mit lang gezogener Motorhaube, beigefarbenen Ledersitzen und einem großen Speichenlenkrad aus poliertem Holz. Hinten, auf der Ablage unterm sportlich abgeschrägten Heckfenster, achtlos hingeworfene Bücher mit ausgeblichenen, zerfledderten Schutzumschlägen und dazu eine sehr abgegriffene Straßenkarte von Frankreich. Die Haustür stand weit offen; von drinnen aus dem Erdgeschoss hörte ich Stimmen, oben das Patschen nackter Füße auf den Dielen, ein Mädchen lachte. Ich war draußen am Tor stehen geblieben, hatte unverhohlen gelauscht, und jetzt kam plötzlich ein Mann mit einem Glas in der Hand aus dem Haus. Er war klein und oberlastig, breite Schultern, breite Brust, großer runder Kopf mit kurz geschnittenem, krausem, schwarz glänzendem, stellenweise vorzeitig grau meliertem Haar und ebenfalls meliertem Spitzbart. Er trug ein weites grünes, offen stehendes Hemd und kakifarbene Shorts und war barfuß. Und so braun gebrannt, dass die Haut richtig violett schimmerte. Selbst seine Füße, fiel mir auf, waren oben auf dem Spann gebräunt, wo doch die meisten Väter, die ich kannte, von der Kragenlinie abwärts bleich waren wie ein Fisch am Bauch. Er stellte sein Glas – eisblauer Gin mit Eiswürfeln und einer Zitronenscheibe – gefährlich schief aufs Autodach, öffnete die Beifahrertür, beugte sich hinein und kramte unter dem Armaturenbrett herum. Im unsichtbaren Obergeschoss des Hauses lachte abermals das Mädchen und stieß übermütig einen schrill kollernden – und unverkennbar gespielten – Angstschrei aus, dann wieder das Patschen hastig davonlaufender Füße. Sie spielten Fangen, sie und jemand anders, der keine Stimme hatte. Der Mann richtete sich auf, nahm seinen Gin vom Wagendach und warf die Autotür zu. Er hatte das, wonach er suchte, nicht gefunden. Als er sich umdrehte, um wieder ins Haus zu gehen, begegneten sich unsere Blicke, und er zwinkerte mir zu. Aber nicht auf diese schelmische und zugleich einschmeichelnde Art, die ich normalerweise von Erwachsenen kannte. Nein, es war ein komplizenhaftes, ein verschwörerisches Zwinkern, fast wie bei den Freimaurern, als hätte dieser Augenblick, den wir, zwei Fremde, der eine ein Erwachsener, der andere ein Junge, miteinander geteilt hatten und der, rein äußerlich betrachtet, keinen tieferen Sinn, keinen Inhalt besaß, dennoch etwas zu bedeuten. Der Mann hatte ungewöhnlich blassblaue, geradezu durchsichtige Augen. Er ging hinein und fing, noch in der Tür, zu reden an. »Dieses verdammte Ding«, sagte er, »hat sich anscheinend …«, dann war er weg. Ich blieb noch ein paar Minuten draußen stehen und fixierte die Fenster im oberen Stockwerk. Wo aber kein Gesicht sich zeigte.
Dies also war meine erste Begegnung mit den Graces: Die von oben kommende Stimme des Mädchens, die hastigen Schritte und der Mann hier unten mit den blauen Augen, der mir so lässig und vertraulich und fast schon diabolisch zugezwinkert hatte.
Eben habe ich mich wieder dabei ertappt, bei diesem dünnen, eintönigen Pfeifen durch die Vorderzähne, das ich mir neuerdings angewöhnt habe. Diedel diedel diedel, geht das, wie ein Zahnarztbohrer. So hat mein Vater immer gepfiffen, werde ich jetzt etwa er? Im Zimmer gegenüber lässt Colonel Blunden das Radio spielen. Am liebsten hört er die Gesprächssendungen am Nachmittag, in denen aufgebrachte Bürger anrufen und sich über die verbrecherischen Politiker, die Alkoholpreise und andere Dauerreizthemen beschweren. »Gesellschaft«, sagt er kurz, räuspert sich, guckt leicht verschämt, und seine hervorstehenden, halb beduselt wirkenden Augen weichen mir aus, obwohl ich ihn gar nicht zur Rede gestellt habe. Ob er beim Radiohören auf dem Bett liegt? Schwer, ihn sich da drinnen vorzustellen, dicke Wollsocken an den Füßen, zehenwackelnd, Krawatte ab, klaffender Hemdkragen und die Hände hinter dem sehnigen alten Nacken verschränkt. Außerhalb seiner vier Wände läuft er immer rum, als ob er einen Spazierstock verschluckt hat, kerzengerade vom spitzen Scheitel seines kegelförmigen Schädels bis zu den Sohlen seiner vielfach geflickten, blank gewienerten derben braunen Straßenschuhe. Er lässt sich jeden Samstagmorgen beim Dorffriseur die Haare schneiden, Fassonschnitt, hinten alles ab und an den Seiten auch, da kennt er kein Pardon, nur oben bleibt ein steifes graues Büschel, raubvogelartig. Seine ledrigen Ohren mit den langen Ohrläppchen stehen ab; wie erst getrocknet und danach geräuchert sehen sie aus; auch das Weiß in seinen Augen hat einen Stich ins Gelbliche, wie Räucherware. Ich höre das Stimmenbrummen aus seinem Radio, verstehe aber nicht, wovon die Rede ist. Kann sein, ich werde hier verrückt. Diedel diedel.
Später dann an jenem Tag, dem Tag, als die Graces angekommen waren, oder auch am nächsten Tag oder an dem darauf, sah ich das schwarze Auto wieder, ich habe es sofort erkannt, gleich, als es über die kleine Buckelbrücke über den Bahngleisen gerumpelt kam. Sie ist immer noch da, diese Brücke, direkt hinterm Bahnhof. Ja, die Dinge bleiben bestehen, das Leben aber muss vergehen. Der Wagen kam aus dem Dorf und brauste zur Stadt, die zwanzig Kilometer von hier entfernt ist; Ballymore will ich sie nennen. Die Stadt heißt Ballymore und dieses Dorf hier Ballyless, mal mehr, mal minder Bally, albern, kann schon sein, doch das ist mir egal. Der Mann mit dem Bart, der mir zugezwinkert hatte, saß am Lenkrad, sagte irgendwas, warf den Kopf in den Nacken und lachte. Neben ihm saß, das helle Haar im Fahrtwind flatternd, eine Frau, die den Ellbogen aus dem heruntergekurbelten Fenster gestreckt hatte und ebenfalls den Kopf in den Nacken warf, aber nicht lachte, sondern bloß lächelte, mit diesem skeptischen, nachgiebigen, gelinde amüsierten Lächeln, das sie allein für ihn reserviert hatte. Sie trug eine weiße Bluse und eine Sonnenbrille mit weißem Plastikgestell und rauchte eine Zigarette. Und wo bin ich, wo hab ich mich versteckt, dass ich die Lage überblicken kann? Ich kann mich nicht entdecken. Und schon raste der Wagen mit seinem windschlüpfrigen Heck davon, bog in eine Kurve und war in einer dicken Abgaswolke verschwunden. Das hohe Gras im Straßengraben, blond wie das Haar der Frau, schrak kurz zusammen, um gleich darauf wieder in seine gewohnte traumverlorene Reglosigkeit zu verfallen.
In der sonnengleißenden Leere des Nachmittags ging ich die Station Road hinunter. Der Strand am Fuße des Hügels war ein rehbraunes Schimmern, darüber Indigo. An der See besteht alles aus schmalen Waagerechten, die ganze Welt reduziert sich auf ein paar lange, gerade, zwischen Erde und Himmel gezwängte Linien. Misstrauisch um mich blickend, näherte ich mich der Pension Zu den Zedern. Wie kommt es bloß, dass in der Kindheit alles Neue, das mein Interesse weckte, irgendwie die Aura des Unheimlichen besaß, wo es doch in allen Quellen übereinstimmend heißt, das Unheimliche sei mitnichten etwas Neues, sondern vielmehr etwas Wohlbekanntes, das nur in veränderter Gestalt wieder zu uns zurückkehrt, das zum Wiedergänger wird? So viele Fragen, auf die es keine Antwort gibt, und die hier hat am wenigsten Bedeutung. Als ich näher herankam, hörte ich ein rhythmisch wiederkehrendes, rostig quietschendes Geräusch. Ein Junge, so alt wie ich, hing malerisch über das grüne Tor drapiert, ließ die Arme schlaff über die obere Eisenstange baumeln und schwang, mit einem Fuß sich abstoßend, im Viertelkreis auf dem Kieskarree hin und her. Er hatte das gleiche strohbleiche Haar wie die Frau im Auto und die unverwechselbaren azurblauen Augen des Mannes. Als ich langsam vorüberging, und ja, kann sein, ich blieb sogar stehen, oder besser, hielt inne, da rammte er seinen Segeltuchturnschuh mit der Spitze in den Kies, um das schwingende Tor zu stoppen, und schaute mich feindselig und fragend an. Es war derselbe Blick, mit dem wir uns immer beäugten, wir Kinder, wenn wir uns das erste Mal begegneten. Hinter ihm sah ich den schmalen Garten an der Rückseite des Hauses, dahinter die schräge Reihe von Bäumen, die die Gleise der Eisenbahn säumten – sie sind inzwischen weg, die Bäume, gefällt, um einer Zeile pastellfarbener, an Puppenhäuser erinnernder Bungalows Platz zu machen –, und noch weiter hinten, landeinwärts, hügelige Felder mit Kühen und kleinen grellgelben Einsprengseln, die Ginsterbüsche waren, und in der Ferne einen einsamen Kirchturm und dann den Himmel mit eingerollten weißen Wolken. Auf einmal fuhr der Junge hoch und schnitt mir eine Fratze, er drehte die Augäpfel einwärts, ließ die Zunge über die Unterlippe baumeln. Und als ich weiterging, spürte ich seinen höhnischen Blick im Nacken.
Segeltuchturnschuhe. Auch so ein Wort, das man heute nicht mehr hört, oder nur noch selten, sehr selten. Der Colonel ist schon wieder draußen auf dem Klo. Ich wette, der hat es mit der Prostata. Wenn er an meiner Tür vorbeigeht, tritt er immer extra vorsichtig auf, knarrt auf Zehenspitzen über die Dielen, aus Mitgefühl mit dem trauernden Hinterbliebenen. Ein eifriger Verfechter von Sitte und Anstand, unser tapferer Colonel.
Ich gehe die Station Road entlang.
So vieles im Leben war früher, als wir jung waren, Stille, jedenfalls kommt es einem heute so vor; erwartungsvolle Stille, Spannung. Wir warteten in unserer gleichsam noch ungeformten Welt, taxierten die Zukunft, wie der Junge und ich uns taxiert hatten, wie Soldaten im Felde, die angespannt der Dinge harren, die da kommen. Am Fuße des Hügels blieb ich stehen und schaute in drei Richtungen, die Strand Road hinunter, die Station Road hinauf und nach der anderen Seite, hinüber zum Wellblechkino und den öffentlichen Tennisplätzen. Keiner da. Die Straße hinter den Tennisplätzen hieß Cliff Walk, obwohl die See die Klippen lange abgeschliffen hatte, falls überhaupt mal welche dort gewesen waren. Da unten, so wurde erzählt, sei eine Kirche mit Glockenturm samt Glocke im sandigen Bett der See versunken, auf einer Landzunge habe sie gestanden, die auch nicht mehr da sei, mitgerissen vor unerdenklichen Zeiten in einer sturmgepeitschten Nacht vom furchtbaren Heranfluten der aufgewühlten Wogen. Das waren so Geschichten, die einem die Einheimischen erzählten, Duignan der Milchmann zum Beispiel und der taube Colfer, der mit geretteten Golfbällen handelte, um uns Sommerfrischlern weiszumachen, dass ihr zahmes kleines Stranddorf in vergangenen Zeiten ein Ort des Schreckens gewesen sei. Das Schild oben am Strandcafé, eine Zigarettenreklame für Navy Cut, auf der ein bärtiger Matrose in einem Rettungsring – oder war es eine Tauschlinge? – abgebildet war, quietschte im Seewind an seinen salzverrosteten Scharnieren – ein Echo auf das Tor draußen vor der Zedernvilla, mit dem der Junge, wenn ich mich nicht irrte, noch immer Karussell fuhr. Sie quietschen bis heute, das noch vorhandene Tor und das nicht mehr vorhandene Schild, quietschen bis auf den heutigen Tag, auf die heutige Nacht, in meinen Träumen. Ich ging weiter die Strand Road entlang. Häuser, Geschäfte, zwei Hotels – das Golf, das Beach –, eine granitene Kirche, ein Myler’s-Shop, der Lebensmittelladen, Post und Pub in einem ist, und dann das Field – die Ferienanlage mit den kleinen Holzhäusern; in so einem Holzhäuschen verbrachten wir unseren Urlaub, mein Vater, meine Mutter und ich.
Falls die Leute in dem Auto die Eltern des Jungen gewesen waren, hatten die ihn etwa ganz alleine im Haus zurückgelassen? Und wo war das Mädchen, das Mädchen, das gelacht hatte?
In mir pocht die Vergangenheit gleich einem zweiten Herzen.
Der Name des Chefarztes war Mr Todd. Ein geschmackloser Scherz eines polyglotten Schicksals, anders kann man das nicht sehen. Es hätte auch noch schlimmer kommen können. Im Niederländischen gibt es den Namen ’t Od, mit dieser schicken Binnenmajuskel und dem apotropäischen Apostroph, von dem sich niemand in die Irre führen lässt. Dieser Todd redete Anna mit Mrs Morden an, mich aber nannte er Max. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich diesen Unterschied gut finden sollte und ebenso diesen schroff vertraulichen Ton. Sein Sprechzimmer, nein, seine Räumlichkeiten, man sagt Räumlichkeiten, und zu ihm sagt man nicht Doktor, sondern Professor, seine Räumlichkeiten also, obwohl nicht höher als im dritten Stock gelegen, hatten etwas von einem Adlerhorst. Das Gebäude war ein Neubau, nichts als Glas und Stahl – sogar der röhrenförmige Fahrstuhlschacht, in dem wie ein riesiger Kolben, der immer abwechselnd gezogen und gedrückt wird, summend der Lift hinauf- und hinuntersauste, und der lebhaft an den Zylinder einer Spritze erinnerte, bestand aus Glas und Stahl –, und auch in dem großen Hauptsprechzimmer waren zwei Wände vom Boden bis hinauf zur Decke aus Flachglas. Als Anna und ich hineingebeten wurden, war ich im ersten Moment ganz geblendet von der frühherbstlichen Sonne, deren Strahlen durch diese riesigen Glasscheiben fielen. Die Sprechstundenhilfe, ein verschwommenes blondes Etwas in Schwesternkittel und quietschenden Gesundheitsschuhen – wer würde in so einer Situation wohl auf die Sprechstundenhilfe achten? –, legte Annas Akte auf Mr Todds Schreibtisch und ging quietschend hinaus. Mr Todd bat uns, Platz zu nehmen. Die Vorstellung, mich bequem in einem Sessel niederzulassen, war mir unerträglich, deshalb trat ich an die gläserne Wand und schaute hinaus. Unmittelbar unter mir war eine Eiche, oder vielleicht war es auch eine Buche, bei diesen großen Laubbäumen bin ich mir nie ganz sicher, aber bestimmt keine Ulme, denn die sind alle tot, jedenfalls ein imposanter Bursche, dessen sommerliches Grün der Herbst mit einem Silberhauch von Raureif überzogen hatte. Grell glänzende Autodächer. Eine junge Frau in einem dunklen Anzug überquerte eilig den Parkplatz, und ich meinte, selbst auf die Entfernung das zierliche Klappern ihrer Stöckelabsätze auf dem Asphalt zu hören. Vor mir im Glas Annas bleiches Spiegelbild, sehr gerade auf dem metallenen Stuhl sitzend, im Dreiviertelprofil, der Prototyp der Patientin, die Beine übereinandergeschlagen, die gefalteten Hände ruhen auf dem Oberschenkel. Mr Todd saß schräg an seinem Schreibtisch und blätterte die Befunde in ihrer Akte durch; die blassrosa Pappe des Ordners erinnerte mich an die gespannte Unruhe der ersten Schultage nach den Sommerferien, den Reiz der neuen Schulbücher und den verheißungsvollen Geruch nach Tinte und frisch gespitzten Bleistiften. Wie doch selbst noch im Augenblick der alleräußersten Konzentration unsere Gedanken streunen.
Ich kehrte der Glaswand den Rücken, die Außenwelt war mir unerträglich geworden.
Mr Todd war ein stämmiger Mann, weder besonders groß noch besonders schwer, aber sehr breit; er wirkte irgendwie quadratisch. Und er hatte so eine altmodische, ostentativ beruhigende Art. Er trug einen Tweedanzug mit Weste und Uhrkette, dazu kastanienbraune Brogues, die Colonel Blundens Beifall gefunden hätten. Das Haar war straff zurückgebürstet und mit Pomade fixiert, wie man es früher hatte, dazu der Schnauzer, kurz und borstig, der ihm einen leicht bissigen Zug gab. Ein wenig schockiert war ich schon, als ich mir vergegenwärtigte, dass er, all diesen wohl kalkulierten, respektheischenden Effekten zum Trotz, nicht viel über fünfzig sein konnte. Seit wann sind denn die Ärzte jünger als ich? Er schrieb weiter, spielte auf Zeit; ich nahm es ihm nicht übel, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, ich hätte es genauso gemacht. Schließlich legte er den Stift aus der Hand, war aber immer noch nicht geneigt, etwas zu sagen, sondern setzte stattdessen eine ernste Miene auf, wie jemand, der nicht weiß, wo oder wie er anfangen soll. Sein Zögern wirkte irgendwie aufgesetzt, irgendwie theatralisch. Und ich begriff auch diesmal. Als Arzt muss man nicht nur ein guter Mediziner sein, sondern ein mindestens ebenso guter Schauspieler. Anna rutschte ungeduldig auf ihrem Stuhl hin und her.
»Na, was ist, Doktor«, sagte sie, etwas zu laut und in diesem bemüht munteren, forschen Ton, den man von den Filmstars der Vierzigerjahre kennt, »ist es das Todesurteil, oder kriege ich lebenslänglich?«
Im Raum war es still. Ihr Bonmot, das sie garantiert vorher geprobt hatte, war danebengegangen. Ich hatte den Drang, loszustürzen, sie wie ein Feuerwehrmann mit beiden Armen zu packen und sie leibhaftig von hier fortzutragen. Ich rührte mich nicht. Mr Todd, gelinde entsetzt, sah sie hasenäugig an, seine Brauen waren hochgerutscht und klebten auf der oberen Stirnhälfte.
»So schnell lassen wir Sie nicht fort, Mrs Morden«, sagte er mit einem furchtbaren, seine großen grauen Zähne entblößenden Lächeln. »Nein, das kommt gar nicht infrage.«
Dann wieder Schweigen, einen Herzschlag lang. Anna hatte die Hände im Schoß, betrachtete sie ganz versonnen, als ob sie sie zum allerersten Male sah. Mein rechtes Knie scheute und begann zu zucken.
Mr Todd holte aus zu einer flammenden Rede, einer Rede, die so abgenutzt war, dass sie schon glänzte; er redete von vielversprechenden Therapien, von neuen Medikamenten, von dem gewaltigen Arsenal chemischer Waffen, über das er regiere; er hätte genauso gut von Zaubertränken reden können oder von Alchimie. Anna schaute immer noch versonnen ihre Hände an; sie hörte nicht zu. Irgendwann gab er es auf und saß einfach da und glotzte sie wie zuvor mit diesem hoffnungslosen, hasenhaften Ausdruck an, atmete hörbar, hatte die Lippen zu einer Art Grinsen hochgezogen – und schon wieder diese entblößten Zähne.
»Danke«, sagte sie höflich, und jetzt klang ihre Stimme, als käme sie von sehr weit her. Anna nickte gedankenverloren. »Ja«, aus noch größerer Ferne, »danke.«
Worauf sich Mr Todd, gleichsam erlöst, rasch klatschend mit den flachen Händen auf die Knie schlug und aufsprang, um uns regelrecht zur Tür zu scheuchen. Anna war schon draußen, da drehte er sich noch einmal zu mir herum und verabschiedete mich mit einem tapferen Von-Mann-zu-Mann-Lächeln und einem trockenen, kräftigen, unerschrockenen Handschlag, und ich hätte schwören können, dass dies seine Standardverabschiedung eigens für Ehepartner und Augenblicke wie diesen hier war.
Der Teppichboden des Korridors schluckte unsere Schritte.
Der Lift, drücken, abwärts sausen.
Wir traten hinaus in den Tag, als beträten wir einen neuen Planeten, auf dem sonst niemand lebte, nur wir.
Zu Hause angekommen, blieben wir noch lange draußen im Wagen sitzen, scheuten uns, ins Haus zu gehen, hinein in das Bekannte, sagten nichts, so fremd uns selbst und auch einander, wie wir plötzlich waren. Anna schaute zur Bucht hinüber, wo die Jachten mit gefierten Segeln im glitzernden Sonnenlicht strotzten. Ihr Bauch war geschwollen, eine harte runde Kugel, die gegen den Rockbund drückte. Die Leute würden denken, sie sei schwanger, hatte sie gesagt – »In meinem Alter!« –, und wir hatten gelacht, ohne einander anzusehen. Die Möwen, die in unseren Schornsteinen genistet hatten, waren mittlerweile alle wieder hinausgeflogen auf die See, oder sie waren auf dem Zug nach Süden, oder was sie sonst machen, diese Vögel. Den ganzen trüben Sommer lang hatten sie unablässig über den Dächern ihre Kreise gezogen, hatten uns ausgelacht, weil wir versuchten, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre, als ob nichts fehlen würde, als ob die Welt sich weiterdrehte. Aber es war da, dieses gewölbte Ding, es hockte in Annas Schoß, das große Baby ’t Od, das sich in ihr breitmachte und wartete, bis seine Zeit gekommen war.
Schließlich gingen wir doch hinein, weil es nichts gab, wo wir sonst hätten hingehen können. Durch das Fenster in der Küche strömte helles Mittagslicht, das alle Gegenstände scharfkantig und gläsern leuchten ließ, als sähe ich den Raum durch das Objektiv einer Kamera. Alles wirkte wie von einer allgemeinen schmallippigen Unbeholfenheit erfasst, all die vertrauten alltäglichen Gegenstände – die Krüge auf den Wandborden, die Kochtöpfe auf dem Herd, das Brett mit dem gezackten Brotmesser –, sie alle wandten den Blick ab, als wollten sie nichts zu tun haben mit unserer plötzlich fremden, unglückbehafteten Anwesenheit in ihrer Mitte. So, machte ich mir, zu Tode traurig, klar, so würde es von nun an sein, wohin sie sich auch wendet, immer wird ihr das lautlose Gerassel der Lepraschelle vorausgehen. Du siehst fantastisch aus!, werden sie rufen, wirklich, du hast noch nie so gut ausgesehen, solange wir dich kennen! Und sie mit ihrem strahlenden Lächeln wird tapfer dreinschauen, die arme Mrs Haut-und-Knochen.
Sie stand mitten im Raum, in Mantel und Schal, die Hände auf den Hüften, und guckte ungehalten vor sich hin. Da war sie immer noch ansehnlich, die hohen Wangenknochen, die durchscheinende Haut, fein wie Papier. Ihr klassisches Profil habe ich immer am meisten bewundert, diese Nase, wie aus Elfenbein geschnitzt, die eine Linie bildete mit ihrer Stirn.
»Weißt du, was das ist?«, sagte sie mit bitterem Nachdruck. »Unangemessen, jawohl, unangemessen ist das.«
Ich guckte schnell zur Seite, aus Angst, meine Augen könnten mich verraten; die eigenen Augen sind immer die Augen eines anderen, die des irren, verzweifelten Zwergs, der drinnen in einem hockt. Ich wusste, was sie meinte. Ihr hätte das nicht zustoßen dürfen. Uns hätte das nicht zustoßen dürfen, zu diesen Kreisen gehörten wir nicht. Unglück, Krankheit, früher Tod, das passiert nur dem einfachen Volk, den schlichten Leuten, die das Salz der Erde sind, aber doch nicht Anna, doch nicht mir. Mitten in der majestätischen Prozession unseres Zusammenlebens war auf einmal ein grinsender Taugenichts aus der jubelnden Menge hervorgetreten und hatte meiner tragischen Königin mit höhnischer Verbeugung den Amtsenthebungsbescheid überreicht.
Sie schaltete den Wasserkocher an, kramte ihre Brille aus der Manteltasche, setzte sie auf und legte sich die Brillenkordel um den Hals. Dann fing sie an zu weinen, geistesabwesend vielleicht, lautlos. Ich trat unbeholfen auf sie zu, wollte sie in den Arm nehmen, doch sie wich spröde zurück.
»Herrgott noch mal, mach doch nicht so ein Theater!«, fuhr sie mich an. »Ich sterbe schließlich bloß.«
Das Wasser begann zu sieden, der Kocher schaltete sich von selber aus, und das sprudelnde Wasser darin kam mürrisch blubbernd zur Ruhe. Ich wunderte mich, nicht zum ersten Mal, über die brutale Selbstgefälligkeit der Dinge. Doch nein, nicht brutal, nicht brutal, nicht selbstgefällig, nur gleichgültig, und wie sollten sie auch anders sein? Von nun an würde ich die Dinge nehmen müssen, wie sie sind, nicht, wie ich sie mir vielleicht vorstelle, denn das hier, das war eine neue Spielart von Wirklichkeit. Ich nahm die Teekanne und den Tee, es klirrte – mir zitterten die Hände –, aber sie sagte nein, sie habe es sich anders überlegt, sie wolle lieber einen Brandy, einen Brandy und eine Zigarette, sie, die nie geraucht hatte und nur ganz selten etwas trank. Sie sah mich finster an, wie ein trotziges Kind, stand dort am Tisch, immer noch im Mantel. Ihre Tränen hatten aufgehört. Sie nahm die Brille ab, ließ sie fallen, sodass sie ihr an der Kordel um den Hals hing, und rieb sich mit den Handballen die Augen. Ich suchte die Brandyflasche und goss zitternd einen Schluck in ein Whiskeyglas, wobei ich aus Versehen mit dem Flaschenhals an den Rand des Glases stieß; es klirrte wie ein Zähneklappern. Zigaretten waren keine da, woher sollte ich Zigaretten nehmen? Sie sagte, nicht so wichtig, sie wolle eigentlich gar nicht rauchen. Der Edelstahl-Wasserkocher glänzte, aus seiner Tülle stieg träge gekräuselter Dampf auf – eine vage Assoziation an Geist und Flasche. Oh, lass mich einen Wunsch frei haben, nur den einen.
»Zieh doch wenigstens den Mantel aus«, sagte ich.
Aber warum wenigstens? Was ist das bloß für eine Sache mit der menschlichen Unterhaltung.
Ich gab ihr das Glas mit dem Brandy, und sie hielt es fest, trank aber nicht. Das Licht vom Fenster hinter mir fiel auf ihre in Höhe des Schlüsselbeins hängenden Brillengläser und erzeugte den unheimlichen Effekt einer zweiten Anna, einer Anna en miniature, die mit gesenktem Blick dicht vor ihr stand, unmittelbar unter ihrem Kinn. Plötzlich sackte sie abrupt in sich zusammen, fiel schwer auf den Stuhl und streckte in einer sonderbaren, verzweifelt wirkenden Geste die Arme vor sich auf der Tischplatte aus, als würde sie sich einem unsichtbaren anderen ergeben, der ihr als Richter gegenübersaß. Das Glas in ihrer Hand knallte auf das Holz, und der Brandy darin schwappte zur Hälfte über. Hilflos betrachtete ich sie. Einen schwindelnmachenden Augenblick lang überfiel mich der Gedanke, es könnte mir nie wieder ein Wort einfallen, das ich zu ihr sagen könnte, wir würden immer so weitermachen, in dieser qualvollen Sprachlosigkeit, bis ans Ende. Ich beugte mich hinunter und küsste die fahle, sixpencestückgroße Stelle auf ihrem Scheitel, wo ihr dunkles Haar einen Wirbel hatte. Sie hob ihr Gesicht kurz zu mir hoch und sah mich an mit einem raschen, schwarzen Blick.
»Du riechst nach Krankenhaus«, sagte sie. »Eigentlich müsste ich das sein.«
Ich nahm ihr das Glas aus der Hand, setzte es an die Lippen und trank den restlichen Brandy, der wie Feuer brannte, mit einem Zug aus. Und nun wurde mir klar, was dieses Gefühl war, das mich plagte, seit ich heute früh die gläsern leuchtende Praxis von Mr Todd betreten hatte. Es war Verlegenheit. Anna spürte es auch, dessen war ich mir sicher. Verlegenheit, ja, eine panische Angst davor, nicht zu wissen, was man sagen, wohin man schauen, wie man sich verhalten soll, und noch etwas anderes, nicht direkt Wut, aber doch eine Art finsterer Verärgerung, ein finsterer Groll darüber, dass wir uns in einer derart misslichen Lage befanden. Es war, als hätte man uns ein Geheimnis verraten, das so schmutzig, so abscheulich war, dass wir es kaum aushalten konnten, noch weiter zusammenzubleiben, aber auch nicht in der Lage waren auszubrechen, weil jeder von uns wusste, was der andere für Dreck am Stecken hatte, und ebendieses Wissen uns aneinander fesselte. Von nun an würde alles nur noch Heuchelei sein. Es würde keine andere Methode geben, mit dem Tod zu leben.
Immer noch saß Anna kerzengerade dort am Tisch, mir abgewandt, mit ausgestreckten Armen, die Handflächen nach oben gekehrt, als wartete sie darauf, dass irgendetwas hineinfiele.
»Also?«, sagte sie, ohne sich umzudrehen. »Was jetzt?«
Da geht der Colonel, schleicht sich wieder zurück in sein Zimmer. Das war aber eine lange Sitzung auf dem Klo. Strangurie, schönes Wort. Mein Zimmer ist als einziges im ganzen Haus en suite, wie Miss Vavasour immer mit einer kleinen, leicht affektierten Grimasse sagt. Außerdem habe ich eine Aussicht, oder könnte zumindest eine haben, wenn diese blöden Bungalows dahinten im Garten nicht wären. Mein Bett ist Ehrfurcht gebietend – ein imposantes, hoch aufgepolstertes Monstrum im italienischen Stil, eines Dogen würdig, das Kopfende poliert und mit Volute wie eine Stradivari. Ich muss Miss V. einmal fragen, wo sie das Ding eigentlich herhat. Als die Graces hier waren, war das hier das Schlafzimmer der Eltern. Über die untere Etage bin ich damals nie hinausgekommen, außer in meinen Träumen.
Gerade habe ich gesehen, was heute für ein Tag ist. Heute vor einem Jahr mussten Anna und ich Mr Todd zum ersten Mal in seiner Praxis aufsuchen. Was für ein Zufall. Oder auch nicht, vielleicht; gibt es denn Zufälle in Plutos Reich, durch dessen unbetretene Weiten ich leierloser Orpheus irre? Zwölf Monate schon, immerhin! Ich hätte Tagebuch führen sollen. Mein Tagebuch des Jahrs der Plagen.
Ein Traum hat mich hierhergezogen. Ich ging eine Landstraße entlang, das war alles.
Es war im Winter, in der Abenddämmerung, oder vielleicht war es auch eine eigentümliche, schwach leuchtende Nacht, eine Nacht, wie es sie nur in Träumen gibt, und nasse Schneeflocken fielen vom Himmel. Ich war mit Entschlossenheit unterwegs, irgendwohin, nach Hause anscheinend, obwohl ich nicht wusste, was oder wo genau zu Hause sein sollte. Zu meiner Rechten die offene Landschaft, eben und eintönig, kein Haus in Sicht, auch kein Stall, und zu meiner Linken säumte eine Reihe niedriger, düster dreinblickender Bäume die Straße. Trotz der Jahreszeit waren die Äste noch nicht kahl, und die dichte, dicke, beinahe schwarze Masse der Blätter duckte sich unter der Last des Schnees, der sich in weiches, fast durchsichtiges Eis verwandelt hatte. Irgendetwas war kaputt, ein Auto, nein, ein Fahrrad, ein Knabenfahrrad, denn ich war, obschon genauso alt wie jetzt, zugleich ein Junge, ein dicker, unbeholfener Junge, ja, und ich war auf dem Weg nach Hause, doch, bestimmt, nach Hause oder irgendwohin, wo früher einmal zu Hause gewesen war und wo ich mich sofort wieder auskennen würde, wenn ich dort ankäme. Ich musste stundenlang laufen, aber das machte mir nichts aus, denn es war ein Gang von überragender, wenn auch unerklärlicher Bedeutung, ein Gang, den ich zu gehen und den ich zu vollenden hatte. Ich war innerlich gefasst, ziemlich gefasst, und voller Zuversicht, auch das, obwohl ich nicht so richtig wusste, wohin ich ging, bloß, dass ich unterwegs nach Hause war. Ich war allein auf der Straße. Der Schnee, der den ganzen Tag langsam vor sich hin gefallen war, trug keinerlei Reifen-, Stiefel- oder Hufspuren, denn es war noch niemand diesen Weg gegangen, und es würde ihn auch niemand gehen. Irgendetwas war mit meinem Fuß, dem linken, anscheinend hatte ich ihn mir verletzt, doch schon vor langer Zeit, denn er tat nicht weh, obwohl ich bei jedem Schritt ungeschickt damit ausholen und eine Art Halbkreis beschreiben musste, was mich behinderte, nicht ernsthaft, aber ernst genug. Ich hatte Mitleid mit mir, das heißt, ich hatte Mitleid mit dem geträumten Ich, diesem armen Trottel, der dort am Ende des Tages unerschrocken durch den Schnee stapft, vor sich nur die Straße, ohne die Verheißung des Nachhausekommens.
Das war alles, mehr war nicht in dem Traum. Der Weg nahm kein Ende, ich kam nirgendwo an, und nichts geschah. Ich ging einfach dort entlang, verlassen und beherzt, stampfte endlos durch den Schnee und durch das winterliche Dämmerlicht. Doch als ich im ersten Morgengrauen erwachte, tat ich es nicht, wie sonst immer, mit diesem Gefühl, dass man mir über Nacht eine schützende Hautschicht abgezogen hatte, noch eine mehr, sondern mit der Überzeugung, etwas sei erreicht oder zumindest angestoßen worden. Und plötzlich, zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie langer Zeit, musste ich an Ballyless denken und an das Haus dort an der Station Road und an die Graces und an Chloe Grace, ich habe keine Ahnung, warum, und es war, als wäre ich plötzlich aus dem Dunkel in eine Lache aus fahlem, salzgewaschenem Sonnenlicht getreten. Nur eine Minute hielt sie an, diese glückselige Leichtigkeit, vielleicht nicht einmal eine Minute, aber sie sagte mir, was ich zu tun, wohin ich mich zu wenden hatte.
Als Erstes sah ich sie, Chloe Grace, am Strand. Es war ein heller, windgeplagter Tag; die Graces hatten es sich in den Dünen in einer flachen Kuhle bequem gemacht, die, ausgehöhlt von Stürmen und Gezeiten, durch ihre Gegenwart gleichsam etwas Kulissenhaftes hatte. Eine beeindruckende Ausrüstung hatten sie mitgebracht, zum Beispiel ein Stück verschossenen gestreiften Markisenstoff, der zwischen Stöcken aufgespannt war, um die kühle Brise abzuhalten, Klappstühle, ein Klapptischchen und einen Strohkorb von der Größe eines kleinen Koffers, der Flaschen, Thermoskannen und Büchsen mit Sandwichs und Gebäck enthielt; sogar richtige Teetassen hatten sie dabei, samt Untertassen. Eigentlich gab es eine stillschweigende Übereinkunft, dass dieser Teil des Strandes für die Gäste des Golf Hotels reserviert war, dessen Rasen unmittelbar hinter den Dünen endete, sodass diese Leute dort aus der Villa, die hier so achtlos eingebrochen waren mit ihrem schicken Strandequipment und ihren Weinflaschen, nicht wenige empörte Blicke ernteten, Blicke, die sie, die Graces, indes nicht zu bemerken schienen oder jedenfalls geflissentlich ignorierten. Mr Grace, Carlo Grace, der Daddy, abermals in Shorts, dazu einen bonbonfarben gestreiften Blazer über der Brust, die nackt war, abgesehen von zwei dicken Matten aus gekringeltem Haar, die an ein weit ausgebreitetes, wuscheliges Flügelpaar erinnerten. Ich glaube, ich hatte und habe bis heute noch nie jemanden gesehen, der einen derart faszinierend üppigen Haarwuchs hatte. Auf seinem Kopf klemmte ein Hut aus Segeltuch, der wie ein umgedrehter Buddeleimer aussah. Mr Grace saß auf einem der Klappstühle, hielt vor sich eine aufgeschlagene Zeitung mit beiden Händen fest und schaffte es trotz der steifen Windstöße, die von der See herüberkamen, dabei auch noch eine Zigarette zu rauchen. Der blonde Junge, derselbe, der am Tor geschaukelt hatte – es war Myles, warum soll ich ihn nicht beim Namen nennen? –, kauerte schmollend zu Füßen seines Vaters und buddelte mit einem gezackten, von der See blank polierten Stück Treibholz im Sand. Etwas hinter den beiden, im Schutz der Dünenwand, kniete ein in ein großes rotes Handtuch gewickeltes Mädchen, oder eine junge Frau, im Sand, zappelte nervös unter ihrer Verhüllung herum und versuchte, wie sich bald herausstellen sollte, ihren Badeanzug abzustreifen. Sie war auffallend blass und sah ungemein seelenvoll aus; sie hatte ein langes schmales Gesicht und dickes, sehr schwarzes Haar. Mir fiel auf, dass sie die ganze Zeit, voll Abscheu, wie mir schien, den Hinterkopf von Carlo Grace betrachtete. Außerdem fiel mir auf, dass Myles, der Junge, sie aus dem Augenwinkel beobachtete, offenkundig in der, übrigens von mir geteilten, Hoffnung, sie könnte die schützende Hülle aus Versehen fallen lassen. Demnach konnte sie schwerlich seine Schwester sein.
Mrs Grace kam den Strand herauf. Sie war im Wasser gewesen und trug einen schwarzen Badeanzug, hauteng und dunkel glänzend wie Seehundfell, und darüber eine Art Wickelrock aus durchsichtigem Stoff, in der Taille von nur einem einzigen Knopf zusammengehalten, sodass er sich bei jedem ihrer Schritte öffnete und ihre nackten braunen, ziemlich dicken, aber wohlgeformten Beine offenbarte. Vor ihrem Mann blieb sie stehen, schob sich die weißgerandete Sonnenbrille ins Haar und wartete den Herzschlag lang, den er vergehen ließ, bevor er die Zeitung senkte und zu ihr aufsah, die Hand, in der er die Zigarette hielt, an die Stirn hob und seine Augen gegen das salzgeschärfte Licht beschirmte. Sie sagte etwas, und er neigte den Kopf zur Seite, zuckte die Achseln und lächelte, wobei er seine vielen kleinen weißen, ebenmäßigen Zähne zeigte. Hinter ihm das Mädchen, immer noch unter dem Handtuch, ließ den endlich abgestreiften Badeanzug fallen, drehte sich um, setzte sich mit angezogenen Beinen in den Sand, das Handtuch wie eine Zeltbahn um sich geschlagen, und legte die Stirn an die Knie, worauf Myles mit der ganzen Kraft seiner Enttäuschung seinen Stock in den Sand rammte.
Das waren sie also, die Graces: Carlo Grace und seine Frau Constance, ihr Sohn Myles, das Mädchen oder auch die junge Frau, die aber bestimmt nicht die war, die ich neulich, am ersten Tag, im Haus lachen gehört hatte, und drum herum ihr ganzer Kram, ihre Klappstühle und Teetassen und Wassergläser voll Weißwein und Connie Grace’ Offenbarungsrock und der komische Hut, die Zeitung und die Zigarette ihres Mannes und der Stock von Myles und der Badeanzug jenes Mädchens, der immer noch dort lag, wo sie ihn hingeworfen hatte, schlaff zusammengeknautscht, die feuchten Ränder mit Sand verklebt, gleich einem ertrunkenen Ding, das ausgespien war von der See.