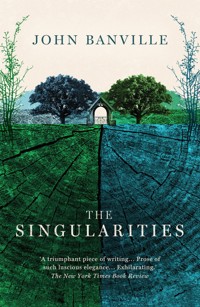9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie der düstere, grobe Caliban in Shakespeares »Sturm« ist Axel Vander ein eher rüder Zeitgenosse. Als bedeutender Literaturwissenschaftler und Verfasser großer Werke über Nietzsche verbringt er seinen Lebensabend in Kalifornien. Überraschend trifft ein Brief aus Europa ein, in dem die Schreiberin andeutet, Geheimnisse zu kennen, die Vander seit Jahrzehnten, seit seiner Jugend als Jude im von den Nazis besetzten Belgien verborgen hat. Um herauszufinden, was die Unbekannte über ihn weiß, reist Vander nach Turin, wo er sie am Rande eines Nietzsche-Kongresses trifft. Es ist Cass Cleave, eine junge Irin, verführerisch, intelligent und zugleich von einer schweren Nervenkrankheit gezeichnet. Zwischen dem alten Mann und der jungen Frau entspinnt sich eine Liebesbeziehung, die Cass immer tiefer stürzen lässt, während Vander sich zum ersten Mal der Wahrheit stellt, seine Rolle als Opfer und Täter begreift. Inspiriert durch die Lebensgeschichte von Paul de Man und Louis Althusser hat Banville in diesem Roman das bewegend erschreckende Bild eines Mannes in seiner Zeit entworfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
John Banville
Caliban
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über John Banville
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über John Banville
John Banville, geboren 1945 in Wexford, Irland, gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen literarischen Autoren. Sein umfangreiches Werk wurde mehrfach, auch international, ausgezeichnet, zuletzt mit dem Franz-Kafka-Literaturpreis, dem Man Booker Prize (für »Die See«) und 2013 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. John Banville lebt und arbeitet in Dublin und schreibt unter dem Pseudonym Benjamin Black Krimis und Thriller, die neben seinen Romanen ebenfalls bei Kiepenheuer & Witsch lieferbar sind.
Weitere Titel von John Banville: http://bit.ly/2qbstrL
Christa Schuenke, geboren 1948, übersetzt Lyrik und Prosa aus dem Englischen, u. a. Werke von Banville, Melville, Singer, Shakespeare. Sie erhielt u.a. den Wielandpreis und den Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wie der düstere, grobe Caliban in Shakespeares »Sturm« ist Axel Vander ein eher rüder Zeitgenosse. Als bedeutender Literaturwissenschaftler und Verfasser großer Werke über Nietzsche verbringt er seinen Lebensabend in Kalifornien. Überraschend trifft ein Brief aus Europa ein, in dem die Schreiberin andeutet, Geheimnisse zu kennen, die Vander seit Jahrzehnten, seit seiner Jugend als Jude im von den Nazis besetzten Belgien verborgen hat. Um herauszufinden, was die Unbekannte über ihn weiß, reist Vander nach Turin, wo er sie am Rande eines Nietzsche-Kongresses trifft. Es ist Cass Cleave, eine junge Irin, verführerisch, intelligent und zugleich von einer schweren Nervenkrankheit gezeichnet. Zwischen dem alten Mann und der jungen Frau entspinnt sich eine Liebesbeziehung, die Cass immer tiefer stürzen lässt, während Vander sich zum ersten Mal der Wahrheit stellt, seine Rolle als Opfer und Täter begreift. Inspiriert durch die Lebensgeschichte von Paul de Man und Louis Althusser hat Banville in diesem Roman das bewegend erschreckende Bild eines Mannes in seiner Zeit entworfen.
Inhaltsverzeichnis
Fördernachweis
Motto
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Teil II
Kapitel 1
Teil III
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Danksagung
Der Verlag dankt Ireland Literature Exchange (Translation Fund), Dublin, Irland, für die finanzielle Unterstützung.
www.irelandliterature.com
Wir stellen ein Wort hin, wo unsere Unwissenheit anhebt, wo wir nicht mehr weiter sehn können, z.B. das Wort »Ich«, das Wort »tun«, das Wort »leiden« – das sind vielleicht Horizontlinien unserer Erkenntnis, aber keine »Wahrheiten«.[1]
I
Wer spricht? Es ist ihre Stimme, in meinem Kopf. Ich fürchte, sie wird nicht aufhören, bevor ich aufhöre. Sie spricht zu mir, während ich mich durch diese kopfsteingepflasterten Gassen schleppe, und sagt mir Dinge, die ich nicht hören will. Manchmal antworte ich, erhebe laut Protest, verlange in Ruhe gelassen zu werden. Gestern bei meinem Bäcker auf der Via San Tommaso, der Laden war knüppelvoll, muss ich wohl irgendetwas gerufen haben, ihren Namen vielleicht, denn plötzlich schauten alle mich an, wie man hier eben schaut, nicht erschrocken oder missbilligend, bloß neugierig. Inzwischen kennt mich jeder hier, der Bäcker, der Metzger, der Gemüsehändler und die Kundschaft auch, die Hausfrauen mit den hennaroten Haaren, die meisten sind betulich wie Tauben, mit ihrem Parfüm und ihrem hässlichen Schmuck und ihren großen dunklen, enttäuscht dreinblickenden Augen. Was mir auffällt, sind ihre erstaunlich schlanken Beine; sie altern von oben nach unten, die Frauen, denn diese Beine, die immer ein ganz klein bisschen krumm sind, hatten sie wohl auch schon mit zwanzig oder noch davor. Sie interessieren sich für mich, das ist keine Frage. Vielleicht ist es dieser Hauch von Commedia dell’Arte in meinem Äußeren, der sie anspricht, das blitzende Auge – nur eines – und der komisch hinkende Gang, mit Krückstock und Hut anstatt, wie Harlekin, mit Knüppel und Maske. Mag sein, sie halten mich für verrückt, was sie jedoch nicht zu stören scheint. Aber ich bin nicht verrückt, wirklich nicht, nur sehr, sehr alt. Ich fühle mich, als lebte ich schon seit Äonen. Wenn ich zurückblicke, sehe ich eine Art Urfinsternis mit kalten, harten Lichtflecken darin, unendlich weit entfernt, voneinander – und von mir. Bald, in wenigen Monaten, beginnt das letzte Jahrzehnt dieses Jahrtausends: Das nächste werde ich nicht mehr erleben, was irgendwie bedauerlich ist, haben doch die beiden vorigen so viel Großartiges hervorgebracht, so viel Erfreuliches.
Ja, ich bin zurückgekehrt in diese Stadt mit ihren Arkaden, was vielleicht unklug war. Ich habe mir eine Wohnung gemietet in einer der kleinen Gassen unmittelbar am Duomo, in welcher, das verrate ich nicht, aus Gründen, die mir selber nicht ganz klar sind, obwohl ich zugegebenermaßen in regelmäßigen Abständen Angst habe, die Polizei könnte mir einen Besuch abstatten. Nichts Besonderes, mein Schlupfloch, ein paar Zimmer, niedrige Decken, dumpfig; die Fenster sind so klein und schmutzig, dass ich den ganzen Tag die Tischlampe brennen lassen muss, damit ich nicht im Halbdunkel über irgendetwas falle. Ich möchte nicht, dass man mich hier tot auffindet, die Tür gewaltsam geöffnet wird, meine Vermieterin schreit und ich in wer weiß was für einem derangierten Zustand. Sie – meine Vermieterin – quella strega! – ist Witwe und entschieden theatralisch veranlagt. Sie erzählt mir, dies hier sei das ehemalige Rotlichtviertel der Stadt, und wirft mir einen Blick zu, über dessen Bedeutung ich nicht weiter spekulieren mag, reißt die Augen auf und wirft den Kopf weit in den Nacken, sodass ich in das Innere ihrer Nasenhöhlen schauen kann, was nicht gerade appetitlich ist. Ich hatte schon immer die Befürchtung, dass ich einmal so enden würde: ein Ausgestoßener, der durch die abgelegenen Seitenstraßen irgendeiner anonymen Stadt hinkt, der Selbstgespräche führt und von den Leuten auf der Straße angeglotzt wird. Und doch habe ich beschlossen, hierher zurückzukehren, wenn auch gewiss nicht aus Begeisterung. Denn Turin mit seinem ganzen Marmor, den Monumenten, den posierenden Statuen gleicht vor allem einem großen, grandiosen Friedhof; kein Wunder, dass der arme N. hier den Verstand verloren hat und sich für einen König hielt, für den Vater von Königen, und dass er hier in diesen Straßen stehen blieb und einen Droschkengaul umarmte. Auch sein Gepäck war verloren gegangen, genau wie meines einmal, nach Sampierdarena hat man seine Sachen geschickt, als er in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war; seitdem begann er jedes Mal, wenn er den melodischen Namen jener Stadt vernahm, wütend zu knurren.
Aber genug der Flausen. Ich stehe im Begriff, mich zu erklären, mir selber, meine Liebe, und auch dir, denn wenn du zu mir reden kannst, dann kannst du mich bestimmt auch hören. Ruhig, leise, ohne den schwülstigen Stil und Gestus, der mir ansonsten eigen ist, werde ich nur von dem sprechen, was ich weiß, wofür ich mich verbürgen kann. Gleich reckt der Zweifel, der Polyp, sein dreistes, widerwärtiges Haupt: Was weiß ich denn? Für was kann ich mich denn verbürgen? Es gibt weder ›Geist‹, noch Vernunft, noch Denken, noch Bewusstsein, noch Seele, noch Wille, noch Wahrheit: alles Fiktion … stellt der verrückt gewordene Philosoph fest und schwingt seinen mächtigen Hammer. Und dennoch geistert mir die Idee im Kopf herum, dass ich noch eine letzte Chance bekommen soll, etwas von mir zu erretten. Ich rede nicht von der Seele, so weit ist meine Senilität denn doch nicht fortgeschritten. Aber vielleicht gibt es ja irgendeine kleine Kostbarkeit, die ich zurückkaufen kann, wie Mama Vanders silbernes Pillendöschen, das ich damals vom Pfandleiher zurückgekauft habe. Auf einmal frage ich mich, ob das nicht etwa deine wahre Absicht gewesen ist, ob du also gar nicht vorgehabt hast, mich bloßzustellen und dir damit einen Namen zu machen, sondern mir die Möglichkeit der Errettung auftun wolltest. Wenn dem so ist, dann hast du eines schon erreicht: Das Wort Errettung hat in meinem Wortschatz bislang eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Andererseits habe ich deine Beweggründe nie durchschaut, genauso wenig wie du selbst, vermute ich. Vielleicht hast du mich tatsächlich getäuscht, und in einem finsteren Winkel der Gelehrtenwelt speien demnächst die Druckerpressen ein Machwerk aus, einen posthumen Essay von dir über mich, und dann werden sie mich schmähen, auslachen, mit Buhrufen aus dem Hörsaal jagen. Nun gut, macht nichts.
Der Name, mein Name, ist Axel Vander, zumindest darauf möchte ich bestehen. Zumindest darauf, wenn schon sonst auf nichts. Eines Morgens vor einer halben Ewigkeit, in dem hübschen Städtchen Arcady, überbrachte mir ein sturzbehelmter, sturmbebrillter, Fahrrad fahrender Hermes ihren Brief. Eine Botschaft, auf die ich immer gewartet, vor der ich mich immer gefürchtet hatte, mein ganzes Leben lang, das, was ich für mein Leben halte, mein wirkliches Leben. Endlich war sie also da, und das Erste, was ich empfand, war Verlegenheit. Es war, als hätte man mir mitgeteilt, ein vor vielen Jahren verstorbener Bruder, an den ich mich kaum noch erinnerte und den ich nie geliebt hatte, sei gar nicht tot, sondern quicklebendig und putzmunter; er wohne sogar ganz in meiner Nähe und wolle mich unverschämterweise besuchen kommen. Was sollte ich darauf für eine Antwort finden, über diese zeitliche Entfernung hinweg, zu dieser zerstörten Version meiner selbst? Ich trank den ganzen Tag Whisky, euphorisch vor Entsetzen und panischer Angst, und erwachte tief in der Nacht, zusammengekauert auf dem alten Drehstuhl unten in meinem Arbeitszimmer, zwischen den Fingern noch die erloschene Zigarettenkippe. Draußen in der sanften kalifornischen Dunkelheit roch ich die Gerüche, die für mich auch nach all den vielen Jahren immer noch exotisch waren: Eukalyptus, Erde, die noch die Sonnenglut des Tages in sich barg, den beißenden Brandgeruch, der von den blonden Hügeln herabgeweht kam, wo das Gras bereits seit Monaten träge vor sich hin schwelte. Ich ließ den Brief zu Boden fallen und lachte das geistlose Lachen des Trunkenen. Auf der Cedar Street fuhr zischelnd ein Auto vorbei, es fuhr sehr langsam, als würde der Fahrer die Hausnummern zählen, und ich stellte mir eine Maske vor, hinter der zusammengekniffene Augen prüfend die Eingangstüren und die blind gewordenen Fenster musterten. Ich hob die Hand und reckte den Daumen kerzengerade nach oben und zeigte mit dem Finger ins Dunkel, wo die Tür war. Und fing wieder an zu lachen, diesmal eher dumpf, und drehte die Hand herum und steckte den Zeigefinger in den Mund und ließ den Daumen herunterfallen wie einen Hammer. Ich hätte mir eine Kugel in den Kopf gejagt, wenn … wenn was?
Pah!
Ich versuchte aufzustehen, konnte aber nicht, sackte krachend nach hinten, unter mir ächzte gequält der Stuhl, mein totes Bein rollte wie ein Baumstamm hin und her. Ich hasse dieses Bein, jenen unentrinnbaren Gefährten meiner nachlassenden Kräfte, hasse es noch mehr als das blicklose Auge, das mich jeden Morgen starr aus dem Spiegel anglotzt, milchig und farblos, wie ich mir das Auge eines toten Albatros vorstelle. Ja, das bin ich: tote Last, Mühlstein um den eigenen Hals. Lange wird es nicht mehr so bleiben. Seit einer Weile merke ich, dass ich mich nach und nach auflöse, dass mein talgiges altes Fleisch allmählich vom Gerippe abschmilzt und bald vollends verschwunden ist. Das soll mir nichts ausmachen; ich will mich darauf freuen; denn dann werde ich mich erheben, von allem Unwesentlichen befreit, nur mehr schimmerndes Gebein und Sehnen, glatt wie Kerzenwachs, neu, unbekannt, endlich mein wahres Ich. Im Zustand der Trunkenheit oder gegen ihr Ende hin gibt es einen Moment – genauso, sagt man, gehe es Menschen in der Agonie des Herzinfarkts –, wo mir ist, als löste ich mich von meinem Körper und schwebte aufwärts und hinge in der Luft und blickte mit gleichmütiger Neugier von oben auf des Spektakel meiner selbst. So ging es mir jetzt. Ich sah mich abgeschlafft im Sessel liegen, sah mich mit gewaltiger Anstrengung versuchen, mich wieder hochzuhieven, wie ein Pferd, das mit ausgerenkten Gliedern daliegt und mühsam versucht, wieder auf die Beine zu kommen, hilflos strampelnd, brabbelnd. Ich langte nach der Flasche auf dem Schreibtisch, setzte sie an, trank schmatzend. Meine Mundschleimhäute waren wund, weil ich den ganzen Tag getrunken hatte. Ich ließ den Arm neben dem Sessel herunterhängen, und dabei rutschte mir die Flasche aus der Hand und kollerte versonnen über den gebohnerten Holzfußboden und schüttete mit verschwenderisch gluckernder Gier ihr Herz aus. Sollte sie ruhig auslaufen. Eigentlich mag ich den Rauch-und-Asche-Geschmack von Bourbon gar nicht, aber ich hatte schon früh beschlossen, ihn zu meinem Lieblingsgetränk zu erklären, als Teil meiner Abgrenzungsstrategie, als eine andere Methode, wachsam zu sein, wie ein Schauspieler sich ein Steinchen in den Schuh legt, um nicht zu vergessen, dass die Figur, die er spielt, ein lahmes Bein hat. Das war damals, im Zuge meiner Selbsterneuerung. Es war sehr schwierig, diese Entscheidungen zu fällen, die feinen Eigentümlichkeiten zu erfinden, dabei auf Ausgewogenheit zu achten – niemand konnte erahnen, wie schwierig das war. Wäre es ein Kunstwerk gewesen, was ich da erschuf, man hätte meiner Meisterschaft Applaus gezollt. Vielleicht war gerade das mein Fehler, dass ich das alles im Geheimen tat, anstatt es öffentlich zu tun und mit Bravour. Es hätte sie unterhalten; sie hätten mir vergeben; dem Harlekin wird stets vergeben, er wird immer überleben.
Unter einer der Laufrollen des Stuhles raschelte wie ein warnendes Kichern Papier. Es war der Brief. Schauen Sie: Ich beuge mich hinunter, ich ächze, ich hebe ihn auf, glätte ihn mit der Faust auf der Armlehne und lese ihn von Neuem in dem kegelförmigen Strahl von golden schimmerndem, stäubchendurchflirrtem Licht, das mich mit seiner Milde völlig unverdient umspült, meinen alten, wirren, baumelnden Kopf, meine schiefe Schulter, meine Kralle mit den Adern, dick wie Taue. Die Schreibmaschinenseiten flattern leis im Rhythmus meines Pulsschlags, den ich in der Schläfe spüre, und mein gutes Auge tränt von der Anstrengung, die Wörter nicht verschwimmen oder aus der Reihe hüpfen zu lassen. Sie war in Antwerpen – Antwerpen, großer Gott! Ihr gelehrter, schulmeisternder Ton amüsierte mich. Ich kniff die Augen zusammen, versuchte mich zu konzentrieren und überlegte, wie viel sie wissen konnte. Ich hatte mir immer eingebildet, ich hätte die Pelle meiner Vorvergangenheit längst abgestreift, doch das hier war der Beweis, dass es mir nie gelingen würde, sie gänzlich abzustreifen, dass ich sie immer noch hinter mir her schleifte, dass sie an mir klebte, festgehalten von ein paar angebackenen Modderfäden.
Da wurde mir mit trunkener Hellsichtigkeit klar, was ich zu tun hatte. Seltsam, wie diese willkürliche Welt uns ihre schlauen Schlüsse aufdrängt. Ich wühlte in den Papieren auf meinem Schreibtisch herum, bis ich die geprägte Karte gefunden hatte, die dort bereits seit einer Woche lag, und las mit angewidert verzogenem Mund die schnörkeligen, bodenlos übertriebenen Schmeicheleien. Chiarissimo Professore! Il Direttore del Convegno considera un altissimo onore e un immenso piacere invitarla ufficialmente a Torino … Selbstverständlich hatte ich mir vorgenommen, die Einladung mit ein paar kurzen, sarkastischen Zeilen abzulehnen, jetzt aber war mir klar, dass ich fahren musste und dass ich sie, wenn ich dort war, dazu bringen musste, zu mir zu kommen. Wo sonst hätte ich mich meiner Vernichtung stellen sollen, falls es das war, was mir bevorstand?
Nachdem ich den Brief zum ersten Mal gelesen hatte, war mir zunächst der Gedanke gekommen zu verschwinden, einfach aufzustehen und fortzugehen aus meinem Leben, wie ich es schon einmal getan hatte, und zwar mit bemerkenswertem, ja geradezu sensationellem Erfolg. Diesmal wäre es allerdings nicht ganz so leicht gewesen; damals war ich ein Niemand, heut hingegen gibt es Menschen auf nahezu allen Kontinenten – eine kleine, erlesene Schar, aber immerhin doch eine Schar von Leuten –, denen der Name Axel Vander etwas sagt; trotzdem, es wäre machbar gewesen. Meinen Fluchtweg hatte ich im Kopf, meine geheimen Konten waren präpariert, meine Schlupfwinkel versiegelt; sie warteten auf mich … Ich übertreibe natürlich. Aber einen Moment lang hegte ich tatsächlich Fluchtgedanken und fand das durchaus unterhaltsam. Es gab mir das Gefühl, tollkühn zu sein, gefährlich; es gab mir das Gefühl, jung zu sein. Ich fragte mich, ob die Schreiberin dieses giftigen anonymen Machwerks, wer sie auch immer sein mochte, gewusst hatte, wie ihr Brief auf mich wirken würde: War es möglich, dass sie mir Zeit ließ, einfach abzuhauen? Aber wo sollte ich denn schon hin? Meine Pläne mochten noch so gut überlegt sein, weiter als hier, an dieses ockerfarbene Gestade – für mich der letzte Winkel der bekannten Welt –, konnte ich doch ohnehin nicht flüchten. Nein, das kam gar nicht infrage, die Genugtuung, meine tönernen Füße auf der Flucht klacken und staksen zu hören, wollte ich ihr nicht gönnen. Dann schon lieber die offene Konfrontation mit ihr, ihre Anschuldigungen der Lächerlichkeit preisgeben – ha! Natürlich würde ich sie belügen; Lügen ist meine zweite, nein, meine erste Natur. Ich habe mein ganzes Leben lang gelogen. Ich habe gelogen, um davonzukommen, ich habe gelogen, um geliebt zu werden, ich habe gelogen für Macht und Würde; ich habe gelogen um des Lügens willen. Es war eine Lebensweise: Lügen sind das Beinahe-Anagramm des Lebens. Und jetzt schlugen meine frühesten Fingerübungen in dieser Kunst, schlug mein Gesellenstück im Fälschen auf mich zurück, mich zu vernichten.
Früh um fünf erwachte ich in spektralem Regenlicht, immer noch nicht nüchtern. Eine Sekunde lang erwartete ich, dass Magda ihr vertrautes, mild vorwurfsvolles Grunzen von sich geben und sich mit ozeanischem Wogen im Bett umdrehen würde. Ich streckte die Hand aus und griff dorthin, wo sie nicht war; das Betttuch auf ihrer Seite hatte eine ganz eigene, etwas klamme Kühle; ich wusste genau, dass ich mir das nur einbildete, und war doch gleichzeitig fest davon überzeugt, es wirklich zu spüren. Ich lag da, die Augen noch immer geschlossen, und zündete mir meine Aufwachzigarette an, dann stand ich auf und ging barfuß ins Wohnzimmer mit meinem toten Bein, das dumpf auf den Ahorndielen hallte. Ich bin nicht apokalyptisch veranlagt, dazu habe ich zu viele Welten scheinbar untergehen und dennoch weiterleben sehen, an jenem Morgen aber war mir, als hätte ich eine Grenze überquert, als hätte man mich gezwungen, eine unsichtbare Grenze zu überqueren, und als befände ich mich nun in einem Zustand, der fortan ein Nach-Etwas bleiben würde, fortan ein immerwährendes Danach. Die Grenzscheide war natürlich der Brief. Gründlicher denn je war ich jetzt zwiegespalten, ich, der ich immer schon mehr als nur ich gewesen war. Auf der einen Seite war das Ich, das ich gewesen war, bevor der Brief eintraf, und nun war da dieses neue Ich, das quer stand zu all den bekannten und auf einmal fremd gewordenen Dingen. Das Haus wirkte irgendwie angespannt, schien auf der Hut zu sein, gleichsam empört, dass ich zu dieser ungewöhnlich frühen Stunde sein verstohlenes Treiben störte. Schattengespenster lungerten herum, versuchten unbemerkt zu bleiben. An einer Fensterscheibe strömte der Regen herab, und am anderen Ende des Zimmers kräuselte sich ein Stück Wand wie dunkle Seide. Unvermittelt blieb ich stehen und blinzelte in die Düsternis, suchte einen Punkt, auf den ich den Blick heften konnte; es gab Zeiten, da war Magda hier, als spürbare Anwesenheit, aber nicht jetzt, und die Schatten waren bloß Schatten. Ich hörte draußen im Garten den Regen auf die Blätter prasseln und auf die lehmige Erde trommeln und stellte mir vor, wie er schnurgerade und glänzend wie Draht durch die windstille Dämmerung fiel.
Die Kaffeemaschine war noch bei ihren durchfallartigen Verrichtungen, als der Regen abrupt aufhörte. An das Wetter an diesem Küstenstrich hab ich mich nie gewöhnen können; es war immer zu ordentlich, zu perfekt abgestimmt; der Frühling dort mit seinen vereinzelten frühmorgendlichen Güssen, denen Tage von saumlosem Sonnenlicht folgten, hatte so gar nichts von der Unvorhersagbarkeit, der aufwallenden Fieberhaftigkeit, die den Frühlingen meiner Jugend eigentümlich war. Die Bewohner von Arcady beklagen sich über das Klima, auf ihre lässige, trockene Art, mir aber, der ich den trüben nordwesteuropäischen Tiefebenen mit ihren Eisstürmen und schrägen Regenfällen und finster dräuenden, endlos sich ostwärts entfaltenden Himmeln entstamme, fiel es schwer, diese Verhältnisse überhaupt als Wetter zu bezeichnen. Ich ging mit meinem dampfenden Kaffeebecher in die Essecke und klemmte mich unbeholfen zwischen Sitzbank und Tisch. Der klatschnasse Garten, glitzernd und zerzaust, sah leicht verschämt aus, wie jemand, der sich nach einer ungehörigen Rauferei gerade wieder hergerichtet hat. Über der Bucht lag noch den halben Morgen Dunst, bis die Sonne stark genug war, um ihn wegzubrennen, wie sie im Wetterbericht immer sagten. Ihn wegzubrennen, ich mag diesen Ausdruck mit seiner Bildhaftigkeit und seiner forschen Gewissheit. Da draußen an jenem Gestade sind die Elemente etwas, worauf man gönnerhaft hinabschaut; selbst die nicht selten auftretenden Erdbeben sind nichts weiter als eine große Volksbelustigung. Die ersten Monate, nachdem wir in dieses Haus gezogen waren, liebte ich es, morgens so wie jetzt dazusitzen und in meinen Avocadobaum zu schauen, in meinen Pfirsichbaum, den Kolibris zuzugucken, die sich emsig an dem Strauch zu schaffen machten, der, glaube ich, Hibiskus heißt, in einem Zustand von prickelnder Seligkeit den Frühnachrichten im Radio zu lauschen und ungeduldig darauf zu warten, dass sie zu Ende waren und der Sprecher mir mit lächerlich salbungsvoller Stimme verkündete, was der Tag für mich bereithielt, die Höhen und Tiefen der Temperatur – nie zu heiß, nie zu kalt –, die Brisen pazifisch und sanft wie Atemzüge, die stehende Fata Morgana des Nebels. Es war, als verhieße einem jemand eine Kette von verschwenderischen und ganz und gar unverdienten Wonnen.
Ich ging ins Bad, und als ich schlampig rasiert und mit halb fertigem Schlipsknoten wieder herauskam, war Magda wirklich da; in ihrem alten grauen Morgenrock mit der ausgefransten Kordel saß sie in der Essecke, wo ich vorhin gesessen hatte. Solide wie ein Lehnstuhl sah sie aus, sie hatte die Hände auf den Oberschenkeln, und zwischen ihren gespreizten Knien spannte sich ein Meter Flanell, und mein Herz schlug einen Haken, und eine Sekunde lang hatte ich Angst, gleich umzukippen. So habe ich sie am besten in Erinnerung in diesem Haus, hingepflanzt im neuralgischen Licht des frühen Morgens, das eiserne Haar in der Mitte streng gescheitelt und die schweren Zöpfe als Schnecken an den Ohren aufgerollt wie zwei überdimensionale Kopfhörer, mit nackten, hornhautverkrusteten Füßen, den grüblerischen, erwartungsleeren Blick auf einen Punkt etwas seitlich von mir gerichtet. Heut hielt sie das Gesicht ein wenig abgewandt, in dem für sie typischen wachsamen Winkel. Es schien, als werde sie womöglich sogar sprechen, wenn ich mich nur lange genug geduldete. Aber dann musste ich zwinkern, und da war sie fort, und mürrisch verfiel mein Herz wieder in seinen gewohnten, steinigen Takt. Warum konnte sie mich nicht in Ruhe lassen? Sie hatte doch weggewollt, dessen war ich mir ganz sicher, warum also musste sie andauernd wiederkommen? Mein Kaffeebecher stand an dem Platz, an dem sie erschienen war, er dampfte noch immer und sah aus wie der rauchende Lauf eines Revolvers.
Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch ging ich in die sogenannte – warum eigentlich sogenannte? – Lounge. Es war der düsterste Raum im ganzen Haus; dort musste immer eine Funzel brennen, Tag und Nacht. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb sich die Leute dort nie länger aufhalten mochten, trotz des Sofas und der Sessel und der Bücherregale mit ihrem einladenden Durcheinander. Leute? Was rede ich denn? Es waren ja überhaupt nie Leute da, außer Magda und mir. Wir zogen keine Gäste an; wir waren nicht gesellig; wir kannten kaum die Namen unserer nächsten Nachbarn; ich hatte es so haben wollen, und Magda hatte sich bereitwillig gefügt; zumindest glaube ich, dass sie es bereitwillig tat. Alkoholisiert und müde, wie ich war, setzte ich mich auf die Couch und wurde auf einmal von einer Woge von süß-triefendem Selbstmitleid überrollt. Nie trifft der Schmerz über mein erbarmungswürdiges, gefahrenreiches Leben mich so hart wie gerade in den frühen Morgenstunden, wenn ich doch eigentlich voll neu erwachter Hoffnung sein sollte und voller Tatendrang. Meine Entschlossenheit geriet kurz ins Wanken; wozu sollte ich mich auf diese Reise begeben, was erhoffte ich mir denn davon? Ich griff mir unters Knie, um mein totes Bein hochzuheben, und legte es krachend auf einem Tischchen ab; die Glühbirne flackerte von der Erschütterung. Was blieb mir weiter übrig, als zu reisen?
Der Raum hatte nur ein einziges großes, hohes Fenster, von dem aus man auf einen schmalen Gartenweg blickte und auf die Giebelwand des Nachbarhauses. Inzwischen hatte der Tag vollkommen Tritt gefasst, und das Fenster war ein großes Rechteck aus feuchtem, von schrägen, indigofarbenen Schatten durchschossenem Sonnenlicht; gegen die Düsternis, in der ich saß, wirkte es wie ein Gemälde, grell und platt, wie die naive Darstellung einer Tropenlandschaft. Wieder registrierte ich im Stillen, wie unaufdringlich doch das Sonnenlicht in diesem Teil der Welt ist, einfach ein mattes, ruhiges, gleich bleibendes Leuchten, wie ein helles, farbloses Gas, von dem jeder Quadratzentimeter des Tages erfüllt ist und das nicht vom Himmel auszugehen, sondern aus den Dingen selbst herauszustrahlen scheint, auf die es fällt, die zuckerwürfelweißen Häuser, die pastellfarbenen Autos, die schwarzgrün glänzenden Bäume, die, verträumten Wächtern gleich, die Straßen säumten. Unmittelbarer noch bemerkte ich den Staub in diesem Zimmer. Seit Magda weg war, hatte ich nicht einmal mehr versucht, das Haus in Ordnung zu halten; ich wusste gar nicht, wo die Reinigungssachen standen, obwohl – irgendwo musste es doch einen Besen geben, einen Mopp, einen Eimer …? Mir war so, als hätte Magda eine Putzfrau gehabt, die jeden Tag kam, mehrere Tage hintereinander war ich morgens zu Hause geblieben und hatte gewartet, aber es war niemand gekommen. Vielleicht hatte es die pechschwarze Jemima mit ihren rollenden Augen, dem gewaltigen Busen und dem wie eine Haube gebundenen weißen Kopftuch ja auch nur in meiner Einbildung gegeben. Hatte Magda den Haushalt etwa ganz alleine gemacht? Ich weiß auch nicht, warum mich der Gedanke überraschte, aber er tat es. Jetzt, wo sie weg war, lag überall Staub, ein feiner, weicher, maulwurffarbener Pelz, und mitten hindurch führten verschlungene Wege – ein Labyrinth, das Muster meines verwitweten Lebens in diesem Haus: von der Tür in den Flur, von der Küche zum Tisch, vom Badezimmer ins Schlafzimmer. Die Ränder meiner Welt verschwanden nach und nach, lösten sich auf in jenen grauen Halbschatten aus weichem Schmutz.
Verwitwet oder verwitwert? Gibt es so ein Wort überhaupt? Manchmal stellt mir sogar die Sprache noch ein Bein, dass ich darüber stolpere.
In den letzten Jahren war es mir immer ein Rätsel, wie Magda ihre Zeit verbracht hat, wenn ich nicht da war, wofür ich übrigens immer öfter Sorge trug. Der Haushalt kann ja schwerlich die ganze Antwort sein, nicht mal für jemanden, der sich so langsam und so bedächtig bewegt, wie sie es getan hat. Wenn ich sie fragte, was sie den Tag über gemacht habe, bekam sie jedes Mal so einen gehetzten Blick, vollführte ihre berühmte Dreivierteldrehung mit dem Kopf, um mich nicht ansehen zu müssen, ließ eine Schulter runtersacken und sah aus wie ein großes, argwöhnisch wiederkäuendes Tier, das sich an mich drängte. Ihre Unterwerfungsgesten ärgerten mich immer, obwohl mir auch nichts einfiel, was ich dagegen hätte unternehmen können, weshalb ich mich damit begnügen musste, sie so stählern und weißlippig anzulächeln, wie ich nur konnte, und rasch mit reptilienhaftem Zischen die Luft durch die Nasenlöcher einzuziehen, was sie stets zurückzucken ließ. Es war mir jedes Mal eine Genugtuung, wenn sie nach solch einem Zusammenstoß den ganzen Abend im Haus herumwanderte und kummervoll vor sich hin stöhnte oder aber besonders still war und gleichsam dem Abklingen meines Unmuts lauschte. Traten wir irgendwo gemeinsam auf, bei einer Party, die nicht zu vermeiden war, oder einem Empfang am College, konnte ich mir nicht verkneifen, die eine oder andere ironische Bemerkung über sie zu machen, womit ich alle, die so unklug waren, uns ins Gespräch zu ziehen, ermunterte, sich mit mir über dieses deplatziert wirkende, unpassend angezogene, schweigsame Wesen an meiner Seite zu amüsieren. Die Bonmots, die ich auf ihre Kosten fallen ließ, waren schuld daran, zumindest teilweise, dass man sich allgemein über sie lustig machte. Ich hatte oft gehört, dass man sie »Vanders Mädchen« nannte, wenn man von ihr sprach, oder auch »Mutter Vander« oder, mysteriös genug, mitunter auch die »Alte Eva«. Ihr schienen diese kleinen öffentlichen Grausamkeiten, denen sie durch mich ausgeliefert war, nichts weiter auszumachen; nein, sie quittierte sie sogar mit einem scheuen Lächeln, als sei sie stolz darauf, wie unmöglich ich mich benehmen konnte, und dann glänzten ihre schwarzen Knopfaugen und sie schob die dicke Oberlippe vor. Diese glückselige Duldsamkeit brachte mich natürlich noch mehr auf die Palme; am liebsten hätte ich auf sie eingeschlagen, wenn sie so dastand, mitten im dichtesten Gedränge, im Mantel, mit ihren breiten, flachen Schuhen, sich an ihrem Weinglas festhielt und das Trinken vergaß, ganz zufrieden und für sich, versunken in den bodenlosen Tiefen ihres Selbst, meine große, langsame, rätselhafte Gefährtin, die ich immerhin fast vierzig Jahre lang geliebt haben muss, denn sonst hätte ich sie doch verlassen.
Ich stand auf und ging wieder ins Schlafzimmer, wo ich zu meiner Überraschung feststellte, dass mein Koffer bereits gepackt war. Das hatte ich dann wohl vor Tau und Tag im Suff getan. Ich konnte mich aber nicht daran erinnern. Ich wusste noch, dass ich die Fluggesellschaft angerufen hatte, und wie erstaunt ich gewesen war, dass am anderen Ende keine Maschine antwortete, sondern eine hellwache und irritierend muntere menschliche Stimme – ich kann mich einfach nicht an die zunehmende Nachtlosigkeit der Welt gewöhnen –, danach aber kam nur die hektische, leise summende Leere eines trunkenen Schlafes. Vielleicht war es nicht allein der Bourbon, überlegte ich, vielleicht war ich ja gerade dabei, den Verstand zu verlieren. Wie soll man die Übergriffe der Senilität entdecken, wenn die Fähigkeit des Entdeckens selber Ziel dieser Attacken ist? Würde es Phasen eines Aufschubs geben, Augenblicke von furchtbarer Klarheit inmitten eines ziellosen Umherirrens, Momente von bebender Erkenntnis vorm Spiegel, wo man entsetzt sein vollgesabbertes Hemd anstarrte und die Pisseflecken auf dem Hosenstall? Wahrscheinlich nicht; wahrscheinlich werde ich einfach in die Senilität hinüberschlurfen, ohne es auch nur zu merken. Das wirklich hohe Alter, so jedenfalls erlebe ich es, ist ein allmählicher Prozess der Akkumulation, bei dem sich ganz langsam eine weiche, graue Substanz absetzt, wie Staub in einem ungepflegten Haus, unter der die einstmals scharfen Kanten meines Selbst nach und nach verschwimmen. Gleichzeitig vollzieht sich ein gegenläufiger Prozess, bei dem die Dinge starr und unbeweglich werden, der meinen Stuhl in Barren aus heißem Eisen verwandelt, meine Gelenke austrocknet, bis sie sich aneinanderscheuern wie Bimsstein, meine Zehennägel hart wie Horn macht. Die Dinge draußen in der Welt, die angeblich unbelebten Objekte, verbünden sich heimlich gegen mich. Ich verlege Sachen, verliere Sachen, meine Brille, das Buch, in dem ich eben noch gelesen habe, das zurückgekaufte silberne Pillendöschen von Mama Vander – nehmen wir nur mal dieses Kleinod –, das mehr als ein halbes Jahrhundert lang mein Talisman war, und jetzt ist es anscheinend weg, in eine Zeitspalte gefallen. Gegenstände stürzen von hohen Regalen und fallen mir auf den Kopf, Möbelstücke pflanzen sich mir in den Weg. Ständig schneide ich mich mit dem Rasierapparat, mit dem Obstmesser, mit der Schere; es vergeht kaum eine Woche, ohne dass ich irgendwann morgens übers Waschbecken gebeugt stehe und nervös mit den Zähnen ein Pflaster abpelle, derweil aus einer Schnittwunde am Finger mit schockierender Selbstverständlichkeit Blut aufs Porzellan tropft. Sind diese kleinen Unfälle nicht anders einzuordnen als bisher? Ich war schon immer etwas tollpatschig, auch schon in jungen Jahren, als ich ansonsten noch ganz quick war, und dennoch frage ich mich, ob meine jetzige Ungeschicklichkeit nicht vielleicht doch etwas Neues ist, nicht bloß eine körperliche Unbeholfenheit, sondern eine radikale Form von Diskontinuität, die äußerliche Manifestation von Fehlschaltungen im Gehirn und von einem in dessen Tiefen sich vollziehenden endgültigen Aussetzen. Die unbedeutendsten Kleinigkeiten sind immer die sichersten Warnzeichen, man muss nur auf sie hören. Magdas Krankheit fiel mir zuerst dadurch auf, dass sie plötzlich einen Heißhunger hatte auf dieses ganze Zeug, das Kinder so gerne essen, Puffmais und Kartoffelchips, Toffeeriegel, Brausepulver, billige Lutscher.
Draußen auf der Straße blökte eine Autohupe; der Klang der Autohupe ist für mich der charakteristischste Schlachtruf dieser großen Republik; sonor, gebieterisch, mit leicht belustigtem, spöttischem Unterton. Ich nahm den Koffer und den Krückstock und humpelte zur Tür wie ein Langzeitverurteilter, der den Riegel aufschnappen gehört hat.
Der Taxifahrer war die Karikatur des typischen osteuropäischen Einwanderers, ein bärenhafter, schweigsamer Typ, allem Anschein nach ein Russe, wovon es in diesen neoliberalen Zeiten offenbar eine ganze Menge gibt. Unwillig nahm er mir den Koffer ab, drehte sich um und schleppte ihn die Verandatreppe hinunter. Bisweilen kann man den Eindruck haben, als sei dieser ganze Küstenstrich eine Filmkulisse und jeder, der sich dort aufhält, ein Charakterschauspieler. An der Straße leuchteten die üppig belaubten Bäume, in den Vorgärten prangten bunte Blumen, und selbst jetzt, zu dieser frühen Morgenstunde, mitten im Frühling, fühlte sich die Luft irgendwie schal und abgestanden an – auch das eine Folge davon, dass es praktisch kein Wetter gibt und keinen Wind, nur Smog, den nicht einmal die Regenfälle bei Tagesanbruch ganz auflösen können. Der Taxifahrer hielt mir nicht die Tür auf; mühsam stieg ich in das niedrige Fahrzeug ein, warf den Krückstock auf den Sitz, klappte meinen Torso auf der Hälfte zusammen und schob mich rückwärts hinein, dann packte ich mit beiden Händen mein nutzloses Bein und holte es nach. Es ist gar nicht so einfach, sich graziös zu bewegen, wenn man ein halber Krüppel ist. Während dieses anstrengenden Manövers saß der Russe die ganze Zeit wie versteinert hinterm Lenkrad, Haarbüschel in den Ohren, den Kopf tief zwischen den massigen Schultern, und schaute ungeduldig geradeaus. Jetzt legte er irgendwo einen Hebel um – ich habe es nie gelernt, die riesigen, monströsen Autos dieses Landes zu fahren – und trat aufs Gaspedal, der Motor heulte auf und das Taxi stieß sich wie ein eingeklemmtes Tier von der Bordsteinkante ab. Ich sah mich um und erblickte einen meiner Nachbarn, der in Unterhemd und kurzen Hosen auf seiner Veranda stand und beobachtete, wie ich davonfuhr; seine Miene kam mir entschieden argwöhnisch vor, als wartete er nur darauf, dass das Taxi um die Ecke bog, um dann sofort zum Telefon zu rennen und die Behörden zu informieren, dass der komische Vogel von nebenan soeben ausgeflogen sei. Lang und schlaksig, ein Menschenschlag, den man hier in der Gegend häufig antrifft, mit grauen Locken und hängendem Banditenschnauzbart. In den über zwanzig Jahren, die wir Tür an Tür gewohnt haben, beschränkte sich unsere Kommunikation im Wesentlichen auf ein paar zurückhaltend höfliche Grußfloskeln, die ich mit ihm gewechselt habe, nur einmal war er angekommen und hatte sich beschwert, dass Magda einen streunenden Hund bei uns aufgenommen hatte; natürlich habe ich den Hund daraufhin weggeschafft. Jetzt ging mir zum ersten Mal der Gedanke durch den Kopf, dass der Bursche vielleicht Jude war. Sehr wahrscheinlich sogar: die Kringellocken, diese Nase. Anscheinend gehörte die Hälfte der Bewohner von Arcady und Umgebung zum Auserwählten Volk, wenn auch nicht auf die gleiche Weise wie ich selbst in der Vergangenheit; diese Luftmenschen hier waren allesamt zu selbstsicher, zu forsch und nicht larmoyant genug.
Wir kamen hinunter zur Küste und bogen ab in Richtung Brücke. Ich hatte recht gehabt, über der Bucht lag immer noch ein Dunstschleier, obwohl die Sonne stetig stärker wurde. Der Highway war vom morgendlichen Berufsverkehr verstopft; auf sechs Fahrspuren sausten die Autos dahin wie eine Herde verrückt gewordener Tiere. Ich schlug die Hände vors Gesicht. Ich war müde; mein Geist war müde; er lässt nach, wie alles andere auch, nur nicht so schnell. Und trotzdem kann er nicht aufhören zu arbeiten, keinen Augenblick, nicht einmal, wenn ich schlafe; das ist eine alarmierende Tatsache, mit der ich mich nicht richtig abfinden kann. Immer öfter, und besonders nachts, grüble ich über die furchtbare Möglichkeit nach, dass der Geist den Tod des Körpers überleben könnte. Es heißt, man habe gehört, wie Dantons abgeschlagener Kopf Robespierre mit Flüchen überhäufte. So in der Falle zu sitzen, und sei es auch nur eine Minute lang, zu fühlen, wie das ganze System zusammenbricht, zu sehen, wie zum Schluss das Licht ausgeht – ach! Das Taxi donnerte über eine Rampe in der Fahrbahn und begann den langen Anstieg hinauf zur Brücke, schleppte sich mühsam mit hundert Sachen dahin, die Reifen jaulten und der Motor ratterte wie eine kaputte Klimaanlage. Ich lehnte den Kopf an den schmierigen Plastikbezug des Sitzes und schloss wieder die Augen. Im Dunkel drängten von Neuem die alten Fragen heran. Was weiß ich? Heute noch weniger als gestern. Zeit und Alter haben mir nicht, wie ich erwartet hatte, Weisheit gebracht, sondern Verwirrung und immer weiter um sich greifendes Nichtverstehen, und jedes Jahr hinterlässt einen neuen Ring von Unwissenheit. Was weiß ich? Als ich die Augen öffnete, hatten wir den ersten Brückenkamm erreicht, und vor uns lag die Stadt, zog sich schläfrig über eine Reihe flacher Hügel hin, die stacheligen Häuser wirkten um die noch immer frühe Morgenstunde eindimensional und konturlos wie bei einem Bühnenbild. Über einer petrolblauen Smogbank schwebte ein winziges Flugzeug. In all der Zeit, die ich dort gelebt habe, war ich kein einziges Mal auf der anderen Brücke gewesen, der berühmten rostroten; ich weiß noch nicht mal ganz genau, von wo nach wo sie führt. Was soll mir denn auch die bloße Topografie? Ja, die Topografie des Bewusstseins, das ist eine andere Frage … Die Topografie des Bewusstseins – sage ich wirklich solche Sachen, sage ich so was etwa laut, dass es jeder hören kann?
Plötzlich drängte sich unmittelbar vor uns ein zerbeulter weißer Wagen mit einem spillerigen schwarzen Jungen am Steuer in unsere Spur; der Russe trat mächtig auf die Bremse, das Taxi schlingerte bedenklich, ich wurde nach vorn geschleudert und stieß mit dem gesunden Knie schmerzhaft an etwas Hartes in der Rückenlehne des Fahrersitzes. Ein Verkehrsunfall, die klassische Form der amerikanischen Straßenrevue, das war seit jeher meine größte Angst, die unerträgliche Absurdität des Ganzen, Lärm, Hitze, zischender Dampf, Schmerz. Verärgert versuchte der Russe auszuweichen; schließlich riss er wie ein Wilder das Steuer herum und zog rüber auf die linke Spur, und als er den weißen Wagen überholte, ließ er das automatische Fenster auf der Beifahrerseite runter und schleuderte einen vielsilbigen Kosakenfluch hinüber. Der junge Schwarze, der den mageren Unterarm im Fenster liegen hatte und mit feinnervigen Fingern im Takt zu der Musik aus seinem Autoradio trommelte, drehte sich um, bleckte die unglaublich großen, unglaublich weißen Zähne und grinste uns breit an, dann zog er laut und herzhaft den Rotz hoch und spuckte; die schleimige grüne Aule landete auf der Heckscheibe des Taxis, genau da, wo ich saß; ich zuckte angeekelt zusammen. Der Junge warf seinen Ägypterkopf zurück, lachte wiehernd – was ich jedoch nur sah, nicht hörte, weil es im Tosen des Verkehrs und im stampfenden Lärm des Autoradios unterging – und raste gut gelaunt in einer schwarzen Abgaswolke davon. Der Russe brummte ein paar bissige Worte, und es störte mich nicht weiter, dass ich ihn nicht verstand.
Wir verließen die Brücke an einer Abfahrt, die mir noch nie aufgefallen war, und fuhren jäh hinab in eine unbekannte Wildnis von Tankstellen, billigen Motels und ockerfarbener Steppe. Mich streifte der Gedanke, ob der Russe wirklich wusste, wie man zum Flughafen kam; es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass so ein zorniger Exilmoskowiter mit mir in die falsche Richtung gefahren wäre. Ich betrachtete die entseelte Landschaft mit ihren schräg vorüberhuschenden Schatten und wunderte mich einmal mehr, wie seltsam es doch war, hier zu sein, überhaupt irgendwo zu sein, in Gesellschaft dieser ganzen trügerischen Einzigartigkeiten. Der Russe war der Russe mit den langen Armen und dem Pelz in den Ohren, der schwarze Junge war der schwarze Junge, der ein zerrissenes Trikot trug und auf uns gespuckt hatte; sogar ich war ich und auf dem Weg zum Flughafen und vom Flughafen in eine andere, ältere Welt. Waren wir oder einer von uns, selbst in unseren eigenen Augen, etwa mehr als die Summe unserer Eigenschaften? War ich mehr als ein sich bewegender Komplex von Impulsen, Ängsten, zufälligen Vorstellungen? Den größten Teil dessen, was ich wohl meine Karriere nennen muss, habe ich damit zugebracht zu versuchen, den wenigen in der Masse der unverbesserlichen Gefühlsmenschen um mich herum, den wenigen, die es hören wollten, die simple Lektion einzuhämmern, dass es kein Selbst gibt: kein Ego, keinen kostbaren Funken Individualität, welchen ein bärtiger Patriarch da droben, den es ebenfalls nicht gibt, einem jeden von uns einhaucht. Und dennoch … Trotz all meiner Sturheit und zu meiner geheimen Schande muss ich eingestehen, dass ich mich nicht mal selber völlig frei machen kann von der Überzeugung, dass im Weltgetöse doch ein dauerhafter Kern von Selbstheit existiert, ein kleiner Kern, dem der Sturm, der dem Mandelbaum die Blätter abreißt und die verbliebenen Zweige schwanken und erzittern lässt, nichts anhaben kann.
Hier ist der Flughafen, im grellen, gesplitterten Licht des Morgens, die eingeschüchterten Reisenden schleppen ihr Gepäck, die Taxis schnüffeln sich gegenseitig am Hinterteil wie streunende Hunde, der Schwarze mit der Uniformmütze grinst und sagt mit frecher, falscher und forcierter Fröhlichkeit: »Guten Morgen, Sir!« Ich bezahlte den Russen – der Grobian, er lächelte! –, nahm meinen Koffer, drehte mich auf meinen Stock gestützt herum und machte mich mit meinem Seemannsgang auf den Weg, darauf gefasst, in den Rauchglastüren der Abflughalle einem schemenhaften Anderselbst zu begegnen, was aber nicht passierte, weil es sich’s die Türen im letzten Moment, als es schon so schien, als würden mein Spiegelbild und ich in gegenseitiger Vernichtung aufeinander treffen, noch einmal anders überlegten und plötzlich mit heißem Fauchen vor mir aufgingen.
Flieg fort! Flieg fort!
Sie legte die zwei mürben Zeitungsfetzen auf den kleinen Tisch am Bett, sodass das Licht der Lampe darauf fiel, kauerte sich davor hin und betrachtete sie eine Weile; ihre Hände lagen flach auf der Tischkante, das Kinn ruhte auf den Händen, sie ließ den Blick zwischen der Meldung von damals über seinen Tod und den beiden nebeneinanderstehenden Fotos von ihm und dem anderen hin und her wandern, beide waren ausgeblichen von der Zeit. Jeder ihrer Atemzüge beschlug sekundenlang die Glasplatte des Tischs und versetzte die vergilbten Fetzen in Bewegung. Sie hatte Gewissensbisse; mit einer Nagelschere hatte sie die Sachen ausgeschnitten, tief über den Zeitungsstapel gebeugt, und dabei hatte sie Angst gehabt, dass der Bibliothekar sie erwischte und ihr in gutturaler Empörung Vorhaltungen machte, und obendrein auch noch in einer Sprache, von der sie nicht ein Wort verstand. Wieder wunderte sie sich über den Druckfehler bei der Bildunterschrift – Axel Vanden – irgendwie passend, unerklärlicherweise. Wie jung er aussah, fast noch ein Junge, sehr hübsch, aber der Gesichtsausdruck war so verstört; wahrscheinlich hatte ihn bloß das Blitzlicht erschreckt, obwohl, sie konnte sich nicht helfen, irgendwie fand sie, dass in diesen Augen Angst war und böse Vorahnung. Der andere neben ihm hatte ein dreistes und gleichzeitiges selbstironisches Grinsen aufgesetzt. Vorsichtig hob sie mit den Fingerspitzen die zwei Rechtecke aus Reispapier hoch, die sie eigens auf die gleiche Größe zugeschnitten hatte, und legte sie auf die beiden Zeitungsschnipsel, erst eines auf die Meldung von seinem Tod, dann eines auf die beiden Fotos. Sie hatte einen Füllfederhalter gekauft, so einen mit altmodischem Design, der in der Mitte dick war und sich nach unten hin verjüngte und ein Vermögen gekostet hatte. In seinem Innern war nicht der Gummikolben gewesen, den sie erwartet hatte – auf alt gemacht war nur die äußere Hülle –, sondern lediglich eine starre Tintenpatrone aus Plastik. Das war auch besser so: Einen Kolben hätte sie herausnehmen müssen, damit er nicht auslief oder platzte, die Patrone aber konnte drin bleiben, die war sicher und klein genug, und es blieb reichlich Platz für das, was sie mit dem Hohlraum vorhatte. Außerdem würde der Füller auf diese Weise weiter funktionieren, und das war gut; die Glaubwürdigkeit liegt im Detail, das hatte sie von klein auf gelernt. Sie zog die beiden Zeitungsausschnitte an die vordere Tischkante und rollte sie vorsichtig mit angehaltenem Atem fest um die Spindel der Tintenpatrone, erst den einen, dann den anderen, jeweils geschützt mit einer Lage Reispapier, und schlang zur Sicherheit einen dünnen Faden darum, den sie aus ihrem Blusensaum gezupft hatte. Das Ganze zuzuknoten, gelang ihr erst im dritten Anlauf, weil die kleine Rolle aus Zeitungs- und Reispapier immer wieder aufgehen wollte. Behutsam setzte sie den Schaft auf das Gewindestück und schraubte den Füller wieder zu; einmal knackte es bedenklich, während sie drehte, und ihr war, als würde etwas Warmes, Weiches in ihrer Magengrube überschwappen. Doch dann war es vollbracht. Der Federhalter lag dick und prall in ihrer Hand und fühlte sich wie eine geladene Pistole an. Zur Probe schrieb sie schwungvoll ihren Namen auf den Block neben dem Bett; die Feder war zu fein für ihren Geschmack. Sie schraubte die Kappe wieder drauf, klemmte den Füller in ihre Blusentasche, trat vor den Spiegel am Kleiderschrank und sah sich lange an. Ihr Spiegelbild faszinierte sie jedes Mal, und zugleich hatte sie Angst vor diesem Wesen, das dort stand, so bekannt, so wissend und doch so fremd und vor dem es kein Entrinnen gab.
Heute Nacht schwiegen die Stimmen in ihrem Kopf.
Jetzt war nichts mehr zu tun; sie hatte alles vorbereitet, soweit es ging. Inzwischen würde Axel Vander ihren Brief haben, dort drüben am anderen Ende der Welt, das hatte man ihr auf der Post versichert. Sie hatte die schnellstmögliche Zustellungsart verlangt, was schon wieder eine erschreckend dicke Hand voll ihres schwindenden Vorrats an Banknoten verschlungen hatte. Sie lehnte sich ans Fenster und schaute in die Nacht hinaus. Auf dem Platz hatte der Regen schwarze, ölig glänzende Pfützen hinterlassen, und die in Reih und Glied stehenden Bäume, sie hielt sie für Platanen, warfen schräge, an den Rändern ausgefranste Schatten aufs Pflaster. Irgendwo in der Ferne spielte mit mechanischer, unheilverheißender Fröhlichkeit eine Drehorgel – eine Drehorgel, um diese Zeit, mitten in der Nacht? –, und in der Luft lag ein schwacher, widerlicher Geruch nach – ja, nach Vanille; es dauerte einen Moment, bis sie ihn identifizieren konnte. Sie war gern hier, in der fremden Stadt, es gefiel ihr gut, so für sich allein zu sein. Sie war sicher, er würde kommen. Vielleicht sogar schon morgen. Durchaus denkbar, dass er bereits unterwegs war. Sie stellte ihn sich vor, versuchte ihn sich vorzustellen, wie er durch den Flughafen eilte, ein aufgeregter, gereizter alter Mann, wie er mit der Faust auf den Ticketschalter schlug, seinen Namen schrie, Aufmerksamkeit forderte, insistierte, er brauche unbedingt einen Platz in der nächsten Maschine; er war ja berüchtigt für seine Wutausbrüche. Ein Schauer von Erregung durchrieselte sie. Das einzige Gesicht, das sie ihm zuordnen konnte, war das von diesem Zeitungsausschnitt, das mit dem jungenhaften Grinsen. Er würde zornig sein und vielleicht auch erschrocken; womöglich würde er ihr Geld anbieten; er könnte sie sogar bedrohen. Aber sie hatte keine Angst. Der Gedanke an seine Wut, seine Drohungen schreckte sie nicht; ganz im Gegenteil, sie war ruhig und gelassen, als würde sie fliegen, als schwebte sie irgendwie in der Luft, unerreichbar, weit über jeder Gefahr. Was wollte sie von ihm? Sie wusste es nicht. Es gab durchaus etwas zu wünschen, gewiss, sie spürte es in ihrem Innern wie einen vagen, nicht einmal unangenehmen Kummer; so stellte sie sich das Gefühl vor, wenn man gerade schwanger geworden ist. Sein Schicksal lag in ihrer Hand, seine Zukunft; sie hatte ihn erwischt. Ja, er würde kommen, da war sie sich ganz sicher.
Als ich endlich in der Stadt ankam, war es bereits nach Mitternacht. Flüge waren verspätet gewesen, Anschlüsse verpasst worden, und die Limousine, die mich am Flughafen abholen sollte, war nicht da, weil der Fahrer keine Lust gehabt hatte, noch länger zu warten, und einfach weggefahren war. Dann sagte man mir, mein Koffer sei nicht angekommen, wahrscheinlich sei er irgendwo anders hingeschickt worden. An dem Schalter für verloren gegangenes Gepäck war ein dunkelhäutiger Beamter mit in den Nacken geschobener Dienstmütze und Zigarette hinterm Ohr, der so tat, als würde er mein Italienisch nicht verstehen, das ich übrigens, wie ich ihm hätte sagen sollen, bei Dante gelernt habe; er erklärte achselzuckend, mein Koffer könne sonst wo sein, und drückte mir einen Packen unverständlicher Formulare in die Hand, die ich ausfüllen sollte. Ich warf ihm die Papiere ins Gesicht, und nach der Art, wie er aufsässig die ohnehin schon tiefen Brauen senkte und wütend das Gesicht verzog, sah es einen entsetzlich langen, Angst einflößenden Moment lang so aus, als ob er handgreiflich werden wollte, weshalb ich einen Schritt zurücktrat und schützend meinen Krückstock hob. Aber dann zuckte er bloß die Achseln und brabbelte irgendwas in ein Telefon, erklärte mir, es werde gleich jemand kommen, und wandte sich verächtlich ab. Wieder hieß es warten. Wütend schlurfte ich in der Ankunftshalle auf und ab, schlug mir eine Schneise durchs Gedränge der Touristen, lärmenden Familien und wichtigtuerischen Geschäftsleute mit ihren schmalen Diplomatenkoffern und ihren allzu blanken, troddelverzierten Schuhen. Binnen kürzester Zeit erschien eine uniformierte junge Frau von der Fluggesellschaft und erklärte mir mit melodischem Lachen, ja, das Gepäck des Professore sei in der Tat fehlgeleitet worden, werde aber umgehend zurückgeschickt, der Koffer werde mir dann direkt ins Hotel gebracht. Sie hatte einen großen Busen, einen leichten Damenbart und unschön vorstehende Augen und erinnerte mich an eine gefeierte Operndiva aus der Zeit unmittelbar nach dem Krieg, deren Name mir gerade nicht einfällt. Ich beschimpfte sie, und sie blinzelte rasch und setzte ein glasiges Lächeln auf, als sei sie sich nicht sicher, ob sie mich richtig verstanden hatte. Dann ging sie los und besorgte mir ein Taxi, und ich wurde in erstaunlichem Tempo – dass man doch immer wieder vergisst, was die Leute hier für einen Fahrstil haben – durch die feuchte Nacht in die Innenstadt befördert, wo unter den steinernen Arkaden noch die letzten samstagnächtlichen Fußgängermassen promenierten.
Im Hotel wurde mir mitgeteilt, dass man mein Zimmer weggegeben hatte. Man behauptete, nichts von meiner Reservierung zu wissen, aber ich musste bloß den ausweichenden Blick des kahlköpfigen Alten an der Rezeption sehen, und schon war mir klar, dass das gelogen war. Ich wurde laut, stieß Drohungen aus und stampfte mit dem Stock auf den Boden. Der Direktor wurde herbeigerufen, ein grotesk gut aussehender, korpulenter alternder Dandy mit Mahagoniteint und glänzendem Haar und der aufgeplusterten Brust eines Heldentenors – die ganze Sache geriet immer mehr zur Opera Buffa –, der salbungsvoll lächelnd mit ausgebreiteten Armen auf mich zukam und mir versicherte, die Sache werde sofort geklärt, es werde alles geregelt, ich solle mich nur einen kleinen Augenblick gedulden. Ich ging also in die menschenleere Bar, setzte mich in einen knarrenden Ledersessel und trank unter den verächtlichen Blicken eines schläfrigen Barkeepers zu viel Rotwein, und als man mich endlich in mein Zimmer brachte, eine abgeteilte braune Zelle im fünften Stock mit einem nackten Klosett in der Ecke, war ich zu müde und beschwipst, um mich noch zu beschweren. Doch trotz meiner Erschöpfung und obwohl es schon so spät war, beschloss ich sofort, auf der Stelle, mit der Briefschreiberin zu sprechen, mit meiner mysteriösen Nemesis, und rief sogar in der Zentrale an und bat, mich mit Antwerpen zu verbinden, aber dann hielt ich inne und überlegte es mir noch einmal – ich hätte nämlich sofort losgebrüllt – und knallte den Hörer auf die Gabel und kroch ins Bett, benebelt und ungebadet, immer noch in derselben Unterwäsche, die ich nicht mehr gewechselt hatte, seit ich vor einer halben Ewigkeit zu Hause aufgebrochen war.
Ich verbrachte eine unruhige Nacht; das Bett war, wie so oft in Hotelzimmern, viel zu schmal für mich und mein steifes Bein, und immer wieder wurde ich durch Geräusche von draußen geweckt, Autohupen, jaulende Motorräder, junge Burschen, die sich von einer Straße zur anderen anschrien. Gegen Morgen ließ der Radau nach, ich döste ein und träumte wilde Träume. Ich erwachte beizeiten, Alkohol ausschwitzend, mit brummendem Schädel, und stolperte zum Fenster, riss weit die Vorhänge auseinander und blinzelte zwischen den schräg nach vorn geneigten Häusern nach oben in den angespannten, himmelblauen Himmel von Europa.
Nach dem Frühstück, bei dem es von Neuem Ärger und Entschuldigungen gab, konnte ich in eine weitläufige Suite in der dritten Etage umziehen, wo es erträglicher war. Die Räume waren groß und kühl und hatten seidenglatte schwarze Marmorböden. Vor dem Bett stand mein zurückgekehrter Koffer und zog ein Gesicht, als ob er sich schämte. Ich habe eine Schwäche für Hotelzimmer, diese Aura von sich auf die Zunge beißender Anonymität, das Gefühl, vor der Welt verborgen zu sein, das beinah hörbare Echo von Geflüster und angehaltenem Atem und in hilfloser Verzückung ausgestoßenen Frauenschreien. Ich nahm ein vormittägliches Entspannungsbad und fantasierte mir ein Bild von Miss Nemesis zusammen: eine vertrocknete alte Jungfer mit blau geäderten Klauen, die Brille um den Hals gehängt und einem Mund, aus dem, inmitten eines Fächers von feinen, in die bärtige Oberlippe eingravierten Falten, bittere Enttäuschung über die verlorenen Verheißungen ihrer Jugend sprach, als sie Marlene-Dietrich-Hosen trug, Zigaretten rauchte und diese Doktorarbeit über das politische Element bei Wordsworth oder den Atheismus bei Shelley schrieb, die ihren Tutor in Girton oder die Suffragetten in Bryn Mawr so tief beeindruckt hatte. Mit der würde ich schon fertig werden. Erst mal würde ich es mit Charme probieren, dann mit Drohungen; und wenn alle Stränge reißen sollten, würde ich eben mit ihr auf die Mole Antonelliana steigen und sie hinunterstoßen. Ich musste lachen und fing an zu husten und spürte meine tabakgemarterte Lunge in ihrem Käfig schlackern wie einen schweren, halb aufgeblasenen, nassen Luftballon, und das Badewasser wogte und schwappte beinah über. Neben mir in der Seifenschale lag mein Zigarettenetui, auch so ein gestohlenes Kleinod aus der Vergangenheit. Ich steckte mir eine an, um mich herum rieselten zischend die heißen Ascheflöckchen ins Wasser. Nichts hilft besser gegen den morgendlichen Husten als eine ordentliche Lunge voll Zigarettenrauch.
In einer wahren Sturzflut von Seifenwasser hievte ich mich hoch und schrammte mir prompt an einer gläsernen Konsole den Ellbogen auf. Dieser neue Schmerz fand Widerhall im Knie, das ich mir gestern auf der Brücke im Taxi gestoßen hatte. Ich blieb einen Moment stehen, hielt meinen Arm umklammert und fluchte. Ich passe einfach nicht in diese Welt, nicht richtig jedenfalls; ich bin zu groß, zu breit, zu schwer für das normale Format der Dinge. Das ist keine Koketterie, ganz im Gegenteil; ich empfinde mein überdimensionales Selbst schon seit jeher als Belastung; es ist mir peinlich. Vor mir im beschlagenen Glas des mannshohen Badezimmerspiegels lümmelte mein bleiches, blinzelndes Spiegelbild. Ich ging ins Schlafzimmer, trat ans Fenster und schaute, immer noch meinen aufgeschrammten Ellbogen massierend, hinunter in die schmale, schattige Straße. Ein Bus huschte vorbei, Autos, perspektivisch verkürzte Menschen. An der Ecke, an der ein butterweicher Sonnenfleck klebte, verkaufte eine Frau Blumen; sie blickte hoch und schien mich zu sehen – konnte das sein, auf diese Entfernung? Was für einen Anblick ich wohl bot, hier oben schwebend, hinter Glas, ein grotesker Seraph, prall, nackt, antik. Ich hob die Hand, das Innere flach nach vorn gekehrt, zum feierlichen Gruß, aber die Blumenverkäuferin reagierte nicht.
Ehe ich noch recht wusste, was ich tat, hatte ich den Telefonhörer in der Hand und verlangte die Nummer in Antwerpen. Während ich wartete, hörte ich mich in die Sprechmuschel atmen, als würde ich hinter mir stehen und mir selber über die Schulter schauen. Noch nass vom Bad, tropfte ich auf den Marmorboden, in dessen dunkel schimmernder Oberfläche ich abermals mein Spiegelbild erkannte, wenn auch nur unscharf und diesmal in umgekehrter Perspektive, zuerst die Füße, dann die Schienbeine, die Knie, die baumelnden Genitalien, den Bauch, die breite Brust und über alledem wie eine Gloriole das wirre Haar und das konturlose, nach unten blickende Gesicht.
Sie nahm beim ersten Klingeln ab. Ich wusste kaum, was ich sagen sollte; ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich sie gleich erreichen würde, ich hatte Verzögerungen erwartet, Hindernisse, Umwege. Ja, sagte sie, ja, sie sei es. Ich konnte ihren Akzent nicht zuordnen; sie war keine Engländerin, aber ihre Muttersprache war Englisch. Etwas in ihrer Stimme sagte mir, dass sie nichts getan hatte, absolut nichts, nichts anderes, als auf meinen Anruf zu warten. Ich stellte mir die Szene vor: das elende Zimmer in dem billigen Hotel, durch ein Mansardenfenster fiel das Licht eines nördlichen Frühlingsmorgens, das die Farbe von poliertem Blei hatte, und sie saß mit gesenktem Kopf auf der Bettkante, die arthritischen alten Hände im Schoß gefaltet, und hatte ausdauernd all die langen Stunden in die Stille gelauscht und sich verzweifelt gewünscht, endlich den gellenden Schlachtruf des Telefons zu hören. Sie sprach vorsichtig und wohl überlegt, geizte mit den Worten, teilte sie sich ein; war jemand bei ihr und hörte mit, was sie sagte? Nein, sie war bestimmt allein, da war ich mir ganz sicher. Ich sagte, sie müsse sich schon zu mir bemühen, ich würde nicht zu ihr kommen, und dann war erst mal eine Weile Stille. Das Problem sei das Fahrgeld, sagte sie dann, die Bahnfahrt sei teuer, es sei eine weite Strecke. Jetzt war es an mir, das Schweigen in die Länge zu ziehen. Sie dachte doch nicht etwa, ich würde sie auch noch dafür bezahlen, dass sie hierher kam und mich fertig machte. Ich ließ sie weiter zappeln. Na schön, sagte sie schließlich, sie werde den Nachtexpress nehmen und morgen früh hier sein, und dann, ohne ein weiteres Wort, aber auch nicht überstürzt, legte sie auf. Ich fröstelte, meine alte Haut spannte vom trocknenden Badewasser und war ganz ausgekühlt. Auch meine Hände zitterten, ein wenig, aber nicht von der Nässe und auch nicht vor Kälte.
Ungeduldig, wie inzwischen immer, kleidete ich mich an. Je älter ich werde, desto lästiger finde ich diese notwendigen morgendlichen Rituale. Für wen warf ich mich in dieses Hemd, diesen Leinenanzug, wozu band ich mir diese Krawatte um, die zu kurz war und unten zu breit, wie ich im Spiegel sah, als würde mir die Zunge heraushängen? Für Alte müsste es ein spezielles Gewand geben, so ähnlich wie eine Mönchskutte, schlicht und funktional geschnitten und ein hübscher Vorgeschmack aufs Leichentuch. Ich fuhr mir mit den Fingern durch die störrisch knisternden Zotteln, was allerdings keinen sichtbaren Effekt hinterließ; ich hatte nie die Absicht gehabt, mir so eine wirre Mähne wachsen zu lassen, schon gar nicht, als meine Haare anfingen, weiß zu werden, aber ich merkte, dass man das von mir erwartete, von dem berühmten Mijnheer de Professor aus der versponnenen, altersschwachen Alten Welt. Plötzlich, wie ein leichter Schlag, kam diese Kindheitserinnerung wieder hoch, wie meine Mutter immer die Fingerspitze befeuchtet und dieses Komma aus drahtigem Haar oben auf meinen Kopf damit glatt gestrichen hatte, das stets im nächsten Moment schon wieder hochgesprungen war. Auch an den merkwürdig lustvollen Ekelschauer erinnerte ich mich, den ich hatte, wenn sie mir half, ein neues Kleidungsstück anzuziehen, ein Hemd oder Kniehosen oder einen gestärkten blauweißen Matrosenanzug, bei dem noch das Pappschildchen mit dem Preis am Knopfloch baumelte. Was war der Grund für diese innerliche Abwehr? Lag es an der übersteigerten Nähe zu meiner Mutter, unter deren nach Chrysanthemen riechendem Gesichtspuder ich ein Gemisch aus intimeren und aufregenderen Düften wahrnahm? Nein, ich glaube, das ist es nicht; was mich zurückschrecken ließ, war wohl eher ein übersteigertes Bewusstsein meiner selbst, die jähe, grässliche Erkenntnis, in diesem Panzer aus Fleisch und Knochen gefangen zu sein wie die Puppe im harten Mastikleder ihres Kokons. Und sogleich war wieder die Frage da: Welches Selbst? Was für ein klebriges Imago stellte ich mir vor, stelle ich mir vor, noch immer, das sich in meinem Innern quält hervorzubrechen und seine herrlichen, augengeschmückten Flügel auszubreiten.