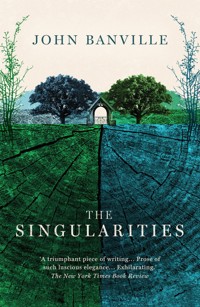9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein attraktiver Mann in den besten Jahren verstrickt sich in eine Kette von Katastrophen, ausgelöst durch einen sinnlosen Mord. Freddy Montgomery pflegt einen Lebensstil des gepflegten Müßiggangs – bis er sich eine größere Geldsumme leiht, die er nicht zurückzahlen kann. Vergeblich hofft er auf die Hilfe eines Kunsthändlers in seiner irischen Heimat. In einem verzweifelten Versuch, eines von dessen Gemälden zu stehlen, wird Freddy von einem Dienstmädchen überrascht. In einem Akt sinnloser Gewalt tötet er sie – ein Mord, der eine Kette weiterer Katastrophen auslöst. John Banvilles Das Buch der Beweise ist ein fesselnder Roman über einen Mann, dessen privilegiertes Leben in einem Strudel aus Schuld, Verbrechen und den Konsequenzen seiner Taten zerbricht. Banville erforscht eindringlich die dunklen Abgründe der menschlichen Psyche und die zerstörerische Macht von Gewalt und Schuld. Ein packender psychologischer Thriller, der lange nachhallt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
John Banville
Das Buch der Beweise
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über John Banville
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über John Banville
John Banville, geboren 1945 in Wexford, Irland, gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen literarischen Autoren. Sein umfangreiches Werk wurde mehrfach, auch international, ausgezeichnet, zuletzt mit dem Franz-Kafka-Literaturpreis, dem Man Booker Prize (für »Die See«) und 2013 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. John Banville lebt und arbeitet in Dublin und schreibt unter dem Pseudonym Benjamin Black Krimis und Thriller, die neben seinen Romanen ebenfalls bei Kiepenheuer & Witsch lieferbar sind.
Weitere Titel von John Banville: http://bit.ly/2qbstrL
Dorothee Merkel lebt als freie Übersetzerin in Köln. Zu ihren Übertragungen aus dem Englischen zählen Werke von Edgar Allan Poe, John Banville, John Lanchester und Nickolas Butler.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Freddy Montgomery ist ein attraktiver Mann in den besten Jahren, der einen Lebensstil des gepflegten Müßiggangs pflegt. Doch damit ist es vorbei, als er sich eine größere Geldsumme leiht, die er nicht zurückzahlen kann. Vergeblich hofft er auf die Hilfe eines Kunsthändlers in seiner irischen Heimat. Als er schließlich versucht, eines von dessen Gemälden zu stehlen, wird er von einem Dienstmädchen überrascht, das er in einem sinnlosen Akt der Gewalt tötet – ein Mord, der eine Kette weiterer Katastrophen auslöst …
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Euer Ehren, da Sie mich auffordern, dem Gericht das Ganze in meinen eigenen Worten zu erzählen, so werde ich Folgendes sagen. Ich werde hier eingesperrt wie ein exotisches Tier, wie das letzte überlebende Exemplar einer Art, von der man glaubt, sie sei ausgestorben. Man sollte Leute hereinlassen, um mich zu besichtigen, mich, den Mädchenfresser, grazil und gefährlich, wie ich auf und ab schleiche in meinem Käfig und mein schrecklicher grüner Blick an den Gitterstäben entlangflackert; damit sie etwas haben, über das sie träumen können, wenn sie nachts behaglich zugedeckt in ihren Betten liegen. Nach meiner Gefangennahme gingen sie wie Hyänen aufeinander los, um einen Blick auf mich zu erhaschen. Ich glaube, sie wären bereit gewesen, für dieses Privileg Geld zu bezahlen. Sie warfen mir Beschimpfungen an den Kopf und schüttelten mir zähnefletschend ihre Fäuste ins Gesicht. Ihr Anblick war irgendwie unwirklich, furchterregend und belustigend zugleich, die Art, wie sie sich auf dem Pflaster hin und her schoben, als seien sie Statisten in einem Film, junge Männer in schäbigen Regenmänteln, Frauen mit Einkaufstaschen und ein paar stumme grauhaarige Typen, die nur dastanden und mich gierig fixierten, von Neid ganz ausgezehrt. Dann warf mir einer der Polizisten eine Decke über den Kopf und verfrachtete mich in einen Streifenwagen.
Ich lachte. An der Art, wie die Wirklichkeit, banal wie immer, meine schlimmsten Fantasien erfüllte, war etwas unwiderstehlich Komisches.
Übrigens, diese Decke. Haben sie die extra mitgebracht, oder haben sie immer eine im Kofferraum, für alle Fälle? Solche Fragen beunruhigen mich jetzt, ich brüte darüber. Für einen flüchtigen Blick muss ich eine interessante Figur abgegeben haben, aufrecht auf dem Rücksitz wie eine Mumie, während das Auto durch die nassen sonnenbeschienenen Straßen raste und wichtigtuerisch blökte.
Und dann dieser Ort. Der Krach war es, der mich als Allererstes beeindruckt hat. Ein fürchterlicher Lärm, Schreie und Pfiffe, johlendes Gelächter, Streitereien, Schluchzen. Aber es gibt auch Augenblicke der Stille, als hätte uns alle plötzlich eine große Angst oder eine große Trauer befallen und sprachlos gemacht. In den Fluren steht die Luft, bewegungslos wie abgestandenes Wasser. Sie ist von einem leisen Karbolgestank durchzogen, der das Leichenhaus verrät. Anfangs glaubte ich, ich sei es selbst; das heißt, ich bildete mir ein, der Geruch ginge von mir aus, sei mein eigener Beitrag. Vielleicht ist er es ja? Auch das Tageslicht ist eigenartig, selbst draußen, im Hof, als ob irgendetwas damit geschehen sei, als hätte man etwas mit ihm gemacht, bevor ihm erlaubt wurde, uns zu erreichen. Es hat einen ätzenden zitronenhaften Schimmer und tritt immer in zwei Extremen auf: entweder reicht es zum Sehen nicht aus, oder es verbrennt einem die Augen. Von den verschiedenen Arten der Dunkelheit werde ich schweigen.
Meine Zelle. Meine Zelle ist. Wozu noch weitermachen damit.
Gefangene in Untersuchungshaft kriegen die besten Zellen zugeteilt. So sollte es auch sein. Man könnte ja immerhin befinden, dass ich unschuldig bin. Oh, ich sollte nicht lachen, es tut zu weh, ich spüre ein scheußliches Stechen dabei, als ob etwas mein Herz zusammenpresst – die Last meiner Schuld, nehme ich an. Ich habe einen Tisch und etwas, das wohl ein Sessel sein soll. Es gibt sogar einen Fernseher, ich benutze ihn jedoch selten, weil jetzt, seit mein Fall verhandelt wird, über mich nichts mehr in den Nachrichten berichtet wird. Die sanitären Anlagen lassen zu wünschen übrig. Das Auskippen der Eimer ist eine ziemlich ekelhafte Angelegenheit. Ich muss schauen, ob es mir gelingt, einen Korydon an Land zu ziehen, oder meine ich einen Neophyten? Irgendein junger Kerl, geschickt und willig und nicht zu pingelig. Das dürfte nicht schwierig sein. Ich muss auch schauen, ob ich mir ein Wörterbuch besorgen kann.
Vor allem stört mich der Geruch von Sperma überall. Das ganze Gebäude stinkt danach.
Ich muss zugeben, dass ich hoffnungslos romantische Vorstellungen davon hatte, wie es wohl hier drin sein würde. Irgendwie hatte ich mir ausgemalt, dass ich eine gefeierte Persönlichkeit sein würde, von den anderen Häftlingen in einem Spezialtrakt abgesondert, wo ich Gruppen von ernsten, wichtigen Personen empfangen würde, um mich in ihrer Gegenwart in Abhandlungen über die zentralen zeitgenössischen Fragen zu ergehen, womit ich die Herren beeindrucken und die Damen bezaubern würde. Welch tiefes Verständnis! würden sie ausrufen. Welch umfassende Einsicht: Man sagte uns, Sie seien eine Bestie, kaltblütig, grausam, aber nun, da wir Sie gesehen haben, Ihnen zugehört haben, ja, nun –! Und ich würde derweil eine elegante Pose einnehmen, mein asketisches Profil zu dem Licht in dem vergitterten Fenster erheben, ein parfümiertes Taschentuch in den Fingern drehen und leicht süffisant lächeln; Jean-Jacques, der kultivierte Killer.
Durchaus nicht, nicht im Entferntesten. Aber auch nicht wie andere Klischees. Wo sind die Krawalle im Esssaal, die Massenausbrüche, all das, was uns von der flimmernden Leinwand so vertraut ist? Und was ist mit der Szene im Hof, in der der Spitzel mit einem Messer kaltgemacht wird, während zwei stoppelbärtige Schwergewichtler als Ablenkungsmanöver eine Rauferei in Szene setzen? Wann fangen die Gruppenvergewaltigungen an? Tatsache ist, hier drin ist es wie da draußen, nur noch intensiver. Wir sind besessen von dem Problem unseres körperlichen Wohlbefindens. Es ist immer überheizt, wir könnten genauso gut in einem Brutkasten sitzen, und trotzdem gibt es endlose Beschwerden über Zugluft, plötzliche Kälte und erfrorene Füße des Nachts. Das Essen ist auch ungemein wichtig; wir stochern in unserem Brei herum, schnuppern daran, seufzen, als wären wir in einer Feinschmecker-Konferenz. Wenn ein Päckchen abgeliefert wird, verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Psst! Sie hat ihm eine Marzipantorte geschickt! Selbst gemacht! Eigentlich ist es wie in der Schule, diese Mischung von Elend und Behaglichkeit, die betäubte Sehnsucht, der Krach und überall, immer, dieser gewisse übel riechend graue, warme männliche Mief.
Man sagte mir, dass es anders war, als die politischen Gefangenen noch hier waren. Sie marschierten immer im Gänsemarsch in den Korridoren auf und ab, bellten sich etwas in schlechtem Irisch zu und verursachten große Heiterkeit unter den gewöhnlichen Kriminellen. Aber dann gingen sie alle in einen Hungerstreik oder so was und wurden woandershin verlegt, wo sie unter sich waren, und das Leben kehrte in normale Bahnen zurück.
Warum sind wir so genügsam? Ist es das Zeug, das sie angeblich in unseren Tee schütten, um unsere Libido einzuschläfern? Oder sind es die Drogen? Euer Ehren, ich weiß, dass keiner einen Petzer leiden kann, selbst die Anklage nicht, aber ich meine, dass es meine Pflicht ist, das Gericht davon in Kenntnis zu setzen, dass in dieser Anstalt der Handel mit verbotenen Substanzen floriert. Es sind Wärter daran beteiligt; wenn Sie mir Schutz garantieren, liefere ich Ihnen ihre Nummern. Es ist alles zu haben, Aufputscher und Ruhigsteller, Speed, Tranquilizer, Horse und Crack, alles was das Herz begehrt. Nicht dass Ihnen, Euer Gnaden, solche Begriffe aus den tiefsten Tiefen der Gesellschaft geläufig wären, natürlich nicht; ich habe sie selbst erst gelernt, seit ich hierhergekommen bin. Wie Sie sich vorstellen können, sind es hauptsächlich die jungen Männer, die diesem Laster frönen. Man erkennt sie daran, dass sie wie Schlafwandler durch die Gänge taumeln, mit jenem flüchtigen, wehmütig-betäubten Lächeln der wahrhaft Abgedrifteten. Es gibt jedoch ein paar, die nicht lächeln, die in der Tat den Eindruck machen, als würden sie nie mehr lächeln. Das sind die, die verloren sind, die es nicht mehr lange machen. Sie stehen da und starren ins Leere, mit einem ausdruckslosen, gedankenverlorenen Zug im Gesicht, wie verletzte Tiere, die an uns vorbeischauen, stumm, als wären wir für sie nur Phantome und als erlitten sie ihren Schmerz in einer anderen Welt als der unsrigen.
Nein, eigentlich sind es nicht nur die Drogen. Etwas Wesentliches ist verloren gegangen, man hat uns das Mark ausgesaugt. Wir sind keine richtigen Männer mehr. Alte Knastbrüder, Typen, die einmal ein wirklich beeindruckendes Verbrechen begangen haben, stolzieren herum wie alte Witwen, bleichgesichtig, weichlich, mit hochgewölbter Brust und fettem Hintern. Sie zanken sich um Leihbücher, ein paar von ihnen stricken sogar. Die Jüngeren haben auch ihre Hobbys, sie schleichen sich im Aufenthaltsraum an mich heran, mit ihren wässrigen Kalbsaugen, und zeigen mir schüchtern ihre Handarbeiten. Wenn ich noch ein Flaschenschiff mehr bewundern muss, werde ich anfangen zu schreien. Und doch, sie sind so traurig, so verletzlich, diese Straßenräuber, Vergewaltiger, Kindesmisshandler. Wenn ich an sie denke, dann sehe ich immer, ich weiß nicht genau warum, jenen Streifen von stoppeligem Gras und den einen Baum vor mir, den ich von meinem Fenster aus undeutlich erkennen kann, wenn ich meine Wange gegen die Gitterstäbe presse und schräg an dem Stacheldraht und der Mauer vorbeischiele.
Stehen Sie bitte auf, legen Sie Ihre Hand hierhin und nennen Sie deutlich Ihren Namen. Frederick Charles St. John Vanderveld Montgomery. Schwören Sie, dass Sie die Wahrheit sagen werden, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Dass ich nicht lache! Ich möchte sofort meinen ersten Zeugen aufrufen. Meine Frau. Daphne. Ja, das war, das ist ihr Name. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund fanden die Leute ihn immer leicht komisch. Ich finde, dass er sehr gut zu ihrer feuchten, dunklen, kurzsichtigen Schönheit passt. Ich sehe sie vor mir, meine Lady des Lorbeers, wie sie in einer sonnenbetäubten Lichtung ruht und ein wenig verärgert, mit leichtem Stirnrunzeln den Kopf abwendet, während irgendein unbedeutender Gott in Gestalt eines Fauns mit einer Schalmei um sie herumtollt und tänzelt und vergeblich sein ganzes Herz im Spiel für sie ausschüttet. Es war jenes entrückte, leicht unzufriedene Etwas, das sie an sich hatte, das zuerst meine Aufmerksamkeit auf sie lenkte. Sie war keine besonders feine Frau, und gut war sie auch nicht. Sie passte zu mir. Vielleicht dachte ich da schon an eine Zeit in der Zukunft, in der ich es nötig haben würde, dass mir jemand – irgendjemand – vergibt; und wer wäre besser dazu geeignet als jemand, der so ist wie ich.
Wenn ich sage, dass sie nicht gut war, dann meine ich nicht, dass sie böse war oder verdorben. Ihre Fehler waren bedeutungslos, verglichen mit den gezackten Rissen, die quer durch meine Seele liefen. Wessen man sie noch am ehesten anklagen konnte, war eine gewisse moralische Trägheit. Es gab Dinge, die zu tun sie einfach keine Lust hatte, ungeachtet aller Imperative, die ihr die Notwendigkeit eines Handelns vor die abgestumpfte Aufmerksamkeit drängten. Sie vernachlässigte unseren Sohn, nicht weil er ihr nichts bedeutet hätte – in ihrer eigenen Art und Weise hing sie sehr an ihm –, sondern einfach weil seine Bedürfnisse sie nicht wirklich interessierten. Manchmal überraschte ich sie dabei, wie sie in einem Stuhl saß und ihn mit einem abwesenden Ausdruck in den Augen betrachtete, als ob sie sich daran zu erinnern versuchte, wer oder was er eigentlich war und wie es dazu gekommen war, dass er da war und sich dort auf dem Boden vor ihren Füßen in einer seiner fürchterlichen Unordnungen herumsuhlte. Daphne! murmelte ich dann. Verdammtnochmal! und meistens schaute sie mich daraufhin in der gleichen Art an, mit demselben nichtssagenden, merkwürdig abwesenden Ausdruck in ihrem Blick.
Es fällt mir auf, dass ich anscheinend nicht anders von ihr sprechen kann als in der Vergangenheit. Das kommt mir irgendwie passend vor. Obwohl sie mich oft besucht. Als sie das erste Mal kam, fragte sie, wie es denn so sei hier drin. Du liebe Güte!, sagte ich, der Krach! – und die Leute! Sie nickte nur leicht, lächelte matt und schaute sich dann träge nach den anderen Besuchern um. Wir verstehen uns, wissen Sie.
In südlichen Breiten verwandelte sich ihre Trägheit in eine Art verführerische Lässigkeit. Ich erinnere mich an einen ganz bestimmten Raum, mit grünen Fensterläden, einem schmalen Bett und einem Van-Gogh-Stuhl; draußen pulsierte der Mittag des Mittelmeers in den weißen Straßen. Ibiza? Ischia? Mykonos vielleicht? Immer eine Insel, bitte notieren Sie das, Herr Protokollführer, es könnte von Bedeutung sein. Daphne konnte sich ihrer Kleider mit einer magischen Geschwindigkeit entledigen, sie schüttelte sie einfach ab, als seien Rock, Bluse, Unterhose, alles was sie anhatte, aus einem Stück. Sie ist eine üppige Frau, nicht fett, nicht einmal schwer, aber trotzdem massiv und wunderbar ausgewogen. Immer wenn ich sie nackt sah, wollte ich sie streicheln, in derselben Art, wie es mich danach verlangte, eine Skulptur zu streicheln, die Kurven in der Höhlung meiner Hand abzuwägen, mit dem Daumen an den langen, glatten Linien entlangzufahren und die Kühle zu spüren, die samtige Beschaffenheit des Steins.
Protokollführer, streichen Sie diesen letzten Satz, man wird glauben, dass er mehr bedeutet als beabsichtigt.
Diese versengenden Mittage, in jenem Raum und in zahllosen anderen ihm ähnlichen Räumen – mein Gott, ich zittere, wenn ich jetzt an sie denke. Ich konnte ihrer sorglosen Nacktheit nicht widerstehen, dem Gewicht und der Dichte dieses schimmernden Fleisches. Sie lag neben mir, eine abwesende Maya, und starrte an mir vorbei an die sich im Schatten verlierende Decke oder auf den dünnen Spalt von brennendem weißen Licht zwischen den Fensterläden, bis es mir endlich gelang, wie genau, habe ich nie verstanden, einen geheimen Nerv in ihr zu berühren, und dann wandte sie sich mir zu, schwerfällig, rasch, mit einem Stöhnen, und klammerte sich an mich, als ob sie fiele, ihr Mund an meiner Kehle, ihre Fingerspitzen, die wie die einer Blinden waren, auf meinem Rücken. Sie hielt ihre Augen immer offen, ihr matter sanfter grauer Blick irrte hilflos hin und her, zuckte zusammen unter dem zärtlichen Schaden, den ich ihr zufügte. Ich kann nicht sagen, wie sehr er mich erregte, dieser schmerzliche schutzlose Blick, der ihr zu jeder anderen Zeit so wenig ähnlich sah. Ich versuchte, sie dazu zu bringen, ihre Brille aufzubehalten, wenn wir so im Bett waren, damit sie noch viel verlorener, viel schutzloser aussah, aber es gelang mir nie, egal was für ausgeklügelte Methoden ich anwendete. Und natürlich konnte ich sie nicht darum bitten. Danach war es immer so, als wenn überhaupt nichts passiert wäre, sie stand auf und schlenderte ins Badezimmer, eine Hand in ihren Haaren, und ließ mich ausgestreckt auf den völlig durchnässten Betttüchern zurück, erschüttert, keuchend, als hätte ich einen Herzanfall erlitten, den ich auf eine gewisse Weise wohl auch tatsächlich gehabt hatte.
Sie hat nie gewusst, glaube ich, wie sehr sie mich im Innersten berührte. Ich gab darauf acht, dass sie es nicht erfuhr. Oh, missverstehen Sie mich nicht, es war nicht so, als ob ich Angst gehabt hätte, mich in ihre Gewalt zu geben, oder irgendetwas in der Art. Nur wäre zwischen uns ein solches Wissen, wie soll ich sagen, unpassend gewesen. Von Anfang an hatten wir uns stillschweigend darauf geeinigt, Zurückhaltung und Takt zu wahren. Wir verstanden einander, durchaus, aber das hieß nicht, dass wir uns kannten oder uns kennen wollten. Wie hätten wir sonst jene unbefangene Anmut aufrechterhalten können, die uns beiden so wichtig war, wenn wir nicht gleichzeitig die notwendige Verschlossenheit unseres innersten Selbst aufrechterhielten?
Wie gut tat es dann, am kühlen Nachmittag aufzustehen und durch die krasse Geometrie von Sonne und Schatten in den engen Straßen hinunter zum Hafen zu gehen. Ich genoss es, Daphne dabei zuzuschauen, wie sie vor mir herging und ihre kräftigen Schultern und Hüften unter dem dünnen Stoff ihres Kleides in einem gedämpften, komplexen Rhythmus bewegte. Ich genoss es auch, die Männer der Insel zu beobachten, wie sie, gebückt über ihren Pastis und ihren Fingerhüten voll trüben Kaffees sitzend, ihre Echsenaugen verdrehten, wenn sie vorbeiging. So ist’s recht, ihr armen Schweine, lechzt nur, lechzt.
Am Hafen gab es immer eine Bar, immer dieselbe, egal was für eine Insel es war, mit ein paar Tischen und Plastikstühlen im Freien, geknickten Sonnenschirmen, die für Stella oder Pernod warben, und einem dunkelhäutigen fetten Inhaber, der im Türrahmen lehnte und in seinen Zähnen herumstocherte. Auch die Leute waren immer die gleichen: ein paar magere raue Typen in ausgewaschenen Jeans, sonnengegerbte Frauen mit hartem Blick, ein fetter alter Kerl mit einer Seglermütze und einem ergrauten Backenbart und natürlich ein oder zwei Schwule mit Armreifen und schicken Sandalen. Sie waren unsere Freunde, unsere Clique, unser Kreis. Selten nur wussten wir ihre Namen, oder sie die unsrigen, wir nannten uns Kumpel, Kamerad, Käpten, Schätzchen. Wir tranken unsere Brandys oder unsere Ouzos oder was immer der billigste einheimische Fusel war und sprachen lebhaft von anderen Freunden, lauter Originalen, in anderen Bars, auf anderen Inseln, während wir uns die ganze Zeit genau beobachteten, selbst wenn wir lächelten, auf etwas lauernd, wir wussten nicht was, vielleicht auf eine Bresche, eine weiche, für einen Moment unbewacht gelassene Stelle, in die wir unsere Giftzähne schlagen konnten. Meine Damen und Herren Geschworenen, Sie haben uns gesehen, wir waren Teil des einheimischen Ambientes in Ihrer Pauschalreise. Sie gingen mit wehmütigem Blick an uns vorüber, und wir haben Sie ignoriert.
Wir herrschten unter diesem Haufen, Daphne und ich, mit einer Art hoheitsvoller Distanz, als wären wir ein Königspaar im Exil, das täglich auf die Nachricht einer Gegenrevolution und auf den Ruf des Palastes zur Rückkehr wartet. Ich stellte fest, dass die Leute im Allgemeinen ein bisschen Angst vor uns hatten, von Zeit zu Zeit beobachtete ich in ihren Augen einen beschwichtigenden, hundehaften Ausdruck, oder aber ich fing einen hasserfüllten Blick auf, verstohlen und düster. Ich habe über dieses Phänomen nachgegrübelt, es scheint mir bedeutungsvoll zu sein. Was in uns war es – oder besser gesagt, was war es, das wir an uns hatten, das sie beeindruckt hat? Nun, wir sind groß, gut gebaut, ich bin attraktiv, Daphne ist eine Schönheit, aber das kann nicht alles gewesen sein. Nein, nach langem Nachdenken bin ich zu folgendem Schluss gekommen: sie bildeten sich ein, in uns eine Geschlossenheit, eine Ganzheit zu entdecken, eine Art essenzielle Authentizität, die ihnen fehlte und derer sie sich nicht ganz würdig fühlten. Wir waren – nun ja, wir waren Helden.
Ich fand das alles natürlich lächerlich. Nein, warten Sie, ich stehe hier unter Eid, ich muss die Wahrheit sagen. Ich genoss es. Ich genoss es, entspannt in der Sonne zu sitzen, mit meiner glanzvollen, von einem skandalösen Hauch umgebenen Gemahlin an meiner Seite, und würdevoll den Tribut zu empfangen, den unsere bunt gemischte Hofgesellschaft uns zollte. Es gab ein besonderes, ganz leichtes Lächeln, das ich an mir hatte, gelassen, tolerant, mit nur einer Idee von Verachtung, das ich besonders den Beschränkteren unter ihnen zuteilwerden ließ, den armen Narren, die mit Kappe und Schelle plappernd um uns herumtollten und wie besessen lachend ihre erbärmlichen Mätzchen machten. Wenn ich in ihre Augen schaute, sah ich mich darin geadelt wieder und konnte so einen Augenblick lang vergessen, was ich war; ein schäbiges zitterndes Ding, genau wie sie, voll von Sehnsucht und Abscheu, einsam, ängstlich, von Zweifeln gequält und dem Tod ausgeliefert.
So kam es, dass ich in die Hände von Gaunern geriet, ich hatte mir erlaubt, mich in dem Glauben einzulullen, unverletzbar zu sein. Ich versuche nicht, Euer Ehren, meine Handlungsweise zu entschuldigen, ich möchte sie nur erklären. Jenes Leben, das Sichtreibenlassen von Insel zu Insel, förderte Illusionen. Die Sonne, die salzige Luft laugten die Dinge aus, entleerten sie ihrer Bedeutung, sodass sie ihr wahres Gewicht verloren. Meine Instinkte, die Instinkte unseres Stammes, jene in den dunklen Wäldern des Nordens geschmiedeten Sprungfedern wurden dort unten lasch, Euer Ehren, tatsächlich, das wurden sie. Wie könnte irgendetwas gefährlich oder böse sein in solch zärtlichem blauen Wasserfarbenwetter? Und überhaupt, schlechte Sachen sind immer solche, die anderswo passieren, und schlechte Menschen gehören nie zu denen, die man selber kennt. Der Amerikaner zum Beispiel schien in keiner Weise schlechter zu sein als irgendjemand sonst aus dem in jenem Jahr versammelten Trupp. Tatsächlich schien er mir nicht schlechter zu sein als ich selbst, jedenfalls nicht schlechter, als ich damals zu sein glaubte, denn dies war selbstverständlich, bevor ich entdeckte, wozu ich fähig war.
Ich nenne ihn »den Amerikaner«, weil ich seinen Namen nicht kannte oder ihn vergessen habe, aber ich bin nicht sicher, ob er überhaupt ein Amerikaner war. Er sprach mit einem näselnden Tonfall, den er sich auch im Kino hätte angeeignet haben können, und die Art und Weise, wie er sich beim Sprechen mit zusammengekniffenen Augen umschaute, erinnerte mich an den einen oder anderen Filmstar. Ich konnte ihn unmöglich ernst nehmen. Wenn ich ihn in meiner herrlich treffenden Weise nachahmte – ich war schon immer ein guter Imitator –, lachten die Leute laut auf in überraschtem Wiedererkennen. Zunächst dachte ich, dass er noch ein ziemlich junger Mann sei, aber Daphne lächelte und fragte mich, ob ich mal einen Blick auf seine Hände geworfen hätte. (Sie hatte einen Blick für so was.) Er war mager und muskulös, mit einem scharf geschnittenen Gesicht und jungenhaft kurz geschorenem Haar und hatte eine Vorliebe für enge Jeans, hochhackige Stiefel und Ledergürtel mit riesigen Schnallen. Er gab sich entschieden den Anstrich eines verhinderten Wildwesthelden. Ich werde ihn – lassen Sie mich überlegen –, ich werde ihn Randolph nennen. Er war hinter Daphne her. Ich beobachtete ihn dabei, wie er sich an sie heranschlich, die Hände in die engen Hosentaschen gequetscht, und um sie herumzuschnüffeln begann, selbstgefällig und nervös zugleich, wie so viele andere vor ihm; und wie bei diesen konnte man ihm sein Verlangen aus einer gewissen angespannten Blässe zwischen den Augen ablesen. Mich behandelte er mit wachsamer Zuvorkommenheit, nannte mich Freund und sogar – bilde ich es mir nur ein? – Partner. Ich erinnere mich an das erste Mal, als er sich an unseren Tisch setzte und sich auf einen Ellbogen gestützt nach vorne lehnte, während seine Spinnenbeine sich um den Stuhl wanden. Es fehlte nur noch, dass er seinen Tabaksbeutel hervorzog und sich mit einer Hand eine Zigarette drehte. Der Kellner, Paco oder Pablo, ein junger Mann mit brennenden Augen und aristokratischen Ambitionen, brachte uns aus Versehen die falschen Getränke, und Randolph benutzte die Gelegenheit, um gnadenlos über ihn herzufallen. Der arme Junge stand da, seine Schultern gebeugt unter den wie Peitschenhieben auf ihn niederprasselnden Beschimpfungen, und war wieder der Bauernsohn, der er immer schon gewesen. Nachdem er davongestolpert war, schaute Randolph Daphne an und entblößte grinsend eine Reihe von langen dunkelgelben Zähnen, wodurch er mich an einen Hund erinnerte, der stolz wie Oskar vor seiner Herrin Männchen macht, nachdem er ihr eine tote Ratte vor die Füße gelegt hat. Gottverdammte Kanaken, sagte er lässig, und machte ein Geräusch mit den Mundwinkeln, als spucke er aus. Ich sprang auf, packte den Rand des Tisches und kippte ihn um, wobei ich die vollen Gläser in seinen Schoß schleuderte; Steh auf und zieh, du Scheißkerl! brüllte ich ihn an. Nein, nein, natürlich tat ich nichts dergleichen. Wie sehr auch immer ich es genossen hätte, einen Tisch voller zerbrochener Gläser in seinen auf groteske Weise bis zum Platzen vollgestopften Hosenstall zu kippen, das war nicht meine Art, jedenfalls damals nicht. Und nebenbei gesagt, ich hatte es genau wie alle anderen auch genossen, mit anzusehen, wie Pablo oder Paco seine Quittung bekam, dieser Einfaltspinsel mit seinen seelenvollen Blicken, seinen zarten Händen und diesem ekelhaften Schamhaarschnurrbart.
Randolph erweckte gern den Eindruck, ein gefährlicher Typ zu sein. Er erzählte von finsteren Machenschaften in einem fremden Land, das er »zu Hause in den Staaten« nannte. Ich ermunterte ihn zu diesen Draufgängergeschichten, heimlich entzückt von der »Ach-was«- und »Nicht-der-Rede-wert«-Art, in der er sie zum Besten gab. Es war etwas herrlich Lächerliches in dem Ganzen; der verschlagene Blick des Angebers, sein durchtrieben bescheidener Tonfall, sein Gehabe voll euphorischer Selbstbeweihräucherung und die Art, wie er sich unter der Wärme meiner still nickenden, mit ehrfürchtiger Scheu erfüllten Reaktion wie eine Blume öffnete. Die kleinen Verderbtheiten in meinen Mitmenschen haben mir schon immer Befriedigung bereitet. Es ist ein besonderes Vergnügen, einen Idioten und Lügner so zu behandeln, als sähe ich in ihm den Inbegriff aller Redlichkeit, und auf seine Posen und Schwindeleien scheinbar einzugehen. Er behauptete, ein Maler zu sein, bis ich ihm ein paar unschuldige Fragen zu diesem Thema stellte; da wurde plötzlich ein Schriftsteller aus ihm. In Wirklichkeit verdiente er sein Geld, wie er mir eines Nachts in betrunkenem Zustand mitteilte, mit Drogenhandel für die vermögenden Urlauber der Insel. Natürlich war ich schockiert, betrachtete es jedoch als eine wertvolle Information; und später, als –
Aber dies alles hängt mir zum Hals raus, lassen Sie mich es hinter mich bringen. Ich bat ihn, mir etwas Geld zu leihen. Er weigerte sich. Ich erinnerte ihn an jene durchzechte Nacht und sagte, dass ich sicher sei, die Guardia würde sich für das, was er mir erzählt hatte, interessieren. Er war bestürzt. Er überlegte es sich. So viel Knete, wie ich verlangte, habe er nicht, sagte er, er müsste sie irgendwo für mich besorgen, vielleicht von den Leuten, die er kannte. Und er kaute an seinen Lippen. Ich sagte, das ginge in Ordnung, es sei mir egal, wo es herkäme. Ich war amüsiert und zufrieden mit mir und der Art, wie ich den Erpresser spielte. Ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass er mich ernst nehmen würde, aber es schien so, als hätte ich seine Feigheit unterschätzt. Er beschaffte das Geld, und für eine Weile lebten Daphne und ich auf großem Fuße; alles war bestens, außer dass Randolph wie eine Klette an mir hing, wo immer ich auch hinging. In seiner Interpretation von Wörtern wie »leihen« und »zurückzahlen« ließ er es bedauerlicherweise sehr an Fantasie fehlen. Hatte ich nicht sein schmuddeliges kleines Geheimnis für mich behalten, sagte ich ihm, war das kein fairer Tausch? Diese Leute verstehen keinen Spaß, sagte er mit einem schrecklichen, zuckenden Versuch, zu grinsen. Ich sagte, dass ich erfreut sei, das zu hören, schließlich würde man doch ungern glauben wollen, dass man, wenn auch nur aus zweiter Hand, mit Leuten gehandelt habe, die bloß leichtsinnig seien. Daraufhin drohte er, ihnen meinen Namen zu geben. Ich lachte ihm ins Gesicht und ging davon. Es war mir noch immer unmöglich, irgendetwas daran ernst zu nehmen. Ein paar Tage später kam ein kleines, in braunes Papier gewickeltes Paket an, das in einer kaum lesbaren Schrift an mich adressiert war. Daphne machte den Fehler, es zu öffnen. Der Inhalt war eine Tabaksdose – Balkan Sobranie, was dem Ganzen einen merkwürdig internationalen Anstrich verlieh –, gefüllt mit Baumwolle, in die sich ein eigenartig gewundenes, bleiches, knorpeliges Stück Fleisch schmiegte, das von getrocknetem Blut verkrustet war. Es dauerte eine Weile, bis ich es als ein menschliches Ohr identifizierte. Wer auch immer es abgeschnitten hatte, hatte schlampige Arbeit geleistet, mit so etwas wie einem Brotmesser, dem gezackten schartigen Rand nach zu urteilen. Qualvoll. Ich nehme an, das war die beabsichtigte Wirkung. Ich weiß noch, wie ich dachte: Wie passend, ein Ohr, in diesem Land der Toreros! Ziemlich lustig, eigentlich.
Ich begab mich auf die Suche nach Randolph. An die linke Seite seines Kopfes hatte er ein großes Stück Mullbinde gepresst, das in einem verwegenen Winkel von einem nicht sehr sauberen Verband an seinem Platz gehalten wurde. Bei seinem Anblick dachte ich nicht mehr an den Wilden Westen. Jetzt, als hätte das Schicksal sich entschlossen, seine Behauptung, ein Künstler zu sein, zu unterstützen, hatte er eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem armen verrückten Vincent in jenem Selbstporträt, das entstanden war, nachdem er sich um der Liebe willen entstellt hatte. Als er mich sah, dachte ich, er würde anfangen zu heulen, so voller Selbstmitleid und entrüstet sah er aus. Jetzt werd allein mit ihnen fertig, sagte er, du schuldest ihnen was, nicht ich, ich hab bezahlt, und er berührte verbissen seinen bandagierten Kopf mit der Hand. Dann schmiss er mir ein unflätiges Schimpfwort an den Kopf und stahl sich durch eine enge Gasse davon. Trotz der Mittagssonne lief mir ein Schauer den Rücken herunter, wie ein grauer Wind, der übers Wasser streicht. Nachdenklich verweilte ich noch einen Moment dort, an der weißen Ecke. Ein alter Mann auf einem Esel grüßte mich. In der Nähe läutete eine blecherne Kirchenglocke wie wild. Warum, fragte ich mich, warum lebe ich so?
Das ist eine Frage, auf die ohne Zweifel auch das Gericht gerne eine Antwort hätte. Bei meiner Herkunft, meiner Erziehung, meinem – allerdings – meinem Geschmack, wie konnte ich ein solches Leben führen, mit solchen Leuten verkehren, in eine derartige Klemme geraten? Die Antwort ist – ich weiß die Antwort nicht. Oder ich weiß sie, und sie ist zu weitreichend und verworren, um sie hier in Angriff zu nehmen. Wie jeder andere glaubte ich damals daran, dass ich den Lauf meines eigenen Lebens selbst bestimmte, gemäß meinen eigenen Entscheidungen. Nach und nach, als sich immer mehr Vergangenheit ansammelte, auf die ich zurückblicken konnte, begriff ich jedoch, dass ich das, was ich getan hatte, deswegen getan hatte, weil ich nichts anderes tun konnte. Bitte denken Sie nicht, Euer Ehren, – ich beeile mich, dies hinzuzufügen – denken Sie nicht, dass ich das als eine Art Rechtfertigung oder Verteidigung meine. Ich möchte für meine Handlungen die volle Verantwortung übernehmen – immerhin sind sie das Einzige, das ich mein Eigen nennen kann –, und ich erkläre im Voraus, dass ich das Urteil des Gerichts widerspruchslos hinnehmen werde. Ich frage nur, mit allem Respekt, ob es möglich ist, das Prinzip der moralischen Schuld aufrechtzuerhalten, sobald die Idee des freien Willens aufgegeben worden ist. Es ist dies, das gebe ich Ihnen zu, eine knifflige Frage, eine von der Sorte, über die wir hier drinnen des Abends bei Kakao und Zigaretten gerne diskutieren, wenn die Zeit bleiern auf uns lastet. Wie gesagt, ich habe mir mein Leben nicht immer als ein Gefängnis vorgestellt, in dem alle Handlungen nach einem von einer unbekannten und gefühllosen Macht willkürlich hingeworfenen Muster bestimmt werden. Tatsächlich sah ich mich, als ich jung war, als ein Baumeister, der eines Tages ein wunderbares Gebäude um mich herum errichten würde, eine Art Pavillon, luftig und hell, der mich völlig umschließen und in dem ich doch frei sein würde. Sieh, würden sie dann sagen, die Erhebung von Weitem erkennend, sieh, wie stabil es ist, wie solide; natürlich, das ist er, ja, kein Zweifel, ganz er selbst. In der Zwischenzeit jedoch, unterkunftslos, fühlte ich mich allen Blicken ausgesetzt und gleichzeitig unsichtbar. Wie soll ich es beschreiben, dieses Gefühl meiner selbst als etwas Gewichtslosem, ohne Verankerung, ein vorübertreibendes, unwirkliches Trugbild? Andere Leute schienen eine Dichte zu haben, eine Gegenwart, die mir fehlte. Ich war unter ihnen, diesen großen, sorglosen Wesen, wie ein Kind unter Erwachsenen. Ich beobachtete sie mit weit aufgerissenen Augen und wunderte mich über ihre gelassene Zuversicht im Angesicht einer verwirrenden und grotesken Welt. Missverstehen Sie mich nicht, ich war durchaus kein Mauerblümchen, ich lachte, grölte und prahlte wie alle anderen auch – nur im Innern, in jenem trostlosen, dunklen Stollen, den ich mein Herz nenne, stand ich unbehaglich da, mit einer Hand am Mund, still, neidisch und unsicher. Sie verstanden die Dinge oder akzeptierten sie wenigstens. Sie wussten, was sie über eine Sache dachten, sie hatten Meinungen. Sie hatten den umfassenden Überblick, als ob ihnen nicht klar geworden sei, dass alles unendlich teilbar ist. Sie sprachen von Ursache und Wirkung, als ob sie glaubten, dass es möglich sei, ein Ereignis abzusondern und es in einem leeren zeitlosen Raum, außerhalb des irrsinnigen Wirbels der Dinge einer Untersuchung zu unterziehen. Sie sprachen von ganzen Völkern, als ob sie von einem einzigen Individuum sprächen, während es mir schon tollkühn vorkam, selbst von einem Individuum mit irgendeiner Gewissheit zu sprechen. Oh, sie kannten keine Grenzen.
Und als ob die Leute in der Außenwelt nicht genug waren, hatte ich auch in meinem Innern ein mustergültiges Gegenüber, eine Art Aufsichtsperson, vor der ich meinen Mangel an Überzeugung verbergen musste. Wenn ich zum Beispiel etwas las, eine These in irgendeinem Buch, und ihr begeistert zustimmte, um dann am Ende zu entdecken, dass ich völlig missverstanden hatte, was der Autor eigentlich hatte sagen wollen, dass ich das Ganze in der Tat völlig falsch herum aufgezäumt hatte, dann sah ich mich gezwungen, blitzschnell eine Kehrtwende zu machen und zu mir selbst, ich meine zu meinem anderen Selbst, jenem strengen inneren Feldwebel, zu sagen, dass das, was gesagt wurde, wahr sei, dass ich niemals wirklich anders gedacht hatte und dass, selbst wenn es so gewesen wäre, es nur der Beweis für Offenheit sei, wenn man so zwischen den Meinungen hin- und herwechseln kann, ohne es überhaupt zu merken. Dann wischte ich mir die Stirn ab, räusperte mich, richtete mich auf und ging voll unterdrückter Bestürzung behutsam zum nächsten Punkt über. Aber warum rede ich in der Vergangenheit? Hat sich irgendetwas geändert? Nur dass der Beobachter aus meinem Innern hervorgetreten ist und die Sache in die Hand genommen hat, während der verwirrte vormalige Bewohner der Außenseite sich im Innern duckt.
Ich frage mich, ob sich das Gericht darüber klar ist, was mich dieses Geständnis kostet?
Ich nahm das Studium der Wissenschaft auf, um Gewissheit zu finden. Nein, das stimmt nicht ganz. Sagen wir lieber, ich wandte mich der Wissenschaft zu, um mit dem Mangel an Gewissheit besser zurechtzukommen. Ich glaubte, hier einen Weg gefunden zu haben, um auf dem Sand, der sich immer und überall tückisch unter mir verschob, einen soliden Bau zu errichten. Und ich war erfolgreich, ich hatte Talent. Die Tatsache, dass ich in Bezug auf das Wesen der Realität, der Wahrheit und der Ethik, all dieser großen Dinge, keinerlei Überzeugung vertrat, war eine Hilfe. Tatsächlich tat sich mir in der Wissenschaft die Vision einer unberechenbar wuchernden Welt auf, die mir, dem Materie immer schon als ein Wirbel von zufälligen Zusammenstößen erschienen war, auf unheimliche Weise vertraut war. Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie, das war mein Gebiet. Abgehobenes Zeug, ich werde mich hier nicht weiter darüber auslassen. Ich hatte eine gewisse kalte Begabung, die nicht unbedeutend war, selbst an den ehrfurchtgebietenden Maßstäben dieser Disziplin gemessen. Meine studentischen Arbeiten waren ein Muster an Klarheit und Präzision. Meine Lehrer liebten mich, diese schäbigen alten Kerle, die nach Zigarettenrauch und schlechten Zähnen stanken, erkannten in mir jenen seltenen unbarmherzigen Zug, dessen Fehlen sie zu einem Leben voll stumpfsinniger Plackerei am Katheder verurteilt hatte. Und dann entdeckten mich die Amerikaner.
Wie habe ich Amerika geliebt, das Leben dort an jener pastellfarbenen sonnenüberfluteten Westküste, es hat mich für alles andere verdorben. Ich sehe es noch in meinen Träumen, es ist alles da, unangetastet, die ockerfarbenen Hügel, die Bucht, die herrlich anmutige rostrote Brücke, vom Nebel umhüllt. Ich kam mir vor, als sei ich zu einem hohen sagenumwobenen Plateau aufgestiegen, zu einer Art Arkadien. Welch Reichtum, welche Muße, welche Unschuld. Von allen Erinnerungen, die ich an diesen Ort habe, wähle ich eine beliebig aus. Ein Frühlingstag, die Cafeteria der Universität. Es ist Mittagszeit. Draußen, auf dem Hof beim Springbrunnen, ergötzen sich atemberaubende Mädchen in der Sonne. Wir haben an jenem Morgen dem Gastvortrag eines wissenschaftlichen Genies gelauscht, einem der Großmeister dieser Loge, der nun mit an unserem Tisch sitzt, Kaffee aus einem Pappbecher trinkt und mit seinen Zähnen Pistazienkerne knackt. Eine magere, schlaksige Person mit einer wilden Mähne aus krausem, sich grau färbendem Haar. Sein Blick ist humorvoll, mit einem Funken Boshaftigkeit, und huscht ruhelos hin und her, als ob er nach etwas sucht, das ihn zum Lachen bringen könnte. Tatsache ist, sagt er, dass die ganze verdammte Sache nur Zufall ist, Freunde, reiner Zufall. Und plötzlich lässt er sein Haifischlächeln aufblitzen und zwinkert mir zu, mir, der ich auch ein Außenseiter bin. Die um den Tisch versammelten Mitglieder der Fakultät, große braun gebrannte ernste Männer in kurzärmeligen Hemden und Schuhen mit breiten Sohlen, nicken und schweigen. Einer kratzt sich am Kinn, ein anderer schaut träge auf seine klobige Armbanduhr. In kurzen Hosen und ohne Hemd geht draußen ein flötespielender Junge vorbei. Die Mädchen erheben sich langsam, in Zweierpaaren, und gehen über das Gras davon, mit verschränkten Armen und wie Brustharnische gegen den Leib gepressten Büchern. Mein Gott, kann es sein, dass ich wirklich dort gewesen bin? Es scheint mir nun, hier an diesem Ort, eher Traum als Erinnerung zu sein, die Musik, die sanften Mänaden, und wir an unserem Tisch, blasse bewegungslose Figuren, die Weisen, hinter Glas regierend, in dem sich die Blätter der Bäume spiegelten.
Sie waren fasziniert von mir dort drüben, von meinem Akzent, von den Fliegen, die ich mir umband, von dem leicht finsteren Charme der alten Welt, den ich an mir hatte. Ich war vierundzwanzig; unter ihnen fühlte ich mich, als sei ich Ende dreißig. Sie schmissen sich mit feierlicher Inbrunst an mich heran, als gelte es, sich an einer Art Selbstverbesserung zu beteiligen. Zu jener Zeit war gerade einer ihrer kleinen ausländischen Kriege in vollem Gange, jeder außer mir, so schien es, protestierte – ich wollte nichts zu tun haben mit ihren Märschen, ihren Sitzstreiks und der ohrenzersplitternden Echophrasie, die sie für eine Diskussion hielten – aber selbst meine politischen Ansichten, oder das Fehlen derselben, wirkte nicht abschreckend, und mit zitternden Blütenblättern fielen Blumenkinder in allen Größen und Farben in mein Bett. An wenige von ihnen kann ich mich mit einiger Präzision erinnern, wenn ich an sie denke, sehe ich so etwas wie eine Mixtur vor mir, mit den Händen der einen, den Augen der anderen, dem Schluchzen einer Dritten. Von jenen Tagen, jenen Nächten bleibt nur ein ferner, bittersüßer Geschmack zurück, und eine Spur, ein verschwindender Nachglanz jenes Zustands von Schwerelosigkeit, von, wie soll ich sagen, von diaphanischer, ataraxischer Glückseligkeit – oh ja, es ist mir gelungen, ein Wörterbuch zu besorgen –, so ließen sie mich zurück, meine Muskeln noch schmerzend von ihrer erschöpfenden Fürsorge, mein Fleisch in dem Balsam ihres Schweißes gebadet.
Es war dort in Amerika, dass ich Daphne kennenlernte. Eines Nachmittags auf einer Party im Haus irgendeines Professors stand ich auf der Veranda, mit einem dreifachen Gin in der Hand, als ich unter mir auf dem Rasen die Stimme meiner Heimat hörte; leise, doch klar, wie der Klang von auf Glas fallenden Wassers und mit jenem Hauch von Trägheit, welcher der unverwechselbare Ton unserer Kreise ist. Ich schaute hin, und da war sie, in einem geblümten Kleid und unmodischen Schuhen, ihr Haar in dem Afro-Look frisiert, der damals gerade in Mode gekommen war. Sie starrte stirnrunzelnd an der Schulter eines Mannes vorbei, der eine Jacke in schreienden Farben trug und mit blasierten Gesten auf etwas antwortete, das sie gefragt hatte, während sie ernsthaft nickte und überhaupt nicht zuhörte. Ich hatte nur diesen flüchtigen Blick von ihr, dann wandte ich mich ab, ich weiß nicht genau warum. Ich hatte eine meiner schlechten Launen und war halbwegs betrunken. Diesen Moment sehe ich als ein Emblem unseres gemeinsamen Lebens. Ich sollte die nächsten fünfzehn Jahre damit verbringen, mich von ihr abzuwenden, auf die ein oder andere Weise, bis zu jenem Morgen, als ich an der Reling des Inseldampfers stand, die schmierige Luft des Hafens einsog und ihr und dem Kind, zwei winzigen Gestalten unter mir auf dem Kai, halbherzig zuwinkte. An jenem Tag war sie es, die sich von mir abwandte, mit einer, wie es mir jetzt scheint, unendlich traurigen Endgültigkeit.
Das Bewusstsein meiner eigenen Dummheit bedrückte mich ebenso sehr wie die Angst vor dem Kommenden. Ich kam mir lächerlich vor. Die Klemme, in die ich geraten war, war unwirklich: einer dieser verrückten Träume, aus denen irgendein unfähiger, fetter kleiner Mann einen drittklassigen Film drehen würde. Oft verdrängte ich es einfach für längere Zeit, wie man einen Traum verdrängt, egal wie schrecklich er war; aber es dauerte nie lange, bis dieses scheußliche, polypenhafte Monstrum wieder hervorgekrochen kam und eine heiße Welle von panischer Angst und Scham in mir emporstieg – ich schämte mich darüber, wie dumm ich gewesen war, auf welch unverantwortliche Weise es mir an Voraussicht gefehlt hatte; wie hatte ich mir bloß eine solche Suppe einbrocken können!
Da ich durch Randolph in eine Art Vorfilm gestolpert zu sein schien, hatte ich erwartet, dass die Besetzung dieser Komödie aus lauter Schurken bestehen würde, beängstigenden Typen mit niedrigen Stirnen und kleinen dünnen Schnurrbärten, die mit den Händen in den Hosentaschen im Kreis um mich herumstehen, grässlich grinsen und an Zahnstochern nagen würden. Stattdessen wurde ich zu einer Audienz mit einem silberhaarigen Hidalgo im weißen Anzug zitiert, der mich mit einem langen festen Händedruck begrüßte und mir mitteilte, dass sein Name Aguirre sei. Sein Benehmen war höflich und enthielt eine Spur des Bedauerns. Er passte schlecht zu seiner Umgebung. Ich war in einem engen Treppenhaus zu einem schmutzigen niedrigen Raum über einer Bar hinaufgestiegen, in dem ein mit einem Wachstuch bedeckter Tisch und ein paar Korbstühle standen. Auf dem Boden unter dem Tisch saß ein völlig verdrecktes Kleinkind und saugte an einem hölzernen Löffel. Ein übergroßes Fernsehgerät kauerte in einer Ecke, in dessen leerem, drohenden Bildschirm ich mein Spiegelbild sah, unheimlich groß und dünn und in einem Bogen gekrümmt. Es roch nach gebratenem Essen. Mit einer leicht angeekelten Grimasse prüfte Señor Aguirre den Sitz eines der Stühle und ließ sich nieder. Er goss Wein für uns ein und leerte sein Glas, indem er auf mein Wohl trank. Er sei ein Geschäftsmann, sagte er, ein einfacher Geschäftsmann, kein berühmter Professor – und er lächelte mich an und verbeugte sich leicht –, aber trotz alledem wisse er, dass es gewisse Regeln gebe, gewisse moralische Imperative. Er dächte besonders an einen, vielleicht könne ich mir denken, welchen? Stumm schüttelte ich den Kopf. Ich fühlte mich wie eine Maus, mit der eine geschmeidige, gelangweilte, alte Katze spielt. Sein Bedauern vertiefte sich. Darlehen, sagte er sanft, Darlehen sollten zurückgezahlt werden. Das sei das Gesetz, auf dem sich der Handel gründe. Er hoffe, dass ich seinen Standpunkt verstünde. Es folgte ein Schweigen. Eine Art entsetztes Erstaunen hatte mich ergriffen: dies war die harte Wirklichkeit, die Welt der Angst und der Schmerzen und der Vergeltung, ein bedrohlicher Ort, nicht jener sonnige Spielplatz, auf dem ich ganze Hände voll Geldes vergeudet hatte, das nicht das meine war. Ich werde nach Hause fahren müssen, sagte ich endlich, mit einer Stimme, die nicht meine eigene zu sein schien, dort gibt es Leute, die mir helfen werden, Freunde, Familie, von ihnen kann ich mir etwas leihen. Er überlegte. Ob ich alleine fahren werde? fragte er. Für einen Moment war mir nicht klar, worauf er hinauswollte. Dann wandte ich meinen Blick von ihm ab und sagte langsam ja, ja, meine Frau und mein Sohn werden wahrscheinlich hierbleiben. Und indem ich dies sagte, kam es mir vor, als hörte ich ein scheußlich meckerndes Lachen, ein urwaldhaftes verächtliches Gejohle direkt hinter meiner Schulter. Er lächelte und goss vorsichtig noch ein paar Tropfen Wein ein. Das Kind, das mit meinen Schnürsenkeln gespielt hatte, begann zu heulen. Ich war aufgeregt und hatte das Balg nicht absichtlich getreten. Señor Aguirre verzog das Gesicht und rief etwas über seine Schulter. Eine Tür hinter ihm öffnete sich und eine unwahrscheinlich fette, ärgerlich aussehende junge Frau steckte ihren Kopf herein und knurrte ihn an. Sie trug ein schwarzes ärmelloses Kleid mit schiefem Saum und eine glänzende schwarze Perücke, die so hoch war wie ein Bienenstock, mit dazu passenden falschen Augenwimpern. Sie kam hereingewatschelt, bückte sich mühevoll, hob das Kind auf und gab ihm einen klatschenden Schlag ins Gesicht. Es zuckte überrascht zusammen und starrte mich, indem es einen mächtigen Schluchzer herunterschluckte, mit seinen runden Augen ernst an. Die Frau warf mir ebenfalls einen wütenden Blick zu, nahm den hölzernen Löffel und schmiss ihn mit Geklapper vor mich auf den Tisch. Dann stampfte sie aus dem Raum, das Kind fest auf eine ihrer immensen Hüften gepflanzt, und knallte die Tür hinter sich zu. Señor Aguirre zuckte leicht und entschuldigend mit den Schultern. Er lächelte wieder und zwinkerte mir zu. Was ich denn von den Frauen der Insel hielte? Ich zögerte. Nun, nun, sagte er fröhlich, ich hätte doch bestimmt eine Meinung zu solch wichtigen Angelegenheiten. Ich sagte, sie seien hübsch, sehr hübsch, so ziemlich die Hübschesten, die ich je gesehen hätte. Er nickte glücklich, es war die Antwort, die er von mir erwartet hatte. Nein, sagte er, nein, zu dunkel, überall zu dunkel, selbst an den Stellen, die der Sonne nie ausgesetzt sind. Und er lehnte sich vor, mit seinem zerknitterten silbrigen Lächeln, und tippte mir mit einem Finger leicht auf das Handgelenk. Die Frauen aus dem Norden dagegen, ah, diese bleichen Frauen aus dem Norden. Was für eine weiße Haut! So zart! So zerbrechlich! Ihre Frau zum Beispiel, sagte er. Es folgte ein weiteres atemloses Schweigen. Entfernt konnte ich scheppernde Musikfetzen aus dem Radio in der Bar unter uns hören. Stierkampfmusik. Mein Stuhl machte ein knackendes Geräusch unter mir, wie eine gemurmelte Warnung. Señor Aguirre legte seine El-Greco-Hände zusammen und schaute mich über den Dachfirst seiner Fingerspitzen hinweg an. Ihre Fhrau, sagte er, das Wort herausatmend, Ihre wunderschöne Fhrau, Sie werden zu ihr zurückkommen? Es war keine wirkliche Frage. Was konnte ich zu ihm sagen, was konnte ich tun? Auch das sind keine wirklichen Fragen. Ich erzählte Daphne so wenig wie möglich. Sie schien zu verstehen. Sie machte keine Schwierigkeiten. Das war immer schon das Großartige an Daphne: sie macht keine Schwierigkeiten.