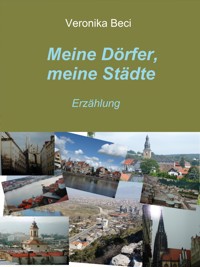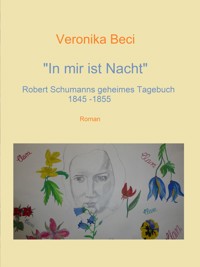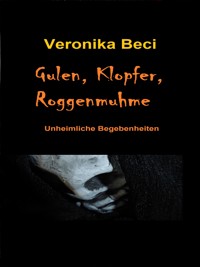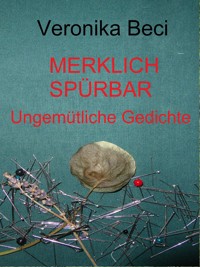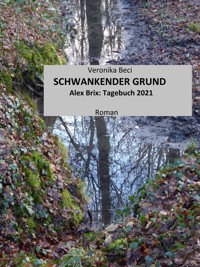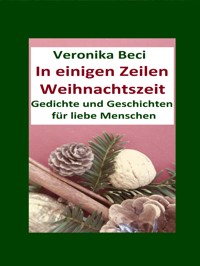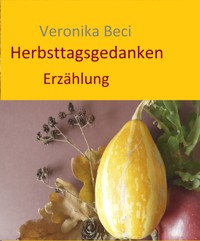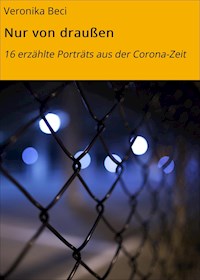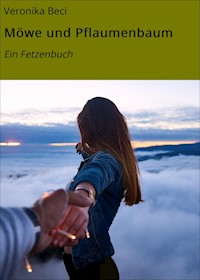9,99 €
Mehr erfahren.
Sprache öffnet Welten für Kinder und befähigt sie zur Mitgestaltung ihrer Umwelt. Ein gelingender Spracherwerb und eine gesunde Sprachentwicklung sind die Voraussetzungen. Sie werden durch systematische sprachliche Bildung optimal unterstützt. Das Lexikon zu Sprache, Spracherwerb und sprachlicher Bildung gibt pädagogischen Fachkräften einen grundlegenden Einblick in die Thematik und ist ein praktischer und unverzichtbarer Begleiter für Beruf und Studium.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Veronika Beci
Sprache
Lexikon für pädagogische Fachkräfte
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
I. Sprache allgemein
II. Sprachentwicklung/Spracherwerb
III. Literacy
IV. Mehrsprachigkeit
V. Sprach- und Sprechstörungen
VI. Sprachliche Bildung
VII. Inklusion
VIII. Intuitive Unterstützung des Spracherwerbs
IX. Fachkraft-Kind-Interaktion
X. Kind-Kind-Interaktion
Literaturauswahl
Eine Bemerkung zum Schluss
Autorin
Impressum neobooks
Vorwort
Sprache ist ein sehr umfassendes Fachgebiet. Dieses Lexikon fokussiert sich daher auf den Zusammenhang von Sprache, dem Spracherwerb von Kindern und verschiedenen Aspekten sprachlicher Bildung.
Um den Überblick zu vereinfachen und das Lexikon im pädagogischen Alltag praktikabel zu machen, wurde es in zehn Abteilungen unterteilt: Sprache allgemein, Spracherwerb, Literacy, Mehrsprachigkeit, Sprach- und Sprechstörungen, sprachliche Bildung, Inklusion, intuitive Sprachbildung, Fachkraft-Kind-Interaktion und Peer-Interaktion. Das machte nötig, das einige Begriffe mehrfach auftauchen, die Inhalte der jeweiligen Lexikoneinträge sich jedoch ergänzen. Verweise sind mit einem Pfeil und der römischen Kapitelzahl gekennzeichnet, z.B. → VI Legasthenie. Die Einträge sind möglichst verständlich geschrieben.
Das wichtige Kapitel Inklusion zeigt an, wie weit sich das Gebiet ‚Sprache‘ erstreckt, und dass ohne Sprache viele Bereiche der Welt verschlossen bleiben würden.
Es ist mir daher ein großes Anliegen und ständige Motivation, pädagogische Fachkräfte bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, den Spracherwerb der Kinder optimal zu begleiten, damit den Kindern durch reiche sprachliche Kompetenzen mehr als nur eine Welt offensteht.
Ich wünsche allen Lesenden dieses Lexikons viel Vergnügen bei der Beschäftigung mit Sprache und sprachlicher Bildung!
Veronika Beci, Münster 2024.
PS: Einige Impulse und Ideen für die Kita-Praxis lassen sich ebenfalls finden!
I. Sprache allgemein
„Die Sprache ist ein Gewölke, an dem jede Phantasie ein anderes Gebilde erblickt“.
Jean Paul
Sprache ist ein Kommunikationssystem. Sie dient der Verständigung zwischen Lebewesen oder der Informationsverarbeitung (z.B. Programmiersprache). Sprache gehört zur Kultur des Menschen, denn sie ist eine geistige und gestaltende Leistung menschlicher Gemeinschaften. Sprache ist ein Kulturgut, d.h. sie wird als kultureller Wert begriffen und weitergetragen. Natürliche menschliche Sprachen (durch Entwicklungsprozesse erworbene Sprachen) stehen neben künstlich geschaffenen Sprachen (z.B. Esperanto, eine 1887 erfundene Plansprache).
Äußerung
Als Äußerung wird einmal das Hervorbringen von Lautfolgen, zum anderen die Realisierung eines Satzes bezeichnet: aussprechen und das Ausgesprochene.
Akronym
Ein Ausdruck, der sich aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Worte zusammensetzt. Ein oft zitiertes Beispiel ist das Wort LKW, das sich aus /L/ für Last, /K/ für Kraft und /W/ für Wagen zusammensetzt: Lastkraftwagen.
Bilden die zusammengesetzten Buchstaben ein Wort, das es bereits gibt, wird von Apronym gesprochen. Zum Beispiel ist das Kürzel ‚ERASMUS‘ aus den Buchstaben des europäischen Studentenaustausch-Programms ‚European community action scheme for the mobility of University students‘ der Vorname Erasmus (hier wurde bei der Benennung an den Philosophen Erasmus von Rotterdam, ≈ 1467 - 1536, gedacht, der ein kritischer Humanist und toleranter Theologe war und daher für Kritikfähigkeit, Humanismus und Toleranz steht).
Allophon
Allophone sind Lautvarianten. Die Varianten unterscheiden sich dabei nur nach dem Artikulationsort eines →Phons, sie sind nicht bedeutungstragend wie das →Phonem. Allophone sind zum Beispiel das Zungen-/r/ [r] oder das Zäpfchen-/r/ [ʁ]; so kann das /r/ im Wort ‚rot‘ sowohl mit Zungen-/r/, als auch Zäpfchen-/r/ ausgesprochen werden, ohne dass sich die Bedeutung des Wortes ändert.
Hingegen macht es einen Bedeutungsunterschied, ob z.B. das /a/ lang gesprochen wird [a:] oder kurz [a], dann kann nämlich aus ‚lahm‘ [la:m] ein ‚Lamm‘ [lam] werden; in diesem Fall spricht man von Phonemen.
Ausgangssprache
Das zuerst erlernte sprachliche System (umfasst auch → IV Dialekt und → IV Soziolekt).
CALP
Cognitive academic language proficiency
Dt.: Kognitiv-akademische Sprachkompetenzen
CALP bezeichnet die Fähigkeit schriftliche Äußerungen zu produzieren und abstrakte Inhalte zu verstehen und verinnerlichen zu können.
Die Kompetenz bezieht sich v. a. auf den Umgang mit Sach- und Fachtexten.
Chomsky
Avram Noam Chomsky, geb. 1928, ist ein US-amerikanischer Linguist. Er geht davon aus, dass die sprachlichen Erwerbsmechanismen angeboren und neuronal verankert sind. Diese angeborenen Sprachlern-Strategien nannte er ‚Language Acquisition Device‘ (LDA – Sprachliches Erfassungsmittel). Außerdem gäbe es so etwas wie eine universale Grammatik (linguistische Universalien), über die jeder Mensch von Geburt an verfüge und die seinen Spracherwerb begünstigten. Damit gehört Noam Chomsky zu den Nativisten (→II Nativismus).
Chomsky hält nicht die Kommunikation mit anderen für das Hauptziel der Sprache, sondern, den eigenen Gedanken Ausdruck zu verleihen: „Sprache ritzt die Kerben, durch die unsere Gedanken fließen“.
Eines seiner zentralen Werke ist die Vorlesungssammlung „Language and Mind“, New York 1968.
Chunk
Chunks sind sprachliche Formeln, also Mehrwortäußerungen, die häufig im Alltag gesprochen werden, z.B. „Hallo, wie geht’s“, Redewendungen wie „Alter vor Schönheit“ oder Standartsätze wie „Haben Sie einen Tisch frei“.
Chunk heißt wörtlich übersetzt ‚Klumpen‘. Die ‚Klumpen‘ sind einfach zu memorieren, erleichtern die Kommunikation in einer fremden Sprache und beschleunigen das Erlernen einer Fremdsprache.
Decodierung
Der Empfänger einer Nachricht muss diese für sich entschlüsseln (decodieren).
Ein Code umfasst alle einer Sprachgemeinschaft zur Verfügung stehenden Sprachzeichen. Zu den Sprachzeichen gehören Worte, Laute, Phrasen, Gebärden, Symbole usw.
Dialog
Dialog ist ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen. Wörtlich aus dem Griechischen übertragen heißt ’Dialog‘: Hindurch (διά, diá) - erzählen (λέγειν, legein).
Der Dialog ist bestimmt durch Rede (und Zuhören) und Gegenrede (und Zuhören). Das erfordert Fähigkeiten des aktiven Zuhörens, des Respekts, des aktiven Sprechens und der Hinwendung zum Gesprächspartner (wie der österr. Religionsphilosoph Martin Buber [1878-1965] unterstrichen hat).
Ein Dialog zeichnet sich durch Eigenaktivität der Dialogpartner und Intensität aus.
Siehe auch →I Gesprächsart und →IX Dialogisieren.
Diakritisches Zeichen
Diakritische Zeichen sind Zusatzzeichen des schriftlichen Alphabets. Sie weisen auf eine andere Akzentsetzung oder eine Ausspracheänderung hin.
Im Deutschen sind das die beiden Pünktchen über den →Vokalen a, o und u, die auf die Umlaute ä, ö und ü hinweisen.
Geläufigere diakritische Zeichen anderer Sprachen sind neben den Akzent-Strichen Gravis (ù) und Akut (á) das Trema (zwei Pünktchen über einem Buchstaben, z.B. /ë/), das Cedille (Haken unter einem Buchstaben, z.B. /ç/) und das Circumflex (ein Hütchen über einem Buchstaben, z.B. /û/.
Diphtong
Diphtonge sind Doppellaute, die entweder aus zwei Vokalen, z.B. /au/ im Wort ‚Traum‘, oder einem Vokal und einem Umlaut, z.B. /äu/ im Wort ‚Träume‘ zusammengesetzt sind. Neben /au/und /äu/ sind /ei/ und /eu/ die am häufigsten gebrauchte Doppellaute der deutschen Sprache.
Diphtonge, Doppellaute werden auch ‚Zwielaute‘ genannt.
Es gibt Worte, die einen vermeintlichen Diphtong aufweisen, wie z.B. das Wort ‚Museum‘. Hier werden die aufeinanderfolgenden Vokale aber nicht zum Diphtong /eu/ zusammengezogen, sondern einzeln aufeinanderfolgend. Diese Vokalstellung heißt: Hiat.
Entscheidungsfrage
Eine Frage, die nur mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ beantwortet werden kann.
In der sprachlichen Bildungsarbeit spielen Entscheidungsfragen eine untergeordnete Rolle, da sie keinen Sprachanlass darstellen und nicht zu weiteren sprachlichen Äußerungen einladen.
Erzählen
Erzählen heißt, ein Ereignis, eine Begebenheit, ein inneres oder äußeres Erleben mündlich oder schriftlich wiederzugeben. Erzählen heißt auch, eine Geschichte (Erzählung, → II Narration) sprachlich gestalten zu können.
Das Erzählen will gelernt sein: → II narrative Entwicklung. Kinder erwerben und erweitern diese Fähigkeit ab etwa 3;5 Jahren bis ca. zum Eintritt in die Pubertät.
Die Erzählfähigkeit hängt eng mit der logischen und mathematischen Entwicklung zusammen – diese drei Entwicklungsprozesse bedingen einander, allein deshalb ist eine gelingende Erzählentwicklung von hoher Bedeutung. Erzählen und Erzählungen sind identitätsstiftend und wirken auf die psychosoziale Entwicklung von Kindern: sie helfen, sich in der Gesellschaft und Lebenswelt zu verorten. Außerdem bindet Erzählfähigkeit Zuhörer, künftige Kommunikations- und Beziehungspartner*innen.
Fäkalsprache
Auch Kinder nutzen im Laufe ihrer Entwicklung die Fäkalsprache, vor allem während ihrer Autonomiephasen. Im Gegensatz zu Erwachsenen sind ihre Intentionen, sich von den Erwachsenen abzugrenzen und sehr starken Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Wer die Gefühle hinter der kindlichen Fäkalsprache benennt, Schimpfworte aus Kindermund größtenteils ignoriert oder Schimpf-Alternativen anbietet (z.B. ‚Scheibenkleister‘ statt ‚Scheiße‘), nimmt der Fäkalsprache ihre Wirkung und macht sie für Kinder wieder uninteressant.
„Kacka“, „Aa-Mann“, „Pubskopf“ u. ä. sind harmlose, dem Entwicklungsalter von Vorschulkindern entsprechende Fäkal- oder Schimpfworte.
Wenn Kinder jedoch zu fäkalen Worten und Floskeln greifen, die ihrem Alter überhaupt nicht entsprechen, sollte die pädagogische Fachkraft aufmerksam werden: → VII schmutzige Wörter können ein Alarmzeichen für eine Kindeswohlgefährdung sein.
Gebärdensprache
Gebärdensprache ist eine visuell wahrnehmbare Sprache, die aus Handbewegungen, Fingergesten, Mimik und lautlos gebildeten Worten besteht. Gebärdensprache wird meist von /mit gehörlosen Menschen und Menschen mit auditiven Einschränkungen gesprochen.
Es existieren über hundert verschiedene Gebärdensprachen; in Deutschland zum Beispiel die ‚Deutsche Gebärdensprache‘, DGS. Im pädagogischen Alltag wird sich der Gebärdenunterstützten Kommunikation bedient (→ V GuK). Eine Art ‚internationaler‘ Gebärdensprache ist die ‚International Sign‘, IS, die sich aus dem Bedürfnis nach globaler Verständigung herausbildete.
Eine im pädagogischen Umfeld genutzte Verständigungsmethode bei Lernbehinderungen ist MAKATON, eine Kommunikation, die aus einer Mischung von Deutscher Gebärdensprache, Lautsprache sowie Bildsymbolen besteht (MAKATON heißt die Sprache nach den Namenskürzeln ihrer drei Entwicklerinnen).
Gebärdensprachen wurden bereits in der Antike für taube Menschen entwickelt. Es darf auch nicht vergessen werden, dass Gestik und Mimik zu jeder Kommunikation dazugehören und in einigen Sprachen, zum Beispiel im brasilianischen Portugiesisch, Gebärden fest zum Wortschatz gehören. Auch umgebungsbedingt setzten sich vielerorts Gebärden als ‚Ersatzsprache‘ durch, zum Beispiel in Klöstern, in denen das Schweigegebot herrschte, weswegen Mönche und Nonnen auf eine Gestensprache zur Verständigung zurückgriffen.
Im Zeitalter des Humanismus und besonders ab der Epoche der Aufklärung im 18. Jahrhundert, wurde damit begonnen, die Gebärdensprachen zu systematisieren und an Schulen für Gehörlose zu unterrichten.
Gesprächsart
Ein Gespräch dient dem Informations- und Meinungsaustausch und der Verständigung, auch über Vorstellungen wie Weltbild und Werte. Ein Gespräch hat immer auch einen sozialen Aspekt, dient flüchtigen Begegnungen genauso wie dem dauerhaften Aufbau einer Beziehung.
Zu den Gesprächsarten zählen der Dialog (Wechselgespräch zwischen zwei Interaktionspartnern), das Gruppengespräch und der Monolog, das Gespräch mit sich selbst, meist ein innerer Vorgang.
Im Umgang mit Kindern zählt vor allem der Dialog, der gezielt gestaltet werden sollte (siehe auch →I Dialog und → IX Dialogisieren).
Herder
Johann Gottfried Herder, 1744-1803, war ein deutscher Philosoph und Schriftsteller der Aufklärung.
Bereits während seines Theologie-Studiums in Königsberg trat er als Schriftsteller an die Öffentlichkeit. Er besuchte Vorlesungen Immanuel Kants, dessen philosophischen Werke ihn nachhaltig beeindruckten; zu seinen Vorbildern gehörte auch der Philosoph Johann Georg Hamann. Seinen Lebensunterhalt verdiente Herder zunächst als Prediger und Erzieher in Eutin und Bückeburg, später wurde er Superintendent in Weimar.
Herder beschäftigte sich vor allem mit Sprachphilosophie und wirkt als Sprachphilosoph nachhaltig auf die Sprachwissenschaft.
In der Studie „Kritische Wälder, oder Betrachtungen die Wissenschaft und Kunst des Schönen betreffend“ (1769), diskutiert er zum Beispiel, dass die Dichtkunst die Muttersprache aller Menschen sei.
In seiner „Abhandlung über den Ursprung der Sprachen“ (1772) untersuchte er die Frage, wie sich die menschliche Sprache entwickeln konnte. Gefühlslaute seien die Wurzeln der menschlichen Sprache. Da der Mensch ein Mängelwesen sei, das nicht mehr nur auf seine Instinkte zum Überleben zurückgreifen könne, sondern auf andere Menschen angewiesen sei, um zu überleben, müsse es sich notwendig mitteilen.
Johann Gottfried Herder sammelte Volkslieder, in denen sich seiner Meinung nach die ursprüngliche Poesie der menschlichen Sprache am reinsten erhalten hätte. Die Volksliedersammlungen (1775-1779) hatten große Wirkung auf die Kunstschaffenden der Früh- und Hochromantik, besonders die 1807 posthum unter dem Titel „Stimmen der Völker in Liedern“ veröffentlichte Neufassung seiner Sammlungen.
Für die sprachliche Bildung setzte Herder viele Impulse, zum Beispiel mit seinen Hinweisen, dass Sprache ihren Ursprung, ihre Entwicklung und ihren Sinn in der Interaktion fände: „Am Innigsten aber wird Sprache und Rede durch Umgang gebildet“ (Gesammelte Schulreden).
IC-Analyse
Die Immediate constituent analysis ist eine Methode der Linguistik. Sie bezeichnet die Zerteilung eines Satzes stufenweise hinab bis zu seinen Morphemen (→ I Sprachliche Bereiche Grammatik Morphem).
Information
Eine Nachricht, die mit Hilfe von Signalen während einer Kommunikation übermittelt wird.
Inhalt
Als Inhalt wird die gebündelte Menge von Bedeutungselementen verstanden. Es kann auch gesagt werden: Inhalt umfasst die Idee, die mitgeteilt werden soll.
innere Sprache
Die innere Sprache ist die Sprache des Nachdenkens und des Monologs (siehe→ I Gesprächsart), sie ist die kreative Sprache der Fantasie und des Vorstellungsvermögens. Mit Hilfe der ‚inneren Sprache‘ planen wir unsere Handlungen vorausschauend und seriell.
Im Gegensatz zur äußeren, tatsächlich gesprochenen Sprache verfügt die innere Sprache über den passiven →I Wortschatz, der um einiges höher ist als der aktive Wortschatz eines Menschen. Das heißt, die innere Sprache ist ausdrucksstärker als die äußere Sprache.
Intention
Intention bezeichnet bezogen auf Kommunikation alle Beweggründe und Absichten eines sprachlichen Verhaltens.
kategorisieren
Der Begriff bezieht sich in Hinblick auf den kindlichen Spracherwerb auf die Zuordnung von Worten zu den Wortarten (Nomen, Verb Adjektiv…), zu den Wortgeschlechtern und ihre Erscheinung in Einzahl und Mehrzahl in den vier Fällen der deutschen Sprache (morphologische Kategorisierung), und die Unterteilung von Worten in Ober- und Unterbegriffe wie Tiere als Oberbegriff, Säugetiere, Insekten, Vögel, Fische, Reptilien als Unterbegriffe usw.
Klicklaute
Klicklaute werden durch verschiedenartiges Schnalzen mit der Zunge gebildet. Sie werden als Sprachlaute in südafrikanischen Sprachen (Khoisan-Sprachen) verwendet.
Knacklaut
Knacklaute oder Glottale Plosive sind Konsonanten, die dadurch gebildet werden, dass ein Verschluss der Stimmlippen plötzlich gelöst wird. Im Deutschen gibt es einen Knacklaut [ʔ], der zum Beispiel bei dem Wort beachten [bəˈʔaçtʰən] auftritt oder von vielen (nicht allen) vor und in dem Wort erinnern [ʔɛɐ̯ˈʔɪnɐn] gesprochen wird.
Konsonant
Konsonant oder Mitlaut ist ein Laut, der immer durch eine Hemmung des Atemstroms gebildet wird.
Der Atem (oder auch phonetische Strom) kann an verschiedenen Orten im Mundraum blockiert werden, z.B. an den Lippen, an den Zähnen, am Gaumen, im Rachen. Demnach werden die Konsonanten nach ihren Artikulationsorten unterschieden: z.B. labial – mit den Lippen, dental – an den Schneidezähnen, velar – am weichen Gaumen, pharyngal – im Rachen usw.
Der phonetische Strom kann auch auf verschiedene Weise gehemmt und freigegeben werden. Die Artikulationsart unterscheidet z.B. Plosive, bei denen explosionsartig die Luft ausgestoßen wird, Frikative (Reibelaute) oder Nasale, bei denen die Atemluft durch die Nasenöffnung geführt wird.
Die Konsonanten unserer Buchstabenreihe lauten: /b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x/ und /z/.
Das /j/, [j] ist ein Halbkonsonant oder Halbvokal. Mit dem → I Vokal teilt er, dass der Atemstrom bei seiner Artikulation nicht gehemmt wird, mit dem Konsonanten, dass er eines Mitlauts bedarf - [j] klingt nicht allein wie die übrigen Vokale.
Kryptophrasie
Geheimsprache.
Eine Geheimsprache ist eine künstlich erschaffene Sprache, deren Regeln nur wenigen Eingeweihten bekannt sind. Geheimsprachen zu entwickeln, gehört zu den Sprachspielen vieler Kinder während ihres Spracherwerbs. Eine bekannte Geheimsprache ist die ‚Hühnersprache‘ (Silbenwiederholungen nach Einschub des Konsonanten /h/und einer festgelegten Lautfolge, z.B.: „Dahalefa ihistlefist deherlefer Bahalefal“ – „Da ist der Ball“.
Eine beliebte Geheimsprache englischsprachiger Kinder ist das pig latin (dt. Schweinelatein); dabei wird der erste Buchstabe eines Wortes an sein Ende gesetzt und mit -ay verbunden, z.B.: „ere-thay s-iay e-thay all-bay“, „There is the ball!“, „Da ist der Ball!“ (/th/ ist ein Laut!).
Zu den Geheimsprachen gehören für Außenstehende auch Geschwistersprachen, hier vor allem die → IV Zwillingssprache.
Aber auch jenseits von Kindheit gibt es Geheimsprachen: zum Beispiel entwickelten Kriminelle nur ihnen verständliche Sprachen (siehe auch → IV Rotwelsch) und auch zu militärischen und geheimdienstlichen Zwecken werden verschlüsselte Sprachen, Kryptophrasien, genutzt.
Laute
Die dt. Sprache besteht aus über 47 Lauten.
Ihnen stehen 26 Buchstaben gegenüber, die die Laute schriftlich repräsentieren, z.B. werden die Laute [r] (Zungen-r), [ʀ] (Vibrant), [ʁ] (Zäpfchen-r) alle durch den Buchstaben /r/ repräsentiert.
Die Laute werden zunächst in →Monophtonge, →Diphtonge, →Konsonanten und →Knacklaute unterteilt.
Dann werden sie danach beschrieben, wo sie im Mundraum gebildet werden (Artikulationsort): ob ein Laut mit den Lippen (labial), an den Zähnen (dental), am Zahndamm (alveolar) am harten Gaumen (palatal), am weichen Gaumen (velar), im Rachen (glottal) oder an mehreren Artikulationsorten (z.B. Lippen und Zähnen, labio-dental) usw. gebildet wird.
Danach erfolgt die Einordnung, wie sie gebildet werden (Artikulationsart), ob sie stimmhaft oder stimmlos sind – bei stimmhaften Lauten vibrieren die Stimmbänder mit, z.B. [b] im Gegensatz zum stimmlosen [p]. Kräftige, starke Laute wie das [p] heißen Fortislaute; weichere, ungespannte Laute wie das [b] werden Lenislaute genannt.
Die Beschreibung der Laute geht weiter: wie ist die Zungenposition (niedrig, mittel, hoch) bei der Lautproduktion, wie ist die Mundstellung (rund, unrund) und wie fließt der →phonetische Strom: weil der Laut [p] durch Mundschluss, Luftstau und plötzlicher Freigabe des phonetischen Stroms gebildet wird, ist er ein plosiver Laut. Entsteht ein Laut durch Reibung, wird er als ‚frikativ‘ (Reibelaut/Zischlaut) bezeichnet. Ein Approximant hingegen ist ein Laut mit gleichmäßiger phonetischer Strömung.
Siehe auch: →Phon, →Phonem, →Allophon
Lautinventar
Gesamtheit aller Laute einer →Sprache (Phoneminventar).
Lautschrift
Nicht alle Laute werden von Buchstaben repräsentiert. Um schriftlich darstellen zu können, wie ein Wort genau ausgesprochen wird, wurde die Lautschrift oder phonetische Schrift eingeführt. Lautschrift [lautʃʁıft]wird in eckigen Klammern dargestellt. Die Lautschrift ist im Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA) aufgeführt (im PC-Programm unter ‚Sonderzeichen‘ oder ‚Symbol‘ zu finden).
Linguistik
Linguistik beschäftigt sich mit Sprache generell; die Erforschung einzelner Sprachen ist die Philologie, z.B. Germanistik, Anglistik, Romanistik, Skandinavistik…).
Die Linguistik teilt sich in verschiedene über- und untergeordnete Fachbereiche mit zahlreichen interdisziplinären Berührungspunkten. Im Hinblick auf den kindlichen Spracherwerb und die alltagsintegrierte sprachliche Bildung liegt der Schwerpunkt in diesem Lexikon auf den linguistischen Bereichen Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik und Pragmatik (siehe unter → I Sprachliche Bereiche).
Literacy
Literacy, oder eingedeutscht Literalität, bezeichnet die Lese- und Schreibkompetenz. Sie umfasst neben grundlegenden Fähigkeiten der Kulturtechniken Lesen und Schreiben Textverstehen, Sinnverständnis und auch Medienkompetenz. Siehe weiter dazu →III Literacy und → VI Bildungsbereiche Literacy.
Minimalpaare
Zwei Worte, die sich nur durch einen Laut voneinander unterscheiden und unterschiedliche Bedeutung haben, werden als Minimalpaar bezeichnet, z. B.: Mund – Hund.
Mund – Hund ist ein kleines Minimalpaar, da der Artikulationsort und die Artikulationsweise nur gering geändert werden müssen, um die Worte zu produzieren. Bei Kamm – Damm ist die Veränderung aufwendiger; diese Minimalpaare sind ‚große‘ Minimalpaare.
Minimalpaare zu bilden, fördert die Lautwahrnehmung und die phonologische Bewusstheit (siehe unter → I Sprachliche Bereiche) der Kinder und kann als eine einfaches Sprachspiel jederzeit in den Kita- und Schulalltag eingebaut werden.
Monolog
Ein Monolog ist ein Gespräch mit sich selbst, das sich nicht nach außen und nicht an eine andere Person richtet. Es kann auch von einem ‚Ich-Gespräch‘ geredet werden.
Im Monolog versichert sich der Sprecher seiner selbst, plant, bildet Vorstellungen, bildet seine Identität. Es gibt aber auch Menschen, denen die Gabe der ‚inneren Sprache‘ nicht gegeben ist; sie denken vermutlich eher in Bildern, Filmsequenzen usw.
Siehe auch → I Gesprächsart.
Monophtong
Früher wurde der Begriff ‚Selbstklang‘ benutzt. Ein Monophtong ist ein einfacher Vokal: a, e, i, o, u.
Sein Gegenüber ist der → I Diphtong eine Mischlaut aus zwei Vokalen wie z.B. /ei/.
Non verbal
Non verbal heißt genau übersetzt ‚nicht-Wort‘, nicht wörtlich, nicht mit Worten.
Der Philosoph und Kommunikationswissenschaftler Paul Anton Watzlawick (1921-2007) hat in seinem in den 60ern des vorigen Jahrhunderts verfassten Grundlagenwerk „Menschliche Kommunikation“ geschrieben: „Wir sind wie eingesponnen in Kommunikation; selbst unser Ichbewusstsein hängt [...] von Kommunikation ab“, und, ein prägender Satz: „Wir können nicht nicht kommunizieren.“ Unsere Kommunikation umfasst nämlich nicht nur das gesprochene Wort, sondern wir teilen uns anderen auch non-verbal (teils bewusst, teils unbewusst) mit.
Non-verbal meint, dass wir uns über unsere Körperhaltung, unsere Gesten und unsere Mimik ausdrücken und mitteilen.
phonetischer Strom
Der phonetische Strom ist die Atemluft (pulmonischer Strom), die zur Produktion eines Lauts benutzt wird.
Mit der Art und Weise der Produktion von Lauten und den akustischen Bedingungen befasst sich die Phonetik, ein Teilgebiet der Linguistik (siehe auch → I Sprachliche Bereiche/Phonologie/Phonetik).
Rezipient
Der Rezipient ist der Empfänger einer Botschaft, einer Nachricht; das Wort kommt vom lat. ‚recipere‘ – aufnehmen.
Je nach Setting ist der Rezipient der Zuhörende (im Gespräch, im Konzert…), Lesende, Zuschauende (im Theater…), Besuchende (im Museum, in der Kunstausstellung…).
Der Rezipient rezipiert Informationen, indem er sie aufnimmt, wertet, interpretiert, weiternutzt usw.; dieser Prozess heißt Rezeption.
Der Rezipient reagiert aktiv durch seiner Aufnahmebereitschaft auf den Sender einer Nachricht, den Kommunikator. In jedem → I Dialog wechseln die Rollen von Rezipienten und Kommunikator.
Salienz
Ein Merkmal, das sich von seiner Umgebung auffällig abhebt, ist salient; es zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Fachlich ausgedrückt: Salienz meint, dass ein Reiz besonders hohe Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bei einer Person, die ganz in grau gekleidet ist, aber einen breiten roten Gürtel trägt, würde dieser Gürtel die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich ziehen; der rote Gürtel ist ein salienter Reiz.
In Bezug auf Sprache sind mit Salienz sprachliche Merkmale gemeint, die leicht wahrnehmbar sind. Zum Beispiel ist die Betonung der ersten Wortsilbe in der deutschen Sprache (Trochäisches Versmaß, wie zum Beispiel: Ha-se, Wa-gen, Koh-len-schau-fel) ein salientes Merkmal der deutschen Sprache. Salienz der niederländischen Sprache sind ihre Rachenlaute, Salienz der englischen Sprache ihre höhere Stimmlage usw.
In der Schriftsprache kann mit Fett- oder Kursivschrift ein Wort, ein Satz hervorgehoben werden, z.B. die Überschriften in diesem Lexikon: sie sind salient.
Siehe auch → II Salienz.
Schwa-Laut
Auch: mittlerer Zentralvokal, denn bei seiner Bildung nimmt die Zunge eine neutrale Stellung ein.
Der Schwa-Laut ist ein Laut am Ende eines Wortes bzw. an unbetonter Stelle im Wort, wie der Laut [ǝ] in ‚Mühle‘ - [ˈmyːlə].
Der Schwa-Laut wird in der deutschen Schrift durch den Buchstaben ‚e‘ dargestellt.
Sprachbesitz
Bezeichnet die gesamten sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten einer Sprachgemeinschaft.
Sprachfähigkeit
Sprachfähigkeit ist die Kompetenz, sich mit Hilfe von Sprache zu verständigen, mittels Sprache zu kommunizieren. Voraussetzungen für Sprachfähigkeit sind das Denken und das Gedächtnis, also kognitive Grundbedingungen. Sprache ist Teil der → II Kognition.
Die Sprachfähigkeit unterscheidet den Menschen von anderen Lebewesen. Sprache ist nämlich auch eine kulturelle Leistung des Menschen.
Sprachfamilien
Es gibt derzeit weltweit ca. 7.000 Sprachen. Die Sprachen befruchten einander und unterliegen einem steten Wandel, dennoch finden sich Sprachen mit verwandten Merkmalen, weil sie z.B. von ein und derselben Ur-Sprache abstammen. Es gibt nur wenige isolierte Sprachen (keiner Sprachfamilie zugehörig) wie z.B. Koreanisch.
Es gibt weltweit etwa 200 Sprachfamilien. Eine große Sprachfamilie Europas (und Südasiens, heute weltweit verbreitet) ist die indogermanische, zu der etwas drei Milliarden Muttersprachler gehören (von ca. acht Milliarden Menschen Weltbevölkerung, Stand: 2024). Die indogermanische ‚Großfamilie‘, die vermutlich auf eine einzige indogermanische ‚Ursprache‘ zurückgeht, lässt sich wiederum in kleinere Sprachfamilien unterteilen: in germanische, slawische, baltische, romanische usw. Sprachfamilien.
Die germanische Sprachfamilie wiederum zerfällt in ost-, west- und nordgermanisch. Das Westgermanisch beispielsweise wieder in Deutsch, Friesisch und Englisch.
Mit den Sprachfamilien befassen sich historisch-vergleichende Sprachwissenschaftler.
Sprachisolat
Sprache, die mit keiner anderen Sprache verwandt ist und auf einer langen kulturellen Tradition beruht, z.B. das Bretonisch in Nordfrankreich.
Sprachliche Bereiche
Sprache ist ein sehr umfassendes Fachgebiet. Dieses Lexikon fokussiert sich auf den Zusammenhang von Sprache und dem Spracherwerb von Kindern.
Die pädagogische Begleitung des kindlichen Spracherwerbs konzentriert sich auf fünf Bereiche der Sprache: Grammatik, Kommunikation, Lexikon, Phonologie, Prosodie und Semantik.
Grammatik
Grammatik war ursprünglich die ‚Lehre von den Buchstaben‘, im Sinne einer Sprachstilkunde – das Wort ‚Grammatik‘ wird von ‚grammatikos‘, ‚die Buchstaben betreffend‘ abgeleitet. Heute wird unter ‚Grammatik‘ die Lehre von der Architektur und den Regelsystemen der Sprache verstanden.
Die Grammatik wird – oft vorbelastet durch Erinnerungen an die trockene Vermittlung im Schulfach Deutsch und abschreckend durch viele Fachbegriffe – bei der Begleitung des vorschulischen Spracherwerbs manchmal etwas vernachlässigt. Dabei ist sie ein sehr kreativer und interessanter sprachlicher Bereich, der viel über die Sprachfähigkeit einer Person aussagt und wichtig für die sprachliche Entwicklung der Kinder ist.
Die zentralen Fachbegriffe der Grammatik, denen pädagogische Fachkräfte im Zusammenhang mit sprachlicher Bildungsarbeit begegnen, sind im Folgenden erklärt (siehe ergänzend → I Wortarten):
Artikel
Der ‚Begleiter‘ eines Wortes heißt Artikel. Er gibt Aufschluss über das grammatische Geschlecht eines Wortes, also ob es ein männliches, weibliches oder sächliches Wort ist, d.h. wie es dekliniert (in die vier Fälle gesetzt) wird.
Es gibt die bestimmten Artikel: der, die, das. Daneben gibt es unbestimmte Artikel: einer, eine, eines. Bestimmte Artikel werden genutzt, um einen hinweisenden Bezug zu einem Substantiv herzustellen, z.B. ist mit ‚der Ball‘ ein ganz bestimmter Ball gemeint; hier verweist der Artikel auf eine besondere Bedeutung des Substantivs. Dagegen bezeichnet das unbestimmte ‚ein Ball‘ irgendeinen Ball.
Deklination
Deklination bezeichnet gemäß des Wortursprungs die Beugung von Substantiven und ihrer Begleiter, Adjektiven und Pronomen. Beugung heißt so viel wie ‚Anpassung.
Angepasst werden müssen die genannten Worte je nachdem ob sie eine Einzahl (Singular) oder Mehrzahl (Plural) bezeichnen, also z.B. ‚der Ball‘ und ‚die Bälle‘ – sowohl der Artikel als auch das Substantiv verändern sich, um die Mehrzahl anzuzeigen. Weiteres Beispiel mit Adjektiv: aus ‚der bunte Ball‘ wird ‚die bunten Bälle‘; nehmen wir das Pronomen ‚er‘ als Stellvertreter für ‚der Ball‘ dann wird daraus in der Mehrzahl ‚sie‘ (‚die bunten Bälle‘).
Angepasst werden müssen Substantive je nach ihrem Wort-Geschlecht (Genus), männlich (Maskulinum), weiblich (Femininum) sächlich (Neutrum): Der Mann, die Frau, das Kind; der Baum, die Wiese, das Feld; der Ball, die Puppe, das Auto.
Die dritte Anpassung richtet sich danach, welche Rolle ein Substantiv in einem Satz übernimmt. Dabei wird von den vier Fällen (Fall, lat.: Kasus) gesprochen: Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ oder Wer-, Wessen-, Wem- und Wen-Fall.
Beispielsätze:
‚Der Ball rollt über die Wiese.‘ - Der Ball ist in diesem Satz Nominativ (Wer-Fall, denn es kann gefragt werden: Wer rollt? Und die Antwort lautet: ‚der Ball‘.)
„Die Farbe des Balls ist rot.“ – Der Ball ist in diesem Satz Genitiv: des Balls (Wessen-Fall, denn es kann gefragt werden: Wessen Farbe ist rot? Und die Antwort lautet: ‚des Balls‘.)
„Ich gebe dem Ball einen Tritt.“ Der Ball ist in diesem Satz Dativ (Wem-Fall, denn es kann gefragt werden: Wem gebe ich einen Tritt? Und die Antwort lautet: ‚dem Ball‘.)
„Ich sehe den Ball“. – Der Ball ist in diesem Satz Akkusativ (Wen-Fall, denn es kann gefragt werden: Wen sehe ich? Und die Antwort lautet: ‚den Ball‘.)
Flexion
Flexion oder Beugung beschreibt, wie eine Wortform gebildet werden kann, je nachdem, welche Rolle sie in einem Satz übernimmt. Bei der Flexion verändert sich die Erscheinungsform eines Wortes, z.B. wird aus der Einzahl ‚der Traum‘ die Mehrzahl ‚die Träume‘, dabei muss sich der Artikel beugen (anpassen), sowie aus /au/ ein /äu/ und der Endbuchstabe (Endlaut) /e/ angehängt werden.
Gebeugt werden, sich anpassen können sich die Worte nach ihrem Genus, ihrem Kasus und ihrem Numerus.
Genus
Die Worte werden im Deutschen in drei verschiedene grammatische Geschlechter eingeteilt: sie sind entweder männlich (Maskulinum), weiblich (Femininum) oder sächlich (Neutrum). Diese Einteilung lehnt sich wahrscheinlich an die Einteilung der natürlichen Geschlechter an, das trifft aber nicht auf den gesamten Wortschatz zu, z.B. bezieht sich das Wort ‚Mädchen‘ auf eine junge weibliche Person, heißt aber nicht demgemäß (Femininum) ‚die Mädchen‘, sondern (Neutrum) ‚das Mädchen‘. Mutmaßlich sollen mit der neutralen Bezeichnung gewisse ethische Normen und Vorstellungen vermittelt werden, weshalb die Einteilung in bestimmte Genera auch von Wertvorstellungen und Bedeutungs-Zuschreibungen geleitet wurde/wird.
Siehe auch → VII Gender.
Kasus
Kasus ist ein lat. Wort und bedeutet: Fall. Ein Kasus gibt genau an, welche Rolle ein Wort in einem Satz spielt.
Der Nominativ (1. Fall oder Wer-Fall) bezeichnet das Subjekt eines Satzes. Das Subjekt übernimmt die Hauptrolle in einem Satz, z.B. „Der Freund des Kindes gab der Erzieherin den Ball.“ ‚Der Freund‘ ist Nominativ, die handelnde Hauptfigur.
Der Genitiv (2. Fall oder Wessen-Fall) bezeichnet ein Objekt, und zwar wem etwas gehört, woher etwas kommt, zu wem eine Relation besteht. Das Genitivobjekt spielt eine im Hintergrund stehende Nebenrolle: „Der Freund des Kindes gab der Erzieherin den Ball“. ‚Des Kindes‘ ist Genitiv, es zeigt die Relation zur Hauptrolle an.
Der Dativ (3. Fall oder Wem-Fall) bezeichnet ein mithandelndes Objekt, ist also der Spielpartner der Hauptrolle. „Der Freund des Kindes gab der Erzieherin den Ball.“ ‚Der Erzieherin‘ ist Dativ; sie handelt auf Veranlassung des Hauptdarstellers.
Der Akkusativ (4. Fall oder Wen-Fall) bezeichnet ein Objekt (eine Person oder ein Ding) mit dem etwas geschieht oder bewirkt wird. „Der Freund des Kindes gab der Erzieherin den Ball.“ ‚Den Ball‘ ist Akkusativ; mit ihm geschieht etwas, er wird von dem Freund der Erzieherin übergeben.
Konjugation
Auch ein Verb (Tuwort) muss sich hinsichtlich des Numerus, der Zeit (Tempus) oder des Modus (aktiv oder passiv) im Satz anpassen. Diese Formveränderungen des Verbs heißen ‚Konjugation‘; ein Verb wird konjugiert (angepasst).
Für die Flexion des Verbs ist von Bedeutung, ob es sich um ein starkes oder schwaches Verb handelt. Starke Verben haben die Fähigkeit sich stark zu ändern, wenn sie konjugiert werden: springen, sprang, gesprungen (hier ändert sich der Vokal in den verschiedenen Zeitformen). Ein schwaches Verb ändert sich selbst nicht, sondern kann das nur mit Hilfe des Anhangs (Suffix) /-te/, z.B.: rollen, rollte, gerollt.
Zeitliche Anpassungen des Verbs sind die Gegenwart (Präsens: „ich rolle“), das Perfekt (vollendete Gegenwart: „ich bin gerollt“) und das Imperfekt oder Präteritum (Vergangenheit: „ich rollte“), die vollendete Vergangenheit (Plusquamperfekt: „ich war gerollt“) und Futur (Zukunft: „ich werde rollen).
Der aktive Modus zeigt an, dass ein Subjekt/Objekt handelt: „Das Kind rollt den Ball.“
Der passive Modus zeigt an, dass ein Objekt eine Handlung erfährt: „Der Ball wird vom Kind gerollt.“
Der Numerus bezeichnet wer und wie viele etwas tun: ich rolle, du rollst, er/sie/es rollte, wir rollen, ihr rollt, sie rollen.
Morphem
Ein Morphem ist das kleinste, Bedeutung tragende Element eines Wortes. Zum Beispiel besteht das Wort ‚gerollt‘ aus drei Morphemen. Das erste Morphem ‚ge‘ bedeutet, dass das Wort ein Partizip ist; ‚roll‘ ist der Wortstamm und ‚t‘ bedeutet, dass das Verb in der dritten Person steht.
Ein weiteres Beispiel: das Wort ‚Hunde‘ besteht aus den beiden Morphemen ‚Hund‘ und ‚e‘. Das erste Morphem bedeutet ‚Hund‘, das zweite Morphem, ‚e‘, bedeutet, dass es sich um mehrere Hunde handelt.
Morphologie
Die Morphologie (manchmal auch Morphemik genannt) befasst sich mit der Wortbildung und spürt Fragen nach, wie Worte geformt werden und welche innere Struktur sie besitzen.
Die Morphologie ist eine sehr spannende sprachwissenschaftliche Teilrichtung.
Numerus
Der Numerus (Zahl) zeigt an, ob etwas einmal (Singular, Einzahl) oder mehrmals (Plural, Mehrzahl) vorkommt.
Syntax
Die Syntax (dt.: Zusammenstellung) handelt vom Satzbau. Es geht um die Architektur von Sätzen.
Es gibt schlichte Ein- und Zweiwortsätze, z.B.: „Mama kommt.“ Es gibt Drei- und Mehrwortsätze, z.B.: „Meine Mama kommt gleich.“
Es gibt Satzreihen; dabei bestehen die Sätze aus mehreren aneinandergereihten Hauptsätzen, z.B.: Meine Mama kommt und mein Papa kommt.
Es gibt Satzgefüge, die aus einem Hauptsatz und einem Nebensatz oder mehreren Nebensätzen bestehen: „Meine Mama kommt, weil sie mich abholt, auch wenn es später wird.“
Die Syntax befasst sich mit den Regeln, wie Sätze aufgebaut werden können, z.B. Frage-, Aussage- und Ausrufesätze.
Verbzweitstellung
Die meisten Sätze haben eine Verbzweitstellung, d.h. das Verb steht an zweiter Stelle im Satz, z.B. „Der Ball rollt ins Tor.“ Kinder, sobald sie mit dem Satzbau vertraut sind, nutzen meist Sätze mit Verbzweitstellung. Das Verb kann, zum Beispiel in Fragesätzen, auch am Anfang eines Satzes stehen: „Rollst du, Ball?“
Kommunikation
Kommunikation meint jede Art der Informationsübertragung mittels Symbole. Die Akteure können alle Lebewesen, aber auch Kommunikationstechnik (z.B. PC) oder künstliche Intelligenz sein.
Im hier fokussierten Themenkreis bedeutet Kommunikation die → II Interaktion von Menschen mit Hilfe → I verbaler und → I non-verbaler Mittel.
Kommunikationsmodelle
Als Kommunikationsmodelle werden schematische Darstellungen von Kommunikationsprozessen bezeichnet. Die Modelle befassen sich mit Bedingungen, Strukturen und Abläufen von Kommunikation.
Das einfachste Modell wurde von den US-Amerikanischen Mathematikern Claude Shannon (1916-2001) und Warren Weaver (1894-1978) 1949 entwickelt, nur bezogen auf technische Nachrichtenübermittlung. Es besteht aus einem Sender und einem Empfänger von Nachrichten, wobei der Empfänger ein Feedback an den Sender zurückschicken kann.
Der dt. Sprachpsychologe Karl Bühler (1879-1963) hatte bereits 1934 ein erweitertes Modell vorgestellt, indem er dem Sender drei verschiedene Funktionen oder Werkzeuge (daher Organon—Model; organon ist das altgriechische Wort für Werkzeug) zuwies: Ausdruck, Darstellung und Apell.
Noch weiter führt das allgemein bekannte ‚Vier-Ohren-Modell‘ des dt. Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun (*1944). Sowohl eine gesendete als auch eine empfangene Nachricht besitzt demnach vier Ebenen, die die Kommunikation prägen: Sachebene, Appellebene, Beziehungsebene und Selbstaussage. Eine einfache Aussage wie „Ihr Kind hat keine Hausschuhe mit“ bedeutet auf der Sachebene nichts anderes als die Tatsachenfeststellung; sie kann als Apell gemeint und verstanden werden: „Geben Sie Ihrem Kind Hausschuhe mit!“, oder auf der Beziehungseben, z.B.: „Sie sorgen nicht gut genug für Ihr Kind.“ Und daran können sich Selbstaussagen wie: „Ich achte besser auf Ihr Kind als Sie“, „Ich lege keinen Wert auf Kita-Vorschriften“ knüpfen. Wie zu sehen ist, offenbart das ‚Vier-Ohren-Modell‘ vortrefflich, woran eine Kommunikation scheitern kann, wenn die Kommunikationspartner sich nämlich auf unterschiedlichen Ebenen bewegen, was zu Missverständnissen führt.
Das ‚Vier-Ohren-Modell‘ wurde 1981 veröffentlicht.
Der Psychologe Sigmund Freud (1856-1939) hat das Eisberg-Modell entwickelt, das erst später auf die sprachliche Kommunikation zugeschnitten wurde und so auch auf Schulz von Thuns ‚Vier-Ohren-Modell‘ eingewirkt hat. Es zeigt, dass sich nur wenige Teile der Kommunikation auf der Sachebene, der Spitze des Eisberges, abspielen, die meisten Anteile, die in einer Kommunikation mitschwingen, spielen sich unsichtbar, sozusagen unter der Wasseroberfläche ab: hier dreht es sich um Werte, Kultur, Ängste, Erfahrungen, Erwartungshaltungen usw., die eine Kommunikation mitbestimmen.
Die Transaktionsanalyse des kanadischen Psychologen Eric Bernes (1910-1970) streicht heraus, dass jede Kommunikation positiv, respektvoll und auf → IX Augenhöhe zu geschehen habe, was vielen Missverständnissen von vorneherein entgegenwirke. Berne entwickelte die TA (veröffentlicht 1971) auf Grundlage seiner Gespräche mit an Schizophrenie erkrankten Menschen.
Paul Watzlawicks (österr. Philosoph und Psychotherapeut, 1921-2007) 5 Axiome fassen diese Modelle im Prinzip noch einmal zusammen, ergänzt um den wichtigen Satz: man kann nicht nicht kommunizieren (siehe auch → I Non-verbal).
Kommunikationsstörung
Eine Kommunikationsstörung liegt vor, wenn Personen Probleme mit dem Hören, dem Sprechen, der Stimme, der Kognition und der Sprache haben, und ihre Mitteilungsfähigkeit dadurch beeinträchtigt ist. Kommunikationsstörungen können auch kombiniert auftreten. Sie beeinträchtigen hauptsächlich die pragmatischen Kompetenzen (siehe auch → I Sprachliche Bereiche Pragmatik).
Kommunikative Kompetenz
Diese Kompetenz ist die Fähigkeit, angemessen einer Situation entsprechend miteinander zu kommunizieren.
Metakommunikation
Metakommunikation ist die ‚Kommunikation über Kommunikation‘. Metakommunikation wird zum Beispiel da eingesetzt, wo das eigene Kommunikationsverhalten reflektiert wird – für pädagogische Fachkräfte ist die Metakommunikation also Teil des Handwerks.
Die Metakommunikation geht auf den dt. Gestaltpsychologen Wolfgang Metzger (1899-1979) zurück.
Lexikon
Lexikon meint hier den Wortschatz.
Zum einen bezeichnet der Begriff die Gesamtheit der Worte einer Sprache, zum anderen den Wortschatz einer Person.
Das Lexikon des Deutschen umfasst fast eine halbe Million Wörter, davon entfallen ca. 80.000 Worte auf die Standartsprache.
Der Basiswortschatz der deutschen Sprache, also der Wortschatz, mit dem sich jemand in der deutschen Sprache gut verständigen und den Alltag bestreiten kann, umfasst ca. 800 Worte.
Als die wortreichste Sprache gilt Englisch.
Der Wortschatz einer erwachsenen Person mit deutscher Erstsprache umfasst ca. aktiv gesprochene 15.000 Worte.
Sechsjährige haben ein Lexikon von etwa 13.000 Worten.
Der ‚Dichterfürst‘ der Deutschen, der klassische Dichter Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) soll ein aktives Lexikon von ca. 90.000 Worten gehabt haben.
Aktives Lexikon
Aktives Lexikon oder aktiver Wortschatz bezeichnet die Gesamtheit aller Wörter, die eine Person kennt und in ihrem Alltag nutzt.
Das aktive Lexikon speist sich meist aus der Standartsprache. Es ist ungleich niedriger als das passive Lexikon.
Grußformeln
Grußformeln sind Einzelworte oder Wortkombinationen, die zur Anrede oder Begrüßung genutzt werden: „Hallo!“ „Hallo, wie geht’s“ „Guten Tag“, „Grüß dich!“ „Was geht ab?“
Grußformeln hauptsächlich der Schriftsprache sind bspw.: „Sehr geehrte Damen und Herren“ „Liebe*r …“
Einfache Grußformeln gehören zu den Worten, die sich Kinder aneignen.
Siehe dazu: → Chunks.
Lexem (Lex)
Lexem ist der Fachbegriff für ‚Wort‘.
Die Linguistik umreißt den Begriff noch genauer: sie unterscheidet zwischen dem Lex, dem Wort, und dem Lexem, dem Grundwort. Zum Beispiel sind ‚lesen‘, ‚las‘, ‚gelesen,‘ jedes ein Lex (Wort), das Lexem ist aber nur ‚lesen‘.
Lexikologie
Lexikologie ist die Wortkunde. Sie erforscht den Wortschatz und beschreibt ihn.
Passives Lexikon