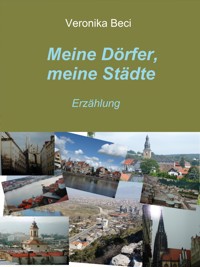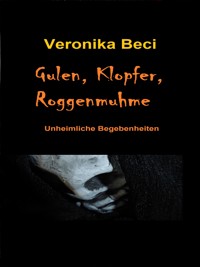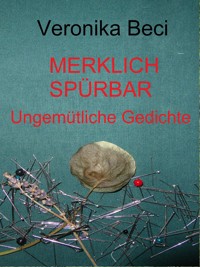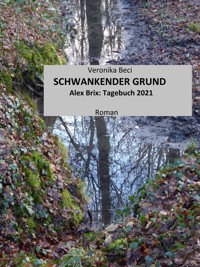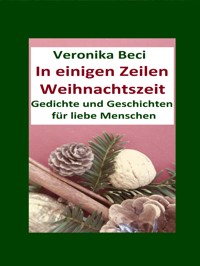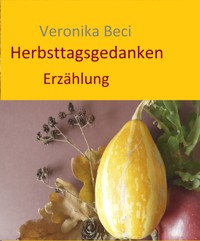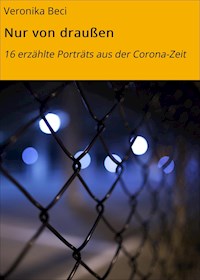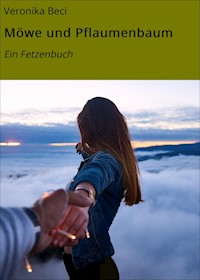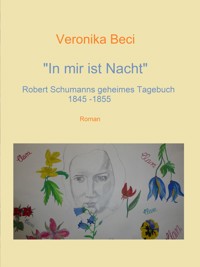
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Komponist und Musikschriftsteller Robert Schumann (1810-1856) war einer der bedeutendsten Tonschöpfer der Romantik. Gleichwohl führte er zu seinen Lebzeiten ein Schattendasein als Musiker und Mann der berühmten Pianistin Clara Wieck (1819-1896). Die geheimen Tagebücher erzählen von Musik, Liebe und einer Familie mit acht Kindern, aber auch von Krisen, Konflikten und seelischen Schwankungen. Schumanns Leben endete tragisch in der Heilanstalt Endenich bei Bonn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Veronika Beci
In mir ist Nacht
Robert Schumanns geheimes Tagebuch 1845-1855
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorbemerkung
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
Schlußbemerkung
Anmerkungen
Robert Schumanns Leben vor 1845
Robert Schumanns Jahre 1845 bis 1856
Weitere Bücher von Veronika Beci
Impressum neobooks
Vorbemerkung
Auf sehr abenteuerlichem Weg sind die hier folgenden Tagebuchblätter des Komponisten Robert Schumann in den Besitz meiner Familie und damit endlich in meine Hände gekommen: Einer meiner Vorfahren, Jean-Willem Frohnhoff, arbeitete Mitte der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts als Gärtnergehilfe in der Nähe Bonns. Ein Auftrag führte ihn auf das Gelände der Heilanstalt Endenich, wo es galt, den alten Baumbestand zu sichten und notfalls abzuholzen. Dabei entdeckte er in einem Baumstamm versteckt eine Mappe aus rötlich-braunem Leder, die er aus Neugierde an sich nahm. Später stellte sich heraus, dass es sich um Tagebuchnotizen des bekannten Komponisten Robert Schumann handelte.
Nun vertraute mir meine Familie, die Tagebuchseiten zur Veröffentlichung an, wofür ich mich an dieser Stelle bedanken möchte.
Die erhaltenen Blätter (Quartformat) umfassen die Ereignisse der Jahre 1845 bis 1855 fast lückenlos. Die ersten Tagebuchseiten fehlen, sodass die Notizen abrupt im Juli 1845 beginnen. Einige Einzelblätter, eindeutig in die Jahre 1837 und 1839 zu datieren, wurden in der vorliegenden Veröffentlichung nicht berücksichtigt; ihr Inhalt entspricht in weiten Teilen den in Berthold Litzmanns Tagebuchbiographie „Clara Schumann. Ein Künstlerleben“ publizierten Briefen. Vermutlich in das Jahr 1856, dem Todesjahr des Komponisten, gehört ein Zettel mit einem in Endenich verwendeten Stempel, der Aufschrift „Johannes, Letztes – dir“ und der Wortwiederholung „Klara, Clara“ in Schumanns Handschrift.
Ich habe den Originaltext behutsam der heutigen Orthographie angepasst. Er liegt in ungekürzter Fassung vor. Schumann schrieb den Namen seiner Frau stets mit „K“, „Klara“, wich aber manchmal in die Schreibweise mit „C“ ab, was ich, da ich es psychologisch bedeutsam fand, so stehen ließ.
Veronika Beci, Ratingen, Münster 2024
1845
26. Juli 1845 – Krisis der Entschlüsse – Wien!
Ja, ich glaube, es ist in der Tat das Beste in eine neue Stadt zu ziehen. Ich sehe nicht, wie ich hier in Dresden weiterkomme. Es will mir hier nichts gelingen und mit anderer Musik ist es fast gar nichts. Ferdinand Hiller, der gute Freund, strengt sich sehr an, das Musikleben auf Vordermann zu bringen und seine Frau führt einen ausgezeichneten musikalischen Salon.
Ich fürchte, Klara will ihr nacheifern und auch einen solchen Salon leiten. Dann gäbe es aber so viele fremde Leute in unserer Wohnung. – Der unerträgliche Lärm der Leute und warum sie immerzu sprechen müssen. – Die Erfüllung des Schweigens, wenn man so randvoller Töne ist.
Also Wien. Die Stadt Mozarts und Schuberts.
27. Juli Im Heine-Band geblättert. Über die Balladen nachgedacht. Die explosive Kraft der Gedichte Heines. Habe ich das immer richtig aufgefasst? Die Leute schätzen meine Heine-Lieder. Klara hat mehrere davon fürs Klavier solo umgeschrieben. Ich habe mir aber verbeten, dass sie sie spielt ohne Gesang. – Klara musiziert. Aus ihrem Zimmer kommen Töne. Mendelssohn.
Klara, du tust Recht, auf diese Weise an unseren liebsten Freund zu denken. Er ist im Begriff, nach Leipzig zurückzukehren und dort wieder das Gewandhausorchester zu leiten.
„Der erste Schritt aus Berlin ist der erste Schritt zum Glück“, hat er mir einmal gesagt. Jetzt geht er nach Leipzig, ins Glück.
Wäre besser, für mich, ebenfalls zu gehen.
28. Juli Schwarze Melancholie. – Immer nur Töne.
30. Juli Mühsam nur gelesen. Catherine Fanshawe.
There is a river clear and fair,
Tis neither broad nor narrow.
Weder breit noch schmal. – Über Flüsse nachgedacht und wie selten sie klar sind. Die Mulde fließt manchmal sehr hell und freundlich an Zwickau vorüber. Kindheitserinnerungen. Kindernarreteien. Heimlich dabei gelacht. – Die meisten Flüsse sind aber trüb.
1. August Klara und unsere kleinen Mädchen. Seligkeiten. Marie hat eine schöne Stimme, Julie schreit viel, Elise manchmal trotzig. Klara muss härter sein mit ihr. Werde ihr die Rute geben müssen. – Klara komponiert. Fugen. Ich sehe es nicht ungern. Bin auch bei Fugen. Es ist schön, wenn wir uns gemeinsam in eine Musik versenken. Das ist Liebe. – Klara meint es freilich anders. – Lästige Briefe an Verleger und Leute. – Neue Nachrichten von Felix: Aufbruch nach Leipzig.
2. August Zigarettenqualmerei. Klara zieht ein böses Gesicht darüber. Spielt aus Rache Herz-Variationen. Sie spielt stets diese brillante Herz- und Krabbelmanier, wenn sie mich ärgern will. Ich verweise es ihr jedes Mal streng.
Als Mädchen hat sie viel Geld damit gemacht. Diese seltsamen Leben der Wunderkinder. Jahrmarktsfiguren. Hotelzimmer, Salons, Konzertsäle, heute Berlin, morgen Frankfurt, übermorgen Paris und Ende der Woche London. Müde, mit zerschlagenen Knochen aus der Kutsche steigen und sofort zur Probe. Wie klingt der Saal? Ist das Piano gut gestimmt? Und dann ins weiße Seidenkleidchen. Darunter das Mieder festgespannt, damit die kleinen Brüste kindlich flach aussehen. Eine Schleife ins Haar. Lächeln. Knicksen. So ist brav.
„Seht einmal, den kleinen zauberhaften Engel!“ Dann geht der kleine Engel an den Flügel. Und lässt Musikdämonen frei. Dem Publikum fehlen vor Staunen die Worte. Atemberaubend. Welche Kraft – diese dünnen Kinderärmchen und –fingerchen und welche Kraft und Geschwindigkeit! Ende. Unterm Beifall wird wieder ein Engelchen aus dem Wunder. Knickst brav, Lächeln nicht vergessen! Die Glieder sind wie zerschlagen vor Müdigkeit, die Tränen wollen in die Augen kommen vor Erschöpfung, aber jetzt musst du erst noch den Beifall aushalten, und dann die Damen, die dich so lieben und fragen, wie alt du bist und ob du Geschwister hast und ob dir das Klavierspielen Spaß macht. Immer dieselben Fragen. Du antwortest brav. Wie der Papa dich instruiert hat. Lächeln nicht vergessen! Den Kopf lieblich ein bisschen zur Seite neigen.
3. August Unwohlsein. Contrapunkt-Studien. Neigung zu Schwindel. Angst und Unruhe namentlich in Händen und Füßen – Kollern in den Gliedern – nicht viel Appetit – Puls schwach, leicht erregbar – Schmerzen in verschiedenen Stellen im Kopfe - nicht heftig, aber beängstigend.
Klaras Unwohlsein wegen des zu erwartenden Kindes. Ängste. – Geld fehlt. – Am Abend Gehöraffection. Töne.
6. August Klara übt für die Herbstkonzerte. Sie würde gerne wieder das Virtuosenleben führen. Ich spüre es. Das hat der Alte nun mal in seine Tochter eingepflanzt. Sie vermisst den Beifall. Sie mag es, wenn ihr Lorbeerkränze überreicht und Bouquets zugeworfen werden. – Aber sie wird einsehen, dass es nicht geht. Die Unruhe in mir, wenn sie unterwegs ist. Verflucht, soll ich hier sitzen und komponieren und Kinder auf dem Schoß wiegen, während sie, ich weiß nicht wo, herumläuft und, ich weiß nicht wem, vorspielt? – Im Herbst. Im Herbst spielt sie in Leipzig. Nun gut. Leipzig ist nah. Der Herbst ist noch weit.
Julie weint. Unruhe beim Arbeiten. Es ist mir, als kündigt sich etwas Großes in mir an. Ich höre Töne. Trompeten. Sehr hehr. Vielleicht Bläserhymnus über Streicherteppich. Ich mag den aufreibenden Kontrast. Beschwingtes auf Lyrisches. Brüche nie vermeiden! Widerspenstige Musik machen. Vielleicht ein Scherzo. In einem prickelnden Tempo? – Die Trompeten! Es wird schon etwas recht Großes sein. Vorerst Fugenallerlei.
7. August Zwist mit Klara. Sie ist unglücklich über das neue Kind. Und dabei noch die kleine Julie mit ihren Paar Monaten. Kosten für die Amme. Geld, Geld, Geld. Und ich hab ’s nicht.
9. August Alles nimmt mich mit. Alles wirft mich aus der Bahn. Gutes wie Schlechtes. Dann krank. Sehnsucht. Krank vor Sehnsüchten. – Klara schreibt Fugen. Ich bin mit den Fugen vorläufig zu Ende. Keine Kontrapunkte mehr. Kein Maß. Die Töne schwellen so furchtbar sehnsüchtig auf! Kein Kontrapunkt, kein Maß. Das quillt alles über, ich weiß nicht, wie ich es zusammenhalten soll!
10. August Unwohlsein.
13. August Bittere Melancholie. – Geheimnisvolles Leiden.
14. August Bei Hillers. Muntere Gesellschaft, aber nicht laut. Darum wurde ich auch ein wenig munter. Klara sah aber streng darauf, dass ich nicht zu viel Wein trank. Ferdinand am Flügel. Er schreibt gute Musik, aber ihm fehlt der geniale Splitter im Hirn. Er ist sehr liebenswürdig. Das mögen die Leute. Wenn es einem gelingt, das Musikleben hier hochzubringen, dann ihm und seiner ebenso freundlichen Frau. Anatolka singt gut, wenn auch für meinen Geschmack zu französisierend. Überhaupt ist sie manchmal sehr prätentiös. Ihr Musiksalon soll gut besucht sein. Ich geh nicht hin.
Richard Wagner soll da gewesen sein.
Von dem erwarten sie, dass er ein exzellenter Komponist werden wird. Ich glaub ’s nicht; er redet zu viel. Leute, die zu viel reden, können unmöglich gut komponieren. – Hiller sprach nach einem Toast von Konzerten, die sie hier in Dresden organisieren wollen. Er setzt sich stark dafür ein. Sprach von Mozart, Spohr, Schneider. Hofft auf eine weitere Orchestermusik von mir.
„Robert, wir müssen uns hier unser Publikum schaffen“, sagte er. Ja, er ist der Mann dazu. Hat kräftige Hände wie ein Bauer. Ich kann’s nicht. Dieses feste Zupacken. Mich mit den Leuten herumschlagen. Wen soll ich von Konzerten überzeugen? Entweder mögen die Menschen Musik oder nicht!
16. August Mit den Malern Bendemann und Reinick. Eduard Bendemann sprach uns wieder von seinem geliebten Albrecht Dürer. Klara meinte bereits, man müsse Eduard einfach lieb gewinnen durch sein bescheidenes und dabei so künstlerisches Wesen. Das ist einer, dem vertraut man ohne großes Besehen. Ein echter Freund. Reinick dagegen entzieht sich oft. Bendemann meinte, darin ähnelte er mir, was vielleicht am Vornamen läge, den wir teilten. Er will Reinick einmal malen und stellt ihn sich als dunklen, schweigenden Monolithen vor einer lieblichen, hellen Landschaft vor. Das gäbe ein Bild! Reinick schleppte uns seine Skizzen zum „Felsen von Olevano“ herbei. Südliche Träumerei. Sie gefallen mir, seine Bilder. Mehr noch seine Gedichte. „An den Sonnenschein“ habe ich gern vertont. Klara bringt Marie bei, es zu trällern.
O Sonnenschein! O Sonnenschein!
Wie scheinst du mir ins Herz hinein,
weckst drinnen lauter Liebeslust,
dass mir so enge wird die Brust.
Habe es wirklich bei schönem Sonnenschein, auch des Lebens geschrieben. Klara! Klara! Kurz vor unserer Hochzeit. Fast genau fünf Jahre ist es her, dass ich es vertonte. Das war reines Glück. Nur fünf Jahre seither. – Reinick erzählte Histörchen aus Düsseldorf und aus Rom, wo es ihn herumgetrieben hat. Vom Karneval vor allem. Dem Zotigen da und dem Verdorbenen dort. Rom hat ihn ziemlich niedergehauen, durch die großen Meisterwerke, die er da sah. Schlimme Gedanken waren ihm gekommen, zum Beispiel er wäre ganz unfähig für die Kunst.
„Auch mich fassen Dämonen jener Art zuweilen beim Schopf und wollen mir das bisschen Kraft aussaugen“, gestand er, „was mir früher das Fieber und ewiges Kränkeln, Augenübel und Zersplitterungssucht, Träumerei etc. etc. noch gelassen“. Merkwürdig. Mir hat Italien keine große Sehnsucht, keine Dämonen, rein gar nichts eingepflanzt. Hab’ auch wenig Erinnerungen, meist ungute an meine Italientour. Meine Todesangst auf der Reise hinunter, als wir über die Via mala geführt wurden. Diese Übermacht der Felsen, dieses Starre, Drückende und dann die Schlucht und von unten her das donnernde Rauschen des Wildwassers. Dann die verwanzten Herbergen. In Venedig war ’s ganz arg, da haben mich die Flöhe und Mücken bei lebendigem Leibe aufgefressen, ich habe mich im Bett herumgewälzt, floh aus den Kissen und bin endlich auf einem wackelnden Stuhl eingeschlafen. 1829 war das. Ich gab beide Geschichten Bendemann und Reinick zum Besten. Lachen. Reinick ließ sich über die Kost in den italienischen Wirtshäusern aus, behauptete, seitdem weder Broccoli noch Eier mehr ohne Würgen essen zu können. Über alles Reden von Italien und Reisen, fremden Ländern und Menschen, wieder Sehnsucht, Dresden zu verlassen. - Wien. Ja, von allen Städten könnte es am ehesten Wien sein. Die Wiener mögen die Sehnsucht, sie werden deshalb meine Musik lieben.
17. August Knülle. Klaras Wut darüber. Das Weinen der Kinder.
20. August Flut der Töne. Manchmal wie ein wilder Strom. Klara und ich als zwei mächtige Wogen. Sie rauscht oben, ich unten. Ihr quellen Mendelssohn-Klänge aus den Fingern, mir brodelt ’s und strudelt ’s in eigenen Tönen.
Sie übt für das Konzert in Leipzig. Wenn ihr nur nicht so oft unwohl wäre wegen dem Kinde.
Sie lacht: „Es ist in den ersten Monaten ja immer so, Robert. Bald geht es vorüber.“ – Wenn sie krank ist, bin ich es auch. Beischlaf. Trotzdem.
21. August Mendelssohns Musik. Mendelssohn selbst wieder in Leipzig. Konferiert viel mit dem jungen Niels Vilhelm Gade. Auch so einer, der wunderbare Musik machen kann, aber solche, die schon der Zukunft gehört. Sie werden ihn nicht hinaufkommen lassen. Mich lassen sie auch nicht hinaufkommen. Vieles, was ich schreibe, ist ihnen herzlich unverständlich. Klara kann es nicht begreifen. Sie schimpft über das Publikum, das von Musik keine Ahnung habe. Ich versuche, sie zu beruhigen. Sage: meine Musik wird man in zehn Jahren verstehen. Gebe mich gelassen. Das ist gelogen. Ich will, dass meine Musik jetzt verstanden wird. Ich muss von ihr leben.
Hiller sagte zu mir, Mendelssohn hätte all seine charmante Jugendlichkeit verloren. Die Berliner Jahre hätten ihn kaputt gemacht. Die Musik hat ihn von innen her aufgefressen. Ich weiß, dass sie das tut. Sie bohrt und bohrt und wälzt einem die Seele um und um! Mendelssohn, meint Hiller, sei der Welt müde. – Bei Gott, das bin ich auch.
22. August Bei Hillers. Neue Nachrichten aus Leipzig machen die Runde. Es heißt, auch Ignaz Moscheles wolle sich mit seiner Familie dort niederlassen. Wieder ein Pianist mehr in der Messestadt. Da blüht die Musik! Hier in Dresden hat Hiller alle Mühe. Die Leute sehen hier mehr auf die Oper, weniger auf Konzerte. Wagner wittert Morgenluft. Wenn er’s nur sein lassen würde, einem die Oktavparallelen um die Ohren zu hauen!
24. August Klara zu ihrem Vater. Das ist auch so ein Übel an Dresden, dass Friedrich Wieck sich hier niedergelassen hat. Er schimpft immer noch wider mich. Ich bin der Bösewicht, der ihm das Wunderkind, das Goldeselchen weggeheiratet hat.
„Was hat er denn bisher komponiert“, bohrt er bei Klara nach: „Romanzen, Balladen und an Größerem nur eine Symphonie, die keiner hören mag, und ein Klavierkonzert, von dem man nicht satt wird. Was nennt er sich Komponist! – So, er befasst sich mit Kontrapunkt, Fugen? Na, wohl bekomm ’s ihm! Bringt es denn auch Geld ins Haus? Bringt es ihm Anerkennung? – Kind, er muss endlich etwas schreiben, das brillant ist, das die Leute hören wollen und verstehen.“ Dann kommt Clara stets und käut die Worte ihres Vaters wieder: „Robert, du musst auch mal nach dem Geschmack des Publikums gehen. Was kostet es dich!“
Alles, mein Herz. Ich verleugne nicht meine Kunst. Ums Verrecken nicht. Die Leute sind selbst schuld, wenn sie zu stupide sind, meine Musik zu begreifen. – Und Großes! Großes! Ich überarbeite das Klavierkonzert. Das übt das Instrumentieren. Und dann wird schon Großes werden. Ich höre die Töne. Große Pauke am Ende. Schmelz und Ritterlichkeit. Ich höre es in mir. Das wird groß!
Julie weint. Kümmert sich keiner um das Kind? – Ich höre Klara, die Julie zur Ruhe singt.
27. August Klara halb im Vorwurf zu mir: „Du bist lauter Musik jetzt, so dass eigentlich gar nichts mit dir anzufangen ist.“ Ich weiß aber, dass sie mich so mag. Sie merkt immer, wenn ich über etwas Neuem brüte.
30. August Wiener Pläne etwas aus den Augen verloren. Mit dem neuen Kinde geht es vorerst gar nicht. Es muss erst auf der Welt sein. Vielleicht wäre eine Rückkehr nach Leipzig denkbar. Wo Wieck da nicht mehr wohnt, aber Mendelssohn und Gade das Gewandhaus leiten… – Heute über den Sternenhimmel spekuliert. Seine Klarheit. Die Grenzenlosigkeit seiner Feuerfunken, Myriaden Feuerfunken! Wenn sich die in Musik bringen ließen…
2. September Klara und die Kinder wohl. Ich befinde mich übel. Wanderte abends über die Terrassen, allein. Der Mond, dieser riesige Käse, tropfte milchigen Brei ins All und die Planeten schrien dazu in Quinten, Terzen und Oktaven. Dies soll nun die Sphärenharmonie sein?
3. September Klara war beim Vater. Brachte seine Geschichten mit zurück ins Haus. Er muss nun so furchtbar mit seiner anderen Tochter, Marie, so wüst mit ihr hausen wie vordem mit Klara. Er macht Marie zum Wunderkind am Klavier; sie singt, singt gut, aber nun muss sie auch noch eine Art Musiksalon führen und darin die alleinige Hauptfigur spielen, sich musikalisch präsentieren und alle anderen sollen ihr zu Füßen liegen und das bloß, weil die Hiller und Klara auch Salons haben und der Alte nicht leiden will, dass nur andere von der Musik profitieren. Er will sich überall hineinmengen und Marie ins Spiel bringen. Er versteht das Geschäft, weiß Gott! – Klara mit Wehmut. Könnte sie’s, sie tauschte sicherlich mit ihrer Stiefschwester, Ich fürchte den Einfluss des Alten auf sie. Er nimmt wieder zu. Mit den Kindern ist der Alte närrisch und verwöhnt sie. Wir müssen fort von hier.
6. September Klara unwohl. Lag viel auf dem Sofa heute. Was wird mit den Konzerten? Bangigkeiten.
7. September Sie sind wieder hin und her mit ihren Konzerten, die sie hier in Dresden einrichten wollen. Hiller im Organisationsfieber, wie ein Heuhüpfer springt er umher, macht und tut. Er hofft, Mendelssohn zu gewinnen, hier viele Konzerte zu bestreiten. Hiller schwebt geradezu eine Konkurrenz zum Gewandhaus vor. Große Pläne. Ich zweifle, ob die Dresdner die Konzerte tragen werden, Sie sind hier viel zu sehr auf die Oper. Musik, die sie nur hören, können und bei der es wenig zu sehen gibt, verstehen sie hier nicht. – Es muss ja doch auf der Welt einen Ort geben, wo meine Musik verstanden wird und wo ich zufrieden sein kann und wäre es das letzte Dorf hinter dem Nordpol. – Eine Freude: die Kinder. Heute viel mit Marie und Elise gespielt. Sie bekommen nicht genug von „Hoppe Reiter“ und anderen Späßen dieser Art. Ich galoppierte Huckepack mit ihnen durchs Wohnzimmer. Klara stand lachend dabei, die Köchin schüttelte den Kopf. – Abends mit Klara vierhändig. Sie trug das Haar offen.
8. September Schmerzhafte Anstrengungen. Dumme Melancholie.
13. September Klaras Geburtstag. Sie, sehr beglückt über alle Präsente und Angebinde. Ich hoffe, ihr noch mehr schenken zu können. Sie dachte heute an ihr Konzertdebüt, ein bisschen mit Wehmut.
„Achtzehn Jahre ist es her, Robert“, sagte sie: „Beinahe zwanzig.“ Ich nickte stumm dazu. Überlegungen, ängstlicher, aber auch gemeiner Natur. – Bendemanns, Hillers zu Gast. Reinick und Richter sprachen vor. Von Wagner ein Bouquet. – Ich abends wieder wie die Tage zuvor: Es ist eine große Anstrengung in mir. Manchmal scheint mir, will es mich von innen her zersprengen. Ich bin so voller neuer Töne, ich glaube zu platzen. Aber noch kommt es nicht heraus. Ich höre das Adagio, die schmerzvoll sich dehnende Sehnsucht. Es muss ein Espressivo werden! Aber recht fassen kann ich es noch nicht, immer noch nicht, Verzweiflung, wüste Gedanken. Unruhe.
15. September Krank.
16. September Leidlich wohlauf. Arbeitete, nach einem Spaziergang an der Elbe entlang, flüssig und recht entspannt. Besuch von Richard Wagner. Er in Unruhe und Aufregung, einmal wegen seines „Tannhäuser“, der über die Bühne gehen soll, zum anderen wegen einer Dichtung, die ihn umwälzt, von der er aber noch nichts verraten will. Sonst redete er die meiste Zeit von sich und viel. Ich weiß nicht was. Ich hörte nur zu. Weil ich nichts zu sagen wusste, ging er nach einer guten Stunde wieder So geht’s mir immer mit den Leuten. – Klara noch unter dem Eindruck des Geburtstages: „In vier Jahren bin ich schon dreißig, eine alte Frau“. Ich musste herzlich darüber lachen, sie ein wenig verstimmt. Abends mit Hiller und Julius Hübner. Künstlerrunde. Die geplanten Abonnementkonzerte kamen wieder aufs Tapet.
Hiller wird die dirigieren, so viel ist sicher. Er macht das gut, ist gewandt, freundlich, kann durchgreifen; die Musiker folgen ihm. Aber das Konzertkomitee, das sich aus – ich weiß nicht wem – zusammensetzt, scheint nicht organisiert genug. Jeder mit wirren Ideen, meint Hiller. Er wünscht sich, in dieser Sache als Diktator handeln zu können.
„Alleinherrschaften haben wir schon genug“, knurrte ich. Hübner machte dazu große Augen und fragte, ob heute schon Wagner da gewesen wäre, woher hätte ich sonst meine Revolutionsstimmung. Ich brummte etwas darauf. Hübner leicht verstimmt, Hiller glättete die Wogen rasch wieder. – Wegen der Konzerte warte ich einmal ab.
19. September Merkliche Enttäuschung Hillers, wie ich in den Konzertangelegenheiten nicht so tatkräftig mittue. Ich gestehe ihm, dass ich Musik ausbrüte und darum zurzeit wie die Henne auf ihren Eiern sitze und innerlich unruhig mit den Flügeln schlage. – Unwohlsein kündigt sich an. Klara übt besessen für die Konzerte. Ihre Musik stört die meine.
20. September Ginge es nach mir, gäbe es nur noch innere Klänge. Jeder hörte dann seine eigenen Töne, dann wären auch alle Seelen in ihrem Gleichgewicht. Äußere Musik schmerzt oft. In mir paukt und trompetet es seit einiger Zeit sehr.
22. September Mit Klara das Duo op. 92 von Mendelssohn gespielt. Mein Klavierkonzert unter ihren Händen. Wunderlich und wunderbar. Neue Lektüre: Otto Ludwig. Überhaupt, die Dichtkunst. Mannigfaltige Gedanken zur Literatur und wie man sie in dramatische Gedichte, Opern, Oratorien umwandeln kann.
23. September Hiller mit Konzertangelegenheiten, Bendemann mit Dürervorträgen, Klara mit Dienstmädchenproblemen (stiehlt eines der dreien?), Elise mit einem aufgeschlagenen Knie und vielen Tränen – was wollen die alle von mir?
24. September Ich fliehe zu Bach-Fugen. Kopfschmerzen. - Ich sehne mich nach Leipzig und Felix und seiner reinen Welt der Musik. Klara übt fleißig mein a-moll-Konzert. Wie es jetzt ist, ist es vollendet. Es brauchte tatsächlich einige Änderungen. –
Schrieb an Mendelssohn: „Man will hier Abonnementkonzerte einrichten, doch zweifle ich, ob sie zustande kommen. Mit der Kapelle ist nichts anzufangen und ohne sie auch nichts. Der Zopf hängt ihnen hier noch gewaltig. So will die Kapelle in Extrakonzerten nie Beethovensche Symphonien spielen, weil das ihrem Palmsonntagkonzert und dem Pensionsfond schaden könnte.“ –
Unbegreiflich, wie aufrührerisch sie hier Beethovens Musik finden. Sie haben aber doch Recht: Beethovens Musik ist rebellisch, die reißt alles ein und baut neu auf, sie ist gewaltig, umwälzend. Es ist immer noch zu früh für Beethoven. Vielleicht wird man ihn erst in zehn, zwanzig Jahren richtig verstehen und zu den großen Namen Bach, Händel, Haydn und Mozart hinzuzählen. – Unterschiedliche Lektüre.
26. September Felix, der Glückliche, erwartet Jenny Lind zu seinen Winterkonzerten. Die schwedische Sängerin soll wie kaum eine singen. Felix behauptet, sie interpretiere seine Lieder wie eine Seelenverwandte. Das haben wir Komponisten selten genug. Manchmal meine ich, Klara versteht meine Musik doch nicht so ganz, trotz aller Mühe, die sie sich gibt. Exaltierte Gedanken. Sich steigerndes Unwohlsein. Kopfschmerz, Melancholie. Ziehen vor allem im Hinterkopf. Mitunter den Hals hinunter – Zuckungen der rechten Hand. Erschwert das Schreiben. Unruhe.
27. September Bis auf die letzten Tage war der September eigentlich recht vergnügt. Viel in der guten Spätsommerluft herumspaziert. Den September mag ich sehr, es ist noch warm, die Natur blüht und grünt, es ist so gleichförmig mild. Es ist ein stiller Monat. Sonst sind die Monate so laut. Der September nicht: Die Farben der Natur sind auch milder: das Blau des Himmels sticht weniger als im Mai und August, das Grün ist verblichener als im Juni und Juli, die braune Erde wohltuender aussehend als das kalte Schwarz der nackten Felder im Winter. – - -
Lektüre: in Wilhelmine Lorenz’ Romanen geblättert; „Die Belagerung von Gotha“ und „Der Fluch“. Darüber nachgedacht, Warum namentlich die kleinbürgerlichen Elemente derart für historische Romane schwärmen. Abenteuerlust und gute, alte Zeit? Sich wiegen in dem schlichten Gedanken: gottlob ist heutzutage alles besser? Mir fallen Wiecks und Claras Ermahnungen ein, doch populärer zu komponieren, damit es möglichst vielen Leute gefällt. nachgedacht. Entschluss: ich werfe meine Perlen nicht vor die Säue. Lorenz’ Bücher zugeklappt und in die Ecke geworfen.
29. September Allmählich nimmt es in mir Gestalt an. Ich schreib doch wohl manches zur Symphonie schon nieder. Ich denke sie mir nicht so wild wuchernd wie die Erste, sondern der Form entsprechender. Beethoven. Die Form ist das Gefäß des Geistes. Alles auf das Ende hin Gerichtete. Und vielleicht etwas von Berlioz, ein immer wiederkehrendes Motiv, erkennbar und doch variiert. Ja, die neuen Symphonien müssen wohl Geburten aus Beethovenschen und Berliozschen Gedanken sein. - Berlioz, dieser originelle Kopf. Von dem wollte ich wohl wieder etwas hören. – Abends Schwindel.
1. Oktober Heute ging es mir ganz fatal - dem Mädchen fiel beim Auftragen des Mittagessens das große silberne Vorlegemesser vom Teller auf den Steinboden. Das gab einen schaurigen Klang, dass ich durch und durch zusammenfuhr. Und dann lag dieses Silbermesser da wie etwas Lebendiges und schien mich anzustarren und immerzu hallte der Ton des Aufschlags in mir nach! Ich fürchtete mich, das Messer anzurühren. Das Mädchen hob es auf, entschuldigte sich und brachte rasch ein neues, aber was half das. Mir war der Blick des Messers zu tief hineingefahren. Wie mir vorgelegt ward, mochte ich gar nicht mehr essen. Alles hatte einen eklen metallischen Geschmack. Ich hasse Metall. Es ist ein böses, kaltes Element. – Kopfschmerz.
2. Oktober Draußen gilbt es mächtig. Musste an den vergangenen Herbst denken, den Herbst 1844, in dem ich so furchtbar krank war, wovon ich mich nicht erholt habe. Damals ging Kläre mit Julie schwanger. Es ist also alles fast wie vor einem Jahr. Eine wiederholte Zeit. Diese ganze unsägliche Reise nach Russland, die mich krank gemacht hat. Die Nächte dort so kalt. Und ich? Niemand hat mich wahrgenommen. Meine Aufgabe war es, ihr die Seiten umzublättern.
Dann waren wir wieder in Leipzig und da musste die Musik aus mir heraus, die in Russland hatte schweigen müssen. Goethe war während der unseligen Reise mein Anker gewesen. Jetzt brodelte „Faust“-Musik in mir. Der ganze Juli ging mir hin mit fleißigem, doch angestrengtem Arbeiten und wie der Herbst kam, da war ich wieder innerlich fertig. Schreckliche Tage. Ich schwebte in furchtbaren Phantasien und lag nach vor Angst durchwachten Nächten weinend auf meinem Bett. Ich weiß, wie es ist, wenn man alles, alles gegeben hat. Jetzt bin ich aber besser, viel besser. Vor einem Jahr war die vielleicht schrecklichste Woche meines Lebens.
6. Oktober Ich muss nun völlig anders komponieren. Diese Fülle von Tönen, die mich zersprengen will, die kann ich am Klavier nicht mehr fassen. Ich schreibe jetzt erst auf, wenn ich etwas vollständig in mir höre und mir ausgeführt habe, mit den Klangfarben, in der wohltönenden Harmonie. – Abends leichte Gehöraffection.
Oktober Klara versucht, mein Klavierkonzert a-moll zu zwingen. Sie wird es schaffen. Ihr Üben fährt mir nur in meine Symphoniegedanken hinein; die Zweite wird im Ganzen ein finsteres Stück. Vielleicht ein paar freundliche Strahlen im letzten Teil hereinbrechen lassen? Ich zwinge dich nicht dahin, schöne Musik. Such’ dir deine Wege selbst. Ich bin nur das schlichte Werkzeug, das dich in schwarzen Strichen und Punkten, Fliegendreck, festzuhalten sucht.
11. Oktober Die Konzerte, wie Hiller sie jetzt durchgesetzt hat, wünscht er noch auszubauen. Ich glaube, er plant, Dresden zu einem Musikmekka zu machen. Es sieht aber nicht aus, als wolle er sich um die neue Musik kümmern. Er wird auf das setzen, fürchte ich, was dem Publikum gefällt. Ich werde wieder verlieren. - Wagner Feuer und Flamme für die Oper. Auf den kann man nicht zählen, wenn es um meine Instrumentalmusik geht. „Tannhäuser“, rauschende Musikkaskaden. Dieser Mensch ist an die Oper verloren.
12. Oktober Schlimm. Kopfschmerz. Reizungen aller Art. Platen gelesen.
20. Oktober Anhaltend schlimmer Zustand.
22. Oktober Innere Wüstenei.
23. Oktober Klara: „Ach, mein Robert, mein Robert!“ Die Art, wie sie’s sagte. Nicht Liebe. Sorge. Furcht? – Lektüre: Schelling.
Oktober Was ist ein Datum, wenn die Bäume sich entlauben und die Sonne nicht mehr scheinen will. – Trost und Ablenkung bei den Büchern. Wenn ’s in mir nicht so drängen würde, selbst zu schaffen, dann würd’ ich, glaube ich, nur noch lesen. Lese wieder Karl Immermann. Der sitzt fett in der Theaterdirektion in Düsseldorf und bringt Shakespeare auf die Bühne. Und Goethe. Wofür das Publikum halt zahlt. Ich weiß aber, dass er gerne auch Grabbe auf die Bühne bringen würde. Nur die Leute wollen ’s nicht. Die sind nicht für das Moderne. In der Musik nicht und in der Literatur erst recht nicht, dabei sind Shakespeare und Goethe tot – Grabbe freilich auch, früh verraucht -, aber andere, junge, wollen ihr Brot beißen. - Grabbes Kraft. Die schmissigen Worte gleich zu Anfangs seines Napoleon-Dramas: O mein Karabiner, dürft ich mit deiner Kolbe wieder die Kisten zerschmettern wie die Gehirne!
Da möchte man gleich mittun. Blutrausch. Hände in Blut und Hirn baden. Verspritztes Hirn. Dem Grabbe war wohl auch oft so, als müsste man alles zerfleischen und sich selbst dazu. Immermann dagegen oft verspielt und arglos. Das braucht man genauso wie das andere. Sein Humor ist fein. Aber er bricht ihn dann auch. Im „Tulifäntchen“ ist ein Abgrund sichtbar, genau wie in anderem Lustigen, wie dem „Karneval und die Somnambule“.
1. November