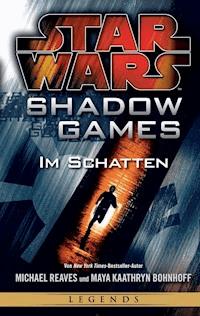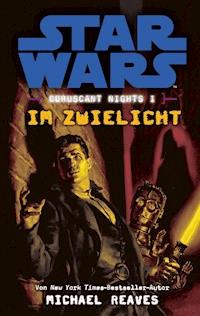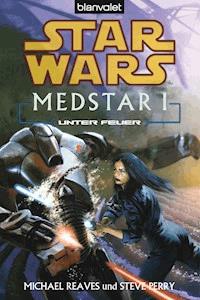4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: MedStar
- Sprache: Deutsch
Die junge Jedi-Heilerin Barriss Offee kämpft auf dem Sumpfplaneten Drongar um die Leben ihrer Patienten, während um sie herum die Schlacht tobt. Sie ahnt nicht, dass sie und alle Soldaten der Republik von höchster Stelle verraten wurden. Doch der Tod lauert längst in Barriss' unmittelbarer Nähe, denn dem Feind ist es gelungen, einen Spion in ihr Team zu schleusen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Michael Reaves & Steve Perry
JEDI-HEILERIN
MedStar 2
Aus dem Englischen
von Andreas Kasprzak
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Star Wars™ Medstar 2. Jedi Healer«
bei Del Rey/The Ballantine Publishing Group, Inc., New York.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2011
bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe
Random House GmbH, München.
Copyright © 2004 by Lucasfilm Ltd. ® & or ™ where indicated.
All rights reserved. Used under authorization.
Translation Copyright © 2011 by Verlagsgruppe
Random House GmbH, München
Umschlaggestaltung: HildenDesign, München
Cover Art Copyright © 2004 by Lucasfilm Ltd.
Cover illustration by Dave Seeley
Redaktion: Marc Winter
HK · Herstellung: sam
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN 978-3-641-07822-5
www.blanvalet.de
Für meinen Sohn Alexander.
»Die Macht wird mit dir sein – immer.«
– M. R.
Für Dianne.
– S. P.
Es war einmal vor langer Zeit in einer weit,
weit entfernten Galaxis …
1. Kapitel
FLEHR-7
DAS JASSERAK-HOCHLAND VON TANLASSA, NAHE DER QAROHAN-STEPPEN
PLANET DRONGAR
JAHR 2 NACH DER SCHLACHT VON GEONOSIS
Mit einem Mal blieb wenig Zeit zum Nachdenken. Keine Zeit, um den bewussten Verstand über Aktion und Reaktion urteilen zu lassen, keine Zeit für Entscheidungen über Form und Fluss. Das Bewusstsein war viel zu langsam, um ihr in dieser Situation auf Leben oder Tod Schutz zu gewähren. Sie musste auf ihr Muskelgedächtnis vertrauen, musste jede Bindung zu vergangenen oder künftigen Belangen loslassen. Sie musste vollkommen und total im Jetzt sein, wenn sie diesen Kampf überleben wollte.
Selbst diese Gedanken schossen ihr binnen eines Zeitraums von nicht mehr als einem Herzschlag durch den Kopf.
Barriss Offee hieb und schnitt mit ihrem Lichtschwert durch die Luft, drehte und wirbelte es, um mit diesen Bewegungen vor sich einen Schild leuchtender Energie zu erzeugen, der Blastersalven, Pfeile, Schwerter, ja, sogar ein paar Schleudersteine abhielt, ohne irgendetwas davon geradewegs zu ihren Angreifern zurückzuschicken. Das war von entscheidender Bedeutung und der schwierigste Teil des Kampfes: Bring keinen von ihnen um! Was das betraf, war Meister Kenobi eisern gewesen. Trenn keine Arme, Beine oder Köpfe ab, ramm die Klinge nicht durch die Leiber der Angreifer! Nicht durch die der Brokii, nicht durch die der Januul.
Es war viel schwerer, zu kämpfen und den Gegner dann zu entwaffnen oder zu verwunden, als ihn direkt zu verstümmeln oder zu töten. Es war immer schwerer, das Richtige zu tun.
Barriss kämpfte …
Neben ihr stellte Anakin Skywalker ein solides Maß an Geschick im Umgang mit dem Lichtschwert zur Schau, auch wenn seine Technik noch immer ein wenig rabiat war. Er hatte erst viel später als die meisten Jedi mit der Ausbildung begonnen, doch er schlug sich ziemlich gut. Durch die Macht spürte sie, dass er mehr tun wollte, dass er sie alle niedermetzeln wollte, doch er behielt sich im Griff. Allerdings konnte sie fühlen, was ihm das für Schwierigkeiten bereitete. Und dieses kleine Lächeln auf seinem Gesicht, als er zur Verteidigung ein Energienetz vor sich wob, beunruhigte sie ein wenig. Er schien hieran viel zu viel Gefallen zu finden.
Zu ihrer Linken mähte Meister Kenobis brummende Energieklinge einen nach Ozon riechenden Gobelin verwaschener Lichter, schlug Blasterschüsse in den Boden, blockte heranzischende Pfeile ab und zerschmetterte Durastahlklingen beinahe zu schnell, als dass man dem Spektakel mit bloßem Auge folgen konnte. Seine Miene war ernst, grimmig.
Meisterin Unduli bewegte sich mit dieser unglaublichen, geschmeidigen Anmut, die ihr Markenzeichen darstellte, tanzte defensiv umher, wehrte die Angriffe mit Leichtigkeit ab. Barriss stand neben ihrer Lehrmeisterin und führte die blaue Klinge im perfekten Gleichklang mit dem blassgrünen Schimmer, der vom Lichtschwert ihrer Meisterin ausging. Jede für sich allein waren sie Gegnerinnen, mit denen man rechnen musste. Zusammen, von und in der Macht verschmolzen, stellten sie eine Kampfeinheit dar, die wesentlich stärker und schneller war als die Summe ihrer beiden Teile. Sie ergänzten die Finten, Paraden und Blöcke des jeweils anderen so absolut und vollkommen, dass viele der wilden ansionianischen Ebenenbewohner ungläubig glotzten, während sie den Angriff fortsetzten.
Als die heulende Meute ungeachtet ihrer routinierten Fähigkeit das erste Mal vorgerückt war, hatte Barriss eine Woge der Furcht verspürt. Da waren so viele von denen, und die Oberhand über sie zu erlangen, ohne zu töten, war ziemlich schwer. Doch als sie nun sprang und parierte und die Waffe schwang, während die Macht jede ihrer Bewegungen leitete, war die anfängliche Panik verflogen. Sie hatte den Fluss der Macht noch nie so stark gespürt wie jetzt, als sie vier auf diese Weise hier vereint waren. Sie war mit Anakin und Meister Kenobi ebenso vollkommen verbunden wie mit Meisterin Unduli. Es war ein unglaublich kraftvolles, berauschendes Gefühl, aufregend, überwältigend, das sie mit Zuversicht erfüllte: Wir können es schaffen … Wir können beide Armeen besiegen …
Vernunftmäßig wusste sie, dass es nicht klappen konnte, doch Überzeugung war eine Frage des Herzens, nicht des Verstandes. Sie waren unbezwingbar. Sie schlugen den Tod aus der Luft: leistungsstarke Partikelstrahlen, Pfeile mit Nadelspitzen, Schwerter, die scharf genug waren, um die langen Mähnen der Ansionianer abzurasieren …
Der Kampf schien lange Zeit zu währen, doch als er vorüber war, wurde Barriss bewusst, dass die gesamte Auseinandersetzung vielleicht zehn Minuten oder weniger gedauert hatte. Zu ihren Füßen lagen Dutzende zerschmetterter Waffen, und die überraschten Krieger umringten sie voller Ehrfurcht vor den Kampfkünsten der Jedi.
Die sollten sie auch besser haben …
Barriss lächelte bei der Erinnerung an die Begegnung auf Ansion. Sie hatte die Macht viele Male gefühlt, davor und danach, aber niemals sonst war sie so … unwiderstehlich gewesen. Selbst, als sie den Alwari ihre »Seele« gezeigt hatten – sie mit ihrem Zirkeltanz, Anakin mit seinem Gesang, Meister Obi-Wan Kenobi mit seinem Geschichtenerzählen und Meisterin Luminara Unduli mit ihrer Macht-Skulptur aus wirbelndem Sand –, hatte sie sich nicht so lebendig gefühlt wie während des Kampfes, als sie an der Seite ihrer Meisterin und der anderen focht. Allein zu kämpfen war eine Sache, aber als Duo oder als Teil einer Gruppe zu kämpfen? Das war viel, viel besser.
Doch das war die Vergangenheit, und wenn sie in ihren Jahren im Jedi-Tempel etwas gelernt hatte, dann, dass man die Vergangenheit zwar Revue passieren, aber nicht erneut erleben konnte. Jetzt befand sie sich nicht mehr auf Ansion, sondern auf Drongar, diesem klammen Treibhaus von einem Planeten, und obgleich ihre Mission, den Dieb zu finden, der die kostbaren, hier wachsenden Bota-Pflanzen gestohlen hatte, vorüber war, wartete sie im Moment noch darauf, von ihrer Meisterin zu hören, um anschließend mit dem nächsten Schritt ihrer Ausbildung fortzufahren.
Gerade, als sie von Neuem fühlte, wie Frustration in ihr aufstieg, piepte die Kom-Einheit auf ihrem Tisch. Sie aktivierte sie, und schon schimmerte ein kleines Holoprojektor-Abbild ihrer Lehrmeisterin in der warmen Luft. Die Kom-Einheit war klein und schien eine geringfügige Fehlfunktion zu haben. Abgesehen von dem üblichen Flackern und Rauschen, das bei der Kommunikation über viele Parsecs hinweg nichts Ungewöhnliches war, schien irgendein Element des Energieverstärkers so viel Wärme abzugeben, dass Schaltkreise schmolzen, so unmerklich, dass sie sich nicht sicher war, ob sie das Ganze tatsächlich wahrnahm oder es sich einfach nur einbildete. Es war kein unangenehmer Geruch, er erinnerte Barriss vielmehr an geröstete Klee-Klee-Nüsse.
Meisterin Unduli war jetzt Lichtjahre entfernt, auf Coruscant, auch wenn ihr Bild nah genug war, um es zu berühren. Das dreidimensionale Abbild war allerdings substanzlos, sodass dieser Versuch genauso vergebens gewesen wäre, wie einen Geist anzufassen.
Barriss seufzte, als sie fühlte, wie sich die Anspannung in ihr löste. Hier auf Drongar hatte sie die Trennung von ihrer Lehrerin deutlich gespürt. Allein der Anblick von Meisterin Unduli, selbst in einer flackernden, niedrig aufgelösten Holoübertragung, genügte, ihr dabei zu helfen, sich zu sammeln. Sie hatte es auch bitter nötig, sich zu sammeln. Nach der jüngsten, gezwungenen Umstationierung der Feldlazaretteinheit – gute fünfzig Kilometer weiter nach Süden, um zu verhindern, dass sie von Kampfdroiden der Separatisten überrannt wurde –, dem Tod von Zan Yant und den niemals endenden Strömen neu eintreffender Verwundeter, verspürte sie das drängende Verlangen nach dem beruhigenden, zentrierenden Einfluss, den ihre Lehrmeisterin stets auf sie ausübte.
Nachdem sie einander begrüßt hatten, sagte Barriss: »Also, ich nehme an, meine Mission hier auf Drongar ist zu Ende.«
Meisterin Unduli neigte den Kopf. »Und was führt dich zu dieser Annahme?«
Barriss betrachtete das Bild, mit einem Mal unsicher. »Nun … Ich wurde hierhergeschickt, um herauszufinden, wer das Bota stiehlt. Diejenigen, die dafür die Verantwortung trugen, der Hutt Filba und Admiral Bleyd, tun das mittlerweile nicht mehr, da sie tot sind. Das Militär hat einen neuen Admiral entsandt, um den MediStern und die Flehrs auf dem Planeten zu befehligen. Er sollte in Kürze hier eintreffen, und ich vermute, dass er angesichts des Werts der Bota-Pflanzen wegen seiner Redlichkeit für den Posten ausgewählt wurde.«
»Das war bloß ein Teil deiner Mission, Padawan. Du bist außerdem als Heilerin hier, und es gibt immer noch Leute, die Hilfe nötig haben, nicht wahr?«
Barriss blinzelte. »Ja, Meisterin, aber …«
Es folgte eine Pause, als ihre Lehrmeisterin sie musterte. »Aber du denkst nicht, dass das ein hinreichender Grund für dich ist, dort zu verweilen, oder?«
»Mit allem gebotenen Respekt, aber ich scheine hier kaum einen Unterschied auszumachen. Es ist, als würde man versuchen, einen Sandstrand Körnchen für Körnchen anderswohin zu schaffen. Ich könnte ohne Weiteres durch irgendeinen kompetenten Mediziner ersetzt werden.«
»Und du denkst, dass deine Talente anderswo von größerem Nutzen wären.« Das war keine Frage.
»Ja, meine Meisterin. Das tue ich.«
Meisterin Unduli lächelte. Selbst bei der flackernden Projektion konnte Barriss sehen, wie sich um diese intensiven, blauen Augen herum Fältchen bildeten. »Natürlich tust du das. Du bist jung, und dein Verlangen, eine leuchtende Macht des Guten zu sein, hat dich ein bisschen blind gemacht für all die anderen Dinge um dich herum, die ebenfalls deiner Aufmerksamkeit bedürfen. Aber ich spüre, dass du dort noch nicht fertig bist, mein ungeduldiger Padawan. Es gibt immer noch Lektionen zu lernen. Auch Seelen brauchen Heilung, manchmal ebenso sehr oder noch mehr, als Leiber es tun. Ich werde mit dir in Kontakt treten, wenn ich denke, dass es für dich an der Zeit ist, Drongar zu verlassen.«
Meisterin Undulis Abbild erlosch.
Barriss saß einige Zeit auf ihrer Pritsche. Sie konzentrierte sich darauf, ihren Geist zu beruhigen, und stellte fest, dass das schwierig zu erreichen war. Die Gründe ihrer Meisterin, sie hierzulassen, waren ihr ein Rätsel. Ja, sie war eine Heilerin, und ja, sie hatte ein paar Leben gerettet, aber das konnte sie überall tun. Auf diesem wildwüchsigen Planeten schien es wenig zu geben, das ihr dabei helfen würde, eine voll ausgebildete Jedi-Ritterin zu werden. Sie fand, dass ihre Meisterin lieber nach einem Ort suchen sollte, wo sie sie angemessen testen konnte, um all ihre Fähigkeiten auf die Probe zu stellen, und nicht bloß die als Heilerin.
Doch stattdessen hatte Meisterin Unduli beschlossen, sie auf dieser durchnässten Schlammkugel zu lassen, auf der Schlachten geschlagen wurden, wie sie in den vergangenen tausend Jahren selten geschlagen worden waren – auf dem Boden, zwischen Armeen, die angehalten waren, mit Bedacht ins Gefecht zu ziehen, um zu vermeiden, dass die wertvollen Bota-Pflanzen Schaden nahmen, die hier dichter wuchsen als irgendwo sonst in der bekannten Galaxis. Bota – ein erstaunliches, adaptogenes Gewächs, aus dem eine Vielzahl von Wundermitteln hergestellt werden konnten – war überaus schadensanfällig, und selbst die schwache Druckwelle einer zu nahen Explosion konnte ein ganzes Feld davon ruinieren. Manchmal genügte sogar der Donner eines dichtbei einschlagenden Blitzes – von denen es auf diesem jungen und unbeständigen Planeten jede Menge gab –, um die fragile Pflanze zu schädigen. Weder die Republik noch die Konföderation wollte das, weshalb die hier eingesetzten Waffen und Kriegstaktiken in höchstem Maße primitiv waren. Meistens kämpften Kampfdroiden in Handblaster-Reichweite in kleiner Zahl gegen Klontruppen, ohne dass viel Artillerie oder leistungsstarke Energiestrahlen zum Einsatz kamen. Da die Pflanze, um deren Vorherrschaft die beiden Seiten kämpften, ihr Gewicht in wertvollen Edelsteinen wert war, wollte niemand das Bota zu Tode schütteln oder in Brand setzen – was in der überaus sauerstoffhaltigen Atmosphäre trotz des sumpfigen Geländes nur allzu leicht passieren konnte. Obwohl es stimmte, dass beide Seiten gelegentlich schwerere Waffen eingesetzt hatten – wie beispielsweise bei dem jüngsten Separatistenangriff, der es notwendig gemacht hatte, die gesamte Basis zu verlegen –, kämpfte – und blutete – meistens die Infanterie um jeden kostbaren Zentimeter Boden, und das alles wegen des zimperlichen Vorgehens, den das Bota erforderte. Nicht zum ersten Mal fragte Barriss sich, wie es eine einheimische, so anfällige Pflanze bloß geschafft hatte, sich auf dieser stürmischen Welt so lange in ihrer ökologischen Nische festzuklammern.
Doch solche Fragen spielten jetzt keine Rolle. Alles, was zählte, war, dass der Bota-Dieb tot war – und dennoch hatte Meisterin Unduli ihr befohlen hierzubleiben. Warum? Was steckte dahinter?
Sie schüttelte diese Gedanken ab. Zu viel nachzudenken, war der Klarheit des Geistes nicht förderlich – tatsächlich war genau das Gegenteil der Fall. Sie musste von sich selbst ablassen, musste der Macht erlauben, sie mit der Ruhe und Gelassenheit zu erfüllen, die sie ihr stets schenkte – wenn es Barriss gelang, damit in Verbindung zu treten.
An manchen Tagen war das wesentlich schwerer als an anderen.
2. Kapitel
Jos Vondar lag auf dem Bett und schaute den jungen Mann in Offiziersuniform, der im Türrahmen seiner Bude stand, finster an. Eigentlich kaum mehr als ein Junge … Er sah aus, als wäre er gerade mal fünfzehn Standardjahre alt.
»Was ist?«
»Captain Vondar? Ich bin Lieutenant Kornell Divini.«
»Das ist schön. Und warum stehst du da in der offenen Tür und lässt die Hitze in mein trautes Heim?«
Der Junge schaute etwas unbehaglich drein. »Ich wurde Ihnen zugewiesen, Sir.«
»Ich brauche keinen Hausburschen«, erwiderte Jos.
Überraschenderweise lächelte der Junge. »Nein, Sir, das hatte ich auch nicht erwartet – wenn man sieht, wie sauber und ordentlich Ihre Bude ist.«
Jos erwiderte nichts darauf. Es stimmte, dass die Dinge in letzter Zeit ein wenig … unorganisiert geworden waren. Er ließ den Blick durch die kleine Wohneinheit schweifen. Seine letzten beiden Garnituren Wechselwäsche hingen über der Rückenlehne eines Formplaststuhls, der Getränkekühler war versifft genug, dass es sich selbst ein schäbiger Meuchelhändler zweimal überlegt hätte, etwas aus dem Ding zu trinken, und der Schimmel, der die Wände hochkroch, war so dicht wie Waldmoos von Kashyyyk. Jos musste ehrlich zugeben, dass vermutlich nicht einmal ein Sumpfschwein freiwillig in einem Saustall leben würde, der so dreckig und vollgemüllt wie dieses Quartier war.
Von ihnen beiden war Zan stets der Ordentlichere gewesen. Er hätte nie zugelassen, dass diese Sache außer Kontrolle geriet. Beinahe konnte Jos die Stimme des Zabrak hören: Hör mal, Vondar, ich habe schon Müllschuten gesehen, die steriler waren als das hier. Was willst du damit erreichen? Versuchst du, dein Immunsystem auf die Probe zu stellen?
Aber Zan war nicht hier. Zan war tot.
Wieder sprach der Junge. Jos schenkte ihm wieder seine Aufmerksamkeit: »… wurde Flehr Sieben als Chirurg zugewiesen, Sir.«
Jos setzte sich in seiner Koje auf und starrte ihn an. Hörte er richtig? Dieses … dieses Kind war Arzt?
Unmöglich!
Sein Unglauben musste ihm anzusehen sein, da der Junge ein wenig steif sagte: »Coruscant Medizentrum, Sir. Vor zwei Jahren graduiert, dann habe ich mein praktisches Jahr und danach ein Jahr Facharztausbildung im Großen Zoo gemacht.«
Das zauberte ein Lächeln auf Jos’ Antlitz. Der Große Zoo war der inoffizielle Name für das Galaktische Polysapiens, das Multi-Spezies-Medizentrum auf Alderaan, bei dem er selbst sein Berufspraktikum absolviert hatte. Das Zentrum beherbergte nicht weniger als dreiundsiebzig verschiedene Umgebungszonen und Operationsbereiche und verfügte über Behandlungsprotokolle für jede bekannte kohlenstoffbasierte empfindungsfähige Spezies in der bewohnten Galaxis sowie über die meisten der silikon- und halogenbasierten Lebensformen. Wenn es lebte und halbwegs ein Bewusstsein besaß, fand es sich früher oder später im Großen Zoo wieder.
Jos bedachte den Jungen mit einem eingehenderen, abschätzenderen Blick. Er war ein Mensch – entweder Corellianer wie Jos oder irgendeine andere nahe Variante –, mit flachsblondem Haar und Wangen, die aussahen, als stünde ihnen die Begegnung mit Enthaarungscreme noch bevor. »Eigentlich hättest du drei Jahre Assistenzzeit haben müssen, bevor die dich ins Getümmel werfen«, meinte Jos.
»Ja, Sir. Offensichtlich gehen ihnen allmählich die Frontärzte aus.«
Die Überbleibsel von Jos’ Lächeln verschwanden. Zan war erst seit einer Woche tot. Und dieser Junge sollte sein Ersatz sein? Die Republik musste allmählich verzweifeln, wenn sie auf diese Weise schon Babys aus ihren Wiegen rissen.
Abgesehen davon konnte ohnehin niemand Zan ersetzen. Niemand.
»Also gut, Lieutenant … Divini, nicht wahr?«
»Uli.«
Jos blinzelte. »Wie bitte?«
»Alle nennen mich Uli, Sir. Ich stamme von Tatooine, aus der Nähe des Dünenmeeres. Das ist die Kurzform von Uli-ah, das Wort für Sandleutekinder. Wie ich diesen Spitznamen bekommen habe, ist eigentlich recht interessant …«
»Lieutenant Divini, es liegt mir fern, die Weisheit der Republik in Frage zu stellen – ich glaube nicht, dass das überhaupt irgendjemand könnte, da es da keine Weisheit gibt, die man infrage stellen könnte. Also schön, willkommen im Krieg! Schon Meldung beim Kommandanten der Einheit gemacht?«
»Bei Colonel Vaetes, ja, Sir. Er hat mich hierhergeschickt.«
Jos seufzte. »In Ordnung. Ich schätze, dann sollten wir dir lieber eine Unterkunft suchen.« Er stand von seiner Pritsche auf.
Der junge Divini schaute unbehaglich drein. »Der Colonel sagte, ich wohne mit Ihnen zusammen, Sir.«
»Hör auf, mich Sir zu nennen! Ich bin nicht dein Vater, obwohl ich mich in diesen Tagen alt genug fühle, dass ich das sein könnte. Nenn mich Jos … Vaetes hat dich hergeschickt, um hier zu bleiben?«
»Ja, Sir. Ähm, ich meine, ja, Jos.«
Jos spürte, wie sich seine Backenzähne fest gegen den Oberkiefer drückten. »Bleib genau hier!«
»In Ordnung.«
Als Jos in Vaetes’ Büro eintraf, wartete dieser bereits auf ihn. Bevor er ein Wort rausbringen konnte, sagte der Colonel: »Das ist richtig, ich habe den Jungen zu Ihrer Wohneinheit geschickt. Er wurde als Allgemeinchirurg hierherversetzt, und ich habe nicht die Absicht, die Konstruktionsdroiden anzuweisen, alles stehen und liegen zu lassen, um eine neue Bude zu bauen, wenn Sie in Ihrer noch ein leeres Bett haben.« Er hob eine Hand, um Jos’ Kommentaren zuvorzukommen. »Dies ist kein Debattierklub, Captain, dies ist die Armee. Sie sind der Chefchirurg dieser Einheit. Zeigen Sie ihm, wie die Sache läuft, machen Sie ihn mit allem vertraut! Das muss Ihnen nicht gefallen, aber Sie müssen es tun. Wegtreten!«
Jos starrte Vaetes an. »Was ist mit Ihnen los, D’Arc? Hat Ihnen irgendwer den Kopf aufgemeißelt und Ihnen ein ordentliches Militärhirn eingepflanzt? Sie klingen wie eine Figur in einem schlechten Holostreifen. Haben Sie in letzter Zeit mal einen Blick nach draußen geworfen? Bislang steht noch nicht einmal die Basis wieder richtig, bloß ein einziger Bacta-Tank ist funktionsfähig, und wir haben während der Umstationierung einen kompletten Container Kryoflüssigkeit verloren. Dummerweise hat seitdem niemand dem Feind gesagt, dass wir Probleme haben, also schießen sie einfach weiterhin auf unsere Jungs, und wir müssen sie dann irgendwie wieder zusammenflicken. Ich habe nicht die Zeit, die Amme von irgendeinem Randvolk-Bengel zu spielen.«
Vaetes musterte ihn milde, als hätten sie sich über das Wetter unterhalten. »Fühlen Sie sich jetzt besser? Gut. Der Ausgang ist hinter Ihnen. Drehen Sie sich einfach um und gehen Sie ein paar Schritte, um den Sensor zu aktivieren, und Sie sollten sich vielleicht ein bisschen beeilen, weil …«
»Ich höre sie«, sagte Jos empört. Mindestens zwei Mediberger waren im Anflug. »Aber diese Sache ist noch nicht erledigt, D’Arc.«
»He, Sie können jederzeit vorbeischauen. Meine Tür steht immer offen. Nun, es sei denn, sie ist gerade zu – worum Sie sich auf Ihrem Weg nach draußen bitte kümmern können.«
Jos marschierte aus dem Büro des Colonels in den feuchten, erstickenden drongarianischen Nachmittag hinaus.
Das ist genau das, was ich jetzt brauche, dachte er. Ein Kind, das noch grüner hinter den Ohren ist als ein frisch geschlüpfter Klon. Der Junge mochte vielleicht denken, er sei bereit für den Feldeinsatz, doch Jos’ Ansicht nach waren seine Erfolgsaussichten gering. Gewiss, in jedem großen Medizentrum konnten die Dinge heftig werden, doch er hatte schon abgehärtete Veteranen mit Jahren der Erfahrung gesehen, die die Myriaden Arten kannten, auf die empfindungsfähige Wesen sterben konnten, und die doch aus einem Flehr-OP rannten, um zu vermeiden, dass sie sich in ihre Masken erbrachen.
»Mimn’yet-Chirurgie«, nannten sie das, nach einem Fleischgericht von fragwürdiger Herkunft, das bei den blutdurstigen Reptiloiden auf Barab I ausgesprochen beliebt war. Das war eine anschauliche Metapher, die das schnelle, rabiate Flickwerk-Tempo verdeutlichte, mit dem sie arbeiten mussten. Die Blutung stoppen, ein Synthfleischpflaster draufpappen oder eine Gipsschiene aufsprühen und weiter. Da blieb keine Zeit für Feinheiten wie Regenerationsstim. Wenn am Ende jemand einen bleichen Streifen schimmernden Narbengewebes quer im Gesicht hatte, spielte das keine große Rolle – solange er oder sie immer noch schießen konnte.
Es gab Tage, an denen Jos zwanzig Stunden am Stück auf den Beinen war, seine Arme in Rot getüncht und zwischen den Patienten kaum genügend Zeit, um Atem zu holen. Das war primitiv, das war barbarisch, das war brutal.
Das war Krieg.
Dies war die sterile Hölle, in die Vaetes gerade ein Kind geschubst hatte, das kaum alt genug aussah, um von Rechts wegen einen Landgleiter fliegen zu dürfen.
Jos schüttelte den Kopf. Lieutenant Kornell »Uli« Divini stand ein unsanftes Erwachen bevor, um das Jos ihn nicht beneidete.
Andererseits hatte die Situation einen möglichen positiven Aspekt: Tolk würde den Jungen vermutlich lieben.
An sie zu denken, zauberte ihm ein aufrichtiges Lächeln auf die Lippen. Seine Beziehung zu der lorrdianischen OP-Schwester war die eine gute Sache, die dieser Krieg mit sich gebracht hatte. Die einzige gute Sache, soweit es Jos betraf.
Den Dhur hatte eine Mission.
Es war eine Mission, die wenig mit dem Krieg zwischen der Konföderation und der Republik zu tun hatte, allenfalls in recht abstrakter Hinsicht. Und obgleich er ein freischaffender Feldkorrespondent war, handelte es sich dabei um nichts, über das er in jedem Fall eine Story bringen würde. Nein, bei dieser Sache ging es darum, einem Freund zu helfen – jemandem, den er während seines Aufenthalts auf Flehr Sieben gut kennengelernt und den er mittlerweile als verwandte Seele betrachtete.
Denjenigen, die den abgebrühten Sullustaner von früher kannten, würde es zweifellos schwerfallen zu glauben, dass Den für irgendein lebendes Wesen so etwas wie Freundschaft empfand. Was bedeutete, dass sie ihre Meinungen über ihn nicht revidieren mussten, da das Wesen, dem Den diesen Gefallen tat, nicht lebendig war – jedenfalls nicht im traditionellen Sinne.
Was das Ganze zu einer noch größeren Herausforderung machte.
Den saß mit seinem Kameraden in der Basis-Cantina. Er nippte an einem besonders starken Machwerk aus Würzbräu, sullustanischem Gin und Altem Janx-Geist, das Sonic Servodriver genannt wurde. Niemand schien zu wissen, warum der Drink so hieß, und sobald man die ersten ein oder zwei intus hatte, verschwendete auch kaum noch jemand einen Gedanken daran. Wie gewöhnlich trank sein Begleiter nichts. Das war nicht überraschend, da er keinen Mund und keine Kehle besaß, und es war ihm bereits gelungen, Den davon zu überzeugen, dass es vermutlich keine sonderlich gute Idee war, Alkohol in seinen Vokabulator zu gießen.
Den richtete seine großen trüben Augen auf I-5YQ. Der Droide besaß die lästige Angewohnheit – noch verschlimmert durch die polarisierten Lichtschutzlinsen, die der Sullustaner trug –, sich in mehrere Abbilder aufzuspalten. Abgesehen davon wirkte alles mehr oder weniger normal. »Wir müssen dich wirklich ma’ betrunk’n mach’n«, erklärte er I-Fünf.
»Und warum ist das unbedingt erforderlich?«
»Weil’s nich fair is«, sagte Den zu ihm. »Alle annern könn’n sich abfüll’n, bis innen der Schäd’l wechfliecht …«
»Was sie mit alarmierender Regelmäßigkeit tun, wie mir aufgefallen ist.«
»Alle außa dir. Dassis nich gut. Das müss’n wa in O’nung bring’n.«
»Gehen wir einen Moment lang davon aus, dass es sich bei Trunkenheit um einen Zustand handelt, den ich anstrebe«, meinte der Droide. »Ich sehe eine Reihe von Problemen, die hierfür gelöst werden müssten. Von denen nicht das unerheblichste ist, dass ich keinen Metabolismus besitze, der Ethanol verarbeiten würde.«
»Richtig, richtig.« Den nickte. »Das müss’n wa irgendwie umgeh’n. Keine Sogge, mir wird schon was einfall’n …«
»Augenblicklich hätten Sie schon Mühe, sich an Ihren Namen zu erinnern. Nichts gegen Sie, aber momentan würde ich Ihnen nicht einmal zutrauen, die Schaltkreise eines Mausdroiden neu zu verkabeln. Vielleicht später, wenn Sie …«
Mit einem Mal blähte der Sullustaner aufgeregt seine Wangenlappen. »Jetz habbich’s! Dassis perfekt!«
»Was genau?« Der Tonfall des Droiden war skeptisch.
Den kippte den Rest von seinem Drink hinunter, ehe er sich einen Moment lang an der Tischkante festhalten musste, bis sich die gesamte Cantina, die unerklärlicherweise plötzlich in den Hyperraum katapultiert worden war, wieder stabilisiert hatte. »Wa werd’n einfach dein’n Prozzzessor teilweise runnerfah’n. Fummeln ’n bischen annen Sensoreingäng’n rum, lockern die Logikschaltkreise.«
»Tut mir leid. Multiple Redundanzsicherungen. Die sind fest verdrahtet – ich könnte ebenso wenig aus freien Stücken dagegen interferieren, wie Sie aufhören könnten zu atmen.«
Den musterte stirnrunzelnd seinen leeren Krug. »Verdammt!« Dann hellte sich seine Miene auf. »Inonnung, wie wä’s, wenn wa die Elegdronig direkt neu ausricht’n? Bloß vorüberge’nd, natürlisch …«
»Das könnte funktionieren – wenn Sie die Pikodroideningenieure herschaffen könnten, die nötig sind, um die Neuausrichtung durchzuführen, und die ausschließlich in Reparaturzentren von Cybot Galactica oder bei ihren autorisierten Vertragspartnern anzutreffen sind. Ich glaube, der nächste ist schätzungsweise zwölf Parsecs von hier entfernt.«
Den rülpste und zuckte die Schultern. »Nun, wa lass’n uns schon irgendwas einfall’n. Keine Sogge – so schnell gibt Den Dhur nich auf. Ich bleib da dran, Kumpel.« Sein Kopf schlug mit einem vernehmlichen Tschunk auf den Tisch, und einen Moment später begann er zu schnarchen.
I-Fünf betrachtete den bewusstlosen Reporter und seufzte dann. »Irgendetwas hieran«, murmelte der Droide, »kommt mir so bekannt vor.«
3. Kapitel
Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, wäre es Jos lieber gewesen, den Jungen nicht auf diese Weise mit seiner neuen Arbeit vertraut zu machen. Als sie eintrafen, war der Operationssaal jedoch voller verwundeter Klonsoldaten, das Dröhnen der Mediberger, die neue Verletzte brachten, schien so konstant wie das der Wärmetauscher, und jeder, der ein Vibroskalpell halten konnte, wurde gebraucht. Sofort.
Er hatte keine Zeit, den Jungen zu beaufsichtigen – er steckte bis zu den Ellbogen im Brustkorb eines Klons voller Granatsplitter. Count Dookus Waffenforschungsgruppe hatte eine neue Splitterbombe ausgetüftelt, die »Unkrautscherer« genannt wurde – eine intelligente Bombe, die beim Abschuss in hohem Bogen nach oben flog, über jedes Verteidigungsgitter hinweg, um inmitten eines Truppenverbandes zu landen und in Brusthöhe über dem Boden zu explodieren, um kreisförmig winzige, spitze, messerscharfe Durastahlflechets zu verschießen. Gegen »weiche Ziele« war der Unkrautscherer bis zu einer Entfernung von zweihundert Metern tödlich, und die Rüstung der Klontruppen hielt nicht viel von dem Schrapnell ab, wenn überhaupt etwas.
Wer auch immer die Klonrüstung entworfen und produziert hatte, musste Jos’ Ansicht nach für einiges geradestehen. Die Kaminoaner mochten Genies sein, wenn es darum ging, weiches Gewebe zu entwickeln und zu formen, doch soweit er das sehen konnte, war die Rüstung praktisch nutzlos. Die nicht geklonten Teile der Truppen bezeichneten die Ganzkörperanzüge gern als »Körperkübel«. Das war ein treffender, anschaulicher Begriff.
Er setzte gerade an, darum zu bitten, dass das Pressorfeld eine Stufe höher geschaltet wurde, doch Tolk kam ihm zuvor: »Plus sechs auf das Feld«, wies sie den 2–1B-Droiden an, der die Einheit bediente.
Tolk la Trene war Lorrdianerin. Ihre Spezies besaß die verblüffende Gabe, die Mikroausdrücke der meisten Personen zu lesen und irgendwie ihre Gefühle zu erspüren – und das in einem Ausmaß, dass es fast wie Telepathie wirkte. Darüber hinaus war sie die beste OP-Schwester der Einheit. Mehr noch, sie war wunderschön, mitfühlend und Jos’ Liebste, und das ungeachtet des Umstands, dass sie eine Ekster war – nicht permes, eine Außenseiterin, die nicht zum Clan seines Heimatplaneten gehörte –, was bedeutete, dass es für ihre Beziehung eigentlich keine Zukunft gab. Die Vondars waren Enster, und das hieß, dass die Ehe bloß mit jemandem aus dem eigenen System geschlossen werden konnte, vorzugsweise mit jemandem von seinem Heimatplaneten. Es gab keine Ausnahmen.
Vorübergehende Bindungen zu Ekstern wurden stillschweigend geduldet, damit man sich die Hörner abstoßen konnte und all das, aber man brachte keine Freundin, die nicht permes war, mit nach Hause, um sie seiner Sippe vorzustellen, zumindest dann nicht, wenn man nicht bereit war, seinem Clan den Rücken zu kehren und dauerhaft verbannt zu werden. Ganz zu schweigen von der Schande, die man seiner Familie damit bereiten würde: Er hat eine Ekster geheiratet! Kannst du dir das vorstellen? Seine Eltern sind vor Scham tot umgefallen!
Jos schaute zu Uli hinüber und dann zu Tolk, die sagte: »Uli scheint sich gut zu schlagen. Die Pflegedroiden haben gerade seinen ersten Patienten rausgerollt, und sie haben nicht den Weg zur Leichenhalle genommen. Er ist ein pfiffiger Bursche.«
Jos schüttelte den Kopf. »Ja, pfiffig.«
Er riskierte einen raschen Blick in die Runde. Ihnen fehlten immer noch zwei Ärzte und drei FX-7-Chirurgiedroiden, um ein komplettes Team zu bilden, und das würde sie heute einiges kosten, mindestens …
Noch während er das dachte, sah er eine maskierte und mit einer Robe bekleidete Gestalt, die an einen der leeren Tische trat. Das Sterilisationsfeld sprang an, und die Gestalt bedachte die Pflegedroiden mit einer Bringt-sie-her-Geste.
»Ich habe keine Ahnung, wer das ist«, meinte Tolk gerade, als Jos genau danach fragen wollte.
Nach Monaten der Arbeit in diesem tropischen Seuchenherd erkannten die OP-Ärzte einander sogar, wenn Gesichter und Köpfe von Chirurgenmasken und Hauben bedeckt waren – was bedeutete, dass dies ein neuer Spieler war. Das warf allerdings folgende Frage auf: Warum hatte niemand ihn, Captain Vondar, den Chefchirurgen, darüber informiert, dass sie einen Neuen im Team hatten?
Eine frische Ader riss auf, aus der fächerförmig Blut spritzte, und schlagartig hatte Jos andere Dinge, die seine Aufmerksamkeit erforderten.
Neun Patienten später erwischte Jos einen einfachen Fall, eine simple punktierte Lunge, die er innerhalb weniger Minuten mit Klebepflaster flicken konnte. Tolk fing an, den Klon zuzumachen, und Jos schaute sich um. Aktuell wartete gerade kein weiterer Patient mehr auf sie. Endlich hatte sich die Lage ein wenig beruhigt. Er sah den Triagedroiden an – heute war es I-Fünf –, und der Droide hielt mehrere Finger hoch, um anzuzeigen, wie viele Minuten es noch dauern würde, bis der nächste Patient für sie vorbereitet wäre.
Jos streifte die sterilen Handschuhe ab und zog ein frisches Paar über, dankbar für die kurze Verschnaufpause.
»Ich könnte hier drüben eine helfende Hand brauchen«, sagte der neue Chirurg. »Falls Sie nichts Dringenderes vorhaben.«
Die Stimme war tief und klang älter, als er es in diesem Operationssaal zu hören gewohnt war, in dem die meisten der Chirurgen und Ärzte in einem Alter waren, das menschlichen zwanzig oder fünfundzwanzig Standardjahren entsprach. Jos ging an drei Tischen vorüber und drängte sich an Leemoth vorbei, der an einem Quara-Aqualishaner arbeitete, der von den Separatisten übergelaufen war. Er sah sich die Operation an, die der neue Chirurg gerade an einem Klonsoldaten durchführte.
»Herz-Lungen-Transplantation?«, fragte er.
»Ja. Hat einen Schallimpuls abgekriegt, der den Herzmuskel und die Alveolen förmlich weggeblasen hat.«
Jos musterte die neuen Organe, frisch von den Klonbanken. Die sich selbst auflösenden Klammern, die die Arterien und Venen zusammenhielten, waren x-förmig – so was hatte er seit dem Medizinstudium nicht mehr gesehen. Dieser Kerl war alt – mittlerweile mussten sie die Ärzte vom Boden des Wiederverwerters kratzen. Zuerst ein Junge, jetzt irgendjemandes Großvater, dachte er. Was kommt als Nächstes – Medizinstudenten?
»Wollen Sie diese Nervenanastomosen distal machen?«
»Sicher.« Jos streifte sich neue Handschuhe über, nahm das Adaptopressionsinstrument, das ihm die Schwester hinhielt, und begann mit der Mikronaht.
»Danke. Ohleyz Sumteh Kersos Vingdah, Doktor.«
Jos wäre nicht überraschter gewesen, wenn der Mann ihm ins Gesicht geschlagen hätte. Das war eine Clan-Begrüßung! Dieser Mann stammte von Corellia, seinem Heimatplaneten, und darüber hinaus behauptete er, mütterlicherseits mit ihm verwandt zu sein. Erstaunlich!
»Hast du deine guten Manieren verloren, Söhnchen?«
»Äh, tut mir leid. Sumteh Vondar Ohleyz«, erwiderte Jos. »Ich bin, ähm, Jos Vondar.«
»Ich weiß, wer du bist, Söhnchen. Ich bin Erel Kersos. Admiral Kersos – und dein neuer Kommandant.«
Und da war der nächste Schlag ins Gesicht. Erel Kerson war der Onkel seiner Mutter. Sie waren sich noch nie zuvor begegnet, aber natürlich wusste Jos über ihn Bescheid. Er hatte seinen Heimatplaneten als junger Mann verlassen und war nie dorthin zurückgekehrt … weil er …
Jos versuchte, sich seine Überraschung nicht anmerken zu lassen. Das war unglaublich. Wie standen die Chancen, bei all den Flehrs auf all den Planeten in der ganzen Galaxis ausgerechnet hier auf Großonkel Erel zu stoßen?
»Vielleicht haben wir später noch Gelegenheit, uns zu unterhalten – wenn du das für angebracht hältst«, sagte Kersos.
»Äh, ja. Genau. Das würde ich gern, Sir.«
Erstaunlicherweise zitterten seine Hände nicht, als er die Naht zu Ende brachte. Sein Großonkel, vor sechzig Jahren vom Clan verstoßen, hier auf Drongar und noch dazu der Chef des Ganzen.
Wie standen die Chancen für so was?
Kaird von den Nediji sah zu, wie die Jedi-Heilerin den verletzten Truppler versorgte. Der geklonte Soldat war gerade aus dem OP zur Nachsorge gebracht worden, und die Male der Lasernaht hoben sich von seiner bronzefarbenen Haut ab. Die Heilerin hatte ihm die Hände aufgelegt, zweifellos, um etwas mit der Macht zu tun. Kaird wusste wenig über solche Dinge und scherte sich auch nicht darum. Er hegte keinen Zweifel, dass die Macht existierte, doch da Jedi ihm für gewöhnlich keine Sorgen bereiteten, galt das ebenso für ihre mysteriöse Kraftquelle. Als Agent der Schwarzen Sonne lag sein Hauptaugenmerk auf praktischeren Angelegenheiten.
Dennoch war es interessant, sie bei der Arbeit zu beobachten. Er befand sich zudem in einer Position, die es ihm erlaubte, sie ziemlich gut im Auge zu behalten, da er in der OP-Nachsorgekammer nah genug bei ihr stand, um sie berühren zu können – sozusagen direkt vor ihrer Nase verborgen.
Normalerweise wäre Kaird in so ziemlich jeder Gruppe vernunftbegabter Lebewesen aufgefallen, da die Angehörigen seiner Spezies in der Galaxis vergleichsweise unbekannt waren. Nedij war eine der abgelegensten Welten und noch dazu ausgesprochen insular. Bloß jene, die der Gemeinschaft des Nests abgeschworen hatten, wagten es, die Raumstraßen zu bereisen. Sein scharf geschnittenes Gesicht, der kurze, dicke Schnabel, die lila Augen und die mit hellazurblauem Flaum bedeckte Haut hätten definitiv die Blicke auf sich gezogen, wenn er seine übliche Kleidung getragen hätte. Jetzt jedoch war er praktisch unsichtbar, da er für diesen Auftrag die perfekte Tarnung für eine medizinische Einrichtung gewählt hatte.
Die als die Schweigsamen bekannte Geschwisterschaft war in der ganzen Galaxis allgegenwärtig. Sie sprachen niemals, für gewöhnlich blieben Gesichtszüge und Körper unter wallenden, alles verschleiernden Roben verborgen, und die meiste Zeit über taten sie nichts anderes, als dazustehen und anwesend zu sein. Die Schweigsamen glaubten, dass ihre meditative Präsenz in der Nähe von Kranken oder Verletzten irgendwie zur Erholung der betroffenen Patienten beitrug. Das Erstaunliche daran – das, was sich seriöse Wissenschaftler und Ärzte nicht erklären konnten – war, dass die Schweigsamen recht hatten. Statistische Studien belegten ohne Zweifel, dass kranke und verletzte Personen schneller und häufiger wieder gesund wurden, wenn die verschleierten Gestalten zugegen waren, als wenn dem nicht so war. Offenbar hatte das auch nichts mit der Macht zu tun. Die Anhänger des Ordens entstammten allen Spezies und sozialen Schichten und wiesen keine der biologischen Kennzeichen auf, die manchmal auf eine Affinität mit dem mysteriösen Energiefeld hinwiesen. Auch ließ sich das Phänomen nicht zur Gänze mit dem Placebo-Effekt abtun, da Patienten, die noch nie von dem Orden gehört hatten, im selben Maße davon profitierten. Das war ein wahrhaft unerklärliches Wunder.
Kaird hatte keine Ahnung, wie so etwas sein konnte, und es kümmerte ihn auch nicht sonderlich, selbst wenn er sich zuweilen fragte, ob seine Gegenwart dieselbe palliative Wirkung hatte, dass die Gedanken, die ihm normalerweise durch den Kopf gingen, ungefähr so weit vom Gleichmut eines Schweigsamen entfernt waren wie Drongar vom Galaktischen Kern. Egal. Er gab vor, ein Mitglied der Geschwisterschaft zu sein, weil er so auf eine Art und Weise mit dem Hintergrund verschmelzen konnte, wie es ihm mit keinem anderen Posten in dieser mobilen Feldlazaretteinheit der Republik – kurz »Flehr« genannt – möglich gewesen wäre. Bevor er hierhergekommen war, hatte er ein Kräutergebräu von seinem Heimatplaneten zu sich genommen, das seinen Geruch vor den Sinnen der meisten Spezies verbarg. Zusammen mit der Robe blieb seine Anonymität so gewahrt – absolut notwendig für einen Abgesandten der Schwarzen Sonne, dessen Angelegenheiten hier nicht das Geringste mit dem Krieg oder der Behandlung jener zu tun hatten, die im Zuge dessen verletzt wurden.
Kaird war schlicht und einfach wegen des Bota hier. Die seltene Pflanze war eine bedeutende Ergänzung zum Instrumentarium eines jeden Mediziners. Das Bota konnte als Antibiotikum dienen, als Narkotikum, als Schlafmittel – tatsächlich als alles Mögliche, je nachdem, bei welcher Spezies es eingesetzt wurde. Für einen Abyssiner war Bota ein effektiveres Heilmittel als Cambylictusblätter oder Bacta-Flüssigkeit, ein wirkungsvolleres Psychopharmakon als santherianische Tenhowurzel, wenn man ein Falleen war, und ein anabolisches Steroid, das Whiphiden dabei helfen konnte, ihre persönlichen Bestmarken noch zu steigern. Die Schwarze Sonne konnte ein Vermögen damit verdienen, indem sie so viel Bota unters Volk brachten, wie sie in die Finger bekommen konnten – Bota war eine Ware mit wahrhaft universellem Reiz.
Ironischerweise war die Verwendung der Wunderpflanze in den Flehrs hier auf Drongar verboten. Offiziell wurde behauptet, das diene dazu, den Schwarzmarkthandel einzudämmen, doch im Allgemeinen hatte man den Eindruck, dass der wahre Grund dafür ein wirtschaftlicher war: Je weiter man sich von Drongar entfernte, desto kostbarer wurde das Bota. Warum sollte man es da direkt an der Quelle für Klonkrieger vergeuden? Immerhin war es ja nicht so, als würden die ihnen irgendwann in nächster Zeit ausgehen …
Einige der hier stationierten Ärzte hatten Gesuche eingereicht, das Verbot aufzuheben. Kaird hatte gar gehört, dass ein paar die Vorschrift einfach ignorierten und Mittel und Wege fanden, ihre Patienten trotzdem damit zu behandeln. Als Individuum und als Krieger applaudierte er ihrer Courage und Hingabe. Als Angehöriger der Schwarzen Sonne allerdings musste er möglicherweise etwas dagegen unternehmen, falls und wenn die Verordnung geändert wurde.
Bis vor Kurzem war es dem Verbrecherkartell möglich gewesen, von zwei Schwarzmarkthändlern unter den hiesigen republikanischen Streitkräften ausreichende Mengen von in Karbonit eingefrorenem Bota zu beziehen, was die einzige Möglichkeit war, das anfällige Gewächs zu schmuggeln, ohne dass es entdeckt wurde oder Schaden nahm. Leider weilten diese beiden Lieferanten nicht mehr länger unter den Lebenden – einer schien den anderen aus dem Verkehr gezogen zu haben, und Kaird selbst hatte den Überlebenden getötet. Aus diesem Grunde brauchte die Schwarze Sonne vor Ort einen neuen Kontakt, und bis er einen aufgetan hatte, würde er hierbleiben – das hatten die Vigos verfügt.
Die Schwarze Sonne hatte einen Kontakt auf dem Planeten – tatsächlich sogar in eben dieser Flehr –, doch bedauerlicherweise konnte dieser Kontakt, der ein Doppelagent war und ebenfalls für Count Dookus Separatisten arbeitete, diese Operation nicht durchführen. Der Spion wollte nicht riskieren, dass man ihm auf die Schliche kam, indem er als Vermittler tätig wurde, und Kaird hatte Verständnis dafür. Darüber hinaus war Linses aktuelle Aufgabe, der Verbrecherorganisation Informationen über beide Seiten zukommen zu lassen, für sie viel zu wichtig.
Er fühlte sich unbehaglich und spürte, wie ihm das Gewand an der Haut klebte. Die Luftkühler auf der Basis funktionierten bloß sporadisch, und die osmotischen Felder hielten zwar einiges von der Hitze und Luftfeuchtigkeit ab, aber beileibe nicht alles. Drongars übelriechende Umwelt war vollkommen anders als die saubere, dünne Luft, in der sich die vogelartigen Nediji entwickelt hatten. Ihre Schwingen waren schon lange vergessen und ihr weiches, federgleiches Haar bloß noch ein blasser Schatten des Gefieders, das ihre entfernten Vorfahren besaßen, doch die Nediji zogen die kühlen Höhen, die von dichtem Schnee umwehten Bergklippen den Tiefebenen trotzdem immer noch vor.
Ah, hätte er jetzt doch dort sein können …
Kaird lächelte bei sich, die Miene hinter dem Schleier verborgen. Ebenso gut hätte er sich einen Hort voller Frauen und einen Berghang voller Huschratten wünschen können, der traditionellen Beute der Nediji, wo er schon mal dabei war. Vielleicht auch ein bisschen altehrwürdigen Thwillwein, um die hedonistische Träumerei komplett zu machen.
Das Lächeln wurde zu einem Stirnrunzeln, als er sah, wie Padawan Offee ihre Handflächen langsam über die bloße Brust des Klons bewegte. Er fragte sich, ob diese Jedi womöglich Ärger bedeutete. Ihre Anwesenheit auf dieser Welt kam ihm sehr seltsam vor. Gewiss, sie war eine Heilerin, doch die Jedi waren in diesen Tagen überaus dünn gesät. Es schien wie Verschwendung, eine hierherzuschicken, selbst wenn es sich dabei um einen noch nicht voll ausgebildeten Padawan handelte. Als Agent der Schwarzen Sonne hegte Kaird einen Argwohn gegen alles und jeden, das oder den er sich nicht sofort erklären konnte. Seiner Meinung nach gab es alte Einsatzkräfte und es gab achtlose Einsatzkräfte, aber keine alten und achtlosen Einsatzkräfte. Durch ständige Wachsamkeit blieb man am Leben, dadurch, dass man einem potenziellen Gegner stets einen Schritt voraus war.
Diese Frau stellte für ihn keine direkte Gefahr dar, auch wenn die Verbindung zur Macht ihr beträchtliche Fähigkeiten verlieh, mit denen es ihr möglich war, den Geist anderer zu sondieren. Allerdings lagen seine Gedankenschildtechniken weit über dem Durchschnitt – er hatte die beste Ausbildung genossen, die sein Vigo sich leisten konnte. Ein einfacher Padawan, selbst eine Heilerin, würde nichts von ihm wahrnehmen, von dem er nicht wollte, dass sie es wahrnahm. Dennoch war das Ganze beunruhigend. Wen auch immer er am Ende als Versorgungsagenten einsetzte, er würde imstande sein müssen zu vermeiden, sich ihr gegenüber durch einen fehlgeleiteten Gedanken oder ein falsches Gefühl zu verraten. Es hatte keinen Sinn, wenn die Jedi dem neuen Agenten auf die Schliche kam – dann würde die Schwarze Sonne noch mal ganz von vorn anfangen müssen, und das wäre … ärgerlich.
Vielleicht konnte er sie umbringen. Er verwendete einige Gedanken darauf. Das würde nicht sonderlich schwierig sein, und damit wäre die unmittelbare Sorge aus der Welt geschafft. Möglicherweise …?
Nein. In der Galaxis waren bloß wenige Dinge gewiss, doch eins davon war: Wenn man irgendwo, egal wo, einen Jedi tötete, kamen immer andere Jedi, um der Sache auf den Grund zu gehen. Er konnte diesen Padawan mit Leichtigkeit ausschalten, aber als Nächstes bekam er es vielleicht mit einem Jedi-Ritter oder sogar einem Meister zu tun, und mit denen fertigzuwerden, bereitete schon mehr Probleme. Besser, man arrangierte sich mit dem d’javl, den man kannte, als mit dem d’javl, den man nicht kannte, wie das alte Sprichwort besagte.
Die Padawanschülerin beendete ihr Heilritual. Die Augenlider des Soldaten öffneten sich flackernd. Durch den Schleier konnte Kaird sehen, dass sich die Brust des Mannes sanft und regelmäßig hob und senkte und sich seine Augen unter den Lidern in heilsamem, traumerfülltem Schlaf bewegten. Was auch immer sie getan hatte, es hatte gewirkt.
Als sie an ihm vorbeiging, nickte sie ihm zu – eine Geste des Respekts und der Dankbarkeit von einem Heiler zum anderen. Kaird erwiderte das Nicken und sorgte dafür, dass seine Gedanken nichtssagend blieben, bis er zu dem Schluss gelangte, dass sie das Gebäude verlassen hatte. Dann lächelte er.
Er entschied, dass es für ihn fürs Erste am meisten Sinn machte, seine Energie darauf zu konzentrieren, für die Schwarze Sonne einen neuen Partner zu finden und für ihre Sache zu rekrutieren. Dann, sobald der Bota-Strom erneut floss, konnte er sich um alle anderen Probleme kümmern, die womöglich auftauchten. Denn wenn die Schwarze Sonne eines war, dann anpassungsfähig.
4. Kapitel
Ein Spion im feindlichen Lager zu sein, war nicht einfach. Nichts an dieser Feststellung war sonderlich originell oder überraschend – diese Eigenschaften barg die Wahrheit nur selten in sich. Doch das machte die Sache nicht im Geringsten weniger schwierig. Wenn man verdeckt in einer gegnerischen Militärbasis arbeitete, musste man mehr Augen als ein Gran haben und so wachsam wie ein H’nemthe-Mann sein. Man musste sich stets der Tatsache bewusst sein, dass ein Spion ein Außenseiter war, ein Eindringling. Man durfte seine Deckung nie sinken lassen, nicht einmal für eine Sekunde.
Nicht, dass irgendjemand Grund hatte, den Spion zu verdächtigen – umso weniger jetzt, wo sich gezeigt hatte, dass der Hutt und der ehemalige Admiral nicht das gewesen waren, was sie zu sein vorgaben, ganz zu schweigen vom Tod der beiden. Aber das hier war Krieg, und im Krieg wurden Spione kurzerhand exekutiert, wenn man sie erwischte. Und sie wurden erwischt – viele von ihnen –, an Orten, an denen so etwas weit weniger wahrscheinlich war, als bei einer Flehr auf irgendeinem einsamen, abgelegenen Planeten am hinteren Ende der Galaxis.
Noch weiter verkompliziert wurde die Sache durch den Umstand, dass es Todesfälle gegeben hatte. Todesfälle, für die der Spion, der unter zwei Decknamen zwei Meistern diente – als Säule Count Dookus Separatistenstreitkräften und als Linse der Schwarzen Sonne –, zumindest teilweise verantwortlich gewesen war. Spielte es für die Toten eine Rolle, ob derjenige, der dafür verantwortlich war, als Säule oder Linse bekannt war? Nein. Spielte es für eine der beiden Geheimidentitäten eine Rolle, wenn die andere aufflog und hingerichtet wurde? Das war ein klägliches Lächeln wert.
Säule – der erste Spitzname war der, mit dem sich der Spion am ehesten zu identifizieren pflegte, da die Separatisten ihn vor der Schwarzen Sonne rekrutiert hatten – mochte viele dieser Leute. Der kürzliche Tod von einem der Ärzte war überraschend schmerzvoll gewesen, auch wenn er nicht die Folge einer verdeckten Operation gewesen war. Säule hatte schon häufig über die Gefahren nachgegrübelt, die es mit sich brachte, untergetaucht inmitten des Feindes zu leben. Selbst, wenn man lange genug unter einer Meute von Mördern weilte, konnte man gewisse Bande zu einigen von ihnen aufbauen. Und keiner von den Ärzten, Schwestern und dem Pflegepersonal hier war ein Mörder – sie waren allesamt Heiler, und wenn ein Feind fiel und zu ihnen gebracht wurde, versorgten sie den Verwundeten mit demselben Geschick und derselben Hingabe wie einen ihrer eigenen Leute. Es war ihre Pflicht, Leben zu retten, nicht, über sie zu urteilen.
Auch das machte es schwer, wenn der Spion ihnen – ob nun als Säule oder als Linse – Schaden zufügen musste, wie es manchmal nötig geworden war. Es stimmte, dass das langerwartete Ende rechtschaffenen Beweggründen entsprang – die selbst nach Jahrzehnten noch schmerzten –, doch zuweilen schien das Ziel unmöglich weit entfernt, verborgen in einem Nebel, der so dicht war wie die Dämpfe, die aus den endlosen Sümpfen herüberwehten, und die Kleinigkeiten des alltäglichen Lebens – ebenso wie Freundschaften, Ängste, Bündnisse – neigten dazu, einem in die Quere zu kommen.
Säule seufzte. Man konnte keine Holzhäuser bauen, ohne Bäume zu fällen, aber das machte es kein bisschen angenehmer, wenn eine riesige Blauwaldtanne auf jene stürzte, die man als Freunde und Kollegen betrachtete. Doch daran führte kein Weg vorbei – so schmerzvoll es auch manchmal sein mochte, das gehörte zur Pflicht, und es musste getan werden. Was das anging, gab es keine andere Möglichkeit. Keine.
Säule stand vor dem Fenster der Wohneinheit und blickte auf die Basis hinaus. Flehr Sieben war mittlerweile größtenteils wieder aufgebaut worden. Der »Umzug« von den Tiefebenen ins Hochland war mit relativ wenigen Problemen vonstattengegangen. Das Verwaltungszentrum, die Versorgungsgebäude und – am allerwichtigsten – die medizinischen und chirurgischen Bauten waren von den Konstruktionsdroiden in weniger als zwei der lokalen Tageszyklen errichtet worden, wobei ein drongarianischer Tag bloß etwas mehr als dreiundzwanzig Standardstunden lang war. Die Cantina und der Speisesaal standen am dritten Tag vor Einbruch der Nacht. Zumindest oberflächlich schienen die Dinge wieder normal zu laufen.
Doch das hatte seinen Preis gehabt.
Die Umstationierung, die unter schwerem Beschuss durch die Separatisten erfolgt war, hatte den Verlust von drei Patienten gekostet – alle aufgrund von Traumata, die durch den Standortwechsel ausgelöst wurden –, fünfzehn Leute waren verletzt worden, und ein Arzt hatte den Tod gefunden: Zan Yant.
Das war eine gewaltige Schande. Yant war nicht bloß ein ausgezeichneter Mediziner gewesen, sondern auch ein hervorragender Musiker, der zuweilen die gesamte Basis mit der Magie seiner Quetarra in den Bann gezogen hatte. Er konnte dieses Instrument wahrhaftig zum Singen bringen, ihm Melodien entlocken, die so ergreifend schön waren, dass sie imstande zu sein schienen, sterbende Soldaten von der Schwelle der Ewigkeit ins Leben zurückzurufen.
Doch es gab keine Kompositionen, keine Fugen, keine Rhapsodien, die Zan Yant zurückrufen konnten.
Säule wandte sich vom Fenster ab und dem Tisch zu, der den Großteil einer Wand einnahm. Die Separatisten warteten darauf, die jüngsten Neuigkeiten zu erfahren, und es war nötig, eine der komplexen verschlüsselten Nachrichten zu verfassen und sie an Dookus Streitkräfte zu schicken. Der Prozess war schwerfällig und kompliziert: Sobald man die Botschaft mithilfe des sperrigen Codes verschlüsselt hatte, verlangte das Sicherheitsprotokoll, sie mittels Sublichtwellen durch eine Hyperraum-Wurmloch-Verbindung zu übermitteln, anstatt mit dem üblichen Subraum-Trägerimpuls. Alles in allem eine recht ausschweifende und langweilige, aber notwendige Angelegenheit – gelang es einem nicht, solche Nachrichten fristgerecht zu entschlüsseln, konnte sich das als fatal erweisen. Die Warnung vor dem Angriff, bei dem Dr. Yant umgekommen war, war in einer dieser Botschaften enthalten gewesen, und hätte Säule sie schneller dechiffriert, wäre Yants Leben möglicherweise noch für eine kleine Weile länger verschont geblieben. Das war eine Lektion, die einem im Gedächtnis blieb. Wie mühselig und zeitraubend der Prozess auch immer sein mochte, Säule brauchte Dookus Ressourcen und seine Unterstützung, um die Republik zu bezwingen, und dafür mussten gewisse Opfer gebracht werden.
Da war es am besten, sich damit abzufinden. Denn auch in Zukunft würde die Sache nicht einfacher werden …
Eines musste Den Klo Merit lassen – der Equani-Therapeut hatte vor Überraschung nicht einmal mit einem Schnurrhaar gezuckt, als der Reporter anstelle von Jos Vondar aufgetaucht war. Tatsächlich kam der Ratgeber von ihnen beiden mit der Situation wesentlich besser zurecht als Den, da dies das erste Mal war, dass er auch nur einen Fuß ins Büro eines Mentalheilers gesetzt hatte.
Das sei ein kurzfristiger Entschluss gewesen, erklärte er Merit nervös. Eigentlich hatte er nicht das Gefühl gehabt, als müsse er sich seiner Sorgen entledigen, weder, um sie auf die breiten Schultern des Equani zu laden, noch auf die von irgendjemand anderem – zumindest nicht, bis die hochprozentigen Bantha-Blaster seine Frontallappen genug gelockert hatten, um ihn zum Reden zu bringen. Den war der festen Überzeugung, dass Barkeeper im Grunde die besten Therapeuten seien, und das sagte er Merit auch.
Merit nickte und sagte: »Manchmal sind sie das. Ob Sie’s glauben oder nicht, einige meiner besten Sitzungen – kurz entschlossen, aber nichtsdestotrotz erinnerungswürdig – haben unter ähnlichen Umständen stattgefunden. Und übrigens, für gewöhnlich sehe ich es nicht so gern, wenn Patienten einfach miteinander tauschen, besonders nicht in letzter Minute. Aber diesmal drücke ich da wohlwollend ein Auge zu.« Er beugte sich vor. »Also, was führt Den Dhur in mein innerstes Heiligtum?«
Den kaute auf seiner bauchigen Unterlippe. Verflucht, das hier war um einiges schwieriger, als er es sich ausgemalt hatte. Er hätte nicht gedacht, dass ihm derart unbehaglich zumute sein würde, einfach nur zu reden …
»Jos hat gesagt, ich solle mir seine Zeit nehmen«, sagte er schließlich. »Im Augenblick steckt er bis zu den Haarspitzen in verwundeten Soldaten.«
Zuerst ging Merit nicht darauf ein. Dann lehnte er sich zurück und sagte: »Und …?«
Den war bereits klargeworden, dass das hier nicht den geringsten Spaß machen würde. »Äh, nun … Er meinte, ich hätte das hier nötiger als er.«
Merit schaute gelinde überrascht. »Hat er das? Nun, es verstieße gegen die Grundsätze meines Berufsstandes, irgendetwas über die privaten Sitzungen eines anderen Patienten preiszugeben, aber ich darf wohl sagen, dass es sich hierbei um eine überraschende Aussage handelt, wenn sie von jemandem wie Doktor Vondar kommt.«
»Ich weiß«, sagte Den, erleichtert, über Jos reden zu können, anstatt über sich selbst, und wenn auch nur für einen Moment. »Der Tod von Dr. Yant hat ihn wirklich schwer getroffen. Ich meine, im OP hat er die ganze Zeit mit dem Tod zu tun, aber das ist etwas anderes – Zan war sein Freund, und sein Tod war sinnlos. So sinnlos … Aber welcher Tod in einem Krieg ist das nicht?«
Merit nickte. Den wurde bewusst, dass er sich bereits viel entspannter fühlte – vielleicht hatte das etwas mit den empathischen Fähigkeiten des Equani zu tun. Was auch immer der Grund dafür sein mochte, es machte es sehr einfach, mit dem Mentalheiler zu reden. Unterm Strich zog Den Alkohol allerdings immer noch vor.
»Und wie hat sein Tod Sie getroffen?«, fragte Merit.
»Schwer«, gab Den zu. »Aber nicht so schwer wie Jos. Ich glaube nicht, dass er irgendjemanden so schwer getroffen hat wie Jos. Ich meine, ich kannte Zan ja eigentlich gar nicht sonderlich gut … Er war bei den Sabacc-Partien dabei, und er hat anständig Quetarra gespielt, aber …«
Merit lehnte sich im Sessel zurück. »Aber Sie wollen nicht über seinen Tod sprechen, richtig?«
Den starrte den Mentalheiler überrascht an. »Oh, Sie sind gut«, entgegnete er. »Sie sind sehr gut.«