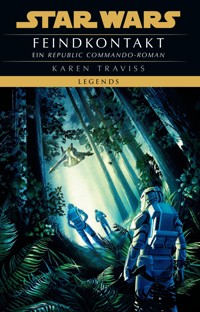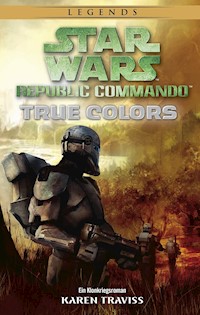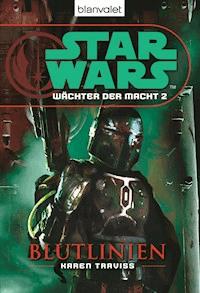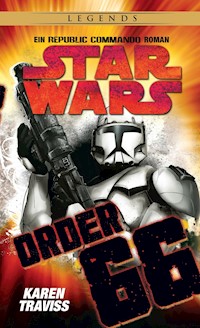
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panini
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Star Wars
- Sprache: Deutsch
Die Elite der Klonkrieger im Undercover-Einsatz! Als die Klonkriege weiter durch die Galaxie toben, müssen die effektivsten Krieger der Republik plötzlich feststellen, dass die Separatisten nicht ihr einziger Feind sind - und bei Weitem nicht der schlimmste. Basierend auf dem Videogame-Hit von Electronic Arts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 819
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AUSSERDEM BEI PANINI ERHÄLTLICH
Star Wars: Leia, Prinzessin von Alderaan
Claudia Gray – ISBN 978-3-8332-3569-6
Star Wars: Blutlinie
Claudia Gray – ISBN 978-3-8332-3354-8
Star Wars: Ahsoka
E.K. Johnston – ISBN 978-3-8332-3450-7
Star Wars BATTLEFRONT: Twilight-Kompanie
Alexander Freed – ISBN 978-3-8332-3259-6
Star Wars BATTLEFRONT II: Inferno-Kommando
Christie Golden – ISBN 978-3-8332-3568-9
Star Wars: REPUBLIC COMMANDO Band 1 – Feindkontakt
Karen Traviss – ISBN 978-3-8332-3627-3
Star Wars: REPUBLIC COMMANDO Band 2 – Triple Zero
Karen Traviss – ISBN 978-3-8332-3628-0
Star Wars: REPUBLIC COMMANDO Band 3 – True Colors
Karen Traviss – ISBN 978-3-8332-3647-1
Star Wars: REPUBLIC COMMANDO Band 4 – Order 66
Karen Traviss – ISBN 978-3-8332-3648-8
Star Wars: THE OLD REPUBLIC – Eine unheilvolle Allianz
Sean Williams – ISBN 978-3-8332-2036-4
Star Wars: THE OLD REPUBLIC – Betrogen
Paul S. Kemp – ISBN 978-3-8332-2249-8
Star Wars: THE OLD REPUBLIC – Revan
Drew Karpyshyn – ISBN 978-3-8332-2373-0
Star Wars: THE OLD REPUBLIC – Vernichtung
Drew Karpyshyn – ISBN 978-3-8332-2608-3
Star Wars: CORUSCANT NIGHTS Band 1 – Im Zwielicht
Michael Reaves – ISBN 978-3-8332-2906-0
Star Wars: CORUSCANT NIGHTS Band 2 – Straße der Schatten
Michael Reaves – ISBN 978-3-8332-2983-1
Star Wars: CORUSCANT NIGHTS Band 3 – Schablonen der Macht
Michael Reaves – ISBN 978-3-8332-2984-8
Star Wars: Shadow Games – Im Schatten
Michael Reaves – ISBN 978-3-8332-3158-2
Nähere Infos und weitere Bände unter:
www.paninibooks.de
Ein Klonkriegsroman
Karen Traviss
Aus dem Amerikanischen von Jan Dinter
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Titel der Amerikanischen Originalausgabe: „Star Wars: Republic Commando: Order 66“ by Karen Traviss, A Del Rey ® Book, published by The Random House Publishing Group.
© & TM 2018 LUCASFILM LTD.
Deutsche Ausgabe 2018 by Panini Verlags GmbH, Rotebühlstraße 87,
70178 Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten.
Geschäftsführer: Hermann Paul
Head of Editorial: Jo Löffler
Head of Marketing: Holger Wiest (E-Mail: [email protected])
Presse & PR: Steffen Volkmer
Übersetzung: Jan Dinter
Lektorat: Carmen Jonas, Dr. Sabine Jansen
Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart
Satz und E-Book: Greiner & Reichel, Köln
YDSWRR008E
ISBN 978-3-7367-9966-0
1. Auflage, November 2018, ISBN 978-3-8332-3648-8
Gedruckte Ausgabe:
1. Auflage, November 2018, ISBN 978-3-8332-3648-8
Findet uns im Netz:
www.paninibooks.de
PaniniComicsDE
Dem britischen Soldaten – mit Stolz und Dankbarkeit
HANDELNDE PERSONEN
Republic Commandos:
Omega Squad:
RC-1309 NINER
RC-1136 DARMAN
RC-5108/8843 CORR
RC-3222 ATIN
Delta Squad:
RC-1138 BOSS
RC-1262 SCORCH
RC-1140 FIXER
RC-1207 SEV
FI SKIRATA, ehemaliger Republic Commando
BARDAN JUSIK, ehemaliger Jedi-Ritter, jetzt Mandalorianer
Sergeant KAL SKIRATA, mandalorianischer Söldner
WALON VAU, mandalorianischer Söldner
Captain JALLER OBRIM, Coruscant Sicherheitskräfte
General ETAIN TUR-MUKAN, Jedi-Ritterin
General ARLIGAN ZEY, Jedi-Meister
JILKA ZAN ZENTIS, Steuervollzugsbeamtin der Republik
LASEEMA, Kellnerin (weibliche Twi’lek)
Null ARC-Trooper:
N-7 MEREEL
N-10 JAING
N-11 ORDO
N-12 A’DEN
N-5 PRUDII
N-6 KOM’RK
ARC-Trooper Captain A-26, MAZE
ARC-Trooper A-30, SULL
ARC-Trooper A-02, SPAR
Agentin BESANY WENNEN, Schatzamtsermittlerin der Republik
Dr. OVOLOT QAIL UTHAN, separatistische Genetikexpertin
NYREEN „NY“ VOLLEN, Handelspilotin
PROLOG
Curbaq Plaza, Galactic City, Coruscant, 600 Tage nach der Schlacht von Geonosis
Das bin also ich.
So habe ich also einmal ausgesehen. Wir alle sollten uns ein Mal aus der Sicht eines anderen sehen. Wenigstens ein einziges Mal im Leben.
Ein Jedi kommt auf mich zu, braune Robe, pure Frömmigkeit. Kein Zopf. Das heißt, trotz seiner Jugend ist er kein Padawan mehr. Er wird Truppen kommandieren. Auf jeden Fall wird er im aktiven Dienst auf eigenen Füßen stehen müssen. Der Krieg macht uns vor unserer Zeit zu Veteranen.
Ich möchte ihn bei seinen Schultern packen und ihn fragen, ob er meint, dies sei ein gerechter Krieg, ein Krieg der ehrenvoll ausgetragen wird? Aber er würde in Panik geraten, wenn ihn ein Mandalorianer in voller Rüstung anhaut – besonders einer, von dem er spürt, dass er ein Machtnutzer ist wie er selbst. Niemand schenkt mir sonderliche Beachtung. Mandalorianer sind auf Coruscant einfach nur Fremdstämmige, Kopfgeldjäger, ein weiterer Haufen wirtschaftlicher Migranten unter den Tausenden von Spezies, die in die Hauptstadt der Galaxis strömen.
Ah, der Jedi sieht sich in der Menge um. Er kann mich spüren.
Ich gehe in der Masse aus Einkäufern und Touristen unter. Sehr seltsam – geradezu obszön – zu sehen, wie jedermann auf Coruscant seinen Geschäften nachgeht, als würden wir uns nicht im zweiten Jahr eines hässlichen Krieges befinden. Aus der Sicht von jedermann tun wir das natürlich auch nicht. Es ist in jeglicher Hinsicht der Krieg der anderen – ausgetragen auf anderen Planeten, gekämpft von anderen Wesen, gefochten von Männern, die nicht zu den Bürgern Coruscants gehören. Klontruppen sind niemandes Bürger. Sie haben keine Rechtsansprüche. Sie sind Objekte. Gegenstände. Militärische Aktivposten.
Niemand sollte zurückstehen und so etwas zulassen, am allerwenigsten die Jedi.
Ich bin jetzt nur noch wenige Meter von dem Jedi entfernt. Er ist so ernst, so verpflichtet. Ja, das war ich. Ist nur ein paar Monate her.
Eine Passantin blickt in seine Richtung, und ich kann ihr Unbehagen spüren. Als ich noch in meiner Robe durch die Stadt gegangen bin, dachte ich, andere würden in mir jemanden sehen, der ihnen hilft. Inzwischen weiß ich es besser: Wahrscheinlich sahen sie jemanden, dem sie nicht trauen konnten, mit Kräften, die sie nicht verstanden, jemanden, den sie nicht gewählt hatten und der dennoch hinter den Kulissen ihr Leben mitgestaltete.
Hätten sie gewusst, wie sehr ich zu alldem ihre Gedanken beeinflussen könnte, wären sie vor mir geflohen.
Der Jedi geht dicht an mir vorbei, aber ich erkenne ihn immer noch nicht. Er starrt in den T-Schlitz meines Helms, als hätte ich ihn gepackt. Im Weitergehen kann ich seine Verwirrung fühlen – nein, nicht bloß Verwirrung: Furcht. Ein machtnutzender Mandalorianer muss auf der Liste seiner schlimmsten Albträume stehen.
Es gab mal eine Zeit, da ging es mir ebenso. Schon komisch.
Dann spüre ich, wie er sich umdreht. Ich fühle die Fragen in ihm brennen, als er sich seinen Weg durch die Menge zu mir zurückbahnt. Bevor er den Arm ausstreckt, um mir auf die Schulter zu tippen – und allein schon für den Versuch muss ich ihm Respekt zollen –, drehe ich mich zu ihm um.
Er zuckt zusammen. Was er sieht, passt nicht zu dem, was er fühlt. „Was seid Ihr?“
„Jemand, der einen Schlussstrich gezogen hat“, erwidere ich. „Wie steht’s mit dir?“
„Ihr seid General Bardan Jusik …“
Ist das so offensichtlich? Für einen Jedi sicher. Ich war einmal Bardan Jusik. Jeder im Jedi-Orden weiß, dass ich bodenständig geworden bin. Es ist die einzige Reaktion, die ich kenne; die völlige Unterwerfung unter eine Lebensart – erst die der Jedi, jetzt die Mandalorianische – mit jeder Faser meines Wesens. Meine Jedi-Meister haben mir nicht beigebracht, halbe Sachen zu machen.
„Nicht mehr“, antworte ich schließlich.
„Ihr habt uns mitten in einem Krieg im Stich gelassen – einem Krieg, den wir kämpfen müssen.“ Er ist verwirrt, empört – verängstigt. „Wie konntet Ihr uns nur so hintergehen?“
Ich frage mich, wen er mit uns meint: Jedi oder Klone?
„Ich bin gegangen, weil er falsch ist.“ Ich sollte ihm das nicht erklären müssen. „Weil ihr eine Sklavenarmee benutzt, um ihn zu führen. Weil es keinen Sinn macht, eine Art Übel zu bekämpfen, wenn man es nur durch die eigene Marke ersetzt.“ Komm zum Punkt. Werde persönlich. Gib ihm keine Gelegenheit, sein eigenes Gewissen außer Acht zu lassen. „Du persönlich. Du triffst diese Entscheidung jeden Morgen. Ein Glaube, den man beiseiteschiebt, wenn es einem passt, ist kein Glaube. Er ist eine Lüge.“
Oh, das hat gesessen. Ich fühle, wie sich seine Seele windet.
„Es gefällt mir ebenso wenig wie Euch.“ Er scheint die Blicke der Passanten gar nicht zu bemerken. „Aber wenn Ihr davonlauft, wird das nichts an der Politik des Rates ändern. Oder am Verlauf des Krieges.“
„Es wird Euren Krieg verändern“, entgegne ich. „Aber ich nehme an, Ihr befolgt nur Befehle, richtig?“
Alles, was in der Galaxis geschehen ist – alles, was jemals geschehen wird –, ist ein Gefüge aus unzähligen Verbindungen aus individuellen Entscheidungen: Ja oder nein, töten oder verschonen, überleben oder sterben. Sie gestalten jeden Moment für alle Ewigkeit. Die Entscheidung eines Mannes ist von Bedeutung. Die Entscheidungen eines Wesens, Augenblick für Augenblick, verbunden mit einem Netzwerk aus Milliarden anderer Entscheidungen, das ist es, woraus die Existenz besteht.
„Wir brauchen jeden General, den wir aufbringen können“, erklärt er. Vielleicht denkt der Jedi, er könne an mein Schuldbewusstsein appellieren. „Eine schreckliche Dunkelheit zieht herauf. Ich kann es fühlen.“
Das kann ich auch.
Sie ist vage und unergründlich, aber sie ist da. Lauernd, als würde mich jemand verfolgen. „Dann tut etwas gegen Eure eigene Dunkelheit.“
„Ihr schließt Euch einer Bande von Söldnern an?“ Er sieht meine Rüstung mit offenkundiger Abscheu an. „Gangster. Wilde.“
„Bevor Ihr an Eurer Frömmigkeit erstickt, Jedi, fragt Euch lieber, für wen Ihr kämpft.“
Fierfek, ich habe ihn Jedi genannt. Meine Trennung ist vollendet. Sein Gesichtsausdruck spiegelt stilles Entsetzen, und ich gehe weiter in dem Wissen, dass ich ihn niemals wiedersehen werde. Ich weiß es. Und dieser Krieg wird leidvoll enden. Auch das weiß ich.
Ich habe meine Wahl getroffen. Im Gegensatz zu den Klonsoldaten habe ich eine. Und ich habe beschlossen, die Galaxis sich selbst zu überlassen und jene Männer zu retten, die vom Rest der zivilisierten Welt auf den Status von Tieren reduziert werden. Es ist das Richtige. Es ist das, was ein Jedi tun sollte.
Der Tag der Abrechnung naht. Ja, auch das kann ich fühlen. Was es auch ist, ich kann es nicht aufhalten. Aber ich kann jene schützen, die mir am Herzen liegen.
Entscheidungen. Ich stand vor meiner. Ich habe sie getroffen.
1.
Wer weiß denn schon, ob Jango mehr als einen Sohn hatte, oder gar, wie alt er ist? Komm schon, Spar, es wird Zeit, deinen Teil fürs Manda’yaim zu leisten. Du musst nicht einen Finger rühren. Tu einfach so, als wärst du Fetts Erbe, während wir uns zusammenraufen, damit alle wissen, dass wir noch im Geschäft sind.
– Fenn Shysa in seiner Bitte an den Deserteur Spar – ehemaliger ARC-Trooper A-02 –, sich in der Übergangszeit nach Jango Fetts Tod als dessen Sohn und Erbe auszugeben
Mes Cavoli, Mittlerer Rand, ungefähr fünfzig Jahre vor der Schlacht von Geonosis
„Steh auf! Steh auf und lauf, du kleiner chakaar, oder ich schleif dich mit.“
Falin Mattran konnte ein paar Hundert Meter weiter den Rauch über dem Söldnerlager aufsteigen sehen. Vielleicht waren es auch ein paar Hundert Kilometer. Er konnte nicht aufstehen. Er konnte nicht weiter. Er kniete auf allen vieren und rang nach Luft. Jeder Muskel brannte, aber er verbot sich zu weinen.
Er war sieben Jahre alt. Beinahe. Er meinte, er wäre sechs Jahre und zehn Monate, aber er hatte das Zeitgefühl im Krieg verloren.
„Kann nicht“, keuchte er.
„Kannst wohl.“ Munin Skirata war ein großer Mann in pockennarbiger, grüner Rüstung, mit einem Blaster, der Metallschrot abfeuerte. Er stand über ihm mit ohrenbetäubender Stimme, das Gesicht unsichtbar in einem Helm mit T-förmigem Visor, der Falin das erste Mal, als er ihn sah, erschreckt hatte. „Ich weiß, du kannst. Du hast ganz allein Surcaris überlebt. Und du spazierst hier nicht durch deinen hübschen Kuati-Park, also beweg deinen shebs, du fauler, kleiner nibral.“
Es war nicht fair. Das war das Leben generell nicht. Falins Eltern waren tot, und er hasste die Welt. Er war sich nicht sicher, ob er Munin Skirata hasste, aber wenn er den Mann in diesem Moment hätte töten können, hätte er es getan. Nur die Erschöpfung hielt ihn davon ab. Beinahe hätte er nach dem Messer gegriffen, das er dem Leichnam seines Vaters abgenommen hatte in dem Moment, als er erkannte, dass Papa tot war und nie mehr aufwachen würde. Damals war es ganz gleich gewesen, wie sehr er sich bemühte, ihn wachzurütteln, aber nun konnte er sein Gewicht nicht auf seine Beine und nur einen Arm verlagern, ohne dabei in den Dreck zu sacken.
„Du kannst es, wenn du willst“, brüllte Munin. „Aber du willst nicht, und das macht dich zu einem nibral. Du weißt, was ein nibral ist? Ein Verlierer. Ein Blindgänger. Überflüssig. Steh auf!“
Eines wollte Falin: Zeigen, dass er nicht faul oder dumm war. Sein Vater hatte ihn niemals als dumm bezeichnet. Auch seine Mutter nicht. Sie hatten ihn geliebt und ihm das Gefühl von Geborgenheit gegeben und nun waren sie für immer fort. Mühsam kniete er sich hin und stand dann schwankend und torkelnd auf, bevor er wieder loslief.
„So ist’s schon besser.“ Munin joggte neben ihm her. „Komm schon. Beweg dich.“
Falins Beine fühlten sich an, als wären sie keine Körperteile mehr. Er war so weit gelaufen, dass sie nicht mehr taten, was er wollte. Er versuchte zu rennen, stolperte aber nur in kleinen Schritten vorwärts, unfähig, einen gleichmäßigen Rhythmus zu finden. Seine Lungen schrien nach einer Pause. Aber er würde nicht anhalten wie ein nibral. So einer wollte er nicht sein.
Niemals wieder würde er etwas finden, das einem Zuhause so nahekam, wie das, was vor ihnen lag: Ein Lager, das jeden Tag von einem Ort zum nächsten zog, in dem er sich jede Nacht in den Schlaf schluchzte, die Fäuste in den Mund gesteckt, damit die Mandalorianer ihn nicht hörten und dachten, er wäre ein Baby, weil er so oft weinte.
Er konnte die Mando-Soldaten sehen, wie sie im Lager herumstanden und wachten. Alle trugen sie Rüstungen. Selbst ihre Frauen waren zähe Krieger, und es war nicht immer einfach zu erkennen, wer sich unter der Rüstung verbarg: Mann oder Frau – oder überhaupt ein Mensch.
Falin trieb seinen Körper mit all seinem Willen an, aber der wollte nicht hören. Mit dem Gesicht voraus stürzte er zu Boden.
Jedes Mal, wenn er versuchte aufzustehen, schnitten ihm Kies und Dreck in die Handflächen, und seine Arme gaben nach. Er schluchzte frustriert. Die Ziellinie lag noch in weiter Ferne. Aber er musste aufstehen. Er musste es zu Ende bringen.
Ich bin nicht faul. Ich bin kein nibral. Ich lasse nicht zu, dass er mich so nennt –
„Okay, ad’ika“, sagte Munin und hob ihn hoch. Er setzte sich Falin auf die Hüfte, als wäre er es gewohnt, ein Kind zu tragen, und schritt ins Lager hinein. Der plötzliche Wechsel von Gebrüll zu Güte verwirrte den Jungen. „Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Alles ist gut.“
Falin schlug Munin, so hart er nur konnte. Aber seine geballte Faust prallte von dem metallenen Brustpanzer ab. Es schmerzte. Aber das würde er Munin nicht wissen lassen. „Ich hasse dich“, sagte er und war sich darin endlich sicher. „Wenn ich größer bin, werde ich dich umbringen.“
„Ich wette, das würdest du“, antwortete Munin lächelnd. „Du hast es bereits einmal versucht.“
Die anderen Mandalorianer beobachteten sie. Manche trugen ihre Helme, andere nicht. Ihren Krieg hier hatten sie ausgetragen, und jetzt warteten sie auf ein Schiff, das sie nach Hause brachte.
„Willst du den Jungen umbringen?“ Einer der Männer blieb stehen und strich Falin übers Haar. Sein Name war Jun Hokan, und er verzehrte Schnitze von diesem widerlichen getrockneten Fischzeugs, gihaal, die er mit seiner Vibro-Klinge von einem großen Brocken abschnitt und sich in den Mund schnippte, so wie manche Leute Früchte aßen. „Armer shab’ika. Hat er nicht schon genug durchgemacht?“
„Ich trainiere ihn bloß.“
„Es gibt so etwas wie Übertreibung.“
„Komm schon, er ist mandokarla. Er hat es bereits geschafft, allein zu überleben. Der hat Mumm, der Kleine.“
„Mumm oder nicht, meinem Jungen hab ich keine Trainingsläufe zugemutet, bevor er acht war.“
Falin gefiel es nicht, wenn über ihn geredet wurde, als würde er nicht verstehen, was los war. In der Mitte des Lagers, das aus Zelten bestand, deren Plastoid-Planen über Gruben aufgezogen und dann mit Zweigen und Gras abgedeckt worden waren, kochte ein Kessel mit Eintopf über einem prasselnden Feuer. Munin setzte ihn auf den Boden und schrubbte ihm Gesicht und Hände mit einem nassen Lappen sauber, bevor er etwas von dem Eintopf in eine Schale schöpfte und ihm reichte.
„Wir müssen dir eine Rüstung besorgen, wenn wir nach Hause kommen“, sagte Munin. „Du musst lernen, darin zu leben und zu kämpfen. Beskar’gam. Die zweite Haut eines Mandalorianers.“
Falin schlürfte aus der Schale. Er war immerzu hungrig. Der Eintopf glich eher einer Brühe – ohne die leckeren Klöße, die seine Mutter gemacht hatte –, und er mochte den fischigen Geruch nicht. Aber verglichen mit dem, was er in den Ruinen der Stadt ergattert hatte, war es ein Festschmaus.
„Will aber keine Rüstung“, maulte er.
„Wenn du in der Rüstung steckst, kannst du alle möglichen Dinge tun, die gewöhnliche Leute nicht tun können, Kal.“
Munin nannte ihn Kal. In der Sprache des Mannes hatte es etwas mit Messern und Stechen zu tun. Munin hatte ihm den Spitznamen Kal gegeben, weil Falin bei ihrer ersten Begegnung versucht hatte, ihn mit seinem dreischneidigen Messer zu erstechen. Der Mandalorianer schien das lustig gefunden zu haben und war überhaupt nicht wütend gewesen. Munin gab ihm zu essen, tat ihm nicht weh, und in den Wochen, in denen Falin Teil des Söldnerlagers gewesen war, hatte er sich besser gefühlt, auch wenn er nicht glücklich war.
Manchmal rief Munin ihn Kal’ika. Die Söldner erklärten ihm, das bedeute „kleine Klinge“ und würde zeigen, wie lieb Munin ihn hatte.
„Ich heiße Falin“, korrigierte er schließlich. „Mein Name ist Falin.“ Aber er vergaß bereits, wer Falin war. Sein Zuhause in Kuat City wirkte wie ein fast vergessener Traum. Wenn er aufwachte, glich er mehr einem Gefühl als einer Erinnerung. Seine Familie war nach Surcaris gezogen, weil sein Vater dort auf den neuen KDY-Kriegsschiffen Ingenieurskram erledigte. „Ich will keinen anderen Namen.“
Munin aß mit ihm zusammen. Wenn er nicht gerade brüllte, war er eigentlich ein liebenswürdiger Mann, aber er konnte niemals Papas Platz einnehmen. „Von vorn anzufangen kann eine prima Sache sein, Kal’ika. Die Vergangenheit oder andere Leute kannst du nicht ändern, aber dich selbst kannst du immerzu ändern, und das verändert deine Zukunft.“
Falin packte dieser Gedanke, und er ließ ihn nicht mehr los. Wenn man sich hilflos fühlte, war die Vorstellung, in der Lage zu sein, alles Schlechte aufhören zu lassen, das Tollste in der Welt, und er wollte sich nie wieder so schlecht fühlen. Er wollte, dass die Dinge sich änderten.
„Aber warum scheuchst du mich rum und lässt mich Sachen schleppen?“, fragte er. „Das tut weh.“
„Damit du mit allem fertig wirst, was das Leben dir entgegenschleudert, Sohn. Damit du niemals wieder vor irgendwem Angst haben musst. Ich werde einen Soldaten aus dir machen.“
Falin gefiel der Gedanke, ein Soldat zu sein. Er besaß eine recht unklare, dafür aber umso längere Liste mit Wesen, die er dafür umbringen wollte, dass sie seinen Eltern Leid angetan hatten, und solche Dinge ließen sich bewerkstelligen, wenn man ein Soldat war. „Warum?“
„Es ist ein edler Beruf. Du bist zäh und gewitzt, und du wirst einen tollen Soldaten abgeben. Das ist es, was Mandalorianer tun.“
„Warum hast du mich nicht umgebracht? Du bringst doch sonst jeden um.“
Munin kaute eine Weile nachdenklich vor sich hin. „Weil du keine Eltern hast, und ich und meine bessere Hälfte haben keinen Sohn. Also macht es Sinn, dass wir tun, was Mandalorianer immer tun: Dass wir dich aufnehmen, dich trainieren, dir das Rüstzeug geben, selbst ein Soldat und Vater zu sein. Möchtest du das nicht?“
Falin dachte lange darüber nach. Er fand keine Antwort. Allerdings fühlte er sich nun unter anderen Wesen einsamer als vorher in seinem Leben, auf sich allein gestellt im Schutt von Surcaris. Denn all diese Mandalorianer schienen zusammenzugehören. Sie waren eng verbunden wie eine Familie. Und sie hatten seine Eltern nicht getötet. Sie waren lediglich in die Stadt marschiert, während der Krieg nach wie vor tobte. Aber er war noch immer wütend, und sie würden als Ziel seiner Wut herhalten müssen, bis ihm die richtige Sache über den Weg lief.
„Du glaubst, ich bin faul und dumm“, sagte er.
„Nein, ich sage das nur und schreie dich an, damit du so wütend wirst, dass du an deine Grenzen gehst.“ Munin sah zu, wie er seine Schale leerte und schöpfte ihm dann nach. „Denn Stärke liegt hier.“ Er tippte sich an den Kopf. „Du kannst deinen Körper alles tun lassen, wenn du es nur doll genug willst. Das nennt man Ausdauer. Wenn du erst herausfindest, was du alles tun kannst, was du alles aushältst, dann wirst du dich großartig fühlen – so als ob dir niemand mehr wehtun kann. Du wirst stark sein, in jeder Hinsicht.“
Falin wollte sich großartig fühlen. Mit vollem Bauch schien das Leben schon wieder etwas vielversprechender, solange er nicht an seine Mutter und seinen Vater dachte, wie sie zwischen den zerbrochenen Balken des Hauses lagen, das sie auf Surcaris gemietet hatten.
Dieses Bild ging ihm nicht aus dem Kopf. Er stand auf, um seine Schale in einem Wassereimer auszuwaschen, und setzte sich dann wieder ans Feuer und betrachtete das Messer seines Vaters, so wie er es jeden Tag tat. Es besaß drei flache Seiten wie eine Pyramide, die sich lang zu einer Spitze hinstreckten. Als sein Vater noch am Leben gewesen war, hatte er es nie anrühren dürfen. Inzwischen hatte er sich selbst beigebracht, damit umzugehen, da er nirgends hingehen konnte und niemanden hatte, der auf ihn aufpasste. Mittlerweile konnte er es recht gut werfen. Er übte viel und traf jedes Ziel, ob beweglich oder nicht.
„Wie ist das so, Soldat zu sein?“, fragte er.
Munin zuckte mit den Schultern. „Oft langweilig. Manchmal schaurig. Man reist viel. Man lernt die besten Freunde kennen, die man überhaupt haben kann. Man lebt wirklich. Und manchmal – stirbt man zu früh.“
„Muss ich Befehle befolgen?“
„Befehle halten dich am Leben.“
Es dämmerte noch nicht einmal, dennoch konnte Falin die Augen kaum noch offen halten, und er sank in eine behagliche Benommenheit, und die Welt um ihn verschwand. Er versuchte diesen Dämmerzustand aufrechtzuerhalten, weil der Schlaf unweigerlich Träume mit sich brachte, aber er war einfach zu müde. Einen Augenblick lang nahm er wahr, wie er hochgehoben und getragen wurde, aber er wachte nicht gänzlich auf, und das Letzte, das er spürte, war das Versinken in einem Haufen Decken in einem der Zelte, in dem es nach Maschinenöl, Rauch und getrocknetem Fisch roch.
Das war der Punkt, an dem die Träume wieder begannen. Er wusste, dass er träumte, aber das half nicht. Er trat durch die Eingangstür des Hauses auf Surcaris. Alle Wände waren zerborsten und eingestürzt, und nur der Boden war noch intakt, und er bemerkte erst, dass es seine Mutter war, auf die er trat, als er den blauen Stoff ihrer Lieblingstunika sah. Er blickte sich nach seinem Vater um.
Papa lag bei den Überresten des Fensters, und Falin wusste, dass etwas nicht stimmte, aber er brauchte einen Augenblick, um zu erkennen, dass der größte Teil des Kopfes seines Vaters fehlte. Er kniete nieder, um das Messer aus dem Gürtel seines Vaters zu ziehen, und meinte, jener würde sich bewegen.
Das war immer der Augenblick, in dem er aufwachte. In Wirklichkeit war es nicht so gewesen – er hatte sich eine Ewigkeit neben den Leichen zusammengerollt, bevor er entschieden hatte, er müsse weglaufen und sich verstecken und das Messer mitnehmen, um sich verteidigen zu können – aber in dem Traum war alles schneller, anders, viel schrecklicher. Ruckartig und mit pochendem Herzen fuhr er aus dem Schlaf.
„Papas Kopf …“, schluchzte er. „Papas Kopf ist gebrochen.“
Munin Skirata drückte Falin an seine Brust. „Alles gut“, raunte er. „Ich bin da, Sohn. Ich bin ja da. Es ist nur ein böser Traum.“
„Ich will, dass es aufhört. Es soll aufhören, dass ich Papas Kopf sehe.“
Munin schrie ihn nicht an, weil er weinte. Er hielt ihn einfach nur fest, bis er aufhörte. Falin klammerte sich an ihn und schluchzte, bis er keine Luft mehr bekam. Ihm wurde klar, dass sein dreischneidiges Messer jetzt an seinem Gürtel hing, in einer neuen Lederscheide, von der er nicht wusste, woher sie gekommen war.
„Es hört auf, Kal“, beruhigte ihn Munin. „Das verspreche ich. Und niemand wird dir je wieder wehtun, solange ich da bin. Du wirst groß und stark werden, und du wirst glücklich sein.“
Falin entschied, dass es ihm gleichgültig war, Kal genannt zu werden, solange das seine Albträume verscheuchte. Irgendwie waren diese beiden Dinge nun verbunden: Wenn er aufhörte, Falin zu sein, hörte er auf, die Leichen seiner Eltern zu sehen. Munin Skirata klang so gewiss und fühlte sich so stark und robust an, dass Falin ihm glaubte. Man konnte sich ändern, wenn man wollte. Man konnte alles tun, wenn man wollte.
„Ich bin nicht wirklich ein nibral, oder?“
„’türlich nicht, Kal“, sagte Munin leise. „Ich hätte das nicht sagen sollen. Für das, was du bist, gibt es kein Wort auf Mandalorianisch.“
Falin – Kal – verstand nicht. Er blickte hinauf in Munins Gesicht und suchte nach einer Erklärung.
„Held“, erklärte Munin. „Wir haben kein Wort für Held. Aber du bist ein echter kleiner Held, Kal Skirata.“
Kal Skirata. Er war es, der er von diesem Augenblick an sein sollte. Er schlief wieder ein, und als er am nächsten Morgen erwachte – ohne Träume, ohne Albträume –, schien die Welt ein anderer Ort zu sein.
2.
Ba’jur bal beskar’gam,
Schulung und Rüstung,
Ara’nov, aliit,
Selbstverteidigung, unser Stamm,
Mando’a bal Mando’alor –
Unsere Sprache und unser Anführer –
An vencuyan mhi.
Helfen uns zu überleben.
– Vers,der mandalorianischen Kindern beigebracht wird, um sie die Resol’nare zu lehren – die sechs Grundsätze der Mando-Kultur
Arca-Kaserne, Hauptquartier der Sondereinsatzbrigade, Coruscant, 736 Tage nach der Schlacht von Geonosis – zweiter Jahrestag des Kriegsausbruches
Scorch hob sein Gewehr und legte auf zwei Sergeants auf dem Paradeplatz unter dem Fenster an.
Die verbesserte Optik des DC-17 erwies sich im Vergleich zur letzten Version als deutlicher Fortschritt. Das Fadenkreuzraster wanderte auf Kal Skirata, genau auf die schmale, imaginäre Linie von den Augen zu der Vertiefung an der Schädelbasis: ein perfekter Hirn-Schädel-Schuss, ideal für sofortige Handlungsunfähigkeit. Scorch konnte sehen, wie sich der Mund des Mandalorianers bewegte, während er mit Walon Vau sprach.
Mann, langsam geht’s hier zu wie im Zentrum von Keldabe. Nicht, dass ich den Typ nicht leiden kann. Aber …
Sergeant Vau – und er würde immer Sergeant Vau sein, Zivilist hin oder her – kam für Scorch einem Vater am nächsten. Vau und Skirata schienen in ein Gespräch vertieft zu sein. Beide redeten gleichzeitig, während sie auf den Ferrobetonbelag des Paradeplatzes hinunterblickten. Keinerlei Augenkontakt. Eine eigenartige Beschäftigung bei Tagesanbruch.
„Hast du nicht gesagt, du könntest Lippen lesen?“, fragte Sev, der eine Handvoll gewürzter Warranüsse knabberte.
„Kann ich auch, aber ich werd nicht schlau draus.“
„Vielleicht reden sie auf Mandalorianisch?“
„Ich kann Mando’a bestens von Lippen ablesen, mir’sheb …“
„Man sollte meinen, die wären clever genug, ihre Deckel zu tragen und das interne Komlink zu benutzen.“
„Vielleicht ist es nicht vertraulich.“ Scorch konnte den scharfen Geruch der Nüsse quer durch den Raum riechen. „Hey, du weißt ja wohl was passiert, wenn du dir die Dinger ins Gesicht stopfst. Du kriegst es mit der Verdauung und bekommst Blähungen. Und ich leg dich bestimmt nicht über meine Schulter und lass dich Bäuerchen machen.“
Sev rülpste. „Du wirst mich vermissen, wenn ich tot bin.“
„Mach dich nützlich und schau mal, ja?“
Sevs Kehle gab ein langes, tiefes Rumoren von sich, dann aß er den Rest der Nüsse und legte seinen eigenen Deeze an. Er war ein Scharfschütze. Er verbrachte noch mehr Zeit damit, durch das Visier zu starren als Scorch.
„Die rezitieren irgendwas“, stellte er schließlich fest, lehnte seinen Deeze zurück an die Wand und setzte sich wieder auf die Pritsche, um weiterzuknabbern. „Sie sagen beide die gleichen Worte.“
„Ja? Und?“
„Keine Ahnung. Kann’s nicht ausmachen.“
Seit Sev denken konnte, lagen sich Skirata und Vau ständig wegen irgendwas in den Haaren. Angefangen bei taktischen Fragen über Truppenmotivation bis hin zur Wandfarbe der Kantine. Und oft trieben sie es dabei bis zum Rand eines Faustkampfs. Aber der Krieg schien ihre Anschauungen gemildert zu haben. Es bestand keine Zuneigung zwischen ihnen – jedenfalls nicht, soweit Scorch das beurteilen konnte –, aber irgendetwas hielt sie als Waffenbrüder zusammen, eng und verschwiegen.
Keiner der beiden musste hier sein. Vaus Bankraub – über den sie zwar nicht sprachen, aber hallo! Der hatte wahrscheinlich Millionen eingebracht. Sie waren Männer mit einer Mission, getrieben von etwas, das Scorch nicht ganz verstand.
Er drehte die Vergrößerung hoch, aber es half nichts. „Vielleicht führen sie einfach nur eine echt langweilige Unterhaltung.“
„Namen“, erkannte Sev schließlich. „Sie sagen Namen auf.“
Sev legte erneut wie gebannt an. „Wie alt ist Skirata?“
„Sechzig, einundsechzig, so was um den Dreh.“
„Wie viel ist das in Klon-Jahren?“
„Tot.“
Das war ein ernüchternder Gedanke, und Scorch fragte sich, warum er ihm noch nie gekommen war. Er hatte sich nie Gedanken über das Älterwerden gemacht. Trotz Delta Squads ständigen Prahlereien, der Separatist, der sie umbringen könne, müsse erst noch geboren werden, hatte er nie geglaubt, er würde überleben.
„Glaubst du, der verrückte, alte Barve wird sein Wunderheilmittel finden?“, fragte er.
Sev schnippte eine Nuss und fing sie mit dem Mund. „Gegen was?“
„Unseren vorzeitigen Abgang aus diesem Leben. Er redet andauernd davon.“
Sev rülpste wieder. „Ich gehe immer noch davon aus, dass er Ko Sai umgelegt hat. Und ich gehe davon aus, dass er ihre Forschungsergebnisse hat und dass er sie genau deswegen umgelegt hat, damit sie nichts ausplaudert. Von daher … ja, ich würd’ drauf wetten, dass er einen Weg findet, unser beschleunigtes Altern aufzuhalten.“
Scorch nahm an, dass Vau ebenso tief in den Tod von Kaminos abtrünniger Klonerin verstrickt war wie Skirata. Er war Vau gegenüber immer noch äußerst loyal. Schließlich war der Mann der Grund, weshalb Delta heute noch am Leben war, eine von einer Handvoll Schwadronen, die seit den Tagen auf Kamino noch intakt geblieben waren. Vau schaffte Überlebenskünstler. „Du wirst das Zey gegenüber doch nicht erwähnen, oder, Sev?“
„Nee. Ich will ihm nur ungern schlaflose Nächte bereiten.“
„Aber wenn Sergeant Kal Ko Sais Ergebnisse hat, warum fängt er dann nicht an, ein Heilmittel auszuteilen? Es ist jetzt schon fast sechs Monate her, dass er dir ihren Kopf gegeben hat.“
„Bei dir hört sich das fast wie ein Geburtstagsgeschenk an“, fand Sev. „Vielleicht kriegt er ja irgendeine Formel nicht zum Laufen. Oder er melkt einfach die Republik noch bis zum Gehtnichtmehr, bevor er mit dem ganzen Batzen abzischt.“
„Kal würde niemals ohne seine geschätzten Nulls abhauen.“ Scorch wandte sich zu Sev um, der ihn mit einer hochgezogenen Braue ansah. „Oder doch?“
„Wenn sie desertieren, würdest du sie erschießen?“, fragte Sev.
Scorch zuckte mit den Schultern und versuchte unbefangen auszusehen, aber der Gedanke, eine Blastersalve durch einen Klon-Bruder zu jagen, gefiel ihm gar nicht. Außerdem waren die Nulls Skiratas Adoptivsöhne, seine geliebten, kleinen Jungs, obwohl es ausgewachsene Männer waren, große Männer, gefährliche Männer – und dennoch: Wenn irgend so ein Barve sie auch nur falsch ansah, würde Skirata Kleinholz aus ihm machen.
Auch aus uns.
„Das müssten wir gar nicht“, antwortete Scorch. „Du hast doch von Palpatines Todesschwadronen gehört, die zur Stelle sind, falls wir aus der Reihe treten.“
„Weich der Frage nicht aus! Würdest du sie erschießen, wenn der Befehl käme?“
„Hängt davon ab“, sagte Scorch schließlich.
„Befehl ist Befehl.“
„Hängt davon ab, wer ihn erteilt.“
„Je länger dieser Krieg läuft, desto weniger habe ich das Gefühl, dass die Nulls auf unserer Seite sind.“
Scorch verstand, was Sev meinte, hielt es aber trotzdem für ein zu hartes Urteil. Er konnte sich die Nulls nicht auf der Seite der Seps vorstellen. Sie waren verrückt, unberechenbar, fungierten sogar als Skiratas Privatarmee, aber sie waren keine Verräter.
„Komm schon“, sagte er, nahm seinen Helm und ging zur Tür. „Lass uns nachsehen, was die alten Kerle vorhaben. Ich halt’s vor Spannung kaum noch aus.“
Der Paradeplatz, eine Plattform mit einer niedrigen Böschungsmauer und einer Rabatte gepflegter Büsche, die auf Vorschriftshöhe – so etwas gab es, dessen war sich Scorch sicher – gestutzt waren, bekam nicht viele Paraden zu sehen. In diesen Tagen stand er meistens leer, bis auf eine gelegentliche, spontane Runde Bolo-Ball. Die beiden altgedienten Sergeants standen mit leicht gesenkten Köpfen in der Mitte des Platzes und nahmen von den näher kommenden Commandos keine Notiz.
Allerdings gab es nichts, das Skirata nicht zur Kenntnis genommen hätte. Das Gleiche galt für Vau. Sie hatten Augen in ihren Hinterköpfen, diese beiden. Scorch hatte immer noch nicht verstanden, wie sie es damals in Tipoca City geschafft hatten, ständig ein so wachsames Auge auf ihre jeweiligen Ausbildungskompanien zu haben. Auf einen jungen Klon wirkten sie wie allwissende Götter, die man nicht umgehen, täuschen oder überlisten konnte und diesem Bild kamen sie auch heute noch ziemlich nahe.
Scorch konnte das Brummeln tiefer Stimmen hören. Es lag ein gewisser Rhythmus darin. Ja, sie beteten eine Liste herunter. Nun, da er sie hören konnte, erhaschte er Töne, die er kannte.
Namen.
Sie sagten tatsächlich Namen auf.
Sev zögerte zuerst. Er griff nach Scorchs Ellbogen. „Ich finde, wir sollten sie nicht unterbrechen, ner’vod.“
Skirata wandte sich langsam um. Seine Lippen bewegten sich weiter, und dann sah auch Vau auf.
„Möchtest du mitmachen, ad’ike?“, fragte Vau freundlich. Und er war gewiss kein freundlicher Mann. „Wir gedenken nur Brüdern, die ins Manda gegangen sind. Schon vergessen, was für ein Tag heute ist?“
Scorch hatte es vergessen, obwohl es ihm eigentlich ins Gehirn geätzt sein sollte. Siebenhundertsechsunddreißig Tage zuvor waren alle zehntausend Republic Commandos zusammen mit dem Rest der Großen Armee ohne Vorwarnung nach Geonosis geschickt worden. In dem Gedrängel beim Einschiffen war keine Zeit für Abschiede von den Ausbildungssergeants geblieben. Von den zehntausend eingeschifften Männern kehrten nur fünftausend zurück.
Scorch kam sich wie ein Depp vor.
Er wusste, was die beiden Sergeants jetzt taten und warum: Sie sagten die Namen der gefallenen Klon-Commandos auf. Es war ein mandalorianischer Brauch, mit dem tote Angehörige und Kameraden geehrt wurden, indem ihre Namen täglich wiederholt wurden. Er fragte sich, ob sie jeden einzelnen Tag all die Tausende aufzählten.
„Sie erinnern sich doch nicht an jeden Namen, oder, Sarge?“, fragte Sev.
„Wir erinnern uns an jeden Burschen, den wir ausgebildet haben, für immer“, sagte Skirata ruhig, aber Scorch konnte sehen, dass er seinen Blick auf ein Datapad heftete, das er in Händen hielt. Fünftausend Namen – plus jenen, die nach der Schlacht von Geonosis gefallen waren –, eine unmögliche Gedächtnisleistung, selbst in Anbetracht von Skiratas Hingabe. „Beim Rest … brauchen wir nur ein bisschen Nachhilfe.“
Scorch hätte nicht die Hälfte der Schwadronen seines Schubs im Ausbildungszentrum von Tipoca benennen können, von den Männern darin ganz zu schweigen. Er schämte sich, als hätte er sie verraten. Vau nickte ihm zu und machte eine Geste mit seinem eigenen Datapad, die ihm zeigen sollte, dass er übertrug. Als Scorch auf das Datapad sah, das an seinen Gürtel geschnallt war, bemerkte er, dass die Liste angekommen war. Die Kompanie, die gerade aufgezählt wurde, war farbig hervorgehoben. Folgsam stimmte er in die Lesung ein. Sev schloss sich an.
Es gab viele Klone mit identischen Spitznamen, die auf ihren Nummern basierten: Eine Menge namens Fi oder Niner oder Forr – und Scorch schauderte, als er den Namen Sev öfter als einmal aufsagen musste.
Auch auf Sevs Stimmung konnte es kaum positiven Einfluss haben. Scorch blickte zu ihm hinüber, aber er hatte den Blick auf sein Datapad geheftet und sah ungerührt aus wie meistens.
„Baris, Red, Kef …“
„… Vin, Taler, Jay …“
„… Tam, Lio …“
Die Liste ging weiter. Nach ein paar Minuten erklangen ihre Stimmen synchron, was eine seltsam hypnotische Atmosphäre hervorrief, gleich einer Beschwörung; Rhythmus und Tonfall brachten Scorch in eine Art Trance. Es war nur der Effekt simpler Wiederholung, aber dennoch irritierte es ihn. Das Mystische lag ihm nicht.
Hinter sich konnte er das schwache Knirschen herannahender Stiefel hören, aber er wagte nicht, den Zauber zu brechen, sich umzudrehen und nachzusehen. Weitere Commandos schlossen sich dem Ritual an. In der Kaserne hielten sich niemals sonderlich viele Männer auf, aber es schien, als würden sie jetzt alle herauskommen, um den Toten ihren Respekt zu zollen.
So viele Namen.
Wird meiner nächstes Jahr um diese Zeit dabeisein?
Fi war dabei; Fi, RC-8015, Omega Squads Scharfschütze. Skirata zuckte nicht einmal mit der Wimper, als er den Namen aussprach und auch Vau nicht, obwohl das Gerücht umging, dass Fi gar nicht tot sei. Es war ein seltsamer Moment, den Namen dieses großmäuligen, kleinen di’kuts zu wiederholen, als wäre er dahingegangen. Scorch, der sich plötzlich schuldig fühlte, so viel persönliche Trauer zu verströmen, sah, wie Sev langsam nach links blickte, als ob er jemanden entdeckt hätte. Scorch wollte seine Konzentration nicht unterbrechen. Er sah nicht nach, was Sev abgelenkt hatte.
Die Liste mit den Gefallenen zu rezitieren, dauerte eine gute Stunde. Schließlich, nachdem der letzte Name ausgesprochen war, standen Skirata und Vau einen Moment lang still und mit gesenkten Köpfen da. Scorch fühlte sich, als wäre er abrupt aufgewacht. Plötzlich war er sich den Geräuschen und dem hellen Sonnenlicht wieder bewusst, so als wäre er gerade aus einem dunklen Raum getreten, und fast schon erwartete er ein gewichtiges Ende der Zeremonie. Aber auf typisch mandalorianische Art hörte sie einfach auf. Denn alles, was gesagt werden musste, war gesagt.
Skirata sah auf. Ein paar Hundert Commandos hatten sich versammelt. Manche hatten ihre Helme auf, andere nicht. Aber jeder Mann trug seine individuell bemalte Rüstung, was angesichts des feierlichen Anlasses unpassend heiter wirkte. Andererseits war es aber auch sehr Mando. Das Leben ging weiter und musste gänzlich ausgelebt werden, und das ständige Gedenken an verlorene Freunde und Familienangehörige gehörte als wesentlicher Bestandteil dazu. Aay’han. Das war das Wort dafür: eine eigenartige, mandalorianische Emotion, jene sonderbare Mischung aus Zufriedenheit und Kummer, wenn man von nahestehenden Personen umgeben ist und sich doch mit bittersüßer Intensität der Toten erinnert. Die Toten wurden niemals ausgeschlossen. Skiratas Tiefseeklassen-Tauchschiff hieß Aay’han. Das sagte viel über den Mann aus.
„Worauf wartest du, ad’ike?“, fragte Skirata. So nannte er sie immer: kleine Söhne. Scorch fragte sich, ob er alle seine Schwadronen formal adoptiert hatte. Das sähe ihm ähnlich. „Passt nur auf, dass ich nächstes Jahr keinen von euren Namen auf die Liste setzen muss, ich wäre ziemlich sauer.“
„Meinen Sie, es wird ein nächstes Jahr geben, Sarge?“ Scorch kannte den Commando, der die Frage stellte, nicht, aber die Deltas blieben die meiste Zeit auch unter sich. Seine Rüstung schmückten marineblaue und goldene Rangabzeichen. „Ich plane gern voraus. Wer weiß, vielleicht habe ich soziale Verpflichtungen …“
Skirata zögerte einen Augenblick. „Du weißt, wie der Krieg bisher lief. Vielleicht sind wir alle in zehn Jahren noch hier.“
„Ihr Enkel wird dann groß genug für eine Rüstung sein.“ Leises Lachen war zu hören, und Skirata lächelte traurig. Scorch hätte bei der Erwähnung des kleinen Jungen, den seine Kinder – seine biologischen Kinder – ihm aufgehalst hatten, ein glücklicheres Gesicht von ihm erwartet. Er schien richtiggehend vernarrt in das Kind. Aber es sah aus, als hätten ihm irgendwelche Umstände seinen fröhlichen, großväterlichen Glanz geraubt.
„Mein größter Wunsch ist“, sagte Skirata, „dass ihr alle erlebt, wie er aufwächst.“
Tja, es war sowieso nicht der Tag für Ausgelassenheit. Sie hatten nur auf dem weiten, leeren Paradeplatz gestanden und die Namen Tausender toter Brüder rezitiert. Daher hielt Scorch diesen Satz für eine passend deprimierende Schlussbemerkung. Dieser Tage sang niemand das Hohelied des darasuum kote – des ewigen Ruhms –, dennoch meinte Scorch, eine Strophe aus dem Vode An wäre angemessen.
Stattdessen löste sich die Stegreifversammlung wortlos auf und Skirata ging wie gewohnt humpelnd davon, in Begleitung von Vau. Aus reiner Neugier behielt Scorch die beiden Sergeants im Auge, bis sie auf der anderen Seite der Kaserne die Hangars erreichten.
„Komm schon“, drängte Sev. „Wir können nicht den ganzen Tag hier rumhängen. Vorm Mittagessen heißt’s noch Einsatzbesprechung. Ich muss mein HUD kalibrieren.“
„Was glaubst du, haben die vor?“
„Alt werden und rausfinden, wie sie die Beute aus Vaus Bankraub verprassen können.“
„Nein, die haben was echt Dickes vor. Ich spür’s.“
„Sind wir jetzt Gedankenleser, ja?“
Scorch konnte nicht verstehen, weshalb Sev niemals sehen konnte, was er sah. Sie waren mit diesen beiden alten shabuire aufgewachsen und wenn einer von ihnen irgendeine Gaunerei am Laufen hatte, hatte er dieses Etwas an sich, ganz dezent, aber für Klone, die auf unterschwellige Einzelheiten angewiesen waren, um sich in dem Meer aus nahezu identischen Brüdern zu erkennen, deutlich wahrnehmbar. Skirata hatte sein Gauner-Gesicht aufgesetzt. Ganz sicher!
„Er weiß definitiv etwas, das wir nicht wissen“, behauptete Scorch.
„Dann kann’s uns nicht schaden, ganz gleich, was es ist.“
Skirata und Vau blieben am Eingang zum Waffenlager stehen. Dann sah Scorch etwas, das seine Paranoia rechtfertigte. Zwei wohlbekannte Gestalten, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Gestalten in beskar’gam – der traditionellen mandalorianischen Rüstung – traten aus einer Seitentür und begrüßten die beiden Sergeants mit dem typischen Hand-zu-Ellbogen-Griff. Mandalorianer schüttelten sich die Hände, indem sie sich gegenseitig am Handgelenk fassten. Vau sagte, es würde einen Griff zeigen, der stark genug sei, um einen Kameraden in Sicherheit zu ziehen.
Vielleicht waren sie wegen des Jahrestages gekommen. Niemand außerhalb der Großen Armee schien sich darum zu scheren.
„Was machen die denn hier?“, murmelte Sev. „Wieso jetzt?“
Wad’e Tay’haai und Mij Gilamar waren zwei der Cuy’val Dar, jener Ausbildungssergeants, die Jango Fett persönlich rekrutiert hatte, um die Klon-Commandos auf Kamino zu trainieren. Die meisten waren Mandalorianer, und die meisten waren wieder verschwunden, nachdem ihr Vertrag erfüllt war, getreu ihrem Namen: „Jene, die nicht länger existieren.“ Aber nun tauchten sie einzeln oder zu zweit wieder auf, und das rechtfertigte für Scorch sein generelles Misstrauen.
„Ich weiß nicht“, sagte er. „Vielleicht meint Kal, er bräuchte die Gesellschaft von Intellektuellen.“ Er hielt inne. Tay’haai trug noch immer den altertümlichen Bronziumspeer um den Rücken geschlungen und eine beskar-Flöte an seinem Gürtel. Beides tödliche Waffen. „Glaubst du, dass er die Dinger jemals benutzt?“
„Hundert pro!“, behauptete Sev. „Ich hab gehört, Zey hätte versucht, Cuy’val Dar zu rekrutieren, um gewöhnliche Trooper per Crosstraining auszubilden.“
„Riecht nach Verzweiflung.“
„Falls du’s noch nicht gemerkt hast, wir sind verzweifelt.“
Die vier Mandalorianer tauschten ein paar Worte und verschwanden. Ohne seine Helmsysteme konnte Scorch über diese Entfernung nichts mithören. „Warum hat Fett überhaupt irgendwelche Nicht-Mando-Sergeants rekrutiert?“
Sev zuckte mit den Schultern. „Er meinte, das wäre eine gute Mischung aus Fähigkeiten, aber ich glaube, er konnte einfach keine hundert Mandos auftreiben, die für ihn antraten.“
Scorch folgte Sev zu den Unterkünften. Er fragte sich häufig, wie sich die Commandos, die von aruetiise – Nicht-Mandalorianer (ein Wort, das alles von Fremder bis hin zu Verräter bedeuten konnte) – ausgebildet worden waren, wohl unter all den anderen fühlten, die so tief mit der mandalorianischen Kultur verwurzelt waren. Allerdings waren nicht mehr viele von ihnen übrig. Von den rund Fünfundzwanzigtausend, die ihre Ausbildung unter aruetiise abgeschlossen hatten, hatten weniger als Tausend überlebt. Das sagte eine Menge über mandalorianische Ausbildung.
„Wir sollten die Fünfzehner besser selbst ausbilden“, schlug Scorch vor. „Wir können Erfahrung an sie weiterreichen.“
Sev nahm seinen Helm vom Tisch und drehte ihn um, um ihn zu kalibrieren. „Hast du die Nase voll vom Kämpfen? Willst du einen hübschen Schreibtischjob?“
„Nö, ich mein bloß …“
Scorch versuchte nicht allzu viel nachzudenken, weil sein Leben ohnehin voller Fragen steckte, die jenseits seines Beantwortungsvermögens und seines Einflusses lagen. In unaufmerksamen Momenten schlichen sie sich an ihn heran. In der Nasszelle, oder wenn er auf dem Weg zu einem Einsatz im Kanonenboot saß, und immer kurz bevor er einschlief. Wo sollte die Große Armee mehr Truppen hernehmen? Wenn sie begannen, im Crosstraining mehr Fleischbüchsen zu Commandos auszubilden, wer würde dann deren Stellen einnehmen? Die Überlastung schien mit jedem Tag anzusteigen.
Und wo waren die Abermillionen dieser shabla Droiden, die die Separatisten angeblich hatten? Es gab reichlich davon, aber wenn tatsächlich so viele existierten, wie der Geheimdienst erzählte, dann mussten die irgendwo ’ne Party feiern und den Krieg aussitzen. Einer der Null ARCs schwor Stein und Bein, dass nur ein Bruchteil der offiziellen Zahl eingesetzt wurde.
Die Nulls wussten eine Menge Dinge, die sie den Commando-Schwadronen nicht erzählten. Wenn sie etwas nicht wussten, dann begann Scorch sich Sorgen zu machen. Er vergaß immer wieder, wie viele Nullen eine Billiarde hatte, aber wie viele es auch sein mochten, es hätten mehr Droiden sein müssen, als er jemals gesehen hatte.
„Vielleicht muss Palpatine bald Zivilisten rekrutieren“, spekulierte er hoffnungsvoll.
Sev lachte. Was selten vorkam. „Ich arbeite lieber unterbesetzt, anstatt mit Promenadenmischungen zu dienen. Hast du gesehen, was die für Flottenoffiziere abgeben? So was willst du als Infanterie?“
„Wenigstens wäre der Krieg dann schneller zu Ende. Wir würden volles Rohr gewinnen oder verlieren.“
„Wohl wahr. Grausam, aber wahr.“
Aber was wird mit uns, wenn es zu Ende geht?
Diese Frage glich jenen, die dieser weinerliche Haufen Omega Squad immerzu stellte. Scorch konnte nicht so weit im Voraus planen. Er wusste nur, dass der Großen Armee in einem Jahr oder so die Truppen ausgehen würden, falls die Verlustraten konstant blieben. Von ausreichend Ersatz konnte er nirgends etwas ausmachen.
„Irgendjemand hat gesagt, Palpatine hätte auf Coruscant mit der Klon-Produktion begonnen, weil er nicht darauf vertraut, dass die Kaminoaner ihre Einrichtungen nicht wieder von den Seps plattmachen lassen“, erzählte Scorch.
Sev schnaubte und fuhr mit der Kalibrierung fort. „Klar, so wie das Gerücht, dass wir so ’ne superklasse neue Ionenkanone bekommen …“
Er hatte recht. Es war nur ein weiteres dummes Gerücht, wie all die anderen, die bei ihnen ankamen. Wenn der Kanzler mehr Klon-Truppen züchten würde, hätte er es allen gesagt, allein schon, um die Moral zu heben und den Seps Angst einzujagen. Und wenn er sie hätte, würde er sie einsetzen.
Für das eine wie das andere hatte Scorch keinerlei Beleg gesehen.
Aber falls er sie züchtete … wären sie noch lange Zeit nicht einsatzbereit. Kamino-Klone brauchten zehn Standardjahre, um sich voll zu entwickeln.
Nein, das war alles nur Gewäsch, ein Strom von Lügengeschichten, aufgeschnapptes, pauschales Gerede, gespickt mit gelegentlichen Brocken Wahrheit, die unter den Rängen zirkulierten. Es gab keine Extra-Verstärkung am Horizont.
Galactic City, Coruscant, 737 Tage NSG
Überwachung war eine Kunst, ebenso, sich ihr zu entziehen.
Die Schatzamtsermittlerin der Republik Besany Wennen hatte in den letzten sechs Jahren schon reichlich Unterschlager und Betrüger verfolgt, aber sie selbst war noch nie Ziel einer Ermittlung gewesen. Als sie nach einem späten Feierabend – manche Arbeiten erledigte man besser, während die Kollegen abwesend waren, insbesondere die Art Arbeit, die einen hinter Gitter bringen konnte – auf dem Nachhauseweg vom Büro war, steckte sie gewohnheitsmäßig die Hand in die Tasche, um nach zwei Dingen zu tasten: Das eine war der Merr-Sonn-Blaster, den Mereel, Null ARC-Trooper N-7, ihr gegeben hatte; das andere war ihr Datapad, voll mit hoch verschlüsselten Daten, die niemals den Hauptcomputer des Schatzamtes hätten verlassen dürfen.
Ich bin eine Spionin. Ich arbeite gegen meine eigene Regierung. Ich war doch immer so ein braves Mädchen, oder, Dad? Und jetzt sieh nur, was aus mir geworden ist!
Ihr Vater hätte sie jedoch verstanden, da war sie sich sicher. Er hatte ihr beigebracht, für die eigenen Überzeugungen einzustehen. Der Blaster war nur die Art Vorsichtsmaßnahme, die man treffen musste, wenn man sich in die Geheimnisse des Kanzlers einmischte. Bei Nacht, selbst in dem grellen Licht eines Viertels, in dem sich Wesen aus allen Ecken der Galaxis tummelten, fühlte Besany sich schrecklich allein und gejagt.
Jeden Tag – manchmal am Morgen, manchmal auf dem Nachhauseweg – war sie überzeugt, dass ein paar Schritte hinter ihr jemand lauerte und sie beobachtete. Dann drehte sie sich um und sah nur Pendler, die ganz andere Sorgen im Kopf hatten als sie, aber die Beklemmung blieb. Sie fragte sich, ob sie noch immer einer der formwandelnden Gurlanin-Spione beschattete, die nicht einmal Jedi aufspüren konnten.
Dieses Mal war das Gefühl, belauert zu werden, nicht nur Ausdruck ihrer Schuldgefühle.
Die Gurlanins hatten sie gewarnt, und ihr folgte tatsächlich jemand. An der Plattform des Speederbusses, nahe dem Schatzamt war ihr ein Mann aufgefallen. Sie war es gewohnt, Blicke auf sich zu ziehen – sie war recht groß und ziemlich blond –, aber dieser Blick war anders. Es war eine Art, knapp an ihr vorbeizuschauen, die zeigte, dass der Mann sie sorgfältig aus dem Augenwinkel heraus beobachtete, indem er versuchte, so auszusehen, als würde er ihr keinerlei Beachtung schenken. Manch einer hätte behauptet, Besany sei paranoid, aber sie war eine professionelle Ermittlerin, und sie wusste es einfach: Ihre Intuition lag nur selten daneben.
Der Mann war korpulent, mittleren Alters, und seine Haare ergrauten. Ein anonym aussehender Mensch in einem ausgetragenen, hochgeschlossenen Geschäftsanzug wie Millionen andere. Er schien es sich noch einmal zu überlegen, ob er den Speederbus zur Universität nehmen sollte, und ging dann zehn Meter hinter Besany.
Sie konnte sein Spiegelbild in den Transparistahlscheiben des Galos-Einkaufszentrums sehen. Oh ja, er beschattete sie, daran gab es gar keinen Zweifel.
Und wenn du mich noch nicht verhaftet hast, bedeutet das wohl, dass du es nicht kannst … oder nicht weißt, was ich vorhabe.
Es war nur schwer vorstellbar, was nicht können bei einer Regierung bedeutete, die scheinbar Noteinsatzkräfte mit völlig sorgloser und ungehemmter Leichtigkeit losschickte. Seit Besany begonnen hatte, die Regeln zu biegen, um sie dann auf Sergeant Kal Skiratas Geheiß hin ganz und gar zu brechen, wartete sie des Nachts in stiller Furcht auf ein Klopfen an der Tür. Kal Skirata – Kal’buir, Papa Kal – wegen dessen väterlichem Charisma sie ihre lebenslange Vorsicht über Bord geworfen hatte.
Sie tat es für eine edle Sache. Daran hatte sie nie gezweifelt. Es war nur die gesunde Angst, erwischt zu werden.
Sie warf wieder einen Blick auf das Spiegelbild ihres Verfolgers in der Transparistahlscheibe, und ihr drehte sich der Magen um.
Je tiefer sie in den Konten der Großen Armee buddelte, desto mehr Anomalien fielen ihr auf – Scheinfirmen, Credits die in Klon-Einrichtungen weitab von Kamino flossen – und trotzdem tauchten nirgends Extra-Truppen zur Unterstützung der angeschlagenen Großen Armee auf, die sich jetzt zahlenmäßig gefährlich dünn quer durch die Galaxis erstreckte. Zahlen waren ihr Leben, aber die Zahlen in Kanzler Palpatines Verteidigungsbudget ergaben nicht mal ansatzweise einen Sinn.
Du stellst eine weitere geheime Armee auf, nicht wahr, Kanzler? Und deshalb sind die Kaminoaner beunruhigt. Sie wissen, dass sich etwas zusammenbraut.
Besany verlangsamte ihr Tempo nicht. Sie ging einfach weiter, immer noch relativ sicher in der Menge, versuchte sie sich zu entscheiden, ob sie weiter zur Plattform der Lufttaxis gehen sollte, um sich dort ein Taxi zu nehmen, mit dem sie vor ihrem augenscheinlichen Verfolger fliehen konnte, oder ob sie ohne klares Ziel auf den nächsten Verbindungssteg abbiegen sollte, um ihn dazu zu bringen, seine Tarnung fallen zu lassen.
Und was dann? Weglaufen? Ihn erschießen?
Der Mann war immer noch hinter ihr, als sie das Laufband betrat, welches die tiefere Ebene des Galos-Einkaufszentrums mit den Mode-Etagen verband. Sie stützte sich mit einer Hand auf das Sicherheitsgeländer, während das Band sie an den Holoauslagen verschiedenster Kleidungsstücke vorbeifuhr. Als sie sich drehte, um zur anderen Seite zu sehen, streifte sie den Mann mit einem Blick. Sie erreichte die Konfektionsabteilung und trat im letzten Moment vom Band. Und als sie schon glaubte, ihn abgehängt zu haben, sah sie ihn wieder, beim Durchstöbern einer Auslage mit unerhört aufgetakelter Unterwäsche, so als suchte er nach etwas für seine Frau. Er wirkte vertieft und völlig abwesend.
Am Ende könnte ich natürlich doch paranoid sein …
Besany drehte sich um und ging zu dem Laufband, das zu der Ebene des Verbindungsstegs zurückführte, über den sie gekommen war. Sie beschloss, falls er ihr dieses Mal erneut folgen sollte, ein Lufttaxi zu nehmen oder ihn vielleicht sogar zur Rede zu stellen. Doch, das könnte sie tun: Sie würde direkt auf ihn zugehen, ihm in die Augen sehen, charmant lächeln und fragen, ob er sie kennen würde.
Will ich ihn nur abschütteln oder herausfinden, wer er ist?
Wenn Palpatines Agenten sie umbringen wollten, so hätten sie dazu Gelegenheiten genug. Dieser Mann wollte wahrscheinlich nur herausfinden, zu wem sie gehörte und wohin sie ging. Das Laufband neigte sich zu einem leichten Gefälle hinab zum Verbindungssteg, und sie bewegte sich im Eilschritt hinunter in Richtung der Lufttaxi-Ebene. Seine einzige Alternative bestünde darin, ihr nach Hause zu folgen, und dann – dann hätte sie einen Vorwand, um ihn zu erschießen.
Und selbst dann … würde ein anderer seinen Platz einnehmen.
Wie viel wussten sie? Die Schatzamtssicherheit war ihr Ding. Sie war sich sicher, sie würden nicht realisieren, dass sie Daten aus dem Budgetsystem herunterlud.
Vor ihr hing ein Turm aus schwarzem Transparistahl, einem Wasserfall gleich, der auf jeder Etage ein Erlebnisrestaurant mit unterschiedlicher Ausrichtung bot. Sie konnte die Speisenden sehen und Flammen, die vereinzelt aufloderten, wenn die Köche Cojayav-Flügel an den Tischen zubereiteten. Außerdem sah sie noch immer das Spiegelbild des Mannes im Anzug inmitten der flanierenden Menge. Sie befanden sich mittlerweile schon recht tief im Vergnügungsdistrikt. Auf den Gehwegen wimmelte es von gut betuchten Coruscanti und Touristen, die nach der besten Küche der galaktischen Hauptstadt suchten. Dicht gedrängte Massen konnten entweder eine nützliche Rückversicherung oder aber auch der Grund dafür sein, dass das Schlimmste passierte.
Besany gab vor, nach ihrem Transit-Identichip zu suchen, steckte dabei ihr Datapad in die Innentasche ihres Mantels und griff nach dem Blaster in ihrer Tasche. Es war keine gute Idee, an diesem öffentlichen Ort eine Waffe zu benutzen. Ihre neu gewonnenen Freunde bei den Coruscant-Sicherheitskräften hätten das Problem beseitigen können, wenn sie geschossen hätte, aber sie konnten nicht Tausende Leute dazu bringen wegzuschauen. Aufmerksamkeit war das Letzte, was sie momentan brauchen konnte.
Der Platz füllte sich stetig, während sie sich der Taxi-Plattform näherte. Eine Warteschlange von Gästen, die auf Tische in der Vesari-Braterei wartete, bildete einen Damm in dem Besuchermeer, der den Passantenstrom so weit verlangsamte, dass einzelne Wirbel in der Menge entstanden. Der Mann im Anzug näherte sich Besany jetzt immer mehr. Sie sah ihn, als sie versuchte, der Schlange auszuweichen. Deshalb flitzte sie zur Seite in eine Kolonnade kleinerer Tapcafs, um die Menge zu umgehen.
Sie verließ sich darauf, dass er in der Öffentlichkeit nichts Dummes tun würde – nichts tödlich Dummes. Die Kolonnade führte zu einem Parkplatz für Privatgleiter, sodass sie, falls sie ihn überquerte, wieder zum Hauptgehweg bei der Taxiplattform kommen würde. Der Platz aus Durabeton erwies sich jedoch als verlassenes Labyrinth aus Fahrzeugen, durch das sich lange, schwarze Schatten zogen, und sie erkannte, dass sie einen gefährlichen Fehler begangen hatte. Sie hätte in der Menge bleiben sollen.
Die Hand am Blaster drehte sie sich um. Es hatte keinen Sinn zu rennen. Sie stand dem Mann nun beinahe Auge in Auge gegenüber, nur wenige Schritte entfernt, und ihre Blicke kreuzten sich.
Er schien überrascht, als sie den Blaster aus ihrer Tasche zog. Aber seine weit aufgerissenen Augen galten nicht ihr. Jemand anders stand plötzlich direkt hinter ihm, einen Arm fest um seinen Hals gelegt, sodass sein erschrecktes Keuchen abgewürgt wurde. Besany hörte ein schwaches Gurgeln. Das rechte Bein des Mannes suchte nach Halt, und dann schien er auf den Zehenspitzen stehend zu erstarren.
„Nur weil du jemanden verfolgst“, sagte eine vertraute, schmerzlich vermisste Stimme, „heißt das nicht, dass dich niemand verfolgt.“ Kleidung raschelte. „Wollen doch mal sehen, was du bei dir trägst … oh, einen hübschen DH-Siebzehn. Nicht ganz dein Stil, oder?“
Ein angeschlagener, grauer Auslieferungsgleiter senkte sich aus dem Nichts herab, und Besany blieb nicht einmal Zeit, von völliger Verwirrung auf Furcht umzuschalten. Die Seitenluke öffnete sich: Ein riesiger, haariger Wookieearm schoss heraus und zerrte den Mann hinein. Captain Ordo – Null ARC-11 Ordo, ihr Ordo, ihr Geliebter – schob die DH-17 Blasterpistole in seine Jacke und winkte sie ungeduldig zu sich. Er hätte eigentlich Lichtjahre weit entfernt im Einsatz sein sollen und nicht hier. Sie hatte nicht einmal bemerkt, dass er ihnen gefolgt war.
Der Mann im Anzug offenbar auch nicht.
„Ordo, du hast gesagt, du wärst im Äußeren Rand“, flüsterte sie und sah sich mit hämmerndem Herzen um, ob vielleicht Zeugen in der Nähe waren. „Wie lange folgst du mir schon?“
Der Gleiter sank noch etwas tiefer, und er setzte einen Fuß auf die Kante der Luke. Ohne seine makellose, weiße ARC-Trooper-Rüstung sah Ordo völlig anders aus: In den nichtssagenden, dunklen Straßenklamotten hätte er jedermann sein können. Vom Leibwächter bis zu einem Schläger der örtlichen Banden, die unvorsichtigen Touristen auflauerten.
„Ich behalte dich gern im Auge“, erwiderte er. „Steig ein.“
„Was wirst du mit ihm machen? Wenn seine Hintermänner wissen, dass er mich verfolgt hat, wissen sie, dass ich involviert bin.“
Ordo wirkte erschreckend entspannt. Fast schien es, als hätte ihm nie jemand gesagt, dass es falsch war, andere Leute zu entführen. Aber Skiratas Spezialschwadronen kidnappten, meuchelten und spionierten für die Republik, und es gab eine Unvermeidbarkeit, wenn man super-clevere, ultra-harte Kämpfer heranzüchtete: Früher oder später erkannten sie ihre Macht und setzten sie zu ihrem eigenen Vorteil ein, falls die Republik ihnen keinen Vorteil verschaffte.
„Keine Zeit für Plaudereien“, sagte Ordo. „Steig ein, cyar’ika.“
Ordo strahlte in Krisenzeiten immer unerschütterliche Zuversicht aus, und Besany verstand nun, weshalb Soldaten manchen Offizieren überallhin folgen würden. Bevor sie noch darüber nachdenken konnte, kletterte sie bereits durch die offene Gleiterluke. Befehl ohne Widerrede befolgt. Der Gestank von altbackenem Schrotbrot und Speiseöl – wahrscheinlich die vorangegangene Fracht des Gleiters – schlug ihr entgegen. In der Dunkelheit saß ein Wookiee unbeholfen zusammengekauert in den für Menschen gefertigten Sitzen und hielt den Mann in dem Anzug fest gepackt. Es war Enacca, eine von Skiratas Helferinnen. Kal’buirs Mitarbeiter bildeten einen bunten Mix aus unterschiedlichen Spezies und beruflichen Werdegängen, vom respektablen Ehrenmann bis zum unverhohlenen Halunken. Größtenteils gehörten sie jedoch zu jenen Kleinkriminellen, die allerlei Haken schlagen müssen, um über die Runden zu kommen. Skirata war sehr gut darin, einen scheinbar wahllos zusammengewürfelten Haufen dazu zu bringen, zum gegenseitigen Vorteil zusammenzuarbeiten. Er hatte den Beruf verfehlt, dachte Besany. Leute wie er wurden in der Politik gebraucht.
Enacca gab ein leise grollendes Trällern von sich. Ordo antwortete mit einem Achselzucken.
„Nein, ich habe keine Ahnung, wer dieser chakaar ist“, antwortete er. „Bring diese Kiste in die Luft, und wir finden’s raus.“
„Was wollt ihr?“, fragte der Mann. „Meine Brieftasche? Meinen Gleiter?“
Er versuchte den kleinen Mann zu spielen, aber es gelang ihm nicht. Er war nicht verängstigt – oder wütend genug – für jemanden, den man gerade von der Straße gezerrt hatte. Jedes andere Wesen wäre zu einem zitternden Häufchen Elend zusammengesunken, wenn es von einer Wookiee und einem Mann, der wie Ordo aussah, entführt worden wäre.
Ordo streckte seine geöffnete Handfläche aus. Seine andere Hand zog eine maßgefertigte, kurzläufige Verpinen-Pistole. „Nicht, dass ich annehmen würde, du hättest deinen echten Identichip dabei, aber lass mal sehen.“
Besany sank gegen das Schott. Sie fühlte sich wieder völlig sicher, aber selbst mit einer Wookiee und einem Null-ARC-Trooper, die sich um ihr Problem kümmerten, empfand sie Beklemmungen dabei, so nahe bei jemandem zu sitzen, der sie verfolgt hatte. Ihr Adrenalinspiegel sank langsam. So hatte sie sich ihre besonnene Karriere im Staatsdienst der Republik nicht vorgestellt. Vor einem Jahr war Ordo mit einem buchstäblichen Knall in ihr Leben geplatzt, und ihre Galaxis hatte sich von Grund auf verändert. Das hier war nur die neue Normalität.
Enacca ließ den Gleiter vom Parkplatz aufsteigen und überflog die künstlichen Klippen und Schluchten von Coruscant. Aus dem kleinen Heckfenster blickte Besany auf das Nachtpanorama. Sie fragte sich, wohin es wohl ginge: Enaccas Fachgebiet bestand in der Beschaffung von Fahrzeugen und sicheren Unterschlüpfen – sicher für Klone und Skiratas Kollegen jedenfalls. Wohin sie diesen Mann auch bringen würden, für ihn wäre es gewiss nicht sicher.
„Ich heiße Chadus“, sagte der Mann, und seine Augen folgten dabei Ordos Händen, die seine Brieftasche durchsuchten. „Ich arbeite in der Spätschicht der Transitbehörde.“
„Hört sich für mich nach einem Haufen osik an. Warum bist du dieser Frau gefolgt?“
„Bin ich nicht.“
„Du schleichst immer in der Unterwäscheabteilung um attraktive Frauen herum, ja? Es gibt ein Wort für Männer wie dich.“
„Ich bin ihr nicht gefolgt. Ich habe nach etwas für meine Frau gesucht –“
„Ich bin mehr so der eifersüchtige Typ. Ich hab was gegen Perverse, die meiner Freundin nachstellen.“
„Ich sage doch –“
„Und wieso trägst du dann ’ne amtliche Wumme wie diesen DH-17 bei dir?“
„Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten, Coruscant wird ein immer raueres Pflaster.“
„Ein Handblaster ist ’ne weise Vorsichtsmaßnahme. Bei all dem Gesindel.“ Ordo, der immer noch die Verp auf Chadus gerichtet hielt, griff in seine Jacke und zog den DH-17-Blaster hervor. Einen Moment lang bewunderte er ihn, dann löste er den Sicherungshebel und reichte ihn Besany. Zögernd nahm sie ihn. „Aber das ist die Waffe eines Attentäters. Weshalb sonst bräuchtest du einen Blitzdämpfer und Restlichtoptik?“
„Ich habe ihn von einem Kumpel bekommen.“
„Muss ja in einem harten Gewerbe tätig sein, dein Kumpel. Hör zu, wir können dieses Spielchen so lange spielen, wie du willst, aber ich hatte heute noch nichts zum Abendessen, und da bin ich immer ziemlich launisch.“
„Du bist ein verdammter Klon, oder?“
„Und du bist vom Geheimdienst der Republik.“
Chadus schnaubte. „Ich bin nur ein Büroangestellter.“
„Okay.“ Ordo holte seinen Handscanner hervor. „Besany, wenn er sich bewegt, schieß ihm seine gett’se ab. Wollen doch mal sehen, wer er wirklich ist.“