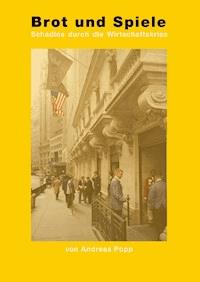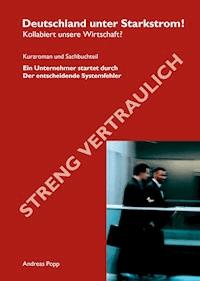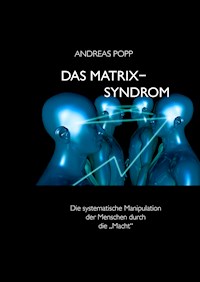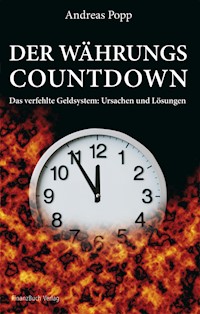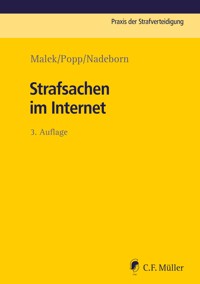
53,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das "Internetstrafrecht" hat stetig an Bedeutung gewonnen. Der Gesetzgeber reagiert auf unerwünschte neuartige Phänomene mit einer Vielzahl an Neuregelungen und Ergänzungen von Straftatbeständen und Ermittlungsmaßnahmen, mit der die Verteidigung vertraut sein sollte. Das Handbuch vermittelt das notwendige juristische Rüstzeug zur Bearbeitung internetspezifischer Strafmandate. Dargestellt werden - internetrelevante Strafvorschriften im StGB sowie im Nebenstrafrecht (UrhG, KunstUrhG, JuSchG und JMStV) - Fragen des Strafanwendungsrechts und des Allgemeinen Teils - strafprozessuale Maßnahmen zur Erhebung von Daten als digitale Beweismittel (polizeiliche Recherche im Internet; Erhebung von Verkehrs-, Nutzungs- und Bestandsdaten beim Diensteanbieter; Mitnahme bzw. Herausgabe und Sicherstellung von Datenträgern und Daten beim Beschuldigten und beim Dritten). In der 3. Auflage wurden insbesondere neu bearbeitet: - Änderungen durch das 60. StrÄndG vom 30.11.2020 (Modernisierung des "Schriften"-Begriffs und Erweiterung der Strafbarkeit nach den §§ 86, 86a, 111, 130 StGB bei Handlungen im Ausland), das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität vom 30.3. 2021 und das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom 16.6.2021 (mit Verschärfungen auf dem Gebiet des Pornografiestrafrechts) - Ablösung der TMG-Vorschriften zur Provider-Verantwortlichkeit durch den europäischen Digital Services Act zum 17.2.2024 - Berücksichtigung der Reform des Telekommunikations- und Telemedienrechts im TKG, TMG und TTDSG mit Wirkung zum 01.12.2021 und deren Folgen für die Datenerhebung nach der StPO - Einwilligung in Ermittlungsmaßnahmen nach BDSG - IT-Durchsuchung inkl. Kooperationsvereinbarung - Durchsicht von lokalen oder externen Speichermedien und der Cloud - Herausgabeverlangen und die Zurückstellung der Benachrichtigung des Beschuldigten - Erhebung und Auswertung von Passwörtern - Umgehung von Verschlüsselung - Protokollierungspflichten - Entschädigung für die Sicherstellung nach StrEG - Einziehung von Daten und Hardware
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Strafsachen im Internet
Begründet von
Dr. Klaus MalekRechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht in Freiburg
Bearbeitet von
Diana NadebornRechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht in Berlin
Prof. Dr. Andreas PoppProfessor an der Universität Konstanz
3., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Herausgeberin und Herausgeber
Praxis der Strafverteidigung Band 21
Begründet von
Rechtsanwalt Dr. Josef Augstein (†), Hannover (bis 1984) Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Beulke, Passau (bis 2022) Prof. Dr. Hans-Ludwig Schreiber (†), Göttingen (bis 2008)
Herausgegeben von
Prof. Dr. Charlotte Schmitt-Leonardy, Bielefeld Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Alexander Ignor, Berlin
Schriftleitung
Rechtsanwalt (RAK Berlin und RAK Wien) Dr. Felix Ruhmannseder, Berlin/Wien
Autorin und Autor
Prof. Dr. Andreas Popp, M.A. ist Inhaber des Lehrstuhls für Deutsches und Europäisches Straf- und Strafprozessrecht, IT-Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Konstanz Kontakt: [email protected]
Diana Nadeborn ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht in Berlin Kontakt: [email protected]
Bearbeiterverzeichnis
Popp
Rn. 1–4, 5–474
Nadeborn
Rn. 1–4, 475–757
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-6062-1
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 6221 1859 599Telefax: +49 6221 1859 598
www.cfmueller.de
© 2024 C.F. Müller GmbH, Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort der Herausgeberin und des Herausgebers
Der vorliegende Band der Reihe „Praxis der Strafverteidigung“ ist die neu bearbeitete 3. Auflage eines Klassikers, der seit vielen Jahren eine verlässliche Erkenntnisquelle im Umgang mit den Strafvorschriften, die das Internet betreffen, ist.
Die Bedeutung der Erhebungen von digitalen Beweismitteln – insbesondere von Verkehrs-, Nutzungs- und Bestandsdaten beim Diensteanbieter – sowie die Durchsicht und Beschlagnahme von Datenträgern und Daten beim Beschuldigten oder Dritten prägt das moderne Strafverfahren in zunehmendem Maße.
Mit Prof. Dr. Andreas Popp und Rechtsanwältin Diana Nadeborn führen zwei in der Materie außerordentlich bewanderte Begleiter durch dieses – stets neue Gestalten annehmende – Terrain der Strafrechtspraxis. Sie knüpfen an die Pionierarbeiten von Dr. Klaus Malek an, der die Weichen auf diesem Feld ebenso früh wie weitsichtig gestellt hat.
In der vorliegenden Auflage werden die Leserinnen und Leser insbesondere auf die Änderungen durch das 60. StrÄndG vom 30.11.2020, das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität vom 30.3.2021 und das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom 16.6.2021 eingestimmt. Die diffizilen Fragen um die Durchsicht von lokalen oder externen Speichermedien sowie solchen in der Cloud werden ebenso thematisiert wie die Erhebung und Auswertung von Passwörtern, die Umgehung von Verschlüsselung oder die Einziehung von Daten und Hardware.
Die Reihe „Praxis der Strafverteidigung“ legt damit eine weitreichend aktualisierte Darstellung der „Strafsachen im Internet“ vor, die ab den ersten Verdachtsmomenten fundierte Strategieoptionen für die Verteidigung bereithält.
Mit dem herzlichen Dank an die Autoren für ihre ebenso handhabbare wie differenzierte Darstellung verbindet sich die Hoffnung, dass der Band eine breite Leserschaft in allen Professionen des Strafrechts finden möge.
Juni 2024
Berlin
Alexander Ignor
Bielefeld
Charlotte Schmitt-Leonardy
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeberin und des Herausgebers
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
Teil 1:Materielles Internetstrafrecht
A.Die Zuständigkeit der deutschen Strafjustiz und die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts6 – 28
I.Allgemeines6, 7
II.Anwendbarkeit deutschen Strafrechts8 – 28
1.Überblick8 – 12
2.Handlungsort in Deutschland (§§ 3, 9 Abs. 1 Var. 1 StGB)13
3.Handlungsort außerhalb der Bundesrepublik14 – 24
a)Erfassung als „im Inland begangene“ Tat (§§ 3, 9 Abs. 1 Var. 3 und 4 StGB) 14 – 16
b)Erfassung als Auslandstat gegen inländische Rechtsgüter17 – 19
c)Auslandstaten gegen international geschützte Rechtsgüter20 – 22
d)Erfassung als Auslandstat eines Deutschen23, 24
4.Überlagerung durch das Herkunftslandprinzip25 – 28
B.Fragen des Allgemeinen Teils29 – 118
I.Das allgemeine Deliktssystem als Ausgangspunkt29 – 36
II.Die besonderen Verantwortlichkeitsregeln der §§ 7-10 TMG a.F., Art. 4 ff. DSA37 – 61
1.Allgemeines37 – 40
2.Das Verhältnis zu den allgemeinen Regeln des deutschen Strafrechts41, 42
3.Verantwortlichkeit für „eigene“ Inhalte43, 44
4.Verantwortlichkeit für von Nutzern bereitgestellte Informationen45 – 61
a)Reine Durchleitung von Informationen (Art. 4 DSA; § 8 TMG a.F.)47 – 54
b)Speicherung (Hosting)55 – 61
III.Tun und Unterlassen62 – 74
1.Allgemeines62 – 64
2.Fragen der Garantenverantwortlichkeit65 – 74
a)Garantenverantwortlichkeit von Diensteanbietern 66 – 69
b)Garantenverantwortlichkeit bei Verlinkung auf fremde Inhalte70, 71
c)Sonderproblem: Strafbarer Besitz 72
d)Schutz von Kindern und Jugendlichen73, 74
IV.Vorbereitung und Versuch75 – 79
V.Beteiligung80 – 110
1.Das allgemeine System: Täterschaft und Teilnahme (§§ 25 ff. StGB)80 – 93
a)Täterschaft (§ 25 StGB)80 – 84
b)Teilnahme85 – 93
aa)Anstiftung (§ 26 StGB) 87, 88
bb)Beihilfe (§ 27 StGB)89 – 93
2.Vorfeldstrafbarkeit 94 – 109
a)Allgemein strafbare Formen der Verbrechensvorbereitung (§ 30 StGB)94 – 101
b)Selbstständige Gefährdungsdelikte102
c)Kriminelle Vereinigung103 – 109
3.Verantwortlichkeit Nichtbeteiligter/Aufsichtspflichtiger 110
VI.Ausschluss strafrechtlicher Verantwortlichkeit111 – 117
1.Verbotsirrtum (§ 17 StGB)111 – 114
2.Verantwortlichkeit von Jugendlichen115 – 117
VII.Verjährung118
C.Besonderer Teil119 – 474
I.Vorbemerkungen119
II.Straftaten mit (typischerweise) wirtschaftlichem Bezug120 – 234
1.Ausspähen und Abfangen von Daten (§§ 202a ff. StGB)120 – 145
a)„Daten“ (§ 202a Abs. 2 StGB) als Tatobjekt121, 122
b)Ausspähen von Daten (§ 202a StGB)123 – 134
aa)Allgemeines123
bb)Gegenstand der Tat: Nicht für den Täter bestimmte und gegen unberechtigten Zugang besonders gesicherte Daten 124 – 129
cc)Tathandlung: Zugangsverschaffung130 – 132
dd)Weitere Hinweise133, 134
c)Abfangen von Daten (§ 202b StGB)135 – 139
d)Vorfeldtatbestand: § 202c StGB140 – 144
e)Sonderfall Geschäftsgeheimnis (§ 23 GeschGhG)145
2.Datenhehlerei (§ 202d StGB)146 – 149
3.Veränderung von Daten und Computersabotage (§§ 303a, 303b)150 – 171
a)Datenveränderung (§ 303a StGB)150 – 160
b)Computersabotage (§§ 303b StGB)161 – 171
4.Betrug (§ 263 StGB)172 – 175
5.Computerbetrug (§ 263a StGB)176 – 195
a)Allgemeines176, 177
b)Die einzelnen Tathandlungsvarianten178 – 186
aa)Programm- und Inputmanipulationen 179, 180
bb)„unbefugte“ Verwendung von Daten (Var. 3)181 – 185
cc)sonstige unbefugte Einwirkung auf den Ablauf (Var. 4)186
c)Weitere tatbestandliche Voraussetzungen187 – 193
d)Vorfeldtatbestand: § 263a Abs. 3 StGB194
e)Subsidiäre Strafvorschrift: Erschleichen von Leistungen (§ 265a StGB)195
6.Fälschungsdelikte196 – 207
a)Gebrauch unechter oder verfälschter Urkunden (§ 267 StGB)196 – 198
b)Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 269)199 – 205
c)Missbrauch von Ausweispapieren (§ 281 StGB)206, 207
7.Erpressung (§ 253)208 – 212
8.Hehlerei (§ 259 StGB)213, 214
9.Geldwäsche (§ 261 StGB)215 – 217
10.Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet (§ 127 StGB)218 – 224
11.Glücksspielstrafrecht (§§ 284 ff. StGB)225 – 234
a)Unerlaubte öffentliche Glücksspiele225 – 228
b)Tathandlungen229 – 232
c)Weitere Hinweise233, 234
III.Urheberrechtliche Straftaten235 – 265
1.Allgemeines235 – 238
2.Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke (§ 106 UrhG)239 – 254
a)Tatgegenstand240, 241
b)Tathandlungen242 – 250
aa)Vervielfältigen243 – 246
bb)Verbreiten247
cc)öffentliche Wiedergabe248 – 250
c)Weitere Hinweise251, 252
d)Qualifikationstatbestand: gewerbsmäßiges Handeln (§ 108a Abs. 1 UrhG)253, 254
3.Unerlaubte Eingriffe in verwandte Schutzrechte (§ 108 UrhG)255, 256
4.Unerlaubte Eingriffe in technische Schutzmaßnahmen und zur Rechtewahrnehmung erforderliche Informationen (§ 108b UrhG)257 – 265
a)Allgemeines257, 258
b)Insbesondere: Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen (§ 108b Abs. 1 Nr. 1 UrhG)259 – 265
IV.Geheimnisschutz266 – 270
1.Schutz privater Geheimnisse (§§ 203, 204 StGB)266 – 268
2.Verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen (§ 353d StGB)269, 270
V.Straftaten gegen fremde Persönlichkeitsrechte271 – 301
1.Tonaufnahmen einer anderen Person (§ 201 StGB)271 – 275
2.Bildaufnahmen einer anderen Person276 – 293
a)§ 33 KunstUrhG276 – 278
b)Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen (§ 201a StGB)279 – 288
aa)Allgemeines279
bb)Tatbestandlich erfasste Bildaufnahmen280 – 283
cc)Internetrelevante Tatmodalitäten284 – 288
c)Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen (§ 184k StGB)289 – 292
d)Bildaufnahmen als Kriegsverbrechen293
3.Datenschutzdelikte294 – 301
a)Allgemeines294, 295
b)Die Straftatbestände in § 42 BDSG296 – 301
VI.Stalking302 – 311
1.Allgemeines302
2.Insbesondere: Nachstellung (§ 238 StGB) 303 – 311
VII.Inhaltsbezogene Delikte312 – 445
1.Allgemeines312 – 330
a)Begriffliches312 – 315
b)Äußerungs- und Verbreitungsdelikte316 – 318
c)Von den „Schriften“ zu „Inhalten“ (§ 11 Abs. 3 StGB n.F.)319
d)Typische Tathandlungen320 – 330
aa)Verbreiten320 – 325
bb)Zugänglich machen326 – 329
cc)„Öffentliches“ Handeln330
2.Delikte gegen den demokratischen Rechtsstaat331 – 359
a)(§§ 86, 86a StGB)331 – 341
aa)Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen331 – 335
bb)Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen (§ 86a StGB)336 – 341
b)Volksverhetzung (§ 130 StGB)342 – 359
aa)Allgemeines342, 343
bb)Schutz des öffentlichen Friedens im Inland (Abs. 1)344 – 350
cc)Antidiskriminierungstatbestand (Abs. 2)351 – 354
dd)Holocaust-Tatbestand (Abs. 3)355 – 357
ee)Affirmative Bekundungen hierüber358
ff)Ergänzungstatbestand (Abs. 5)359
3.Kommunikation, die auf die Begehung von Straftaten bezogen ist360 – 383
a)Öffentliche Aufforderung zu Straftaten (§ 111 StGB)360 – 365
b)Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten (§ 126 StGB)366, 367
c)Gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten (§ 126a StGB)368 – 370
d)Anleitung zu Straftaten (§ 130a StGB)371 – 375
e)Billigung von Straftaten (§ 140 Nr. 2 StGB)376 – 379
f)Bedrohung (§ 241)380 – 383
4.Delikte gegen die persönliche Ehre384 – 395
a)Beleidigung (§ 185 StGB)384 – 389
b)Üble Nachrede und Verleumdung (§§ 186, 187 StGB)390 – 393
c)Verhetzende Beleidigung (§ 192a StGB)394
d)Rechtsverfolgung395
5.Gewaltdarstellung (§ 131)396 – 398
6.Pornographie399 – 435
a)Allgemeines399, 400
b)Die gesetzliche Regelung im Überblick401, 402
c)Tatgegenständliche Inhalte403 – 414
aa)Pornographie403 – 405
bb)Gewalt- bzw. Tierpornographie (§ 184a StGB)406 – 408
cc)Kinder- und Jugendpornographie (§§ 184b, 184c StGB) 409 – 414
d)Internetrelevante Tathandlungen415 – 432
aa)Allgemeines Pornographiestrafrecht415 – 419
bb)Absolute Verbreitungs- und Herstellungsverbote bezüglich harter Pornographie (§§ 184a-184c StGB)420, 421
cc)Nachfrage- und Besitzstrafbarkeit (§§ 184b Abs. 3, 184c Abs. 3 StGB)422 – 427
dd)„Belieferungsverbot“428 – 432
e)Bildaufnahmen nackter Minderjähriger (§ 201a Abs. 3 StGB)433 – 435
7.Jugendschutzdelikte außerhalb des StGB436 – 445
VIII.Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen446 – 461
1.Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind (§ 176a StGB)446 – 455
2.Auf künftige Missbrauchsdelikte bezogene Kommunikation456 – 461
a)Vorfeld des sexuellen Missbrauchs von Kindern i.S.d. § 176 StGB456 – 459
aa)Vollendungsäquivalente Vorbereitung (§ 176 Abs. 1 Nr. 3 StGB)456
bb)Cybergrooming: Der Vorbereitungstatbestand in § 176b Abs. 1 Nr. 1 StGB457 – 459
b)Vorfeld des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt (§ 176a Abs. 2 StGB)460
c)Verbreitung und Besitz von Anleitungen (§ 176e StGB)461
IX.Sonstige sexualbezogene Verhaltensweisen462 – 468
1.Exhibitionistische Handlungen (§ 183 StGB)462 – 464
2.Erregung öffentlichen Ärgernisses (§ 183a StGB)465
3.Prostitution 466 – 468
X.Unterlassene Hilfeleistung/Nichtanzeige geplanter Straftaten469 – 474
1.Unterlassene Hilfeleistung und Behinderung von hilfeleistenden Personen (§ 323c StGB)469 – 471
2.Nichtanzeige geplanter Straftaten 472 – 474
Teil 2:Prozessrecht
I.Überblick475 – 479
II.Polizeiliche Recherche480 – 504
1.Online-Recherche (§ 163 StPO)480 – 493
a)Regelungszweck480 – 484
b)Materielle Voraussetzungen485 – 488
aa)Adressat485
bb)Verdacht486
cc)Verhältnismäßigkeit487, 488
c)Formelle Voraussetzungen489
d)Weitere Verfahrensregelungen490 – 493
2.Verdeckte Ermittler (§ 110a StPO)494 – 504
a)Regelungszweck494 – 496
b)Materielle Voraussetzungen497 – 499
aa)Adressat497
bb)Verdacht498
cc)Verhältnismäßigkeit499
c)Formelle Voraussetzungen500, 501
d)Weitere Verfahrensregelungen502, 503
e)Erhebungs- und Verwertungsverbote504
III.Erhebung von Verkehrs-/Nutzungs- und Bestandsdaten505 – 591
1.Erhebung von Verkehrsdaten (§ 100g StPO)512 – 537
a)Regelungszweck512 – 519
aa)Erhebung von Verkehrsdaten (§ 100g Abs. 1 StPO i.V.m. §§ 9, 12 TTDSG)514, 515
bb)Erhebung von Vorratsdaten (§ 100g Abs. 2 StPO i.V.m. § 176 TKG)516
cc)Funkzellenabfrage (§ 100g Abs. 3 StPO)517
dd)IP-Catching und IP-Tracking518, 519
b)Materielle Voraussetzungen520 – 531
aa)Adressat520 – 522
bb)Verdacht523 – 527
cc)Verhältnismäßigkeit 528 – 531
c)Formelle Voraussetzungen532, 533
d)Weitere Verfahrensregelungen534 – 536
e)Erhebungs- und Verwertungsverbote537
2.Technische Ermittlungsmaßnahmen bei Mobilfunkendgeräten (§ 100i StPO)538 – 554
a)Regelungszweck539 – 542
aa)IMSI-Catcher (§ 100i Abs. 1 Nr. 1 StPO)540
bb)Stille SMS (§ 100i Abs. 1 Nr. 2 StPO)541, 542
b)Materielle Voraussetzungen543 – 547
aa)Adressat543, 544
bb)Verdacht545
cc)Verhältnismäßigkeit546, 547
c)Formelle Voraussetzungen548
d)Weitere Verfahrensregelungen549 – 551
e)Erhebungs- und Verwertungsverbote552 – 554
3.Erhebung von Bestandsdaten (§ 100j StPO)555 – 568
a)Regelungszweck556 – 559
aa)Erhebung von Bestandsdaten (§ 100j Abs. 1 S. 1 StPO)556
bb)Erhebung von Zugangssicherungscodes (§ 100j Abs. 1 S. 2, 3 StPO)557, 558
cc)Erhebung anhand von zugewiesenen IP-Adressen (§ 100j Abs. 2 StPO)559
b)Materielle Voraussetzungen560 – 565
aa)Adressat560, 561
bb)Verdacht562
cc)Verhältnismäßigkeit563 – 565
c)Formelle Voraussetzungen566, 567
d)Weitere Verfahrensregelungen568
4.Erhebung von Nutzungsdaten (§ 100k StPO)569 – 591
a)Regelungszweck569 – 573
aa)Erhebung von Nutzungsdaten (§ 100k Abs. 1, 2 StPO)571, 572
bb)Erhebung von Identifikationsdaten (§ 100k Abs. 3 StPO)573
b)Materielle Voraussetzungen574 – 584
aa)Adressat574 – 576
bb)Verdacht577 – 580
cc)Verhältnismäßigkeit 581 – 584
c)Formelle Voraussetzungen585 – 587
d)Weitere Verfahrensregelungen588 – 590
e)Erhebungs- und Verwertungsverbote591
IV.Mitnahme/Herausgabe und Sicherstellung von Datenträgern und Daten592 – 695
1.Durchsuchung (§§ 102, 103 StPO)596 – 614
a)Regelungszweck596
b)Materielle Voraussetzungen597 – 606
aa)Adressat597 – 599
bb)Verdacht600
cc)Verhältnismäßigkeit601 – 606
c)Formelle Voraussetzungen607 – 609
d)Weitere Verfahrensregelungen610 – 612
e)Erhebungs- und Verwertungsverbote613, 614
2.Durchsicht (§ 110 StPO)615 – 638
a)Regelungszweck615 – 622
aa)Durchsicht lokaler Speichermedien (§ 110 Abs. 3 S. 1 StPO)617, 618
bb)Durchsicht räumlich getrennter Speichermedien (§ 110 Abs. 3 S. 2 StPO)619 – 622
b)Materielle Voraussetzungen623 – 630
aa)Adressat623
bb)Verdacht624
cc)Verhältnismäßigkeit625 – 630
c)Formelle Voraussetzungen631
d)Weitere Verfahrensregelungen632 – 634
e)Erhebungs- und Verwertungsverbote635 – 638
3.Herausgabeverlangen (§ 95 StPO)639 – 650
a)Regelungszweck639 – 642
b)Materielle Voraussetzungen643 – 645
aa)Adressat643
bb)Verdacht644
cc)Verhältnismäßigkeit645
c)Formelle Voraussetzungen646
d)Weitere Verfahrensregelungen647 – 649
e)Erhebungs- und Verwertungsverbote650
4.Sicherstellung und Beschlagnahme als Beweismittel (§ 94 StPO)651 – 669
a)Regelungszweck651 – 654
b)Materielle Voraussetzungen655 – 658
aa)Adressat655
bb)Verdacht656
cc)Verhältnismäßigkeit657, 658
c)Formelle Voraussetzungen659 – 661
d)Weitere Verfahrensregelungen662, 663
e)Erhebungs- und Verwertungsverbote664, 665
f)Untersuchung und Auswertung von Datenträgern666, 667
g)Entschädigung für Sicherstellung668, 669
5.Beschlagnahme als Einziehungsgegenstand und Vermögensarrest (§§ 111b, 111e StPO)670 – 687
a)Regelungszweck670
b)Materielle Voraussetzungen671 – 686
aa)Tatertrag nach §§ 73 ff. StGB 671 – 674
bb)Tatprodukt, Tatmittel und Tatobjekt nach § 74 StGB 675 – 678
cc)Adressat679
dd)Verdacht680, 681
ee)Verhältnismäßigkeit682 – 686
c)Formelle Voraussetzungen687
6.Postbeschlagnahme und Erhebung von retrograden Postdaten (§ 99 StPO)688 – 695
a)Regelungszweck688
b)Materielle Voraussetzungen689 – 691
aa)Adressat689
bb)Verdacht690
cc)Verhältnismäßigkeit691
c)Formelle Voraussetzungen692, 693
d)Weitere Verfahrensregelungen694, 695
V.Verdeckte Erhebung von Telekommunikation und Daten696 – 757
1.Telekommunikationsüberwachung (§ 100a Abs. 1 S. 1 StPO)699 – 722
a)Regelungszweck699 – 704
b)Materielle Voraussetzungen705 – 713
aa)Adressat705 – 709
bb)Verdacht710 – 712
cc)Verhältnismäßigkeit713
c)Formelle Voraussetzungen714, 715
d)Weitere Verfahrensregelungen716 – 718
e)Erhebungs- und Verwertungsverbote719 – 722
2.Quellen-Telekommunikationsüberwachung (§ 100a Abs. 1 S. 2, 3 StPO)723 – 740
a)Regelungszweck723 – 729
b)Materielle Voraussetzungen730 – 733
aa)Adressat730, 731
bb)Verdacht732
cc)Verhältnismäßigkeit733
c)Formelle Voraussetzungen734, 735
d)Weitere Verfahrensregelungen736 – 739
e)Erhebungs- und Verwertungsverbote740
3.Online-Durchsuchung (§ 100b StPO)741 – 757
a)Regelungszweck741 – 746
b)Materielle Voraussetzungen747 – 751
aa)Adressat747, 748
bb)Verdacht einer Katalogtat749
cc)Verhältnismäßigkeit750, 751
c)Formelle Voraussetzungen752, 753
d)Weitere Verfahrensregelungen754 – 756
e)Erhebungs- und Verwertungsverbote757
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a.A.
andere Auffassung
ABl.
Amtsblatt
AfP
Archiv für Presserecht (Zeitschrift)
AG
Amtsgericht
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Alt.
Alternative
Anm.
Anmerkung
AnwK
AnwaltKommentar
AöR
Archiv des öffentlichen Rechts (Zeitschrift)
ARPA
Advanced Research Project Agency
ARPANET
Advanced Research Project Agency Net
Art.
Artikel
BayObLG
Bayerisches Oberstes Landesgericht
Bd.
Band
BDSG
Bundesdatenschutzgesetz
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHSt
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen (Band, Seite)
BKA
Bundeskriminalamt
BT-Drucks.
Bundestags-Drucksache
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Band, Seite)
BVerwG
Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (Band, Seite)
c't
Magazin für Computertechnik
CCC
Convention on Cybercrime
CD
Compact Disc
CD-ROM
Compact Disc – Read Only Memory
CERN
Conseil européen pour la recherche nucléaire
CR
Computer und Recht (Zeitschrift)
CRi
Computer Law Review International (Zeitschrift)
Diss.
Dissertation
DRiZ
Deutsche Richterzeitung (Zeitschrift)
DuD
Datenschutz und Datensicherung (Zeitschrift)
DVD
Digital Versatile Disk
ebd.
ebenda
EDV
Elektronische Datenverarbeitung
EG
Europäische GemeinschaftE-Mail Electronic Mail
EuGH
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
f., ff.
folgende
FPPK
Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie (Zeitschrift)
FS
Festschrift
GA
Goltdammer's Archiv für Strafrecht (Zeitschrift)
GBl.
BW Gesetzblatt Baden-Württemberg
GG
Grundgesetz
GRUR
Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht (Zeitschrift)
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz
h.M.
herrschende Meinung
HK
Heidelberger Kommentar
Hrsg.
Herausgeber
hrsg.v.
herausgegeben von
HTML
Hypertext Markup Language
i.S.d.
im Sinne des
i.S.v.
im Sinne von
IP
Internet Protocol
IRC
Internet Relay Chat
IT
Informationstechnik
IuK
Informations- und Kommunikationstechnik
IuKDG
Informations- und Kommunikationsdienstegesetz
iur
Informatik und Recht (Zeitschrift)
JA
Juristische Arbeitsblätter (Zeitschrift)
JR
Juristische Rundschau (Zeitschrift)
Jura
Juristische Ausbildung (Zeitschrift)
jurisPR-ITR
juris Praxisreport IT-Recht
JurPC
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik
JuS
Juristische Schulung (Zeitschrift)
JuSchG
Jugendschutzgesetz
JZ
Juristenzeitung (Zeitschrift)
K&R
Kommunikation und Recht (Zeitschrift)
KG
Kammergericht
KK
Karlsruher Kommentar
Kriminalistik
Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis (Zeitschrift)
KritV
Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Zeitschrift)
KUG
Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie (Kunsturhebergesetz)
LG
Landgericht
LK
Leipziger Kommentar
m.abl.Anm.
mit ablehnender Anmerkung
m.Anm.
mit Anmerkung
m.w.N.
mit weiteren Nachweisen
m.zust.Anm.
mit zustimmender Anmerkung
MDR
Monatsschrift für Deutsches Recht (Zeitschrift)
MDStV
Mediendienstestaatsvertrag
MMR
Multi Media Recht (Zeitschrift)
MP
Media Perspektiven (Zeitschrift)
NJ
Neue Justiz (Zeitschrift)
NJW
Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
NJW-CoR
NJW-Computerreport (Zeitschrift)
NJW-RR
NJW-Rechtssprechungsreport (Zeitschrift)
NStZ
Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR
Neue Zeitschrift für Strafrecht – Rechtsprechungs-Report
OLG
Oberlandesgericht
PC
Personal Computer
RDV
Recht der Datenverarbeitung (Zeitschrift)
RG
Reichsgericht
RGSt
Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
RL
Richtlinie(n)
Rspr.
Rechtsprechung
S.
Satz; Seite
s.
siehe
SK
Systematischer Kommentar
st.Rspr.
ständige Rechtsprechung
StGB
Strafgesetzbuch
StIGHE
Entscheidungen des Ständigen Internationalen Gerichtshofs
StPO
Strafprozessordnung
str.
strittig
StraFo
Strafverteidiger Forum (Zeitschrift)
StrÄndG
Strafrechtsänderungsgesetz
StV
Strafverteidiger (Zeitschrift)
TDG
Teledienstegesetz
TKG
Telekommunikationsgesetz
TKÜ
Telekommunikationsüberwachung
TMG
Telemediengesetz
UFITA
Archiv für Urheberrechte und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)
URL
Uniform Resource Locator
VG
Verwaltungsgericht
VGH
Verwaltungsgerichtshof
vgl.
vergleiche
wistra
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
WWW
World Wide Web
ZAP
Zeitschrift für die Anwaltspraxis
ZD
Zeitschrift für Datenschutz
ZRP
Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
ZUM
Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
zust.
zustimmend
Einleitung
1
Das „Internetstrafrecht“ ist heute, fast zwei Jahrzehnte nach der Erstauflage dieses Buches,[1] aus der Praxis der Strafverteidigung nicht mehr wegzudenken.[2] Mochte es anfänglich noch als Spezialmaterie gelten, die sich in erster Linie nur durch tatsächliche – eben informationstechnische – Besonderheiten auszeichnete (im Grunde also lediglich „alte Straftaten mit neuen Mitteln“[3] zum Gegenstand hatte), hat sich das Bild in den vergangenen Jahren doch zunehmend gewandelt – nicht zuletzt, weil sich inzwischen auch die Strafgesetzgebung gezielt auf unerwünschte neuartige Phänomene bezieht, die sich „im Netz“ herausgebildet haben bzw. dort besonders auffällig geworden sind,[4] und auch im Verfahrensrecht fortwährend nachjustiert, um entsprechenden Bedürfnissen der (polizeilichen) Praxis entgegenzukommen.
2
Was sich auf diesem Gebiet in den vergangenen Jahren alles getan hat, soll an dieser Stelle nicht im Einzelnen aufgelistet werden; beispielhaft genannt seien lediglich das 60. StrÄndG vom 30. November 2020 (Modernisierung des „Schriften“-Begriffs und Erweiterung der Strafbarkeit nach den §§ 86, 86a, 111, 130 StGB bei [internetgestützten] Handlungen im Ausland),[5] das „Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität“ vom 30. März 2021,[6] die Anpassung des § 238 StGB an neue Erscheinungsformen des sog. Cyberstalking,[7] die Einführung eines erstmals ausdrücklich und ausschließlich auf Internet-Sachverhalte gemünzten Straftatbestandes (Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet, § 127 StGB),[8] sowie die z.T. drastischen Verschärfungen und Erweiterungen, die das Pornographie- und Sexualstrafrecht durch das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom 16. Juni 2021[9] erfahren hat.
3
Auch auf internationaler bzw. europäischer Ebene hat die Rechtsentwicklung weiter Fahrt aufgenommen – und dies wiederum mit Rückwirkung auch auf die Strafgesetzgebung in Deutschland. Einen frühen Meilenstein setzte der Europarat mit der Budapester Convention on Cybercrime (CCC) vom 23.11.2001, der sich inzwischen fast alle Mitgliedstaaten des Europarates (aber auch einige weitere Staaten, unter ihnen Japan und die USA) angeschlossen haben.[10] Ihr folgten u.a. ein (erstes) Zusatzprotokoll vom 28.1.2003 über die „Kriminalisierung mittels Computersystemen begangener Handlungen rassistischer und fremdenfeindlicher Art“ (ETS Nr. 189) und – gleichfalls auf der Ebene des Europarates – die Lanzarote-Konvention vom 25.10.2007 (CETS Nr. 201), die insbesondere auch die Kriminalisierung von Minderjährigen-Pornographie im Auge hat.
4
Die Europäische Union arbeitete im früheren „Drei-Säulen“-System zunächst mit Rahmenbeschlüssen des Rates, hier etwa dem Rahmenbeschluss 2004/68/JI zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornografie vom 22.12.2003[11] oder dem Rahmenbeschluss 2005/222/JI über Angriffe auf Informationssysteme vom 24.2.2005.[12] Erst seit dem am 1.12.2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon können das Europäische Parlament und der Rat „gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Richtlinien Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftaten und Strafen in Bereichen besonders schwerer Kriminalität festlegen, die aufgrund der Art oder der Auswirkungen der Straftaten oder aufgrund einer besonderen Notwendigkeit, sie auf einer gemeinsamen Grundlage zu bekämpfen, eine grenzüberschreitende Dimension haben“ (Art. 83 Abs. 1 Unterabsatz 1 AEUV); zu diesen Bereichen zählt ausdrücklich auch die „Computerkriminalität“ (Unterabsatz 2).[13] Auf diesen Kompetenztitel stützen sich namentlich die Richtlinien 2011/93/EU (Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie), 2013/40/EU (Angriffe auf Informationssysteme) und (EU) 2019/713 (Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln); an ihm zu messen ist auch der jüngste Entwurf[14] einer Richtlinie „zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt“, die insbesondere Phänomene wie „cyber stalking“, „cyber harrassment“ und überhaupt „digitale Gewalt“ in den Blick nehmen (und insoweit auch Vorgaben für die Strafgesetzgebung in den Mitgliedstaaten enthalten) soll. Zunehmend erlangen aber auch außerstrafrechtliche) Maßnahmen zur Regulierung des EU-Binnenmarktes Bedeutung, die insbesondere Diensteanbieter (wie die Betreiber von Plattformen) betreffen – so beispielsweise die E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG vom 8. Juni 2000, die Verordnung (EU) 2021/784 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte[15] und nun vor allem der sog. „Digital Services Act (DSA)“, genauer: die Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.10.2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG, die seit 17. Februar 2024 unmittelbar anzuwenden ist (dazu näher Rn. 37 ff.) und im Übrigen auch das 2017 eingeführte deutsche NetzDG[16] weitgehend ablöst (begleitet vom Digitale-Dienste-Gesetz,[17] das zugleich an die Stelle des bisherigen Telemediengesetzes getreten ist). Auch auf diesem (vergleichsweise dynamischen) Gebiet wird in den nächsten Jahren noch manches in Bewegung bleiben[18] – u.U. mit Nebenwirkungen auch für das Internetstrafrecht).
5
Der Strafverteidigung hat sich somit längst ein weites Feld mit immer wieder neuartigen Sachverhalten und neuem Recht eröffnet. Gedacht ist dieses Buch gerade für sie. Nicht zu verwirklichen gewesen wäre seine Neuauflage ohne tatkräftige Unterstützung – wir danken deshalb den studentischen Hilfskräften Amelie Henjes, Felix Steffen, Maurice Bieller, Stefan Haselwander, Vincent Kreßel und Daniel Wiedemann.
Teil 1:Materielles Internetstrafrecht
A.Die Zuständigkeit der deutschen Strafjustiz und die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts
I.Allgemeines
6
Die Besonderheiten des Internets als Medium, das an nationale Grenzen nicht gebunden ist, rücken das Problem der Zuständigkeit der deutschen Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte immer wieder in den Mittelpunkt juristischer Überlegungen. Sie schließen zugleich die Frage nach der „Anwendbarkeit“ materiellen deutschen Strafrechts auf einen bestimmten Sachverhalt mit ein. Nur diese Frage scheinen die §§ 3 bis 7, 9 StGB auf den ersten Blick zu adressieren: Sie regeln (übrigens auch für das Nebenstrafrecht[1]), in welchen Fällen „das deutsche Strafrecht gilt“, und werden deshalb ebenfalls dem materiellen Strafrecht zugeordnet.[2] Aus ihnen ergibt sich nach h.M. aber auch der Zuständigkeitsbereich deutscher Strafgerichte[3]in internationaler Hinsicht. Insoweit geht es also bereits um eine Prozessvoraussetzung. Im Ergebnis laufen die Antworten auf diese beiden Fragen allerdings stets parallel: Ist die deutsche Strafjustiz zuständig, gilt in der Sache auch deutsches Strafrecht (und umgekehrt). Bei der folgenden kurzen Darstellung des internetrelevanten Strafanwendungsrechts, das sich im Wesentlichen aus den §§ 3 bis 7, 9 StGB ergibt, ist diese prozessrechtliche Dimension deshalb immer mitzudenken.
Fehlt den deutschen Strafgerichten die internationale Zuständigkeit (oft auch „Gerichtsbarkeit“ genannt), besteht ein Verfahrenshindernis,[4] das zur Einstellung des Verfahrens (außerhalb der Hauptverhandlung nach § 170 Abs. 2 bzw. § 206a StPO, in der Hauptverhandlung nach § 260 Abs. 3 StPO) und nicht etwa zu einem Freispruch führt. Diese Frage prüfen von Amts wegen auch noch die Revisionsgerichte, und dies völlig eigenständig im Freibeweisverfahren, ohne dabei an tatrichterliche Feststellungen gebunden zu sein.
7
Für die örtliche Zuständigkeit innerhalb des deutschen Strafjustizsystems gelten dagegen die Regelungen über den Gerichtsstand(§§ 7 ff. StPO). Auch insoweit kommt es zunächst auf den Tatort an (vgl. § 7 Abs. 1 StPO: „Gericht [...], in dessen Bezirk die Straftat begangen ist“), und auch insoweit orientiert man sich im Ergebnis an § 9 StGB und den hierzu entwickelten Grundsätzen.[5] Bei Auslandstaten (Rn. 17 ff.) entfällt diese Möglichkeit natürlich, so dass auf die übrigen Gerichtsstandsregelungen (§§ 8 ff. StPO) zurückgegriffen werden muss.[6]
II.Anwendbarkeit deutschen Strafrechts
1.Überblick
8
§ 3 StGB stellt das Territorialitätsprinzip an den Anfang der Zuständigkeitsnormen. Danach gilt, unabhängig von der Nationalität der handelnden und der tatbetroffenen Personen, das deutsche Strafrecht für alle Taten, die im Inland begangen werden. Die Frage, an welchem Ort eine Tat als begangen gilt, beantwortet § 9 StGB (vgl. hierzu Rn. 13, 14 ff.). Ausreichend, aber nicht zwingend erforderlich ist danach, dass auf deutschem Boden gehandelt worden ist, falls dort zumindest „der zum Tatbestand gehörende Erfolg“ eingetreten ist oder doch eintreten sollte (§ 9 Abs. 1 Var. 3 und 4 StGB). Eine „Inlandstat“ i.S.d. § 3 StGB kann unter diesen Voraussetzungen also grds. auch vom Ausland aus begangen werden (zur Problematik solcher „Distanzdelikte“ noch unten Rn. 14 ff.). Die Begründung eines inländischen Begehungsortes wirkt im Ergebnis auch für diejenigen, die hieran – wo und wie auch immer – anstiftend oder Beihilfe leistend teilgenommen haben, vgl. § 9 Abs. 2 S. 1 StGB (für Mittäter dürfte letztlich nichts anderes gelten[7]); im Übrigen gelten die §§ 3, 9 Abs. 1 StGB unmittelbar auch für Teilnehmer sowie für die in § 30 StGB geregelten Vorstufen der Beteiligung.[8]
9
Taten auf „deutschen“ Schiffen oder Luftfahrzeugen werden nach § 4 StGB im Ergebnis „so behandelt, als wären sie im Inland begangen worden“.[9] Im Übrigen werden Auslandstaten nur ausnahmsweise unter besonderen weiteren Voraussetzungen vom deutschen Strafrecht erfasst. Angeknüpft wird zum Teil an „inländische“ Interessen, die strafrechtlich auch gegen bestimmte Handlungen vom Ausland aus geschützt werden sollen, zum Teil an die Staatsangehörigkeit der Beteiligten, immer häufiger auch kumulativ oder sogar alternativ an ihren tatsächlichen Lebensmittelpunkt. Völkerrechtlich werden die damit verbundenen Interferenzen mit der Jurisdiktion des jeweiligen Tatortstaats gleichfalls unter verschiedenen Gesichtspunkten bzw. „Prinzipien“ gerechtfertigt (und in einzelnen Punkten auch in Frage gestellt).[10] Für das Internetstrafrecht besonders bedeutsam sind neben § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB (Auslandstaten Deutscher – „aktives Personalitätsprinzip“, vgl. unten Rn. 23 ff.) einige Sondervorschriften in § 5 StGB (zu ihnen Rn. 24) sowie, das Pornographiestrafrecht betreffend, in § 6 Nr. 6 StGB (Rn. 20).
10
Im Ordnungswidrigkeitenrecht bleibt es dagegen durchwegs beim Territorialitätsgrundsatz (§ 5 OWiG – mit einer dem § 4 StGB entsprechenden Ergänzung), und zwar auch im Falle einer Verbandsgeldbuße (§ 30 OWiG), soweit sie an Straftaten einzelner Repräsentanten anknüpft.[11]
11
An welchem Ort jemand in tatbestandsrelevanter Weise „gehandelt“ hat oder „der zum Tatbestand gehörende Erfolg eingetreten“ ist, lässt sich offensichtlich immer nur bezogen auf einen bestimmten Straftatbestand beantworten. Aus diesem Umstand folgerte eine in der Literatur verbreitete Ansicht, dass § 3 i.V.m. § 9 StGB das deutsche Strafrecht lediglich tatbestandsbezogen für anwendbar erkläre.[12] Andere wollten diese Rechtsfolge dagegen auf die gesamte Tat im prozessualen Sinne beziehen.[13] Der Bundesgerichtshof will als „Tat“ (im strafanwendungsrechtlichen Sinne des § 3 StGB) nunmehr ausdrücklich sämtliche „im Rahmen desselben Lebensvorgangs verwirklichten Delikte“ verstehen und damit zumindest diejenigen Straftatbestände (mit)erfassen, die tateinheitlich (§ 52 StGB) verwirklicht wurden.[14] Das bedeutet: Die so verstandene „Tat“ soll insgesamt nach deutschem Strafrecht zu verfolgen und zu bestrafen sein, wenn zumindest für einen Straftatbestand die Voraussetzungen der §§ 3, 9 StGB bejaht werden können. Anders liegt es jedoch nach wie vor bei denjenigen strafanwendungsrechtlichen Vorschriften, die sich wie die §§ 5, 6 StGB ausdrücklich auf einzelne Strafvorschriften des deutschen StGB beziehen: Sie erklären das deutsche Strafrecht dann eben auch nur tatbestandsbezogen für anwendbar.
12
Für „reine“ Auslandstaten, aber auch für bestimmte Inlandstaten mit überwiegendem Auslandsbezug sieht § 153c Abs. 1 StPO erweiterte Einstellungsmöglichkeiten vor.
2.Handlungsort in Deutschland (§§ 3, 9 Abs. 1 Var. 1 StGB)
13
Deutschem Strafrecht unterliegt die Tat jedenfalls dann, wenn der Täter im Inland in tatbestandlich relevanter Weise „gehandelt“ hat (§§ 3, 9 Abs. 1 StGB). Das setzt im Ergebnis die körperliche Anwesenheit im bundesdeutschen Hoheitsgebiet voraus.[15] Früher teilweise verfolgte Ansätze, die tatortbegründende Handlung in Internetsachverhalten als einen im Wesentlichen technisch vermittelten Vorgang zu deuten und deshalb z.B. auch einen im Inland genutzten Server genügen zu lassen,[16] haben sich zu Recht nicht durchsetzen können.
3.Handlungsort außerhalb der Bundesrepublik
a)Erfassung als „im Inland begangene“ Tat (§§ 3, 9 Abs. 1 Var. 3 und 4 StGB)
14
Ebenfalls „im Inland begangen“ und damit nach § 3 StGB uneingeschränkt nach deutschem Strafrecht zu beurteilen ist ein Delikt allerdings auch schon dann, wenn auf deutschem Territorium der zum jeweiligen Tatbestand gehörende Erfolg eingetreten ist (§ 9 Abs. 1 Var. 3 StGB), mag er auch vom Ausland aus bewirkt worden sein. Diese Form der Begründung eines inländischen Begehungsortes hat sich nun gerade im Internetstrafrecht als außerordentlich problematisch erwiesen – weniger im Hinblick auf die internetgestützte Kommunikation, die im Inland z.B. einen „zum Tatbestand“ der §§ 263, 263a StGB gehörenden Vermögensschaden verursacht (bzw. dort zumindest die insoweit entscheidende „Vermögensverfügung“ auslöst[17]), als vielmehr bei Äußerungen und anderen strafrechtlich relevanten Inhalten: Sollte die hierauf bezogenen Strafvorschriften des deutschen Strafrechts (Rn. 312 ff.) nach den §§ 3, 9 Abs. 1 Var. 3 StGB immer schon dann Anwendung finden, wenn der betreffende Inhalt über das Internet vermittelt auch in Deutschland wahrgenommen werden kann, würde damit im Ergebnis ein buchstäblich weltweiter Regelungsanspruch erhoben, der sich völkerrechtlich gegenüber anderen Staaten (mit möglicherweise abweichender, jedenfalls aber eigener Gesetzgebung) kaum legitimieren ließe[18] und praktisch auch völlig illusorisch wäre; im Übrigen müsste man Entsprechendes dann theoretisch auch allen übrigen Staaten der Welt zugestehen.[19] Die zahlreichen Lösungsversuche, die in der Literatur über die vergangenen Jahrzehnte hin entwickelt wurden, sind hier nicht im Einzelnen darzustellen. Sie gehen im Wesentlichen entweder dahin, die §§ 3, 9 Ab. 1 Var. 3 StGB durch zusätzliche Erfordernisse im Ergebnis einzuschränken auf Sachverhalte, die einen spezifischen Inlandsbezug aufweisen,[20] oder dahin, den meisten der hier interessierenden Straftatbestände schon von vornherein einen für § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB relevanten „Erfolg“ abzusprechen, da sie lediglich „Tätigkeiten“ bzw. „abstrakte“ Gefährdungen zum Gegenstand hätten.
15
Der zuletzt genannten Linie nähert sich inzwischen auch die Rechtsprechung an. In einer vielbeachteten, aber auch zu Recht vielfach kritisierten Entscheidung[21] hatte der Bundesgerichtshof im Jahre 2000 allerdings noch die Auffassung vertreten, die (internet)öffentliche Leugnung des Holocaust (§ 130 Abs. 3 StGB) durch einen in Australien handelnden australischen Staatsbürger könne in Deutschland – unabhängig von der (wohl abweichenden) Rechtslage am australischen Handlungsort – als Inlandstat (§§ 3, 9 Var. 3 StGB) verfolgt werden, wenn und weil sie dort wahrnehmbar und insoweit zugleich geeignet sei, den „öffentlichen Frieden“ zu stören.[22] Hiervon ist das Gericht aber vor einigen Jahren ausdrücklich wieder abgerückt: Als „Erfolg“ i.S.d. § 9 Abs. 1 StGB könne nur eine „von der tatbestandsmäßigen Handlung räumlich und/oder zeitlich abtrennbare Außenweltsveränderung“ verstanden werden, die § 130 Abs. 3 StGB aber eben gar nicht voraussetze[23] (näher zum Ganzen noch Rn. 348 f., 357). Bereits zuvor hatte der selbe Strafsenat auch dem „abstrakten Gefährdungsdelikt“ nach § 86a Abs. 1 Nr. 1 StGB einen strafanwendungsrechtlich relevanten „Erfolg“ abgesprochen und deshalb das Einstellen eines YouTube-Videos, in dem Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu sehen waren, von einem im Ausland gelegenen Handlungsort aus ebenfalls nicht als Inlands-, sondern als Auslandstat eingeordnet (näher dazu Rn. 339 f.). Von diesem Ausgangspunkt aus müsste dann aber auch bei anderen inhaltsbezogenen Delikten (Rn. 312 ff.) und sonstigen „abstrakten Gefährdungsdelikten“ entsprechend argumentiert werden können[24] – zumal der Gesetzgeber auf die neuere Rechtsprechung inzwischen reagiert und damit in gewisser Weise auch bestätigt hat: Insbesondere in den Fällen der §§ 86 Abs. 1 und 2, 86a Abs. 1 Nr. 1 StGB sollen nach der neuen Regelung in § 5 Nr. 3 lit. a und b StGB u.U. auch im Ausland handelnde Personen – unabhängig vom Recht des Tatorts – dem deutschen Strafrecht unterliegen, wenn sie einschlägige Propagandamittel bzw. Kennzeichen „im Inland wahrnehmbar“ verbreiten, „der inländischen Öffentlichkeit zugänglich machen“ usw., dies aber eben gerade nicht unter dem Gesichtspunkt einer auf diese Weise „im Inland begangenen“ Tat (§§ 3, 9 Abs. 1 Var. 3 StGB), sondern unter dem Gesichtspunkt einer im Ausland begangenen Tat mit „besonderem Inlandsbezug“. Ähnlich verhält es sich bei § 130 Abs. 2 Nr. 1, auch in Verbindung mit Abs. 6 StGB (§ 5 Nr. 5a lit. c StGB) und in einigen weiteren Fällen (zum Ganzen deshalb auch noch unten Rn. 224, 354, 364), während für andere „abstrakte Gefährdungsdelikte“ eine entsprechende Regelung (noch) fehlt, was der Verteidigung ggf. einen gewissen Argumentationsspielraum eröffnen könnte.
16
Nach § 153c Abs. 3 StPO kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung von Straftaten abgesehen, die „im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes durch eine außerhalb dieses Bereiches ausgeübte Tätigkeit begangen sind“, also nur wegen § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB überhaupt als Inlandstaten gelten (deshalb aber nicht schon unter § 153c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Var. 1 StPO fallen). Voraussetzung ist allerdings, dass der Verfolgung überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen, die sich wohl nur in Ausnahmefällen begründen lassen werden.
b)Erfassung als Auslandstat gegen inländische Rechtsgüter
17
Gewissermaßen unterhalb eines im Inland eingetretenen „Erfolges“ i.S.v. § 9 Abs. 1 Var. 3 StGB (mit tatortbegründender Wirkung im Inland, s.o. Rn. 14 ff.) liegen Sachverhalte, in denen sich eine im Ausland begangene Tat gerade gegen „inländische“ Interessen richtet und deshalb gleichfalls nach deutschem Strafrecht verfolgbar sein soll. Sie werden teilweise – und hier ausdrücklich unabhängig vom Recht des Tatorts – durch § 5 StGB erfasst. Für das Internetstrafrecht relevant sind neben den in Nr. 7 genannten Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen (dazu Rn. 133) vor allem der Schutz des demokratischen Rechtsstaats unter dem Gesichtspunkt der §§ 86, 86a StGB (Nr. 3 lit. a und b, dazu noch näher Rn. 339 f.) und das Verbot, Inhalte der in § 130 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 StGB bezeichneten Art zu verbreiten (§ 5 Nr. 5a lit. c StGB, dazu näher Rn. 354, 357).
18
Lediglich formal an die Staatsangehörigkeit der tatbetroffenen Person wird dagegen in § 7 Abs. 1 StGB angeknüpft („passives“ Personalitätsprinzip). Unterliegt der Tatort – wie meist – der Strafgewalt eines anderen Staates, ist dessen Strafgesetzgebung allerdings zu respektieren: Eine Tat, die nach dem Recht des Tatortstaates nicht mit Strafe bedroht ist, darf dann auch nach deutschem Strafrecht nicht verfolgt werden. Erforderlich wird damit ein gedanklicher Abgleich mit der Rechtslage am Tatort. Als genügend angesehen wird, dass das in Rede stehende Verhalten auch vom dortigen materiellen Strafrecht erfasst wird; auf weitere strafverfahrensrechtliche Voraussetzungen soll es dagegen ebenso wenig ankommen wie auf die tatsächliche Verfolgungspraxis.[25]
19
Über die §§ 153, 153a StPO hinaus kann die Staatsanwaltschaft nach § 153c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StPO ohne Weiteres von der Verfolgung von Straftaten absehen, die (ausschließlich) „außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes begangen sind“.
c)Auslandstaten gegen international geschützte Rechtsgüter
20
Ohne Rücksicht auf den Tatort oder die Nationalität der Beteiligten sollen die in § 6 StGB bezeichneten einzelnen Strafvorschriften buchstäblich weltweit gelten und ggf. auch von der deutsche Strafjustiz verfolgt werden können.[26] Für das Internetstrafrecht ist hier allenfalls Nr. 6 von Bedeutung. Sie bezieht sich ausschließlich auf die dort aufgeführten Tatbestände der Tier-, Gewalt-, Kinder- und Jugendpornographie, geht aber auch damit nach ganz h.A. viel zu weit: Völkerrechtlich ist der hier erhobene Regelungs- und Verfolgungsanspruch gegenüber anderen Staaten (insbesondere gegenüber dem jeweiligen Tatort-Staat) letztlich nicht zu rechtfertigen – oder doch nur im Kernbereich der Realkinderpornographie.[27] Einschränkend wird man deshalb einen hinreichenden Inlandsbezug der Tat verlangen müssen, wie ihn die Rechtsprechung bereits in anderen Bereichen des § 6 StGB immer wieder zur (ungeschriebenen) Voraussetzung gemacht hat;[28] er läge dann etwa in der deutschen Staatsangehörigkeit des Täters (ggf. auch des abgebildeten Opfers), nicht aber schon darin, dass die tatgegenständlichen Inhalte über das Internet auch in Deutschland verfügbar geworden sind.[29] Im Übrigen stehen der in § 6 Nr. 6 StGB postulierten Ausdehnung auf Auslandssachverhalte natürlich etliche praktische Hindernisse entgegen.
21
Auch das Prozessrecht nimmt sie letztlich weitgehend wieder zurück: Nach § 153c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StPO kann die Staatsanwaltschaft ohne Weiteres von der Verfolgung von Straftaten absehen, die (ausschließlich) „außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes begangen sind“.
22
Das Völkerstrafrecht berührt sich mit dem Internetstrafrecht bislang nur in Randbereichen (namentlich bei bestimmten Kriegsverbrechen; zu ihnen noch unten Rn. 293). Die Strafvorschriften in den §§ 6 bis 12 des deutschen Völkerstrafgesetzbuches (VStGB) gelten nach § 1 S. 1 VStGB ganz ausdrücklich „auch dann, wenn die Tat im Ausland begangen wurde und keinen Bezug zum Inland aufweist“. Verfahrensrechtlich ist dabei die besondere Vorschrift in § 153f StPO zu beachten.
d)Erfassung als Auslandstat eines Deutschen
23
Das deutsche Strafrecht erfasst Auslandstaten schließlich auch unter dem Gesichtspunkt der Staatsangehörigkeit des Täters – nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB jedenfalls dann, wenn der Täter zur Zeit der Tat Deutscher war[30] und die Tat auch am ausländischen Tatort – soweit er der „Strafgewalt“ eines anderen Staates untersteht – mit Strafe bedroht ist (dazu bereits Rn. 18).
24
Unabhängig von der zuletzt genannten Voraussetzung werden gem. § 5 Nr. 9 StGB bestimmte Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sogar immer schon dann erfasst, wenn „der Täter zur Zeit der Tat Deutscher ist“ oder „seine Lebensgrundlage im Inland hat“. Diese besondere Regelung betrifft im Internetstrafrecht zumindest die in §§ 176a, 176b und § 176e StGB zusammengefassten Tatbestände (s. dazu unten Rn. 446 ff.). Praktisch wohl noch bedeutsamer sind jedoch die gerade auf Internetsachverhalte zugeschnittenen Sonderregeln in § 5 Nr. 3 lit. a und b StGB für Auslandstaten nach §§ 86, 86a StGB (s. dazu Rn. 339 f.), in § 5 Nr. 5a lit. c StGB für Auslandstaten nach § 130 Abs. 2 Nr. 1 StGB (s. dazu Rn. 354) sowie entsprechend in § 5 Nr. 5a lit. a und b StGB für Auslandstaten nach §§ 111 und 127 StGB. Auch hier genügt alternativ zur deutschen Staatsangehörigkeit eine Lebensgrundlage im Inland.
4.Überlagerung durch das Herkunftslandprinzip
25
Hinzuweisen ist schließlich noch auf die mögliche Überlagerung der dargestellten strafanwendungsrechtlichen Regelungen durch das von der „E-Commerce-Richtlinie“ (ECRL) 2000/31/EG[31] vorgegebene und in der AVMD-Richtlinie 2010/13/EU[32] fortgeführte Herkunftslandprinzip. Im deutschen Recht war es bislang in § 3 TMG[33] verankert, der inzwischen jedoch durch eine entsprechende Regelung im neuen „Digitale-Dienste-Gesetz“ (DDG) abgelöst worden ist (§ 3 DDG).[34] Dem Grundgedanken nach soll sich, wer bestimmte Dienste grenzüberschreitend über das Internet anbietet, innerhalb der Europäischen Union nur an einer Rechtsordnung orientieren müssen – und nicht etwa an den Rechtsordnungen sämtlicher Mitgliedstaaten, die mit diesem Angebot erreicht werden. Sichergestellt werden soll insbesondere, dass der Anbieter „keinen strengeren Anforderungen unterliegt, als sie das im Sitzmitgliedstaat dieses Anbieters geltende Sachrecht vorsieht“.[35] Innerhalb des Geltungsbereichs der E-Commerce-Richtlinie – und ebenso innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie 2010/13/EU über audiovisuelle Mediendienste – sollte nach § 3 Abs. 2 TMG deshalb der freie Dienstleistungsverkehr für
•
Diensteanbieter (§ 2 S. 1 Nr. 1 TMG), die
•
in einem anderen Mitgliedstaat der EU niedergelassen sind (vgl. § 2 S. 1 Nr. 2 TMG),
•
jedoch (auch) in Deutschland geschäftsmäßig Telemedien (§ 1 Abs. 1 S. 1 TMG) anbieten oder verbreiten wollen,
grundsätzlich nicht eingeschränkt werden (für die in den beiden folgenden Absätzen 3 und 4 genannten Bereiche sollte das nicht gelten). Ausnahmen von diesem Grundsatz ließ § 3 Abs. 2 TMG nur in dem Umfang zu, der in Abs. 6 für audiovisuelle Mediendienste und in Abs. 5 für alle übrigen Telemedien beschrieben wird. Die damit getroffene Entscheidung für den freien grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr innerhalb der Europäischen Union (und damit zugleich für die gegenseitige Anerkennung der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen) galt rechtsgebietsübergreifend und damit eben auch für das Strafrecht.[36] Einzubeziehen sind insoweit auf Seiten des „Diensteanbieters“ ggf. auch dessen Organe und andere für ihn tätige Personen.[37]
26
Das neue Digitale-Dienste-Gesetz (Rn. 25) führt diese Regelung mit kleineren Aktualisierungen und redaktionellen Anpassungen, im Wesentlichen aber unverändert fort. Dem bisherigen § 3 Abs. 2 TMG entspricht (nahezu wortgleich) § 3 Abs. 2 DDG. Für die Übergangszeit scheint es allerdings sinnvoll, die bisherigen Vorschriften in § 3 TMG und die Nachfolge-Regelungen im neuen § 3 DDG nebeneinander zu behandeln, dies jeweils ausgehend vom früheren Rechtsstand. Zu beachten ist dabei, dass nun nicht mehr von „Telemedien“, sondern von „digitalen Diensten“ (§ 1 Abs. 4 Nr. 1 DDG) gesprochen wird.
27
Was die Anbieter audiovisueller Mediendienste aus anderen EU-Mitgliedstaaten im Anwendungsbereich der AVMD-Richtlinie betrifft, gestattete § 3 Abs. 6 TMG allenfalls vorübergehende Beeinträchtigungen des freien Empfangs und der Weiterverbreitung. Für strafrechtliche Sanktionen ist danach also von vornherein kein Raum, es blieb vielmehr bei der Grundregel des § 3 Abs. 2 TMG.[38] Soweit entsprechende Angebote aus anderen Mitgliedstaaten nach den §§ 3 ff. StGB überhaupt vom deutschen Strafrecht erfasst sein sollten (vgl. oben Rn. 14 ff.), setzte sich folglich das Herkunftslandprinzip durch. Dem entspricht nunmehr § 3 Abs. 6 DDG.
28
Weitergehende Einschränkungen ließ § 3 Abs. 5 TMG dagegen bei sonstigen Telemedien-Angeboten zu. Auch hier kommen aber, wie sich aus Art. 3 Abs. 4 der zugrundeliegenden E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG schließen lässt, nur „Maßnahmen“ in Betracht, die „im Hinblick auf einen bestimmten Dienst der Informationsgesellschaft“ ergriffen werden und ihrer Art nach Gegenstand einer Vorab-Konsultation des Niederlassungsstaats sein können, wie Art. 3 Abs. 4 lit. b der Richtlinie sie für den Regelfall vorsieht. Es geht also immer nur um behördliche Reaktionen auf einen konkreten Einzelfall,[39] nicht aber um generell-abstrakte Vorgaben.[40] Man kann deshalb nicht sagen, dass die in § 3 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 lit. a–c TMG angesprochenen Rechtsgebiete generell vom Herkunftslandprinzip des § 3 Abs. 2 TMG ausgenommen wurden, wie dies im (strafrechtlichen) Schrifttum immer wieder behauptet wurde.[41] Vielmehr ist in jedem einzelnen Fall – zusätzlich zu den allgemeinen Voraussetzungen des Strafanwendungsrechts (§§ 3 ff. StGB) – zu prüfen, ob das betreffende Angebot zumindest eine ernsthafte und schwerwiegende Gefahr für die in Art. 3 Abs. 4 ECRL genannten Schutzziele darstellt (vgl. § 3 Abs. 5 Nr. 1 TMG)[42] und die in Aussicht genommene Maßnahme – hier also: die strafrechtliche Sanktionierung – in einem angemessenen Verhältnis) zu diesen Schutzzielen steht (§ 3 Abs. 5 Nr. 2 TMG), was nicht ganz so leicht zu begründen sein dürfte, wenn andere EU-Staaten – und insbesondere der Niederlassungsstaat – eine vergleichbare Strafvorschrift gar nicht kennen sollten.[43] Lediglich von den in der Richtlinie sonst vorgesehenen Konsultations- und Unterrichtungspflichten bleibt die Strafverfolgung freigestellt (§ 3 Abs. 5 S. 2 Hs. 2 TMG). Auch diese Regelungen finden sich (mit einigen redaktionellen Anpassungen) sämtlich im neuen § 3 Abs. 5 DDG wieder.
B.Fragen des Allgemeinen Teils
I.Das allgemeine Deliktssystem als Ausgangspunkt
29
Ausgangspunkt ist selbstverständlich auch bei Internet-Sachverhalten der dreistufige Deliktsaufbau (Tatbestand – Rechtswidrigkeit – Schuld). Ihm vorgeschaltet ist nach heute h.A. allerdings die Frage, ob die betreffende Strafvorschrift nach den Regeln des deutschen Strafanwendungsrechts auf den in Rede stehenden Sachverhalt überhaupt Anwendung finden kann (dazu bereits oben Rn. 8 ff.). In ähnlicher Weise lassen sich vorab auch Fälle „ausfiltern“, in denen Anbieter von Vermittlungsdiensten nach dem europäischen Digital Services Act (DSA) von rechtlicher (und damit eben auch strafrechtlicher) Verantwortlichkeit frei bleiben[44] (hierzu noch näher unten Rn. 37 ff.).
30
Im Internet-Strafrecht hat man es in der Regel mit Vorsatzdelikten zu tun.[45] Unter „Vorsatz“ versteht man heute „den Willen zur Verwirklichung eines Straftatbestandes in Kenntnis aller seiner objektiven Tatbestandsmerkmale“.[46] Er muss gerade zum Zeitpunkt der Tathandlung gegeben sein. Je nach Ausprägung seiner kognitiven und voluntativen Elemente unterscheidet man drei Vorsatzformen: Absicht, Wissentlichkeit und Eventualvorsatz (dolus eventualis oder auch „bedingter“ Vorsatz). Wenn sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt, reicht für die Annahme vorsätzlichen Handelns jede Form des Vorsatzes aus.
31
Nicht vorsätzlich handelt somit, wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der (in objektiver Hinsicht) zum gesetzlichen Tatbestand gehört (§ 16 Abs. 1 S. 1 StGB). Zu den Tatumständen in diesem Sinne zählt im Falle eines begehungsgleichen Unterlassungsdelikts auch die tatsächliche Grundlage der Verantwortlichkeit als Garant. Nicht mehr Gegenstand des Vorsatzes ist hingegen die Verbotenheit des eigenen Verhaltens. Wer alle relevanten Tatumstände kennt, aber gleichwohl ohne Unrechtsbewusstsein handelt, unterliegt allenfalls einem Verbotsirrtum, der die strafrechtliche Verantwortlichkeit nur dann ausschließt, wenn er im konkreten Fall nicht zu vermeiden war (§ 17 S. 1 StGB).
32
Schwierigkeiten bereiten können Merkmale, die eine vergleichsweise anspruchsvolle Wertung erfordern (wie beispielsweise die Einordnung eines Inhalts als „pornographisch“ oder als Aussage, die etwas „verharmlost“ oder „verherrlicht“). Bei ihnen kommt es für vorsätzliches Handeln zwar nicht darauf an, ob das betreffende Wort im Gesetzestext richtig verstanden worden ist, wohl aber darauf, ob die gegebene Sachlage und das eigene Verhalten insgesamt in demjenigen Sinn erfasst werden, der dem gesetzlichen Merkmal zugrunde liegt (bzw. von der Rechtsprechung zugrunde gelegt wird).[47] Dass im Vorfeld rechtlicher Rat eingeholt worden ist, der die rechtliche Unbedenklichkeit bestätigt, könnte hier in Grenzfällen sogar schon ein Argument für unvorsätzliches Handeln sein.[48]
33
Bei Personen, die den besonderen Regeln der begrenzten Provider-Verantwortlichkeit in Art. 4 ff. DSA (vormals §§ 8 bis 10 TMG) unterfallen (dazu ausführlich Rn. 37 ff.), hängen die Anforderungen an den Tatbestandsvorsatz im Ergebnis auch von den Bedingungen ab, unter denen sie nach diesen Regeln überhaupt nur „verantwortlich“ sein können. Setzt etwa die rechtliche Verantwortlichkeit eines Host-Providers für von Nutzern bereitgestellte Informationen die positive Kenntnis bestimmter Umstände voraus (Rn. 56), kommen in strafrechtlicher Hinsicht letztlich nur Fälle in Betracht, in denen das kognitive Element des Vorsatzes entsprechend ausgeprägt ist.[49] Bleiben andererseits Access-Provider sogar dann von rechtlicher Verantwortlichkeit frei, wenn sie von entsprechenden Umstände sichere Kenntnis haben (Rn. 53), stellen sich strafrechtliche „Vorsatz“-Fragen von vornherein nicht.
34
Besondere Probleme der ausnahmsweisen Rechtfertigung straftatbestandsmäßigen Verhaltens stellen sich nur in einzelnen Randbereichen; „internetspezifisch“ sind sie regelmäßig nicht. Bei den Beleidigungsdelikten (§§ 185 ff. StGB) ist mit der Wahrnehmung berechtigter Interessen (§ 193 StGB) ein besonderer Rechtfertigungsgrund zu beachten.
35
Im Übrigen sind für inhaltsbezogene Delikte (Rn. 312 ff.) Einschränkungen bereits im objektiven Tatbestand typisch. So lassen beispielsweise die §§ 86, 86a StGB das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ebenso wie das Verbreiten entsprechender Propagandamittel unangetastet, wenn die betreffende Handlung „der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient“ (§§ 86 Abs. 4, 86a Abs. 3 StGB); vergleichbare Ausgrenzungen werden auch bestimmten Bildaufnahmen vorgenommen (vgl. § 184k Abs. 3, 201a Abs. 4 StGB), ebenso, wenngleich etwas enger, bei der Gewaltdarstellung (§ 131 Abs. 2 StGB). In anderen Zusammenhängen finden sich zunehmend auch funktionsbezogene Tatbestandsausnahmen für dienstliches bzw. berufliches Handeln (so z.B. in §§ 176e Abs. 4, 184b Abs. 5, 202d Abs. 3 StGB).
36
Ist nach dem Vorstehenden eine „rechtswidrige Tat“ (§ 11 Abs. 1 Nr. 5 StGB) gegeben, bleibt in der Regel nur noch die strafrechtliche Verantwortlichkeit („Schuld“) zu prüfen. Sie wird freilich nur in Ausnahmefällen im Zweifel stehen (zu ihnen noch unten Rn. 111 ff.).
II.Die besonderen Verantwortlichkeitsregeln der §§ 7–10 TMG a.F., Art. 4 ff. DSA
1.Allgemeines
37
Besondere Regeln für die „Verantwortlichkeit“ von Diensteanbietern waren bis vor Kurzem dem Telemediengesetz (TMG)[50] zu entnehmen (§§ 7 bis 10 TMG). Sie waren gerade rechtsgebietsübergreifend konzipiert und deshalb nach allgemeiner Auffassung auch im Strafrecht zu berücksichtigen. Zum 17. Februar 2024 ist an ihre Stelle unmittelbar – und vorrangig – anzuwendendes Unionsrecht getreten, nämlich die Art. 4 bis 8 des sog. Digital Services Act (DSA), genauer: der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG.[51] Auf eben dieser Richtlinie – der sog. „E-Commerce-Richtlinie“ (ECRL) – beruhten bereits die §§ 7 bis 10 TMG; was dort in den Art. 12 bis 15 noch als Vorgabe für die Gesetzgebung der einzelnen Mitgliedstaaten formuliert war, schreibt der Digital Services Act – nun aber als unmittelbar geltende Verordnung (Art. 288 Abs. 2 AEUV) – im Wesentlichen fort. In der Sache ändert sich also gar nicht allzu viel.[52] Für die Übergangszeit scheint es allerdings sinnvoll, die bisherigen Vorschriften des (inzwischen insgesamt aufgehobenen) deutschen TMG und die Nachfolge-Regelungen im europäischen DSA nebeneinander zu behandeln, dies jeweils ausgehend vom früheren Rechtsstand.
38
Die §§ 7 bis 10 TMG betrafen als „Diensteanbieter“ jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt (§ 2 Nr. 1 TMG), und dies ausdrücklich unabhängig davon, ob für die Nutzung ein Entgelt erhoben wird oder nicht (§ 1 Abs. 1 S. 2 TMG);[53] einbezogen waren deshalb grds. auch Privatpersonen. Als „Telemedien“ kamen grundsätzlich alle elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste in Betracht, nach der Systematik des Gesetzes allerdings mit Ausnahme derjenigen Dienste, die § 1 Abs. 1 S. 1 TMG explizit den Regeln des Rundfunkrechts bzw. des Telekommunikationsgesetzes (TKG) überlassen wollte; dies betraf – in der zuletzt geltenden Fassung der Norm[54] – namentlich die in § 3 Nr. 61 TKG genannten Telekommunikationsdienste und damit nicht zuletzt „Internetzugangsdienste“ (§ 3 Nr. 61 lit. a TKG), die deshalb sinnwidrig aus dem Anwendungsbereich des § 8 TMG herauszufallen drohten.[55]
In seinem dritten Abschnitt (§§ 7 bis 10) fasste das TMG die Regelungen über die rechtliche „Verantwortlichkeit“ von Diensteanbietern zusammen. Sie waren größtenteils als „Umsetzung“ der vollharmonisierenden europäischen Vorgaben über die eingeschränkte Verantwortlichkeit der Vermittler (intermediary service providers) in Art. 12 bis 15 ECRL zu verstehen und wie diese horizontal – über alle Rechtsgebiete hinweg – konzipiert. In ihrer Systematik führten sie allerdings zunächst die grundlegende Unterscheidung ihrer Vorläuferbestimmungen (seit § 5 TDG 1997) zwischen „eigenen“ und „fremden“ Informationen (bzw. „Inhalten“) fort. Während Diensteanbieter für „eigene“ Informationen, die sie für andere zur Nutzung bereithielten, (selbstverständlich) „nach den allgemeinen Gesetzen“ verantwortlich waren (§ 7 Abs. 1 TMG), sollte für Dienstleistungen, die in Hinsicht auf „fremde“ Informationen erbracht wurden, grundsätzlich gerade das Gegenteil gelten; innerhalb gewisser Grenzen waren Diensteanbieter nach den §§ 8 bis 10 TMG in ihrer Funktion als schlichte Vermittler „nicht verantwortlich“, insbesondere also auch nicht unter strafrechtlichen Gesichtspunkten. Gezogen wurde damit allein eine negative äußere Grenze: Eine (straf)rechtliche Verantwortlichkeit konnte allenfalls unter den Voraussetzungen bestehen, die in den §§ 8 bis 10 TMG festgelegt waren – ob sie dann bestand, hing dann aber allein von den Tatbeständen und den allgemeinen Regeln des materiellen Strafrechts ab.
Im Einzelnen unterschied das TMG innerhalb der hier denkbaren Vermittlungsleistungen
•
die Durchleitung von Informationen (§ 8 TMG – vgl. Art. 12 ECRL),
•
die Zwischenspeicherung zur beschleunigten Übermittlung von Informationen (§ 9 TMG – vgl. Art. 13 ECRL) und
•
die Speicherung von Informationen (§ 10 TMG – vgl. Art. 14 ECRL).
Es ist wichtig zu sehen, dass damit jeweils Funktionen angesprochen werden, für die die betreffende Verantwortlichkeitsregel gelten soll. Eine Person (oder ein Unternehmen) kann also – je nach Zusammenhang – verschiedene davon übernehmen (und daneben natürlich auch noch „eigene“ Inhalte bereitstellen). Nicht zuletzt können „Diensteanbieter“ auch in die Rolle ihres Gegenübers – der Nutzer (§ 2 Nr. 3 TMG) – wechseln[56] (wer eine eigene Website betreibt, ist beispielsweise Diensteanbieter bezüglich der dort eingestellten „eigenen“ Informationen, kann aber seinerseits Nutzer eines Webhosting-Dienstes sein).
39