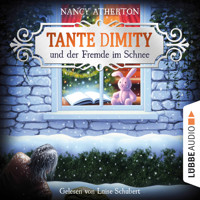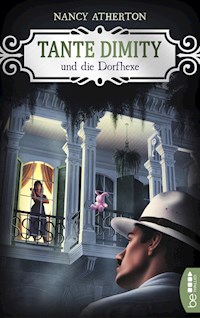5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
Lori und Bill sind nach England gezogen und wohnen jetzt in Tante Dimitys Cottage. Die frisch gebackene Mutter Lori hat alle Hände voll zu tun und ist erleichtert, als die attraktive Francesca ihre Hilfe als Kindermädchen für die Zwillinge anbietet. So bleibt ihr Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, die in Finch für Aufregung sorgen. Durch die Entdeckung eines antiken Römergrabes und die Ankunft eines umtriebigen Archäologen droht das geplante traditionelle Erntedankfest ins Wasser zu fallen. Kann Lori mit Hilfe von Tante Dimitys übersinnlichen Kräften den Frieden im Dorf wiederherstellen und verhindern, dass gefährliche Geheimnisse ans Licht kommen?
Ein gemütlicher Wohlfühlkrimi mit Suchtpotential. Jetzt als eBook bei beTHRILLED.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Lilians Zitronenstangen.
"Kein anderer Krimi ist so liebenswert wie ein Tante-Dimity-Abenteuer!" (Kirkus Reviews)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog
Lilians Zitronenstangen
Über dieses Buch
Lori und Bill sind nach England gezogen und wohnen jetzt in Tante Dimitys Cottage. Die frisch gebackene Mutter Lori hat alle Hände voll zu tun und ist erleichtert, als die attraktive Francesca ihre Hilfe als Kindermädchen für die Zwillinge anbietet. So bleibt ihr Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, die in Flinch für Aufregung sorgen. Durch die Entdeckung eines antiken Römergrabes und die Ankunft eines umtriebigen Archäologen droht das geplante traditionelle Erntedankfest ins Wasser zu fallen. Kann Lori mit Hilfe von Tante Dimitys übersinnlichen Kräften den Frieden im Dorf wiederherstellen und verhindern, dass gefährliche Geheimnisse ans Licht kommen?
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten „Tante Dimity“ Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Amerikanischen von Christine Naegele
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Alvaro Cabrera Jimenez | Montreeboy
Illustration: © Jerry LoFaro
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3372-5
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity Digs In« bei Penguin Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 1999 by Nancy T. Atherton
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2006
by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
ICH WAR MUTTER von zwei Säuglingen, und ich war zur Trinkerin geworden: zwei Kannen Tee am Vormittag, und noch vor dem Mittagsschlaf eine weitere. Und aus irgendeinem Grund hatte ich Schwierigkeiten zu schlafen.
Es lag nicht am Koffein – als stillende Mutter hielt ich mich an Kräutertee –, und es waren auch nicht die Zwillinge. Nach drei zermürbenden Monaten, in denen ich praktisch rund um die Uhr stillte, hatten Will und Rob endlich gemerkt, wie viel schöner es ist, die Nacht durchzuschlafen, und auch ihren Eltern Gelegenheit gegeben, die Freude daran wieder neu zu entdecken. Mein Mann und ich hatten jetzt sechs Stunden himmlischer Ruhe, in denen wir ohne Unterbrechung schlafen und uns von den Strapazen des Tages erholen konnten.
Aber während Bill diese kostbaren Stunden ausgiebig nutzte und meist noch angekleidet auf dem Sofa entschlummerte, reichte es bei mir nur zu unruhigen, kurzen Nickerchen, während dieser ich mit einem Ohr auf das leiseste Weinen, das kleinste Husten oder den winzigsten Schnaufer lauschte.
Es war nicht nur die typische Überempfindlichkeit der frischgebackenen Mutter, die mir den Schlaf raubte. Will und Rob waren zu früh geboren, im März statt im April, und sie hatten ihre erste Lebenswoche im Brutkasten verbracht. Jetzt, mit vier Monaten, waren sie zwar bärenstark und hatten Lungen wie Perlentaucher, aber die Ängste dieser ersten ungewissen Tage waren nie ganz von mir gewichen.
Die Welt, die mich bisher überwiegend freundlich behandelt hatte, war zu einem bösartigen, bedrohlichen Ort geworden, wo jede Ecke eines jeden Couchtisches lediglich dazu geschaffen war, dass meine Söhne sich den Kopf daran aufschlagen konnten. Es war meine und Bills Aufgabe, unsere Kinder vor tückischen Couchtischen zu schützen, und wir nahmen unsere Aufgabe sehr ernst.
Wir waren aus Bills Familiensitz im lebhaften, lärmenden Boston geflohen und hatten die Jungen nach England gebracht, in ein Cottage aus honigfarbenem Stein in einer ruhigen, idyllischen Ecke der Cotswolds. Dieses Häuschen hatte mir die beste Freundin meiner Mutter hinterlassen, eine Frau namens Dimity Westwood, und für mich gab es keinen geeigneteren Ort, um Kinder großzuziehen.
Bill radelte jeden Tag nach Finch, dem nächsten Dorf, wo er in seinem Büro am Dorfplatz die Geschäfte für die Anwaltskanzlei, die er mit seinem Vater führte, per E-Mail, Fax und Telefon abwickelte. Einmal im Monat fuhr er nach London oder auch weiter weg, wenn es nötig war, aber meist war er zum Mittagessen zu Hause und kam auch zum Abendessen selten zu spät.
Dabei war es nicht das Essen, was ihn anzog. Seit den ersten Wochen meiner Schwangerschaft waren meine kulinarischen Ambitionen hauptsächlich auf die Herstellung gesunder Babynahrung beschränkt. Bill hatte sich daran gewöhnt, zu den Mahlzeiten meist irgendwelche geheimnisvollen Breis und Pürees zu probieren.
William Willis junior war ein Ehemann, wie ihn sich jede Frau erträumt, und ein Vater, wie ihn jedes Kind haben sollte. Er wickelte die Babys, badete sie, sang sie in den Schlaf und fand sich auch heldenhaft mit meinen hormonell bedingten Stimmungsschwankungen nach der Entbindung ab, als der Umschwung zwischen Gelächter und Tränen unvorhersehbar war und sich von einer Sekunde auf die andere vollziehen konnte. Wie ich ging er in der Fürsorge um unsere Söhne auf und schien für meine Besessenheit, ihre Umgebung so sicher wie möglich zu gestalten, Verständnis zu haben. Als ich jede Ecke unserer Möbel mit Flanell umwickelte, protestierte er ebenso wenig, wie als ich an sämtlichen Schranktüren in der Küche Sicherheitsschlösser anbrachte, die so kompliziert waren, dass wir sie tagelang nicht öffnen konnten.
Aber als Bill eines Abends Anfang Juli in unser Schlafzimmer kam, wo mir die Jungen in ihren Babywippen zusahen, wie ich die Matratze von unserem Bett wuchtete, das so groß wie ein Fußballplatz war, musste er wohl annehmen, dass ich vollends übergeschnappt sei.
»Lori«, sagte er leise von der Tür her, »was machst du da?«
»Ich nehme die Matratze vom Bett«, schnaufte ich, indem ich vergeblich an einer Ecke zerrte.
»Warum?«, fragte Bill vorsichtig.
Ich verdrehte die Augen, als sei die Erklärung sonnenklar. »Was ist, wenn Will und Rob unter das Bett krabbeln und es über ihnen zusammenbricht? Es ist viel sicherer, die Matratze auf der Erde zu haben.«
Bill warf einen Blick auf die vier pummeligen Babyknie und die herumfuchtelnden Händchen, die noch nicht einmal den Teppich erreichten, und sagte: »Aha.«
In seiner Stimme war etwas, das mich innehalten ließ. Ich starrte auf die Matratze, sah hinüber zu den Jungen und wich dann vor dem Bett zurück, als stünde es in Flammen. »Bill«, flüsterte ich erschreckt, »was mache ich eigentlich hier?«
»Die Frage ist eher, was du nicht machst.« Bill nahm mich bei der Hand und zog mich zum Sessel neben dem Toilettentisch. Er schob die Matratze wieder aufs Bett zurück, hockte sich einen Moment hin, um Will auf den Bauch zu prusten und Rob neckend zu kitzeln, dann setzte er sich vor mich auf die Fußbank. »Du schläfst kaum«, erklärte er. »Du isst nicht vernünftig. Du hast kaum Bewegung an der frischen Luft.« Er sah die Matratze bedeutungsvoll an. »Kein Wunder, dass du langsam durchdrehst.«
»Aber ... aber die Jungen ...«, jammerte ich.
»Die Jungen sind kerngesund und munter«, unterbrach Bill mich. Er drehte sich um und schnitt seinen zufrieden vor sich hin brabbelnden Söhnen ein Gesicht. »Schau sie dir an. Dr. Hawkings hat selbst gesagt, dass er noch nie Frühchen gesehen hat, die so prächtig gedeihen. Du machst es großartig, Lori.«
Ich lächelte mühsam. »Wir machen es großartig.«
»Ich helfe, so gut ich kann«, sagte Bill, indem er sich mir wieder zuwandte, »aber ich bin nicht den ganzen Tag hier wie du. Ein Kind kann eine Mutter schon bis zur Erschöpfung fordern, und du hast zwei. Gib’s zu, Schatz – du bist zahlenmäßig unterlegen.«
Ich lehnte mich im Sessel zurück und nickte kleinlaut. »Ich bin in letzter Zeit auch so viel müder als früher.«
»Und erschöpfter«, sagte Bill mit Nachdruck. »Jetzt, wo die Jungen aus dem Gröbsten heraus sind und anfangen, feste Nahrung zu essen, wird es Zeit, dass du dir eine Pause gönnst.«
»Ich soll meine Babys verlassen?«, fragte ich entsetzt.
»Natürlich nicht«, sagte Bill schnell. »Aber ich habe die Sache mit Dimity besprochen ...«
»Wann?«, wollte ich wissen. »Wann hast du mit Dimity darüber gesprochen?«
»Vorige Woche, als du den Badezimmerschrank mit dem Vorhängeschloss gesichert und den Schlüssel versteckt hast, damit die Jungen ihn nicht finden«, erwiderte Bill. »Weißt du inzwischen wieder, wo du ihn hingetan hast?«
»Äh ...«
»Macht nichts.« Bill zog meine Füße auf seinen Schoß und fing an, sie sanft zu massieren. »Hauptsache ist, dass Dimity es für richtig hält, dass wir jemanden einstellen, der dir mit Rob und Will hilft. Und das finde ich auch.«
Ich sah ihn ungläubig an. »Das kann nicht dein Ernst sein. Ich würde meine Kinder nie einer Fremden überlassen.«
»Dann kann sie mit der Wäsche und dem Kochen und der anderen Hausarbeit helfen«, war Bills vernünftige Antwort. »Egal was, die Hauptsache ist, du bist entlastet. Lori«, sagte er und nahm meine Zehen fest in die Hand, »Tante Dimity sagt, es sei Zeit, dass du dich um dich selbst kümmerst, sonst schadest du unseren Kindern mehr, als dass du ihnen nützt.«
Bill hatte das Zauberwort gesprochen. Vernünftigerweise sagte er nichts weiter, sondern wartete auf die Wirkung. Er wusste, dass ich mich nie gegen das auflehnte, was Tante Dimity sagte – oder vielmehr, was sie schrieb, da die Gespräche mit ihr sich auf das beschränkten, was sie in ein kleines blaues Buch mit Ledereinband schrieb, das in unserem Arbeitszimmer lag. Seit der Geburt der Jungen war ich zu beschäftigt gewesen, mich an Tante Dimity zu wenden, aber es schien, dass sie mich beobachtete und sich Sorgen machte.
Hatte ich ihr wirklich Anlass dazu gegeben? Ich schloss die Augen und dachte über die vergangenen drei Monate nach. Einige Szenen waren mir noch besonders deutlich in Erinnerung: wie während eines der häufigen Besuche von Willis senior Bill und sein Vater Seite an Seite Windeln wechseln; das erste Bad der Jungen in der gepolsterten Babybadewanne; dann ein kostbarer, stiller Morgen, Bill schaukelt Will, während ich Rob stille, wir beide im Schlafanzug und noch ganz verschlafen, aber völlig vernarrt in die zwei Bündel in unseren Armen. Aber die meisten dieser Erinnerungen sind unscharf, ein Tag verschwimmt mit dem nächsten, ohne Form und Unterschied, wie ein Aquarell, das in einen Regenguss geraten ist. So wollte ich mich an die Kindheit meiner Söhne später eigentlich nicht erinnern.
»Vielleicht habt ihr recht, Dimity und du«, räumte ich schließlich ein. »Vielleicht habe ich es wirklich übertrieben.«
Bill unterdrückte mühsam ein Lachen und zog mich auf seinen Schoß. »Hast du jemals etwas getan, ohne es zu übertreiben?«, fragte er, indem er die Nase in meine Locken grub.
Ich grinste verlegen. »Okay, ich gebe es ja zu. Ich könnte schon etwas Hilfe gebrauchen.« Ich befreite mich aus seinen Armen und fragte: »Aber wie finde ich hier die richtige Hilfe? Ich kenne niemanden im Dorf.«
Obwohl wir schon fast ein Jahr im Cottage wohnten, war Finch mir immer noch so fremd wie die Rückseite des Mondes. Während meiner Schwangerschaft hatte ich nichts anderes getan als Bücher über Kindererziehung zu lesen, ziemlich unförmige Babysöckchen zu stricken und nahrhafte Nahrung zu mir zu nehmen. Mein Terminkalender hatte Staub angesetzt.
»Wir kennen nur Emma und Derek«, sagte ich, »aber die haben schon genug zu tun.« Emma und Derek Harris wohnten nicht weit von uns entfernt in einem Landhaus aus dem vierzehnten Jahrhundert, das sie von Grund auf renoviert hatten. Emma hatte früher als erfolgreiche Informatikerin gearbeitet und war inzwischen eine Meisterin im Gartenbau; Derek war ein Bauunternehmer, der sich auf Renovierungen spezialisiert hatte. Sie waren hier in England unsere besten Freunde, aber irgendwie zweifelte ich daran, dass sie sich mit Begeisterung aufs Fußbodenputzen oder Windelnwaschen stürzen würden.
»Dann sind da natürlich noch Ruth und Louise«, überlegte ich weiter, »aber ich glaube nicht, dass sie noch die nötige Kraft haben.« Ruth und Louise Pym, zwei identische Zwillingsschwestern, bewohnten ein Haus am Rande des Dorfes. Niemand wusste, wie alt sie waren, aber die Tatsache, dass sie sich genauso lebhaft an den Ersten wie an den Zweiten Weltkrieg erinnerten, ließ darauf schließen, dass sie nicht mehr die Jüngsten waren.
»Und Sally Pyne ...« Ich stand auf und hakte im Geist die wenigen Namen auf der Liste der Dorfbewohner ab, die ich persönlich kannte. Sally Pyne, eine entzückende, weißhaarige Witwe, war die Inhaberin des Tearoom neben Bills Büro. Sie war gutmütig und tatkräftig, »... aber Emma sagt, dass Sallys Enkelin diesen Sommer bei ihr verbringt, also wird sie auch alle Hände voll zu tun haben. Wer also ...?« Ich sah Bill an. Er betrachtete aufmerksam seine Fingernägel, wobei er süffisant lächelte. »Sag mir bloß nicht, dass du schon jemanden gefunden hast!«
»Okay, dann also nicht.« Bill nickte zustimmend und beugte sich vor, um den krähenden Rob aus seiner Babywippe zu heben. »Jetzt lass uns erst mal diese armen Würmer füttern und fürs Bett fertig machen.«
Den Rest des Abends verbrachte ich damit, meinem Mann, der unerträglich selbstzufrieden schien, weitere Informationen zu entlocken – ebenso wie Dimity –, aber das Einzige, was ich in Erfahrung bringen konnte, war, dass »eine geeignete Kraft« in Kürze eintreffen würde.
Deshalb war es keine besonders große Überraschung, als die Schwestern Pym am Montagmorgen auf dem Plattenweg angeflattert kamen, begleitet von einer ruhigen, kompetent und zuverlässig aussehenden Frau.
Kapitel 2
ICH WAR ETWAS durcheinander, als ich die Tür öffnete. Über die eine Schulter hielt ich Will, über die andere Rob, und meine Schürze war großzügig mit grünlichem Brei beschmiert.
Dagegen sahen Ruth und Louise Pym aus, als kämen sie gerade von einer Gartenparty Eduards VII. Wie immer trugen sie identische perlgraue Seidenkleider mit Spitzenkragen und winzigen Perlknöpfchen. Ihre identischen Hälse schmückten identische cremefarbene Gemmen, an ihren winzigen Busen hatten sie Lavendelsträußchen geheftet. Ihre zarten, aber geschickten Händchen steckten in cremefarbenen Zwirnhandschuhen.
Die dritte Frau, welche die Schwestern um Haupteslänge überragte, sah aus wie eine exotische Gewächshausblume neben zwei Herbstastern. Ich hatte sie noch nie gesehen, sie war groß, breitschultrig und von üppiger Figur. Sie hatte einen olivenfarbenen Teint, volle Lippen und sehr dunkle mandelförmige Augen. Ihr braunes Haar war aus der hohen Stirn zurückgekämmt und im Nacken zu einem kunstvollen Knoten geschlungen. Sie trug ein einfaches weißes Hemdblusenkleid, dazu bequeme flache Schuhe. Der offene Kragen ihres Kleides gab den Blick auf ein merkwürdiges Bronzemedaillon frei, das sie an einem Lederband um den Hals trug.
Ich bemerkte den raschen, abschätzenden Blick ihrer dunklen Augen und errötete verlegen, als ich die Pyms begrüßte. Selbst an meinen besseren Tagen sah ich neben ihnen immer wie eine Putzfrau aus, und dies war keiner meiner besseren Tage.
»Meine liebe Lori«, sagte Ruth. Ruth sprach immer als Erste. Es war das einzige Merkmal, woran ich die Schwestern auseinanderhalten konnte. »Du bist ja der wahre Inbegriff ...«
»... einer beschäftigten Mutter«, fuhr Louise fort. Ein Gespräch mit den Pym-Schwestern war wie ein Pingpong-Spiel. »Wir hoffen, wir kommen ...«
»... nicht ungelegen. Wir hätten erst angerufen ...«
»... aber Bill riet uns, gleich herzufahren.«
Das Auto der Pyms, ein altertümliches Vehikel mit Holzkonsole, Samtpolstern und Trittbrett, stand in der Kieseinfahrt neben meinem schwarzen Morris Mini und dem Mercedes, den Bill bei Regenwetter fuhr.
»Ihr wisst, dass ich mich immer freue, euch zu sehen«, versicherte ich ihnen, wobei ich wünschte, ich hätte mir noch die Zeit genommen, den Jungen das Gesicht zu waschen, ehe ich die Tür öffnete.
»Und wie geht es deinen ...«
»... goldigen Engelchen denn heute?«
»Gut, sehr gut«, brachte ich heraus. Will und Rob hatten die vertrauten Stimmen der Pyms erkannt und versuchten beide, sich umzudrehen, um das einzige weitere Zwillingspaar zu sehen, das sie kannten. Wie Bill am Abend zuvor bemerkt hatte, war ich in der Minderheit, und als die dunkeläugige Frau die Hände nach Will ausstreckte, gab ich ihn ihr mit einem bisher nie gekannten Gefühl der Erleichterung.
»Danke«, sagte ich. Als ich Rob herumdrehte, damit er sehen konnte, wo sein Bruder war, empfand ich eine leichte Enttäuschung, die eigentlich widersprüchlich war. Will hatte sich allzu leicht in sein Schicksal gefunden. Fröhlich sabberte er auf das Kleid der dunkeläugigen Frau und war viel zu eifrig damit beschäftigt, mit Ruth zu flirten, als dass er sich darüber hätte Gedanken machen können, auf wessen Arm er war.
Ruth war gegen seinen Charme nicht immun, aber als sie sich vorbeugte, um ihre Nase gegen seine zu reiben, sagte sie verwundert: »Lori, bist du sicher, dass unser kleiner Liebling ...«
»... auch nicht krank ist?« Louises Vogeläuglein betrachteten meinen Sohn ebenfalls mit Besorgnis.
»Das glaube ich nicht«, sagte ich, bekam aber dennoch sofort Herzklopfen. »Warum? Was ist mit ihm?«
Ruth zog die Stirn in Falten. »Es sieht aus, als ob er ...«
»... lauter kleine grüne Flecken auf der Haut hat. Und sein Brüderchen auch.«
Louise betrachtete den sich windenden Rob eingehender. »Ich habe schon Babys mit roten Flecken gesehen und mit rosa Flecken auch ...«
»... aber niemals mit grünen«, sagte Ruth. »Ich hoffe doch, es ist keine ...«
»... Tropenkrankheit.«
Mein Herz beruhigte sich wieder. »Es ist keine seltene Krankheit«, erklärte ich, »das sind Avocadoflecken. Ich hatte vergessen, den Mixer zuzudecken.« Ich trat zur Seite. »Bitte, kommt doch herein. Das Haus ist ziemlich unordentlich, aber ...«
»Na ja«, sagte Ruth, als sie eintrat. »Du hattest in letzter Zeit bestimmt auch Wichtigeres zu tun ...«
»... als dich um Hausputz zu kümmern«, beendete Louise den Satz fröhlich, indem sie mir durch den Flur und ins Wohnzimmer folgten. »Und mit Recht. Was könnte wichtiger sein, als ...« Das verbale Duell der Pyms verebbte, gefolgt von einer peinlichen Stille.
Ich war fast so überrascht wie Louise. Ich hatte unser Wohnzimmer immer als einen der gemütlichsten Räume des Hauses empfunden, aber jetzt sah es aus, als ob eine Bande Landstreicher hier ihr Lager aufgeschlagen hätte. Von den Tischecken baumelten Flanellstreifen, der Kamin wurde von einem überquellenden Wäschekorb verdeckt, ein paar der Elternzeitschriften, die sich auf den Kissen der Fensterbank stapelten, waren auf die Erde gerutscht, und auf dem Sofa und den Sesseln herrschte ein heilloses Durcheinander von Spielsachen, Kuscheltieren und etwas unförmigen Stricksöckchen.
Die dunkeläugige Frau bahnte sich einen Weg von der Tür zum Laufstall, aber ich musste erst eine Reihe von Bauklötzchen, eine Handpuppe und einen ganzen Zirkus von Plastiktieren zur Seite schieben, ehe Ruth und Louise das Sofa erreichen konnten.
»Entschuldigt die Unordnung«, murmelte ich, während ich vor ihnen zum Sofa eilte, um es von einer Ansammlung von Kuscheltieren frei zu machen, die ich kurzerhand auf den Boden fegte. »Es scheint wirklich, dass mir die Dinge etwas über den Kopf gewachsen sind.«
»Darum sind wir ja gekommen«, sagte Ruth. »Deshalb haben wir dir ...«
»... ein weiteres Paar Hände mitgebracht«, fuhr Louise fort. »Dürfen wir vorstellen ...«
»... das ist unsere liebe Freundin ...«
»... Francesca Angelica Sciaparelli.«
Die dunkeläugige Frau, die gerade Will in den Laufstall gelegt hatte, richtete sich auf.
»Guten Tag«, sagte sie.
Wie zur Antwort spuckte Rob mir einen Teil seiner letzten Mahlzeit über die Schulter.
»Kommen Sie, geben Sie ihn mir.« Die Frau kam zu mir herüber und streckte die Arme aus. »Ich wasche ihn, und Sie können sich eine saubere Bluse anziehen.«
Ich weiß nicht, warum ich ihr Rob so bereitwillig gab. Vielleicht lag es daran, dass ich dem Urteil der Pyms vertraute. Vielleicht war es auch die Tatsache, dass sie einfach so bereit war, ein mit Avocadobrei verschmiertes vier Monate altes Baby zu übernehmen, oder es war der Geruch, der von meiner Bluse ausging – bereits der zweiten Bluse an diesem Tag. Was mich aber völlig überzeugte, so glaube ich, war das Lächeln in ihren Augen, das ein stilles Verstehen ausdrückte.
»Es ist einfacher, wenn Sie mich Francesca nennen«, fügte sie in dem sanft rollenden Dialekt des Südwestens hinzu, der so gar nicht zu ihrem wenig englischen Namen passte. »Sciaparelli ist ein bisschen lang für den Hausgebrauch.«
»Ich heiße Lori«, sagte ich.
»Ich weiß.« Francesca drehte sich langsam um und nahm das Zimmer in Augenschein. »Ich habe dieses Haus immer geliebt.«
»Sie waren schon einmal hier?«
»Sehr oft«, sagte Francesca. »Miss Westwood ist nach dem Krieg nach London gezogen, aber sie behielt das Cottage als eine Art Zuflucht. Wenn sie weg war, hat mein Vater sich um das Haus gekümmert. Miss Westwood ist meiner Familie immer eine gute Freundin gewesen.«
»Sie war auch mir eine gute Freundin«, sagte ich.
»Das glaube ich gern.« Francesca schloss die Augen und sog die Luft ein. »Flieder. Ein wunderbarer Duft. Flieder war Miss Westwoods Lieblingspflanze. Seltsam, was für Erinnerungen so ein Duft wecken kann. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich schwören, dass Miss Westwood selbst hier irgendwo ist.«
»Es liegt sicher daran, dass ich hier nichts verändert habe«, sagte ich rasch. »Das Haus ist weitgehend noch so, wie Dimity es hinterlassen hat – bis auf die Unordnung.«
Ich bereitete mich innerlich auf den kurzen Augenblick der Trennung von meinen Söhnen vor, aber ermahnte mich dann, nicht so albern zu sein. Wenn Dimity einen nach Flieder duftenden Willkommensteppich für Francesca Sciaparelli ausrollte, brauchte ich mir sicher keine Sorgen zu machen.
»Ich werde ... ich bin gleich zurück.« Ich küsste Robs Füßchen, und zum ersten Mal seit der Geburt der Zwillinge ging ich allein die Treppe hinauf.
Als ich im Schlafzimmer stand, geriet ich in Panik. Ich riss mir die Schürze und die schmutzige Bluse herunter und warf sie in Richtung Wäschekorb, um dann hastig eine saubere Bluse aus dem Schrank zu nehmen. Während ich sie noch zuknöpfte, wollte ich schon wieder zur Tür hinausrennen, als ich mich im großen Schlafzimmerspiegel sah und abrupt stehen blieb.
Wer war dieses heruntergekommene Gespenst, das mich da anstarrte?
Die kurzen dunklen Haare waren mit angetrocknetem Avocadopüree verklebt, die Augen vor Müdigkeit rot gerändert, und während sich die Bluse über den ungewöhnlich vollen Brüsten spannte, hingen die Jeans mir lose um die Hüften wie bei einer Vogelscheuche. Ich streckte die Hand nach meinem Spiegelbild aus, und mir wurde schaudernd klar, dass das, was ich sah, ein blasser, müder Abklatsch meiner selbst war.
»Mein Gott«, murmelte ich völlig benommen, »ich sehe ja noch fürchterlicher aus als das Wohnzimmer. Warum hat Bill mir nicht ...?«
Ich beendete die dumme Frage nicht. Bill hätte Feuerwerk und Leuchtraketen abschießen können, und es hätte nicht die geringste Wirkung auf mich gezeigt. Mein eigenes Leben war wegen der Zwillinge seit vier Monaten zum Stillstand gekommen, und kein Bitten, Drängen oder vernünftiges Argumentieren hätte mich dazu bewegt, meine Prioritäten zu ändern.
Aber damit musste nun Schluss sein. Bill hatte recht, die Jungen waren kerngesund. Nicht nur hatten sie ihre Altersgruppe eingeholt, sie rangierten bereits im oberen Bereich sämtlicher Wachstumstabellen, die Dr. Hawkings heranzog. Der Kinderarzt hatte keine Erklärung dafür, aber vielleicht hatte Bill den Nagel auf den Kopf getroffen: Vielleicht hatte ich es wirklich großartig gemacht.
Ich wollte noch mal einen stolzen Blick in den Spiegel werfen, aber mein Spiegelbild war so erbärmlich, dass ich zurückschreckte. Das Arbeitslager der Mutterschaft hatte deutliche Spuren hinterlassen.
»Ruth?«, rief ich, indem ich zur Treppe ging. »Louise? Darf ich euch noch ein paar Minuten allein lassen?«
»Nimm dir Zeit«, zwitscherte Ruth. »Wir kommen ...«
»... sehr gut klar.«
Ich zögerte, dann ging ich entschlossen ins Bad, um zu duschen und mir die Haare zu waschen. Mir mitten am Vormittag die Haare zu waschen empfand ich als einen unglaublichen Luxus, auch wenn ich erst diverse Quietschtiere und Segelboote aus der Badewanne entfernen musste. Ich hatte fast Schuldgefühle, als ich, von Kopf bis Fuß frisch angekleidet und nach Seife statt nach Baby riechend, wieder das Wohnzimmer betrat.
Das Schuldgefühl wuchs noch mehr, als ich sah, was hier inzwischen geschehen war. Das Spielzeug war in eine Ecke geräumt, die Kuscheltiere in eine andere, und die langen Flanellstreifen hatten sich in weiche Polster verwandelt, die säuberlich die Möbelecken umgaben. Der Wäschekorb samt Kindersöckchen war verschwunden, und meine Elternzeitschriften lagen ordentlich aufgestapelt unter der Fensterbank, sodass die Sonnenstrahlen wieder ungehindert durch das bleiverglaste Erkerfenster fallen konnten. Ruth und Louise standen beim Laufställchen, in dem meine Söhne, nunmehr ohne grüne Flecken und vollkommen zufrieden, Bläschen aus Spucke formten.
Auf Zehenspitzen ging ich zur Küchentür, wo ich Wasser plätschern hörte, und blieb gebannt an der Tür stehen. Francesca putzte den Fußboden, nachdem sie bereits die Spuren meines Mixerunfalls von Wänden und Schranktüren beseitigt und das schmutzige Geschirr in die Spülmaschine geräumt hatte. Völlig überwältigt vom Anblick des sauberen Fußbodens und der leeren Spüle, lehnte ich am Türrahmen und fing an zu heulen.
»Aber, was ist denn los?«, sagte Francesca und stellte den Schrubber hin.
»Es ... ist nur ... alles so ...« Ich schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte hilflos.
»Etwas frische Luft ...«
»... wird dir sicher guttun, Liebes.«
Ruth und Louise kamen in den Flur getrippelt, nahmen mich links und rechts beim Ellbogen und steuerten mich hinaus in den Garten. Während Ruth die Steinbank unter dem Apfelbaum mit ihrem Batisttüchlein abstaubte, reichte Louise mir ihr gesticktes Taschentuch.
Ich setzte mich und wischte mir die Tränen ab, eingerahmt von zwei fürsorglichen Schwestern. »Ihr müsst mich für eine schreckliche Mutter halten«, schluchzte ich.
»Das tun wir keineswegs«, widersprach Ruth. »Du bist einfach nur ...«
»... eine frischgebackene Mutter«, sagte Louise. »Und egal, wie viele Bücher man liest, nichts kann eine Frau darauf vorbereiten ...«
»... was einem da wirklich abverlangt wird.« Ruth nickte. »Wir haben es schon ...«
»... so oft gesehen. Ach, als Mrs Farnham, die Frau des Gemüsehändlers, ihre drei entzückenden Töchterchen bekam ...«
»... war Mr Farnhams Laden monatelang völlig durcheinander!« Ruth lächelte bei der Erinnerung daran. »Pflaumen zwischen den Zwiebeln, Rosinen zwischen den Mandeln ...«
»... und überall Kohlköpfe!« Auf Louises Gesicht zeichnete sich das identische Lächeln ab. »Was kann man auch erwarten. Einer wirklich guten Mutter ...«
»... werden ihre Kinder immer wichtiger sein als ihre Kohlköpfe.«
Ich sah von einem hellen Augenpaar zum anderen. »Und ist das auch bei mir der Fall?«
»Natürlich!«, rief Ruth aus. »Deshalb haben wir dir Francesca mitgebracht. Damit sie sich, während du dich um die Jungen kümmerst ...«
»... um deine Kohlköpfe kümmert.« Louise rang entzückt die Hände in den Zwirnhandschuhen. »Sie kocht, putzt, näht ...«
»... und wie sie mit Kindern umgeht, grenzt an Zauberei«, erklärte mir Ruth.
»Aber wer ist sie?«, fragte ich. »Kommt sie aus Finch?«
»Francesca ist auf der Farm ihres Vaters geboren und aufgewachsen ...«
»... nicht weit vom Dorf entfernt«, ergänzte Louise. »Dort lebt sie nun mit ihrem ältesten Bruder und dessen Frau ...«
»... und ihren acht Kindern.«
»Acht Kinder ...?« Ich fürchtete, ohnmächtig zu werden.
»Ja, auf der Farm der Sciaparellis geht es ziemlich lebhaft zu. Francesca hat ...«
»... sehr viel Erfahrung mit Babys.« Louise wechselte einen vorsichtigen Blick mit ihrer Schwester, ehe sie zögernd hinzufügte: »Wir hatten allerdings gehofft, dass sie bei dir wohnen könnte ...«
»... hier im Cottage«, sagte Ruth. »Francesca ist siebenunddreißig, musst du wissen. Sie hat bisher ihr ganzes erwachsenes Leben damit verbracht, ihre kranken Eltern zu pflegen und sich um die Kinder ihres Bruders zu kümmern. Es wird Zeit, dass sie mal herauskommt ...«
»... genau wie du, Lori. Wäre es zu viel verlangt?«
Vor meinem geistigen Auge erschienen eine blitzsaubere Küche und ein aufgeräumtes Wohnzimmer. »Also«, sagte ich nachdenklich, »da wäre das Gästezimmer. Es liegt direkt neben dem Kinderzimmer, also ...«
»Perfekt!« Ruth stand auf. »Dann holen wir Francescas Sachen aus dem Auto ...«
»... und teilen ihr die gute Nachricht mit.« Louise war ebenfalls aufgestanden. »Ruhe du dich nur weiter hier im Schatten aus, Lori ...«
»... wir helfen Francesca schon.« Ruth hakte sich bei ihrer Schwester ein, und zusammen flatterten sie zurück in den Wintergarten.
Ich sollte mich ausruhen, während eine Fremde bei mir einzog? Schon wieder wollte Panik aufsteigen, aber ich unterdrückte sie. Ich sagte mir, dass ich Hilfe bräuchte, und diese Hilfe war mir von der erlesensten Agentur der Britischen Inseln geschickt worden.
Der Exklusivservice der Firma Pym war so zuverlässig wie der Regen im April, und außerdem hatte Dimity bereits ihr fliederduftendes Einverständnis gegeben.
Ein warmer Windhauch fuhr durch meine feuchten Haare, und ich ließ mich mittragen, eingelullt von den leisen Geräuschen des Hochsommers. Er hatte sehr trocken angefangen, doch das schwüle Wetter, das seit einiger Zeit herrschte, erinnerte mich an die Sommer meiner Kindheit in Chicago.
Dennoch, hier im Schatten des Apfelbaums war es köstlich, und die leichte Brise kühlte die schwül-feuchte Luft. Mit etwas Übung könnte ich mich vielleicht daran gewöhnen, einfach ruhig dazusitzen. In den Zweigen über mir zwitscherte ein Rotkehlchen, Hummeln brummten zwischen Rittersporn und Tausendschön, und in dem Wasserbecken, das von Rosen umgeben war, planschten zwei Spatzen. Als ich jedoch die Augen über den stillen Garten gleiten ließ, meldete sich mein Schuldgefühl wieder, und beschämt murmelte ich: »Emma bringt mich um.«
Emma Harris, meine beste Freundin und Nachbarin, hatte meinen Garten mit viel Liebe entworfen, angelegt und bepflanzt. Der Frühling war Emmas liebste Jahreszeit, aber dieses Jahr war er gekommen und vergangen, ohne dass ich es bemerkt hatte. Mir waren die Tulpen und die Osterglocken, der Flieder und die Wildhyazinthen genauso entgangen wie der blühende Judasbaum unten am Bach. Schuldbewusst sah ich hoch in den Apfelbaum und wusste, dass ich auch die Apfelblüte verpasst hatte.
Emma Harris war eine Künstlerin. Ein stiller Seufzer der Bewunderung war ihr schönster Lohn, aber dieses Jahr hatte ich selbst das nicht zustande gebracht. Während Emmas liebster Jahreszeit hatte ich mich im Haus vergraben und kaum bemerkt, was für ein Wunder sie mit Hacke und Spaten vollbracht hatte, ich undankbarer Wurm.
»Ich werde sie dafür entschädigen«, nahm ich mir vor. Und ich würde jetzt sofort damit anfangen, indem ich dieses Paradies, das sie geschaffen hat, genieße und würdige. Ich lehnte mich gegen den Apfelbaum und versuchte, jede Regung der Natur, jedes zitternde Blatt wahrzunehmen, und ... versagte. Meine Lider waren so schwer, die mich umgebende Musik war so einschläfernd ... Ich konzentrierte mich auf das Brummen der Hummeln ... döste ein ... und wurde unsanft geweckt.
»Lori Shepherd«, donnerte eine Stimme, sodass Vögel und Bienen in Deckung gingen. »Dieser Mann muss gestoppt werden, ehe es ein Blutvergießen gibt!«
Kapitel 3
»WA-WAS?« ICH ZWINKERTE ein paar Mal, um die verschwommene Gestalt vor mir scharf zu sehen, dann überlief es mich kalt.
Peggy Kitchen stand in meinem Garten.
Peggy Kitchen – Ladenbesitzerin, Postschalterinhaberin und ungekrönte Herrscherin über Finch – hatte mich nicht nur dazu überredet, einen Afghan-Teppich, ein für mich unersetzliches Familienerbstück, für die Wohltätigkeitsauktion der Saint-George’s-Kirche zu spenden, nein, sie hatte meinen überwiegend sitzenden und völlig unmusikalischen Mann auch dazu gebracht, sich Glöckchen um die Beine zu schnallen und am ersten Mai in aller Herrgottsfrühe mit den geriatrischen Moriskentänzern von Finch aufzutreten. Bill hatte den Teppich wieder ersteigert und dafür den Gegenwert für einen Jahresvorrat an Bienenwachskerzen hingelegt, aber er konnte nicht verhindern, dass Peggy die Wände ihres Ladens mit kompromittierenden Fotos zuklebte, auf denen er, ein weißes Taschentuch schwenkend, wie schwachsinnig auf dem Dorfplatz herumhüpft.
Peggy Kitchen war eine äußerst gefährliche Frau.
Eine mit Strass besetzte, schmetterlingsförmige Brille, das ergrauende Haar am Hinterkopf zu einem Knoten zusammengedreht, die reife Figur von einem Blümchenkleid verhüllt – ihre Verkleidung war perfekt, wäre da nicht das irre Glitzern in ihren Augen gewesen. Peggy Kitchen war auf dem Kriegspfad – wieder einmal – und irgendwie war ich in ihre Schusslinie geraten.
»Hi, Peggy«, brachte ich mühsam hervor.
»Hätte dich erst angerufen«, bellte Peggy, »aber Bill stimmte zu, dass die Sache viel zu wichtig ist, um sie übers Telefon zu besprechen.« Ich zuckte zusammen, als sie die eine Hand zur Faust ballte und sie auf die Handfläche der anderen schlug, um die Sache zu unterstreichen.
»Sicher hat er recht«, sagte ich ernst, wobei ich mich fragte, wie viele unangemeldete Gäste mir Bill heute Vormittag noch schicken würde.
»Hat er auch!«, schrie sie. »Wenn dieser Mensch« – klatsch, klatsch – »bis zum siebzehnten August nicht weg ist, dann kann ich für nichts garantieren!«
»Äh«, fing ich an, verstummte aber wieder, als Francescas stattliche Figur in der Tür des Wintergartens erschien.
»Morgen, Mrs Kitchen.« Francesca richtete sich zu voller Größe auf und verschränkte die kräftigen Arme vor der Brust. »Ein schöner Tag, nicht wahr? Es ist so wunderbar ruhig hier – genau richtig für die beiden Babys, um die ich mich kümmere.« In ihr sanftes Schnurren hatte sich eine stählerne Note gemischt. »Sie werden mir die beiden doch sicher nicht aufwecken wollen, nicht wahr, Mrs Kitchen?«
Das war keine Frage, und Francesca wartete auch nicht auf die Antwort. Sie machte auf dem Absatz kehrt und verschwand im Haus, um mich mit der tickenden Peggy Kitchen zurückzulassen.
»Pfff«, meinte Peggy. Mit den Augen sandte sie Francesca ein paar tödliche Dolchstöße hinterher, dann setzte sie sich neben mich auf die Bank und murmelte: »Du lässt diese Frau an deine Jungen? Nach allem, was ihr Vater sich geleistet hat?«
»Was hat ihr Vater ...?«
»Ich hab jetzt keine Zeit zum Klatschen«, fiel mir Peggy ins Wort und sah nervös zum Haus hinüber. »Schließlich habe ich eine Krise zu bewältigen, und dazu brauche ich deine Hilfe.«
»Was für eine Krise?«
»Es geht um diesen Mann!«, wiederholte Peggy in wütendem Flüsterton. »Dieser schmierige Professor, der alles Mögliche ausgräbt. Wenn er in Scrag End herumwühlen will, dann ist das seine Sache, aber mein Dorffest lass’ ich mir von dem nicht vermasseln!«
»Das Dorffest ...« Ich klammerte mich an diese Worte wie an ein schwaches Schilfrohr in einem reißenden Strom unverständlicher Worte. Dieser schmierige Professor und Scrag End machten für mich keinen Sinn, aber selbst ich in meiner selbst auferlegten Isolierung hatte von Peggys Fest gehört. Wahrscheinlich war auch jeder Eskimo in seinem Kajak und jeder Sherpa auf dem Weg zum Mt. Everest im Besitz eines ihrer Handzettel. Mein Haus war von nicht weniger als sieben Exemplaren bombardiert worden.
Kommt alle herbeizumgroßen Erntedankfest!Samstag, den 17. August, ab 10 UhrAusstellungen! Wettbewerbe!Künstlerische und handwerkliche Vorführungen!Traditionelle Musik und Tanz!Erfrischungen in Peacocks PubOrgelkonzertundSegnen der Tierein derSaint George’s Church, um 9 Uhr.Eintritt: £ 2, Haustiere und Kinder unter 5 frei!
»Gibt es denn ein Problem mit dem Erntedankfest?«, fragte ich zaghaft.
»Ob es ein Problem gibt?«, schnaubte Peggy. »Man hat mir das Messer in den Rücken gestoßen, das ist das Problem!«
»Wer, der schmierige Professor?«
»Nein«, sagte Peggy und rollte ungeduldig die Augen. »Der Pfarrer natürlich.«
»Was hat der Pfarrer gemacht?« Ich konnte mir keinen unwahrscheinlicheren Messerstecher vorstellen als den sanftmütigen Mann, der uns getraut und unsere Kinder getauft hatte.
»Nichts, außer dass er diesem schmierigen Kerl das Schulhaus zur Verfügung gestellt hat. Was hat er sich bloß dabei gedacht, so was zu machen, ohne mich vorher zu fragen! Wie kann ich das Erntedankfest organisieren, wenn ich nicht über das Schulhaus verfügen kann?«
»Ach so ...« Ich verstummte, während Peggy aufsprang und mit einer Aufzählung anfing, von der ich annahm, dass es sich um die verschiedenen Wettbewerbe handelte.
»Da wären die Hirtenstäbe, das selbst gezüchtete Gemüse und das schönste Blumengesteck in einer Sauciere!« Ihre Erregung wuchs zusehends. »Dann die Fotos, die selbst gesponnene Schafwolle, die Weine und das selbst gebraute Bier! Ganz zu schweigen von den Obsttorten und den Zitronenstangen! Wo sollen wir das alles hintun, wenn wir das Schulhaus nicht zur Verfügung haben?«
»Vielleicht Tische im Schulhof?«, wagte ich vorzuschlagen.
»Kein Platz!«, rief Peggy. Sie sah sich über die Schulter um, ehe sie leiser fortfuhr. »Doch nicht bei all dem Geflügel, den Kaninchen, Ziegen, Schafen und Ponys. Und den Dorfplatz kannst du auch vergessen, denn dort sind schon die Lustigen Moriskentänzer und der Gesangverein.« Verzweifelt warf sie die Hände hoch und sank wieder auf die Bank.
»Ich sehe, was du meinst«, sagte ich, und ich meinte es ehrlich. Ich hatte mir das Erntedankfest als ein zwangloses Picknick im Freien vorgestellt, aber Peggy hatte ehrgeizigere Pläne. Der Pfarrer musste geistig umnachtet gewesen sein, als er ihr das Schulhaus wegnahm – wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte. Peggy hatte die Angewohnheit, die Dinge zu dramatisieren, aber wenn sie tatsächlich nicht über das Schulhaus verfügen konnte, dann war es ihr gutes Recht, empört zu sein. Abgesehen von der Kirche war es das größte Gebäude in Finch, und das einzige, das für ein Dorffest, wie Peggy es plante, geeignet war.
»Kann denn der Pfarrer einfach so über das Schulhaus verfügen?«, fragte ich.
»Es gehört der Kirche«, erklärte Peggy. »Wie die meisten Dorfschulen. Es ist ja schon lange keine richtige Schule mehr, aber es gehört immer noch der Kirche. Es geht jedoch nicht darum, ob er kann«, schnaubte sie empört, »es geht darum, ob es richtig ist. Er hat kein Recht, weniger als zwei Monate vor dem Erntedankfest mein Schulhaus mit Schutt von Scrag End anzufüllen. Besonders wo ...« Sie hielt inne und sah mich von der Seite an. »Ich muss dir was sagen, Lori, aber das habe ich noch nicht vielen erzählt. Sobald das Erntedankfest vorbei ist, ziehe ich aus Finch weg. Für immer.«
Ich starrte sie ungläubig an. »Du gehst aus Finch weg?«
»Versuche nicht, es mir auszureden«, sagte Peggy. »Mein alter Freund Mr Taxman hat das schon probiert, und ich will dir sagen, was ich ihm geantwortet habe: Hier in Finch habe ich erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe das Dorf belebt und den Bewohnern ein gutes Beispiel gegeben, und jetzt ist es Zeit für mich, weiterzuziehen.«
»Wohin willst du gehen?«, fragte ich.
»In ein Dorf in Yorkshire namens Little Stubbing. Mr Taxman und ich sind voriges Jahr im Urlaub durchgefahren. Es erinnerte mich daran, wie Finch war, ehe ich hier die Sache in die Hand nahm. Little Stubbing braucht mich, Lori.« Sie rang verzweifelt die Hände. »Aber ich lasse mich nicht von diesem Mann aus Finch vertreiben! Er muss gehen!«
Zweifelnd schüttelte ich den Kopf. »Ich glaube, es wird schwer sein, den Pfarrer zu ver...«
»Nicht den Pfarrer!«, rief Peggy. »Diesen Mann! Diesen schmierigen Kerl! Sagt, er kommt aus Oxford, aber mir ist’s egal, von mir aus kann er auch aus Windsor kommen. Er wird mir nicht mein Fest vermasseln.« Mit blitzenden Augen sah sie mich an. »Und du wirst dafür sorgen, dass er es nicht tut.«
Ich schluckte.
»Du wirst den Pfarrer überreden, dass er den Mann wieder loswird«, fuhr Peggy mit beängstigender Ruhe fort.
»Ich nehme an, du hast noch nicht mit dem Pfarrer gesprochen«, sagte ich ohne große Hoffnung.
Peggy schnaubte. »Der Reverend Theodore Bunting und ich sprechen momentan nicht miteinander. Und wenn er glaubt, dass ich weiter pingelige Sonderbestellungen wie Shrimps in Dosen für ihn aufgebe, nachdem er sich so rücksichtslos über eine alte Tradition wie das Erntedankfest hinwegsetzt« – sie machte eine Pause, um wieder zu Atem zu kommen –, »dann hat er sich geirrt.«
Ich überlegte, wie ich mich aus der Affäre ziehen könnte. »Dein Vertrauen ehrt mich, Peggy, aber wirklich, ich weiß absolut nichts über das Erntedankfest. Ich war in letzter Zeit ziemlich beschäftigt mit den Kindern und überhaupt, und ...«
»Das ist genau, was ich zu Bill gesagt hab«, unterbrach mich Peggy. »›Bill‹, hab ich gesagt, ›Lori ist der einzige Mensch im Dorf, der mit dem Erntedankfest nichts zu tun hat.‹«
»Du hast mit Bill gesprochen?«, fragte ich. Jetzt ahnte ich, wie der Hase lief.
»Hab ich. Und er meinte, dass du genau die Person bist, die wir brauchen. Wie hat er dich noch mal genannt?« Peggy sah nach oben und kniff die Augen hinter der Schmetterlingsbrille zusammen. »Eine unabhängige Zeugin. Eine unbeteiligte Beobachterin. Eine neutrale dritte Person.«
»Das alles hat Bill gesagt?« Ich schürzte die Lippen und versuchte, mir ein Leben als Alleinerziehende vorzustellen.
»Ich hatte meine Zweifel«, versicherte Peggy mir, »aber Bill hat sie alle ausgeräumt. Du bist in der Sache außen vor, sagte er, du hast keinerlei Interessen. Der Pfarrer muss dir zuhören.«
Sie stand auf und sah auf mich herunter, wobei sie mich mit ihrem irren Blick an den Baum nagelte. »Also, kannst du mal zum Pfarrhaus gehen und Mr Bunting ausrichten, wenn er die Shrimps in Dosen nicht für den Rest seines Lebens selbst bestellen will, soll er gefälligst diesen schmierigen Kerl an die Luft setzen. Und ich wäre dir dankbar, wenn du niemandem erzählen würdest, dass ich aus Finch wegziehe. Das möchte ich am Ende des Erntedankfestes selbst bekannt geben.« Peggy nickte mir noch einmal aufmunternd zu und verließ, jeder Zoll wütende Matrone, über den Seitenweg den Garten.
»Dieser Schuft«, stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Dieser elende, hinterhältige, lausige ...« Ich bemerkte zwei Paar helle Äuglein, die mich vom Wintergarten her beobachteten, und hörte auf, meinen Angetrauten zu verwünschen.
»Ihr könnt wieder rauskommen«, sagte ich und winkte den Pyms. »Sie ist weg.«
Ruth kam als Erste, eine Tasse Tee in der Hand. »Ihr hattet wohl eine wichtige Besprechung ...«
»... und wir wollten dabei nicht stören.« Louise erschien neben ihrer Schwester. »Aber wir dachten, eine kleine Erfrischung würde dir ...«
»... nach Peggys Besuch guttun.« Ruth sah mich voll Mitgefühl an. »Danach braucht man meistens etwas.«
»Danke«, sagte ich und nahm die angebotene Tasse. »Wenn ich nicht stillen würde, stünde mir jetzt der Sinn nach etwas Stärkerem. Zum Beispiel Strychnin.«
Ruth kicherte. »Ach, Lori, ich bin sicher, es wird alles ...«
»... wieder ins Lot kommen«, beendete Louise den Satz.
»Ha!« Ich lehnte mich heftig gegen den Baumstamm zurück. »Habt ihr das gehört? Ich bin eine unbeteiligte Beobachterin. In anderen Worten, ich bin ein ›unschuldiger Zeuge‹, und wir wissen ja alle, was mit denen meist passiert.«
Ruth legte mir die Hand auf die Schulter. »Ich habe keinen Zweifel, dass du der Aufgabe gerecht werden wirst. Ich fürchte jedoch, dass wir dich jetzt ...«
»... verlassen müssen«, sagte Louise. »Du kannst dich aber jederzeit an uns wenden ...«
»... wenn du Hilfe brauchst. Wir möchten Mrs Kitchen auf keinen Fall von ihrer neuen Aufgabe in Little Stubbing abhalten.« Damit wandte sich Ruth zum Gehen.
»Wartet!«, rief ich und verschüttete einen Teil meines Tees. »Wisst ihr etwas über diesen schmierigen ...« Das Klingeln des Telefons im Haus unterbrach mich. Einen Augenblick später kam Francesca heraus und reichte mir das schnurlose Telefon.
»Der Pfarrer«, sagte sie.
»O Gott ...«, ächzte ich.
Francesca ging ins Haus zurück, und die Pyms bedachten mich mit einem synchronen Flattern ihrer Fingerspitzen, ehe sie auf Zehenspitzen den Garten verließen.
»Hallo?«, kam die Stimme aus dem Telefon. »Sind Sie es, Lori Shepherd?«
»Ja, ich bin’s, Herr Pfarrer.« Ich horchte auf das vertraute Husten des alten Pym’schen Automobils, das aus unserer Einfahrt tuckerte. Feiglinge, dachte ich bitter.
»Was gibt’s?«
»Ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll.« Der Pfarrer klang ein wenig benommen. »Wäre es Ihnen wohl möglich, kurz ins Pfarrhaus zu kommen? Es ist etwas vorgefallen, wissen Sie, eine vertrauliche Sache. Es wäre mir angenehmer, wenn Sie hier wären, um gewissermaßen den Tatort ... äh ...«
Das Wort Verbrechen hing unausgesprochen in der Luft und ich setzte mich auf. »Könnten Sie mir vielleicht einen kleinen Hinweis geben, worum es sich handelt?«, sagte ich.
Es folgte eine Pause. »Du liebe Zeit«, sagte der Pfarrer, »ich möchte Sie nicht unnötig aufregen, aber ... hier im Pfarrhaus ist eingebrochen worden!«
Kapitel 4
ES GIBT WOHL kaum eine schwierigere Prüfung für effiziente Teamarbeit als das Füttern, Baden und Zubettbringen eines lebhaften, vier Monate alten Zwillingspärchens. Bei der Versorgung der Jungen bewahrheitete sich immer wieder die alte Weisheit, dass vier Hände besser sind als zwei. Was die Zwillinge anbelangte, so kam mit Francesca natürlich noch der Reiz des Neuen hinzu. Die aufregende Ankunft einer weiteren Erwachsenen in ihrem Leben – noch dazu einer, die sich nicht lange mit winzigen Löffelchen aufhielt, sondern ihnen erlaubte, ihre Hände direkt in den Brei zu tauchen – hatte die Jungen so beansprucht, dass es, sobald sie gebadet, gepudert und frisch gewickelt waren, nicht lange dauerte, bis sie eingeschlafen waren.
Ehe ich jedoch meine Babys mit einer Fremden allein ließ, musste ich etwas klären. Während Francesca die Spülmaschine mit schmutzigem Geschirr bestückte, ging ich leise ins Arbeitszimmer, schloss die Tür hinter mir und nahm das blaue Tagebuch vom Regal. Dann knipste ich die Lampen überm Kamin an und kuschelte mich in einen der beiden hohen Ledersessel, die davor standen.
»Dimity?«, sagte ich und öffnete das Tagebuch. »Ich möchte dich etwas fragen.«
Ich sprach sehr leise, damit Francesca, wenn sie hereinkam, mich nicht dabei überraschte, wie ich mich mit einem Buch unterhielt. Bill wusste von dem blauen Buch, genau wie Emma und Derek Harris, aber bisher hatte ich der Versuchung widerstanden, andere einzuweihen. Ich hatte keine Lust, die Rolle des Dorfidioten zu spielen.
Ich konnte es ja selbst kaum glauben und noch viel weniger erklären, wie oder warum es möglich war, dass sich Dimitys Geist immer noch im Cottage aufhielt, nachdem ihre sterblichen Reste längst unter der Erde waren – auf der anderen Seite konnte ich den Beweis, den ich mit eigenen Augen sah, nicht leugnen. Meine Skepsis verstummte, sobald Tante Dimitys Worte in eleganter Kursivschrift mit königsblauer Tinte auf den weißen, unlinierten Seiten des blauen Tagebuchs erschienen.
»Tante Dimity?«, wiederholte ich. »Kannst du mich hören?«
Nicht sehr gut.
Nervös blickte ich zur Tür, während die altmodische Handschrift auf der Seite sichtbar wurde.
Ich nehme an, du möchtest nicht, dass Francesca uns hört?
»Ich glaube, sie könnte einen falschen Eindruck von uns bekommen«, flüsterte ich.
Und wie findest du Francesca?
»Sie ist fantastisch«, sagte ich anerkennend. »Die Kinder haben sich auf Anhieb bei ihr wohlgefühlt, und sie weiß auch, wie man mit Babys umgeht.«
Aber?
Ich seufzte. »Es geht um etwas, das Peggy Kitchen gesagt hat.«
In dem Falle wird es wahrscheinlich völliger Unsinn sein. Was hat sie denn gesagt?
»Nichts Konkretes. Aber sie deutete an, dass Francescas Vater etwas getan hat ...«