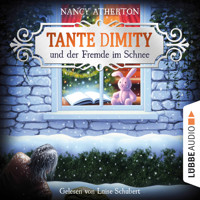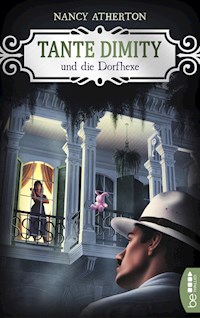5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Lori kann es kaum erwarten, mit ihrem Ehemann Bill und ihren neun Monate alten Zwillingen das Weihnachtsfest in Tante Dimitys Cottage zu feiern. Doch dann macht sie eine beunruhigende Entdeckung: Im verschneiten Garten liegt ein Mann, halberfroren. Wer ist der Fremde? Was will er von Tante Dimity? Leider kann der Mann Loris Fragen nicht beantworten, denn er liegt im Koma. Unterstützt von Tante Dimity, die über ihr blaues Tagebuch mit ihr kommuniziert, macht sich Lori auf die Suche nach dem Geheimnis des Fremden im Schnee ...
Ein gemütlicher Weihnachtskrimi mit Tante Dimity. Jetzt als eBook bei beTHRILLED.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Angel Cookies.
"Diese Krimiserie ist wie ein warmes Kaminfeuer in einer Winternacht." (The Denver Post)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
Angel Cookies
Über dieses Buch
Lori kann es kaum erwarten, mit ihrem Ehemann Bill und ihren neun Monate alten Zwillingen das Weihnachtsfest in Tante Dimitys Cottage zu feiern. Doch dann macht sie eine beunruhigende Entdeckung: Im verschneiten Garten liegt ein Mann, halberfroren. Wer ist der Fremde? Was will er von Tante Dimity? Leider kann der Mann Loris Fragen nicht beantworten, denn er liegt im Koma. Unterstützt von Tante Dimity, die über ihr blaues Tagebuch mit ihr kommuniziert, macht sich Lori auf die Suche nach dem Geheimnis des Fremden im Schnee ...
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten „Tante Dimity“ Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Amerikanischen von Thomas Hag
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Alvaro Cabrera Jimenez | Montreeboy
Illustration: © Jerry LoFaro
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3373-2
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel » Aunt Dimity’s Christmas « bei Penguin Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 1999 by Nancy T. Atherton
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2007
by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Mom und Dadmeine Helden
Kapitel 1
MEIN VATER STARB, als ich drei Monate alt war. Ich erinnere mich nicht an sein Lachen oder daran, wie er mich im Arm hielt. Meine Erinnerungen stammen alle aus zweiter Hand, aus den Erinnerungen meiner Mutter und aus abgegriffenen Fotoalben.
»Dein Vater war ein Soldat«, erzählte mir meine Mutter, und tatsächlich, da steht er, in körnigem Schwarz-Weiß, mit seinem GI-Grinsen und in einer zerknitterten Uniform, inmitten der Ruinen von Berlin. Kinder in zerlumpter Kleidung scharen sich um ihn und halten die Geschenke in die Höhe, die er aus einem abgewetzten Seesack geholt hat – Schokolade und Kaugummi, Strümpfe und Wollmützen und was sonst er noch aus den Vorratskammern seiner Einheit herausgemogelt hatte. Nie hat ein Weihnachtsmann glücklicher ausgesehen als mein Dad an jenem Tag, umgeben von den Kindern in den Ruinen Berlins.
»Weihnachten war das Fest, das dein Vater am meisten liebte«, sagte meine Mutter, und gut die Hälfte aller Fotos in den Alben bestätigt das. Da ist er wieder, Jahre später, diesmal spielt er den Weihnachtsmann in unserer Kirche auf der West Side von Chicago. Auf einem Bild backt er Angel Cookies – Vanilleplätzchen – für Freunde und Nachbarn, auf einem anderen befestigt er die Spitze am Christbaum. Als mein Vater noch lebte, begann das Weihnachtsfest bereits am 14. Dezember, dem Geburtstag meiner Mutter. Höhepunkt war eine ausgelassene Party am Heiligabend.
Der erste Feiertag diente zur Erholung.
Nach dem Tod meines Vaters schränkte meine Mutter den Umfang der Festlichkeiten ein. Sie hatte weder die Kraft noch das Geld dazu. In meiner Kindheit hing stets ein Hauch von Trauer in der kalten Winterluft. Mir war klar, dass die unspektakulären Feiertage, die ich erlebte, nichts mit den ausgelassenen Festen zu Zeiten meines Vaters zu tun hatten, und insgeheim schwor ich mir, dass ich eines Tages ein Weihnachtsfest ausrichten würde, das denen auf den Fotos alle Ehre machen würde.
»Und nun ist der Tag endlich gekommen«, murmelte ich. Mit untergeschlagenen Beinen saß ich auf einem Kissen auf der Fensterbank und schaute versonnen zum Himmel hinauf. Ich war eine erwachsene Frau mit zwei eigenen Kindern, und die mageren Zeiten, die ich nach dem Tod meiner Mutter durchgemacht hatte, waren vorbei und vergessen. Dank einer unerwarteten Erbschaft einer Freundin der Familie besaß ich nun ein Cottage in England und ein Vermögen, dass es mir erlaubte, Weihnachten so verschwenderisch zu feiern, wie es mir einfiel. Ich schwor mir, dass das Lieblingsfest meines Vaters in diesem Jahr wieder eine Zeit der Freude werden würde, frei von jedem Gedanken an harte Zeiten.
Die Sichel des Mondes glitt sachte zwischen niedrigen Wolken dahin, und ein bitterkalter Wind aus Nordosten wirbelte die abgestorbenen Blätter der Buchenhecke auf. Ich betrachtete die schweren, grauen Wolken und fröstelte erwartungsvoll. Noch knapp zwei Wochen bis Weihnachten – mein erstes Weihnachten in England und das erste Weihnachten meiner Söhne. Alles sollte perfekt werden.
Unglücklicherweise hatte mein Kindermädchen ihren Posten zeitweilig verlassen, um mit ihrem Bräutigam in Italien einen verlängerten Urlaub zu genießen. Die Zwillinge waren neun Monate alt und erschreckend rastlos. Es war keine leichte Aufgabe, sie vor Verletzungen oder Schlimmerem zu bewahren oder sie davon abzuhalten, das Cottage abzureißen. Mein Schwiegervater hatte allerdings keine Sekunde gezögert und sich der Herausforderung gestellt.
William Willis senior erschien einen Tag nach der Abreise meines Kindermädchens und bestand darauf, ihre Pflichten zu übernehmen. Willis senior war kein Schönwetter-Großvater. Er stammte aus den besten Kreisen Bostons, ein fast aristokratisch wirkender Jurist von hohem Ansehen, ein äußerst anspruchsvoller Mittsechziger, dessen Liebe zu maßgeschneiderter Kleidung nur noch von der für seine Enkelsöhne übertroffen wurde.
Er schlief auf einer Liege im Kinderzimmer, machte die Jungen morgens fertig, las ihnen abends Gute-Nacht-Geschichten vor und ertrug gelassen schmutzige Windeln, Wolken von Babypuder und Planschbecken. Einmal erkundigte ich mich nach dem Grund seiner Hingabe. Er habe nie geglaubt, dass er es noch erleben würde, dass sein Sohn Kinder haben würde, antwortete er, und nun habe er vor, jeden Augenblick mit seinen Enkeln zu genießen.
Solange Willis senior die Geschäfte übernahm, konnte ich mich voll und ganz meinen Feiertagsplänen widmen. Ich inspizierte meine Wintergarderobe und befand sie für komplett inakzeptabel. Meine Bluejeans und die Pullover von der Heilsarmee erinnerten mich allzu sehr an die schlechten alten Zeiten. Ich brachte sie in einem Schwung zu Oxfam und füllte meine Kleiderschränke mit seidengefütterten, maßgeschneiderten Hosen und Oberteilen aller Art, von rohseidenen, aus handgewebter Wolle gefertigten bis hin zu edel schimmernden aus Samt. Ich ersetzte meine zerschlissenen Turnschuhe durch handgefertigte italienische Stiefel aus butterweichem Leder oder Wildleder und meinen noch viel verschlisseneren Bademantel durch einen Hausmantel im Stil der Vierziger, in einem delikaten Grau, vermischt mit Hellblau. Außerdem leistete ich mir einen prächtigen schwarzen Swing-Mantel aus Kaschmirwolle mit einem Schalkragen, den ich um meinen Hals schlingen konnte, wenn der Wind allzu heftig blies. Eigentlich war ich nie ein Modepüppchen gewesen, aber ich lernte offenbar schnell.
Nachdem ich meine Garderobe erneuert hatte, begleitete ich meinen Mann nach Oxford. Während ihm bei seinem Schneider ein Weihnachtsmannkostüm angefertigt wurde, zog ich los und erbeutete antiken Christbaumschmuck und eine Baumspitze aus Glasgespinst. Wohl ein Dutzend Mal begaben Bill und ich uns auf einen Einkaufsbummel nach London, wo wir Geschenke für alle kauften, die wir kannten.
Wir durchstreiften den Eichenwald in der Nähe des Cottages und sammelten Immergrün, Stechpalmen und Mistelzweige. Aus einer Baumschule bei Oxford brachten wir einen Weihnachtsbaum mitsamt Wurzeln nach Hause. Ich lud Bills englische Verwandte zu unserer Heiligabendparty ein und sorgte dafür, dass sie die Nacht auf Anscombe Manor verbringen konnten. Das geräumige Anwesen gehörte meiner Nachbarin und besten Freundin Emma Harris. Ich bestellte eine Gans, einen Truthahn und zwei Schinken für die Feier, dazu diverse Beilagen und bevorratete mich mit den Zutaten für etliche Backrunden, die das Cottage bis Weihnachten täglich aufs Neue mit Feiertagsduft erfüllen sollten.
Morgen, am 14. Dezember, dem Geburtstag meiner verstorbenen Mutter, würde alles beginnen, das Schmücken, das Backen, das Einpacken der Geschenke, das Schmettern von Weihnachtsliedern. Ich konnte es kaum abwarten.
Schon jetzt sah ich das festliche Cottage vor mir, das Wohnzimmer, den Flur, die Treppe, herausgeputzt mit Girlanden aus Immergrün und Mistelzweigen. Und überall Kerzen. Vor allem aber sah ich meine Familie – Mann, Schwiegervater und Söhne –, wie sie vor dem brennenden Kamin saßen, Becher mit heißer Schokolade und Teller voller Angel Cookies neben sich und den Frieden der Weihnachtszeit genießend.
Nur eines fehlte, um die Feiertage vollkommen zu machen. Ich beugte mich vor, hauchte auf die Fensterscheibe und schrieb ein Wort auf die beschlagene Stelle: Schnee. Ich sehnte den Schnee so sehr herbei, dass ich ihn fast riechen konnte. Ich wollte, dass es nicht mehr aufhörte zu schneien, bis die Straßen und die Stoppelfelder mit dem weißen, reinen Pulver verzaubert waren. Ich wollte die staunenden Augen meiner Söhne sehen, wenn die weiße Pracht vor den Fensterscheiben wirbelte. Als die schwer beladenen Wolken sich vor die Mondsichel schoben, schaute ich hoffnungsvoll zum Himmel hinauf.
Mein Ehemann räusperte sich, und ich wandte mich um. Bill saß in seinem Lieblingssessel, in Pullover und Cordhose. Willis senior hatte in einem Sessel auf der anderen Seite des Kamins Platz genommen und las einen Roman. Er trug einen Pyjama mit Bügelfalte, Lederslipper und einen prächtigen Schlafrock mit Paisleymuster. Die Zwillinge schliefen bereits in ihren Bettchen, und wir hatten ein Feuer entzündet, das fröhlich prasselte und einen rosigen Glanz in dem gemütlich eingerichteten Raum mit der niedrigen Decke verbreitete.
Ich seufzte zufrieden und betrachtete Bill liebevoll. Er würde einen ganz hervorragenden Weihnachtsmann abgeben. Wenn ein Mensch für die Rolle des Geschenke verteilenden Heiligen geboren war, dann mein sanftmütiger, großherziger Gatte.
Bill räusperte sich ein zweites Mal und legte die Hände über dem Bauch zusammen. »Weihnachten«, verkündete er ohne Vorwarnung, »sollte abgeschafft werden.«
»Was?« Ich schreckte auf.
»Weihnachten sollte abgeschafft werden«, wiederholte Bill und betonte jede Silbe. »Ich kann es nicht mehr ertragen.«
»Aber es hat doch noch nicht mal angefangen«, entgegnete ich.
Bill blinzelte. »Noch nicht mal angefangen? Und was haben wir dann in den letzten vier Wochen gemacht?«
»Uns in Stimmung gebracht«, erwiderte ich.
»Lori«, begann Bill bedächtig. »Ist dir bewusst, dass wir in den letzten zehn Tagen auf fünfzehn Partys waren?«
»So viele?«, fragte ich. »Ich habe gar nicht mitgezählt.«
In Bills Lachen schwang ein Hauch von Hysterie mit. »Sieben Dinner-Partys, fünf Brunchs, und drei abendliche Einladungen zum Sherry, und dazu alle zwei Tage die Fahrt nach London und zurück, und zu alldem noch Immergrün und Winterlaub im Eichenwald suchen ... Lori«, klagte er. »Ich kann nicht mehr.«
»Das verstehe ich ja«, gurrte ich, setzte mich auf die Lehne seines Sessels und strich ihm sanft übers Haar. »Es war rücksichtslos von mir, dir so viel aufzubürden, aber du weißt ja selbst, wie schwer es ist, eine Einladung auszuschlagen, ohne jemanden dadurch vor den Kopf zu stoßen. Zu den restlichen Partys werde ich allein gehen, okay? Das einzige, was du bis Weihnachten noch tun musst, ist morgen den Baum aus dem Schuppen ins Haus bringen.«
Bill legte den Kopf zurück und atmete erleichtert auf. »Das schaffe ich noch.«
Ich lächelte süß. »Das und das Krippenspiel.«
Bill sah mich scharf an. »Das was?«
Ich glitt von der Lehne und baute mich einen Schritt entfernt von meinem großherzigen Gatten auf. »Habe ich dir gar nichts von dem Krippenspiel erzählt?«
»Nein«, murmelte Bill beängstigend ruhig. »Das hast du nicht.«
»Nun«, ich holte tief Luft, »Peggy Kitchen hatte die Idee, dass es doch schön sei, Heiligabend ein Krippenspiel in der Kirche aufzuführen. Weil solch ein Spiel aber traditionellerweise immer von der Ehefrau des Vikars in Szene gesetzt wird, hat sie Lilian Bunting überredet, die Regie zu übernehmen. Aber Lilian hat so etwas noch nie gemacht, und so ist ihr wohl auch entgangen, dass es zu wenig männliche Freiwillige gibt.« Ich trat noch einen weiteren Schritt zurück. »Also habe ich dich angemeldet.«
Bill senkte den Kopf wie ein Stier vor der Attacke. »Dann wirst du mich auch wieder abmelden, Lori.«
»Es handelt sich doch in der Hauptsache um Szenen ohne Text. Du musst nur ganz wenige Zeilen auswendig lernen. Und es gibt nur vier Proben!«, lockte ich.
»Nein«, sagte Bill.
»Nicht mal, um Lilian einen Gefallen zu tun?«, flehte ich.
»Nein.«
»Bill.« Ich versuchte es mit Strenge. »Es ist deine Bürgerpflicht, der Frau des Vikars zu helfen.«
»Bürgerpflicht?«, entfuhr es Bill, der sich aus seinem Sessel erhoben hatte. »Seit dem Erntedankfest im Herbst fallen dir dauernd neue Bürgerpflichten für mich ein. Nur zur Erinnerung, Lori. Ich habe beim Fest mit den Morris-Tänzern getanzt, ich habe mir die Augenbrauen versengt, als ich das Feuer am Guy-Fawkes-Tag anzünden musste, und ich habe bei der letzten Wohltätigkeitsveranstaltung für die Saint-George-Kirche einen Jahresvorrat an Kerzen aus Bienenwachs ersteigert. Ich habe meine Bürgerpflichten wahrlich erfüllt, und ich beabsichtige, die nächsten zwei Wochen zu Hause zu verbringen.« Mit zornesrotem Gesicht stürmte mein Weihnachtsmann aus dem Zimmer, lief die Treppe hinauf, knallte mit der Babypforte und stapfte ins Schlafzimmer, wo er die Tür hinter sich zuschlug. Ich stand da wie erstarrt und wartete, bis alles wieder ruhig war. Dann lehnte ich mich stöhnend an den Kaminsims.
Willis senior schaute von seinem Roman auf. »Mein Sohn ist erschöpft«, brachte er vor.
»Dein Sohn ist vor allem im Recht.« Ich ließ mich in den Sessel sinken, den Bill soeben freigemacht hatte. »Ich hätte niemals so viele Einladungen annehmen dürfen.«
»Weihnachten findet nur einmal im Jahr statt«, sagte Willis senior. »Es ist nur allzu verständlich, wenn man die Festtagsfreude mit Freunden teilen möchte.«
»Vielleicht«, widerstand ich dem Tröstungsversuch, »aber ich hätte unsere Einkaufsreisen wirklich besser planen müssen. Wenn ich alles besser organisiert hätte, hätten wir nicht so oft zwischen hier und Oxford oder London pendeln müssen.«
»Mein Sohn ist es gewohnt, dass seine Angestellten die Laufarbeiten für ihn erledigen«, meinte der Senior ungerührt. »Ein wenig eigene Lauferei dann und wann kann ihm nicht schaden.«
»Na schön«, räumte ich ein, »aber ich hätte ihn wohl nicht für das Krippenspiel anmelden dürfen, ohne ihn vorher zu fragen.«
»Das hättest du wirklich nicht tun sollen«, stimmte mein Schwiegervater mir zu.
Ich verschränkte die Arme und sank in den Sessel. »Jetzt ist Bill sauer auf mich, und ich muss Lilian enttäuschen.«
»Zur Linderung erstgenannter Wunde kann ich wenig beitragen«, sagte Willis senior. »Aber beim zweiten Problem kann ich vielleicht helfen.« Er strich mit dem Finger über seine makellos rasierte Wange.
»Möglicherweise könnte ich Bills Rolle im Krippenspiel übernehmen.«
Blitzschnell richtete ich mich wieder auf. »Ist das dein Ernst?«
»Ich bin sicherlich kein herausragender Thespisjünger«, warnte Willis senior. »Aber ich denke schon, dass ich die Rolle des Joseph ausfüllen kann, ohne dass es mir selbst oder Mrs Bunting peinlich sein müsste.«
»Lilian wird zu Tränen gerührt sein«, versicherte ich ihm.
»Dann teile ihr doch bitte mit, dass sie einen neuen Joseph bekommt«, verkündete Willis senior. Er griff wieder zu seinem Roman. »Ich nehme an, du willst dein diplomatisches Geschick jetzt oben einsetzen.«
Ich strahlte ihn an. »Was würde ich nur ohne dich machen, William?«
»Das wage ich mir nicht vorzustellen«, erwiderte er.
Ich gab ihm einen Kuss auf die Wange und ging die Treppe hinauf, in der Hoffnung, dass Bill noch wach war. Auf dem Treppenabsatz wandte ich mich automatisch zunächst dem Kinderzimmer zu, um nach den Zwillingen zu schauen. Als ich die Tür öffnete, sah ich im Halbdunkel, dass Bill mir zuvorgekommen war.
Schweigend beobachtete ich, wie mein Mann sich niederbeugte und ein niedliches rosafarbenes Flanellkaninchen am Fußende von Robs Kinderbettchen platzierte. Als er sich aufrichtete, flüsterte ich: »Es tut mir leid.«
»Das sollte es auch«, entgegnete Bill, zeigte mir jedoch durch seine ausgestreckte Hand, dass er nicht mehr böse auf mich war.
»Sei ganz beruhigt.« Ich ergriff seine Hand. »Von heute an werden wir ausgesprochen besinnliche Feiertage erleben. Bis auf die Party am Heiligabend.«
»Bis dahin bin ich wieder fit.« Bill zog mich zu sich heran und legte seine Arme um mich. »Deine Reue soll belohnt werden, mein Schatz«, flüsterte er mir ins Ohr.
»Wie denn?«, hauchte ich und strich ihm durchs Haar.
»Mit Schnee«, antwortete er.
Meine Hände rutschten auf seine Schultern. Diese Antwort hatte ich nicht erwartet. Bill zog mich zum Fenster. »Ich weiß nicht, ob es bis Weihnachten halten wird, aber es ist immerhin ein Anfang.«
Vor dem Fenster tanzten glänzende Schneeflocken und wirbelten im Wind umher, einige klatschten gegen das Glas, andere schossen in die Dunkelheit. Schon bedeckten sie den Steinpfad. Es war berauschend und hypnotisch, und es war die Antwort auf mein Gebet. Wie verzaubert hätte ich wohl die ganze Nacht am Fenster gestanden, hätte mein Mann nicht einen Vorschlag gemacht, wie wir den Abend noch besser beschließen könnten.
Stunden später, als Bill und ich längst schliefen, und lange nachdem Willis senior sein Buch zugeklappt, das Feuer erstickt hatte und nach oben in sein Bett gegangen war, fiel der Schnee noch immer. Er kräuselte sich wie ein Hermelinpelz um die nackten Zweige, füllte die Furchen auf den gepflügten Feldern und wehte sanft über den Weg zu unserem Haus. Dort lag eine zerlumpte Gestalt.
Das Geschenk, das der Fremde bei sich trug, hätte ihn fast das Leben gekostet.
Kapitel 2
AM NÄCHSTEN MORGEN wurde ich von einem sanften Klopfen an der Tür geweckt. Ich blieb noch einen Augenblick liegen und kuschelte mich an Bills warmen Körper, dann stieg ich aus dem Bett und zog den klassischen Morgenmantel über, den ich in London erstanden hatte. Kurz blieb ich vor dem Spiegel stehen und bewunderte das grau-blaue Muster, bevor ich auf Zehenspitzen auf den Flur ging.
Mein Schwiegervater erwartete mich. Er hatte sich bereits angezogen und schien ehrlich betrübt. »Es tut mir leid, dass ich dich aufgeweckt habe, aber meine Enkel sind schon den ganzen Morgen äußerst lebhaft, und ich finde einfach kein Mittel, sie zu beruhigen.« Er zögerte kurz. »Hast du irgendeine Ahnung, was mit ›alt‹ gemeint sein könnte?«
»Alt?«, echote ich dümmlich.
Willis senior nickte. »Rob und Will wiederholen es die ganze Zeit, alt, alt, alt, als hätte es eine ganz besondere Bedeutung.«
Meine Nackenhaare richteten sich auf. Bislang hatte das identifizierbare Vokabular der Zwillinge aus einer Handvoll grundlegender Ausdrücke wie »Mama« und »Dada« bestanden, dazu das hoch originelle »Gaga«, das – so war zu hoffen – Großvater bedeuten sollte. Hatten meine beiden kleinen Genies ihrem Wortschatz etwa ein richtiges Adjektiv hinzugefügt?
»Wo sind sie?«, fragte ich.
»Im Kinderzimmer«, antwortete Willis senior und ging vor mir den Flur hinunter. »Ich habe die Tür geschlossen, weil ich nicht wollte, dass ihr von dem Lärm aufwacht.«
Als mein Schwiegervater die Tür zum Kinderzimmer öffnete, erklang Kleinkindgeschrei, mit dem man Tote hätte aufwecken können. Will und Rob trugen noch ihre Schlafanzüge. Ihr Haar war zerzaust, ihre Wangen rosa vor Aufregung. Sie standen in ihren Kinderbettchen, hüpften auf und ab und schnatterten wild vor sich hin.
»Siehst du?«, meinte Willis senior.
»Mama!«, rief Will. »Alt, alt, alt.«
»Alt!«, fügte Rob hinzu, für den Fall, dass ich es nicht mitbekommen hatte.
»Was ist hier los?« Bill stand in der Tür und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Er hatte sich eilig ein Harvard-Sweatshirt und eine graue Trainingshose übergeworfen.
»Ich glaube, sie wollen uns etwas sagen«, murmelte ich und schaute mich im Zimmer um.
»So spricht eine liebende Mutter«, sagte Bill mit einem nachsichtigen Lächeln. »Du weißt schon, dass sie zu klein sind, um uns etwas ...«
Ich gab ihm einen Stoß mit dem Ellenbogen und deutete auf das Fensterbrett. »Alt!«, rief ich triumphierend.
Wenn Bill seine Brille aufgehabt hätte, wäre er in der Lage gewesen, das geheimnisvolle Wort so schnell zu enträtseln wie ich. Man musste kein Wunderkind sein, um herausfinden, dass »alt« Reginald heißen sollte, der Name des rosafarbenen Flanellhasen, den Tante Dimity mir zu meiner Geburt geschenkt hatte.
»Was macht Reginald auf der Fensterbank?«, fragte Bill, während er gerade seine Brille auf der Nase zurechtrückte. »Ich habe ihn gestern Abend in Robs Bettchen gelegt.«
»Rob muss ihn herausgeworfen haben?«, schlug ich vor.
»Bis hin zum Fenster?« Bill runzelte die Stirn. »Ein ganz schöner Wurf für so einen kleinen Kerl. Außerdem steht Reginald aufrecht und schaut hinauf. Sehr unwahrscheinlich. Vater, hast du ...«
»Ich habe Reginald nicht berührt«, beteuerte Willis senior und trat ans Fenster. »Er saß so da, als ich heute Morgen aufwachte. Ich dachte, einer von euch hätte ihn dort platziert.«
Mich überkam ein unbehagliches Gefühl. Die Jungen waren plötzlich still geworden und sahen mich erwartungsvoll an. Ich nickte ihnen zu und trat ans Fenster, neben Willis senior, und blinzelte in das helle Sonnenlicht, das der Schnee reflektierte.
Kein Windhauch störte die lautlose Welt, die sich vor dem Fenster auftat. Der Himmel wölbte sich bläulich, die karge herbstliche Landschaft war in klassisches Weiß gehüllt. Die Hecken sahen aus, als hätten Cheerleader sie mit ihren Quasten geschmückt, und der Rasen des Vorgartens war von einem makellosen Weiß überzogen, das vom Kiesweg bis hin zu den Lilienbüschen reichte, die unsere Auffahrt umsäumten.
»Was ist das da?«, sagte Bill hinter mir.
»Was?«, fragte ich.
Willis senior beugte sich vor. »Mir scheint, als läge da etwas hinter den Lilienbüschen.«
Bill richtete sich auf. »Etwas? ...- Eher jemand.«
Einen Herzschlag lang rührte sich niemand. Plötzlich fiel Reginald vom Fenstersitz auf den Boden, und wir schreckten auf. Willis senior blieb bei den Jungs, Bill und ich rannten die Treppe hinunter. In unserer Hast ließen wir die Babypforte offen. An der Haustür schlüpften wir mit nackten Füßen in unsere Stiefel und liefen hinaus, ohne uns etwas überzuziehen.
Hinter den kahlen Zweigen des Lilienbusches lag ein Mann, auf der Seite, die Hände über der Brust verschränkt, die Beine angezogen, als habe er versucht, so einen letzten Rest von Körperwärme zu erhalten. Schulterlanges, graues Haar fiel über sein Gesicht, Raureif bedeckte seinen struppigen Bart. Er sah aus wie ein Landstreicher, zerlumpte Hosen, Fingerlinge an den Händen, ein abgewetzter Wollmantel, den er mit einem Stück Seil zusammengebunden hatte. Schnee hatte sich über seinen Körper gelegt und ein Muster aus Kreisen und Kurven gezeichnet.
Bill ließ sich auf die Knie fallen und tastete den Hals des Mannes ab. »Er lebt noch«, murmelte er. »Aber nur noch so eben. Pack seine Beine, Lori.«
Ich starrte auf die schmutzige Hose des Mannes, unterdrückte ein Gefühl des Ekels und half Bill, ihn ins Haus zu tragen.
Willis senior war ein kleiner, fast schmächtiger Mann, aber wenn er das Kommando übernahm, besaß er die Entschlossenheit eines Fünf-Sterne-Generals. Noch während Bill und ich draußen waren, hatte er zum Telefon gegriffen.
Es dauerte nicht lange, und ein Rettungshubschrauber der Royal Air Force landete auf unserer Wiese und flog den Landstreicher ins Radcliffe-Hospital in Oxford, wo ihn ein Team von Spezialisten – mein Schwiegervater verfügte über hochkarätige Verbindungen – behandelte. Es stellte sich heraus, dass er neben seiner Unterkühlung auch an einer Lungenentzündung und Unterernährung litt.
Dr. Pritchard, der leitende Arzt, hielt uns über den Zustand seines Patienten auf dem Laufenden. Um Viertel nach neun teilte er uns mit, dass der Zustand des Mannes kritisch sei. Er war noch immer ohne Bewusstsein. Seinen Namen kannte man nicht. Er hatte keinerlei Papiere bei sich, und auch der Polizei war es noch nicht gelungen, ihn zu identifizieren.
Wir hielten im Wohnzimmer schweigsame Wache. Willis senior schaute mit auf dem Rücken gefalteten Händen aus dem Fenster auf die Lilienbüsche, Bill und ich saßen uns vor dem kalten Kaminfeuer gegenüber.
Die Zwillinge hatten den Morgen erstaunlich ruhig und artig verbracht, so als spürten sie den Ernst der Lage. Rob saß seit einer halben Stunde auf Bills Schoß und kaute auf Reginalds linkem Ohr herum, Will hatte sich still in meine Arme gekuschelt.
Das Sofa, auf das wir den Landstreicher gelegt hatten, war noch feucht von geschmolzenem Schnee. Ich muss es reinigen und desinfizieren lassen, ging mir durch den Kopf, bevor ich meine Söhne auch nur wieder in die Nähe des Möbels lassen würde.
»Ich frage mich, was er hier wollte«, überlegte Bill.
»Hauptsache, er ist in guten Händen«, sagte ich. »Wir müssen uns um ihn keine Sorgen mehr machen.«
»Findest du es denn nicht seltsam, dass er ausgerechnet hier vorbeigekommen ist?«, fuhr Bill fort. »Das Haus liegt nicht gerade an einer Durchgangsstraße«. In der Tat befand sich das Cottage an einer versetzten, schmalen Straße, die in den meisten Karten nicht einmal verzeichnet war.
»Vielleicht war er per Anhalter unterwegs«, meinte Willis senior. »Und der Fahrer hat ihn kurz vor seinem Ziel abgesetzt.«
»Das bezweifle ich«, erwiderte Bill. »Unsere Straße wird doch fast nur von Anwohnern benutzt. Ich glaube nicht, dass einer unserer Nachbarn einen offensichtlich kranken Mann bei diesem Wetter einfach seinem Schicksal überlassen hätte.«
Willis senior schürzte die Lippen. »Willst du damit sagen, dass der Gentleman mit der Absicht hierher kam, einen von euch zu besuchen?«
»Das ist doch Unsinn«, meinte ich. »Weder Bill noch ich kennen irgendwelche Landstreicher.«
»Das nicht«, sagte Bill. »Aber vielleicht wollte er zu ...« Er unterbrach sich und lauschte. »Hört ihr auch Glocken?«
Ein Lächeln huschte über Willis seniors Gesicht, als er aus dem Erkerfenster schaute. »Lady Eleanor beehrt uns.«
Lady Eleanor, die ansonsten eher als Nell Harris bekannt war, wohnte mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter, Derek und Emma Harris, etwas weiter die Straße hinauf, in jenem Herrenhaus aus dem vierzehnten Jahrhundert, Anscombe Manor, in dem ich auch meine Weihnachtsgäste unterbringen wollte. Nell war dreizehn Jahre alt, groß, gertenschlank, äußerst gewitzt und von geradezu himmlischer Schönheit. Den meisten Erwachsenen jagte sie eine Heidenangst ein, aber Willis senior verehrte den Boden, auf dem sie ging.
Ich trug Will zum Fenster und beobachtete, wie Nell eintraf, mit ihrem üblichen Schwung. Sie kam aus dem Seitenpfad, in einem einspännigen offenen Schlitten. Auf dem Rücksitz saßen zwei Passagiere, neben ihr Bertie, ihr schokobrauner Teddybär.
Nells Mitfahrer erkannte ich sofort, denn sie glichen einander wie ein Ei dem anderen. Ruth und Louise Pym waren in der Tat Zwillingsschwestern, alt genug, um sich noch daran zu erinnern, wie »unsere Jungs« damals abmarschierten, hin zu den blutgetränkten Feldern Flanderns. Sie waren erstaunlich munter, äußerten sich gerne etwas nebulös und trugen stets identische Kleidung.
Heute sahen sie aus, als seien sie einem Gemälde von Currier und Ives entsprungen. Sie hatten sich in taillierte Mäntel aus feinster Wolle gehüllt, deren wattierte Schultern mit schwarzer Spitze versehen waren. Ihre zarten Hände steckten in Muffs aus weißem Kaninchenfell, Federhauben schützten ihre Köpfe. Die zweifellos praktischen Gummistiefel an ihren Füßen passten allerdings gar nicht zu diesem Aufzug.
Während Nell ihr Pferd in den Schuppen führte, den ihr Vater am Ende des Pfads gebaut hatte, huschten die Pyms über den schneebedeckten Plattenweg. Ich übergab Will seinem Großvater und eilte zur Tür, um sie zu begrüßen.
»Es tut uns leid, dass wir so lange gebraucht haben«, begann Ruth, noch während ich sie ins Haus bat. »Die liebe Nell war so freundlich, uns ...«
»... in ihrem Schlitten mitzunehmen«, brachte Louise den Satz zu Ende. Dass die beiden Schwestern sich beim Sprechen abwechselten, zeichnete sie mindestens ebenso aus wie ihre antiquierte Kleidung. »Wie ihr wisst, springt unser Automobil nicht immer an ...«
»... bei solch einem Wetter«, fuhr Ruth fort. Da das »Automobil« der Pyms kurz nach der Ära der Pferdekutschen fabriziert worden war, grenzte es an ein Wunder, dass es überhaupt noch ansprang.
»Ansonsten wären wir schon sehr viel früher hier gewesen. Andererseits dürfte der Schnee ...«
»... unserem schnellen Vorankommen im Wege gestanden haben«, erklärte Louise. »Die Straße ist blockiert, von hier bis Finch, und Mr Barlow hat seinen Schneepflug noch nicht eingesetzt.«
Während ich ihnen die Mäntel abnahm und ihnen aus den Stiefeln half, überkam mich das vertraute Gefühl der Verwirrung, wie stets, wenn ich mit den Pyms zu tun hatte.
Ich hatte keinen blassen Schimmer, warum sich die Schwestern für ihr spätes Eintreffen entschuldigten, da ich sie ja überhaupt nicht erwartet hatte.
»War für heute etwas geplant?«, fragte ich.
»In der Tat«, antwortete Ruth. »Louise und ich sind mit unseren Häkelarbeiten etwas in Verzug geraten, und wenn wir uns nicht sputen ...«
»... werden wir unsere Weihnachtsgeschenke nicht mehr rechtzeitig zustellen können«, stellte Louise besorgt fest. »Diese Pläne nehmen sich jedoch ganz und gar nichtig aus neben dem bedeutenden Thema, das nun anliegt.«
»Natürlich«, sagte ich in der vagen Hoffnung, dass ich irgendwann verstehen würde, wovon sie sprachen. »Kommen Sie doch herein. Bill, würdest du dich um unsere Gäste kümmern?«
Während mein Mann die Pyms begrüßte, ging ich in die Küche und setzte den Wasserkessel auf. Als ich das Teetablett ins Wohnzimmer brachte, klopfte Nell an die Haustür. Ich stellte das Tablett auf dem Couchtisch ab und eilte zur Tür, um sie hereinzulassen.
Nell, Bertie im Arm, stürmte in den Flur. Mit seinem waldgrünen Pullover und dem rot-grün gestreiften Schal sah Bertie aus wie eine etwas zerzauste Elfe, und Nell war die Schneekönigin. Ihr samtener Kapuzenumhang leuchtete fast ebenso blau wie ihre Augen, und ihre goldenen Locken glänzten in der hellen Vormittagssonne wie eine Krone.
»Bitte, sag mir nicht, dass er tot ist!« Ihre Stimme zitterte vor Erregung.
»Wer?«, fragte ich.
»Reginald«, entgegnete sie, als sei diese Antwort völlig selbstverständlich. »Bertie ist außer sich, seit er sah, wie der Rettungshubschrauber auf das Cottage zuflog. Ist Reginald etwas zugestoßen?«
Nells Überspanntheiten verwirrten mich schon lange nicht mehr. Wenn sie glauben wollte, dass sich ihr Teddybär Sorgen um meinen rosafarbenen Flanellhasen machte, bitte sehr. Ich war schon einigermaßen erleichtert, dass sie ihr blondes Haar nicht schwarz gefärbt hatte und ihre Haut nicht mit Tätowierungen bedeckt war.
»Reginald erfreut sich bester Gesundheit«, sagte ich und nahm ihr den Umhang ab. »Bis auf ein wenig Babyspucke im Ohr.«
»Gott sei Dank«, stieß Nell hervor. Sie zögerte kurz und fragte verwundert: »Dann stimmt es also, was Ruth und Louise sagen? Ihr habt wirklich einen Hubschrauber kommen lassen, um einen Landstreicher zu retten?«
Ich sah sie an. »Woher wissen Ruth und Louise von dem Mann?«
Nell zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Sie hielten mich an, als ich an ihrem Haus vorbeifuhr, und baten mich, sie zu euch mitzunehmen. Sie sagten, sie machten sich Sorgen um den Landstreicher. Habt ihr wirklich die RAF gerufen ...«
»Ja, Nell«, sagte ich. »Genau genommen hat William die Royal Air Force gerufen, um den Mann zu retten. Ist das so schwer zu glauben?«
Nell sah mich mit ihren großen blauen Augen an. »Eigentlich nicht. Ich habe nur noch nie gehört, dass jemand so etwas tut.«
»Komm«, sagte ich. »Ich möchte hören, was die Pyms über meinen ungeladenen Gast wissen.«
Nell begrüßte Bill und Willis senior und bedachte Rob und Will mit einem Kuss. Geschickt wich sie dabei Wills Versuch aus, nach einer Handvoll der verlockenden goldenen Locken zu grapschen. Dann brachte sie Rob dazu, ihr im Austausch für einen weichen lila Dinosaurier Reginald zu geben.
Sie platzierte Reginald neben Bertie auf der Fensterbank, bevor sie sich auf der Ottomane neben Willis seniors Sessel niederließ.
Ich setzte mich auf das Sofa, umrahmt von den Pyms, und schenkte Tee ein, wobei ich mich fragte, wie lange es wohl dauern würden, bis die beiden Schwestern auf den Punkt kamen. Zu meiner Überraschung taten sie es sofort.
»Kaum war der Hubschrauber gelandet, wussten wir, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste«, sagte Ruth. »Was für ein Jammer. Hätte der arme Gentleman ...«
»... doch Zuflucht in unserem Haus gesucht, wie wir es ihm angeboten haben.« Betrübt schüttelte Louise den Kopf. »Aber er wollte unbedingt weiter.«
»Sie haben gestern Abend mit dem Landstreicher gesprochen?«, fragte ich beide Schwestern.
»Wir hörten ihn husten, draußen auf dem Reitweg«, antwortete Ruth. »Ein schreckliches, heiseres Husten. Wir sprachen ihn an, ich bot ihm eine warme Suppe an ...«
»... aber er wollte nicht innehalten«, fuhr Louise fort und fügte mit großen runden Augen hinzu: »Um ehrlich zu sein, wir fanden es recht unheimlich. Er erinnerte uns so sehr an den ...«
»... armen Richard Anscombe, der vor langer Zeit verstarb«, sagte Ruth. »Er wurde im Krieg verletzt, 1917, in den Schützengräben. Dabei verlor er einen Arm, und sein Gesicht war so entstellt, dass er es kaum noch wagte, sich anderen Menschen zu zeigen.«
»Aus diesem Grund benutzte er stets den Reitweg, damit ihn niemand sah«, ergänzte Ruth.
Nell nickte. Die Harris’ wohnten nun seit acht Jahren in Anscombe Manor. Als sie einzogen, war das Haus wenig mehr als eine Ruine gewesen, das Grundstück völlig verwildert. Dreißig Jahre zuvor war die Familie Anscombe, die einst zum Landadel von Finch gehörte, von der Bildfläche verschwunden. Nur noch ein paar Bildnisse und verschiedene Marmortafeln in der Saint George’s Church erinnerten an sie.
»Wir bedrängten ihn, bei diesem Sturm nicht im Freien zu bleiben«, sagte Ruth. »Doch er behauptete, er wäre bald am Ziel.«
»Welches war?«, fragte Bill.
»Dimity Westwoods Cottage«, antwortete Louise.
Natürlich, schoss es mir durch den Kopf. Wen sonst hätte der Mann hier besuchen wollen, wenn nicht Dimity Westwood. Die Frau, von der ich das Cottage geerbt hatte, hatte zu ihren Lebzeiten einen ausgedehnten Bekanntenkreis gehabt, darunter auch Menschen vom unteren Ende der sozialen Leiter.
Willis senior verfrachtete Will von seiner Schulter auf seinen Schoß und sprach aus, was auch ich gerade überlegt hatte.
»Offenbar war dem Gentleman nicht bekannt, dass Miss Westwood verstorben ist.«
Die Schwestern nickten im Verein.
»Wir haben ja versucht, ihn darauf hinzuweisen«, sagte Ruth. »Aber er konnte uns nicht hören ...«
»... der Wind heulte zu laut«, sagte Louise. »Dazu sein Husten.«
»Hat er noch irgendetwas über Dimity gesagt?«, fragte Bill.
»Nichts«, erwiderte Ruth. »Er winkte uns nur noch einmal zu ...«
»... und ging seiner Wege«, sagte Louise. »Wir haben uns seitdem schreckliche Sorgen um ihn gemacht. Wie geht es dem armen Gentleman?«
Bill sah zu mir herüber und deutete mit dem Kinn in den Flur. Während er die Ereignisse des Morgens detailliert beschrieb, entschuldigte ich mich und ging in das Arbeitszimmer. Es war offensichtlich, dass mein Mann mich zu einem Gespräch mit Tante Dimity aufgefordert hatte.
Kapitel 3
STRENG GENOMMEN HANDELTE es sich bei Dimity Westwood nicht um meine Tante. Technisch gesehen lebte sie auch nicht mehr. Ersteres zu erklären, fällt mir leichter als Letzteres.
Dimity Westwood war die beste Freundin meiner verstorbenen Mutter gewesen. Sie hatten sich während des Zweiten Weltkriegs in London kennengelernt und noch lange nach Kriegsende regelmäßig miteinander kommuniziert. Als Kind hörte ich sehr oft von »Tante« Dimity, wobei sie mir immer vorkam wie die Heldin aus einer meiner Gutenachtgeschichten. Die wahre Dimity Westwood offenbarte sich mir eigentlich erst nach ihrem Tod, denn sie vermachte mir ein beträchtliches Vermögen, ein entzückendes Cottage in den Cotswolds und ein in blaues Leder gebundenes Tagebuch mit leeren Seiten. Das Buch verwahrte ich in einem Regal im Arbeitszimmer.
Durch diesen blauen Band lernte ich meine Wohltäterin erst richtig kennen. Dimity Westwood gehört nicht zu den Menschen, die sich von einer Kleinigkeit wie dem Sterben von ihren liebgewonnenen Gewohnheiten abhalten lassen. Sie setzte die Korrespondenz, die sie mit meiner Mutter geführt hatte, einfach mit mir fort, auch wenn ihre sterblichen Überreste längst zu Staub zerfallen waren.