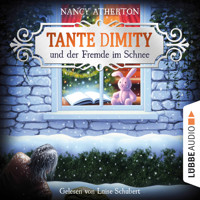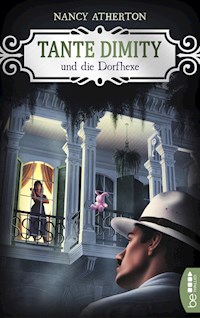5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Eigentlich könnte Lori Shepherd die glücklichste Frau der Welt sein - sie hat einen wundervollen Mann geheiratet und durch das Erbe von Tante Dimity haben sich ihre Geldsorgen in Luft aufgelöst. Aber leider verbringt Bill mehr Zeit im Büro als Zuhause. Um frischen Wind in ihre Beziehung zu bringen, plant Lori einen zweiten romantischen Honeymoon in Tante Dimitys Cottage. Doch Bill sagt kurzfristig ab und Lori muss mit seinem Vater Vorlieb nehmen. Kurz nach der Ankunft verschwindet Willis senior und hinterlässt eine äußerst undurchsichtige Nachricht. Verzweifelt bittet Lori Tante Dimity um Hilfe und stößt bei ihren Ermittlungen auf ein dunkles Familiengeheimnis und einen jahrhundertealten Skandal.
Amüsantes Krimivergnügen mit Tante Dimity. Jetzt als eBook bei beTHRILLED.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Onkel Toms Karamellbrownies.
"Die Tante Dimity Krimis sind wohltuend wie eine heiße Tasse Tee." (Booklist)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
Toms Karamellbrownies
Über dieses Buch
Eigentlich könnte Lori Shepherd die glücklichste Frau der Welt sein – sie hat einen wundervollen Mann geheiratet und durch das Erbe von Tante Dimity haben sich ihre Geldsorgen in Luft aufgelöst. Aber leider verbringt Bill mehr Zeit im Büro als Zuhause. Um frischen Wind in ihre Beziehung zu bringen, plant Lori einen zweiten romantischen Honeymoon in Tante Dimitys Cottage. Doch Bill sagt kurzfristig ab und Lori muss mit seinem Vater Vorlieb nehmen. Kurz nach der Ankunft verschwindet Willis senior und hinterlässt eine äußerst undurchsichtige Nachricht. Verzweifelt bittet Lori Tante Dimity um Hilfe und stößt bei ihren Ermittlungen auf ein dunkles Familiengeheimnis und einen jahrhundertealten Skandal.
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten „Tante Dimity“ Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Amerikanischen von Christine Naegele
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Alvaro Cabrera Jimenez | Montreeboy
Illustration: © Jerry LoFaro
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3371-8
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity’s Good Deed« bei Penguin Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 1996 by Nancy T. Atherton
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2006
by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
MAN SAGT, DASS drei Wünsche nie genug sind, und vielleicht ist das wahr. Es gab einmal eine Zeit, wo ich mir angesichts eines wohlwollenden Flaschengeists nichts sehnlicher gewünscht hätte als einen Job, den ich nicht hasste, und eine Mietwohnung in dem Stadtteil Bostons, der mich an England erinnerte, ein Land, das ich seit meiner Kindheit liebe.
Mein dritter Wunsch – zweifellos das Ergebnis einer trostlosen Ehe und einer noch trostloseren Scheidung – wäre eine mehr oder weniger stabile Beziehung mit einem Mann gewesen, der kein völliges Arschloch war und der mir wenigstens so oft die Wahrheit sagte wie er seine Socken vom Boden aufhob. Damals konnte mir niemand nachsagen, dass ich überzogene Erwartungen hatte. Damals waren meine kühnsten Träume so zahm, dass sie praktisch jedem aus der Hand gefressen hätten.
Aber als Tante Dimity starb, wurden alle meine Wünsche wahr, und zwar auf eine Art und Weise, wie ich sie mir nie hätte erträumen können. Tante Dimity hinterließ mir ein honigfarbenes Cottage, ein Häuschen, das tatsächlich in England stand, und so viel Geld, dass ich nie mehr arbeiten musste. Sie hatte auch dafür gesorgt, dass ihr Testament von einem Mann vollstreckt wurde, der nicht nur rücksichtsvoll in Bezug auf seine Socken war, sondern auch ehrlich und zudem bis über beide Ohren in mich verliebt.
Dank Tante Dimity war es eine Romanze wie im Märchen, einschließlich eines gemütlichen honiggelben Schlosses und eines Märchenprinzen – denn so kam Bill Willis mir vor, obwohl er weder ein Prinz war noch schön. Und die Romanze endete, indem er mich um meine Hand bat. Es war alles so schnell und so mühelos passiert, dass ich Bill liebte, noch ehe ich so recht wusste, wer er überhaupt war. Und vielleicht war das mein Fehler.
Denn das Dumme an Märchenhochzeiten ist meist das, was danach kommt. Ich war zwar vorher schon einmal verheiratet gewesen, also war ich nicht völlig ahnungslos – ich wusste schon, dass die See manchmal rau sein würde –, aber ich hätte nie erwartet, dass mein geliebter Bill versuchen würde, das Schiff zu versenken.
Ich hatte gedacht, dass ich alles über ihn wüsste. Während unserer gemeinsamen Zeit in Tante Dimitys Cottage hatte ich stets darauf gewartet, dass sich ein verhängnisvoller Fehler zeigen würde, wie ihn jeder Märchenprinz zweifellos haben musste, aber er zeigte sich nie. Trotz seines bizarren Humors war Bill Willis ein ausgeglichener, liebevoller Gesellschafter gewesen, ein wirklich anständiger Kerl. Und das blieb er – solange wir in England waren.
Das Problem lag darin, dass ich Bill nie in seiner normalen Umgebung erlebt hatte. Ich hatte ihn nie hinter seinem Schreibtisch bei der Arbeit gesehen. Als ich ihn kennenlernte, hatte er so etwas wie Urlaub, eine lange Abwesenheit von der Rechtsanwaltskanzlei seiner Familie – das war eine Bedingung in Tante Dimitys Testament gewesen –, sodass wir unsere erste Zeit zusammen an einem uns fremden und sehr romantischen Ort verbrachten. Es war idyllisch gewesen, aber es hatte mich überhaupt nicht auf das Leben vorbereitet, das ich führen würde, wenn wir wieder in den Vereinigten Staaten wären, wo mein ausgeglichener und unbeschwerter Verlobter sich in einen arbeitswütigen und ständig abwesenden Ehemann verwandelte.
Selbst unsere Hochzeitsreise wurde von einer endlosen Reihe von Faxen aus der Firma begleitet. Damals fand ich das noch lustig, aber im Nachhinein sehe ich es als eine Ankündigung dessen, was mich erwartete.
Bills natürliche Umgebung war schließlich kein gemütliches Cottage auf dem Lande. Er war in einer imposanten Familienvilla aufgewachsen, einem stadtbekannten historischen Gebäude im nobelsten Teil von Boston. Zusammen mit Bills Vater, William Willis senior, bewohnten wir den Westflügel und den Mittelteil des Gebäudes, der Ostflügel war den Büroräumen von Willis & Willis vorbehalten, einer der ältesten und angesehensten Rechtsanwaltskanzleien in New England. Die Kanzlei Willis & Willis konnte ihre Wurzeln bis in die Zeit vor der Revolution zurückverfolgen, genau wie die meisten ihrer Klienten – ein muffiger Haufen alter Bostoner Familien, deren Rechtsstreitigkeiten der Familie Willis zu Reichtum und Ansehen verholfen hatten.
Bills Aufgabe war es, einer anspruchsvollen blaublütigen Klientel zu dienen, und sobald wir wieder in Boston waren, stürzte er sich in ein Pensum aus endlosen Telefonaten, Konferenzen, Mittagessen, Empfängen und dem damit verbundenen Papierkrieg. Er stand vor Morgengrauen auf und ging lange nach Mitternacht zu Bett und rannte herum wie ein Hamster im Laufrad. Er nahm ab, und auf seiner Stirn bildeten sich neue Falten, die glatt zu streichen ich nur noch selten Gelegenheit hatte.
Bills wahnsinnige Arbeitswut lag zumindest teilweise daran, dass er seinen Vater entlasten wollte. Zwar hatte Willis senior nicht darum gebeten, entlastet zu werden, aber Bill war überzeugt, dass sein Vater nicht wusste, was gut für ihn sei. Mein fünfundsechzigjähriger Schwiegervater erfreute sich überwiegend guter Gesundheit, aber er hatte früher einmal Herzbeschwerden gehabt, und Bill hatte schreckliche Angst, ihn zu verlieren. Allmählich übernahm Bill sämtliche Tagesgeschäfte der Firma, damit sein Vater beruhigt sein konnte, dass alles weiter seinen geordneten Gang gehen würde, falls der alte Herr sich entschließen sollte, in den Ruhestand zu treten.
Ich vermute, dass Bill sich damit auch selbst etwas beweisen wollte. Es war nicht immer leicht, der Sohn des großen William Willis senior zu sein. So wie es nicht immer leicht sein konnte, überhaupt ein Willis zu sein. Bills Vorfahren hatten den Namen berühmt gemacht, seit sie aus England herübergekommen waren; einige von ihnen waren Richter gewesen, andere Abgeordnete im Kongress, aber alle hatten sie etwas Bemerkenswertes geleistet. Es war eine gewichtige Tradition, die es zu erhalten galt, und Bill hatte das Alter erreicht – er war Mitte dreißig –, wo er glaubte, zeigen zu müssen, dass er des Namens Willis würdig sei.
Also hatte mein Mann gute und verständliche Gründe, sich mit einer Unmenge Arbeit in ein frühes Grab zu befördern, und ich hatte gute und verständliche Gründe, mir die Haare zu raufen. Im Leitfaden über das Leben mit Märchenprinzen steht nichts über chronische Workaholics – Aschenputtels Prinz war vermutlich besser im Delegieren –, und ich wusste nicht, wohin ich mich um Hilfe wenden sollte. Was tut man, wenn das Leben anfängt, schiefzulaufen, und man seine drei Wünsche schon aufgebraucht hat?
Ich weigerte mich, zu Hause herumzusitzen und zu jammern. Mein Freund und früherer Chef, Dr. Stanford J. Finderman, hatte reichlich Arbeit für mich. Stan war der Kurator der Sammlung seltener, alter Bücher in der Bibliothek meiner Alma Mater, und er war sofort bereit, sein mageres Budget zu strapazieren und mich nach England zu schicken – auf eigene Kosten natürlich –, damit ich dort auf der Suche nach wertvollen Büchern Auktionen besuchen und private Sammlungen sichten könne.
Zwei lange Jahre hatte ich mich mit großem Eifer meiner Aufgabe gewidmet. Ich hatte viele interessante Menschen kennengelernt und Hunderte von herrlichen Häusern gesehen, und jede dieser Reisen hatte mich von der leisen und völlig irrationalen inneren Stimme abgelenkt, die immer wieder erklang: Es liegt an dir. Es ist deine Schuld, dass Bill sich so in die Arbeit vergräbt. Er hat keine Ahnung, warum er ausgerechnet dich geheiratet hat.
Es war ein absurder und lächerlicher Gedanke, aber er hielt sich hartnäckig. Und als Monat um Monat verging, in dem die Delle in Bills Kopfkissen morgens der einzige Beweis war, dass er überhaupt zu Bett gekommen war, fragte ich mich, ob nicht doch ein Körnchen Wahrheit darin sei.
Egal, wie viele Gemeinsamkeiten wir hatten – Bill und ich hatten keinen gemeinsamen Hintergrund. Er war in einem noblen, denkmalgeschützten Wahrzeichen der Stadt aufgewachsen, ich dagegen in einem unscheinbaren Mietshaus auf der Westside von Chicago. Seine Ahnenreihe bestand aus hervorragenden Männern und Frauen, die erster Klasse mit dem Schiff aus England gekommen waren, noch ehe die Vereinigten Staaten vereinigt waren. Ich stammte von Joe und Beth Shepherd ab, einem überarbeiteten Geschäftsmann und einer Lehrerin, deren Ahnen sich die Schiffspassage nach Amerika wahrscheinlich damit verdient hatten, dass sie das Deck schrubbten. Ich war auf ein gutes College gegangen, Bill jedoch trug das Purpurrot von Harvard; und wenn Tante Dimity nicht gewesen wäre, dann wäre mein Vermögen kleiner gewesen als die Summe, die mein Mann jährlich für Schnürsenkel ausgab.
Mit dem Tod meiner Mutter hatte ich die letzte Familienangehörige verloren, ich stand allein da. Bill hatte noch seinen Vater, mehrere Vettern an der Westküste und zwei Tanten, die in Boston, nicht weit von uns wohnten. Ich hatte Bills Vettern noch nicht kennengelernt, aber sein Vater war ein Schatz, mit dem ich mich bestens verstand.
Seine Tanten jedoch waren ein schwieriges Kapitel. Honoria und Charlotte waren zwei spindeldürre, grauhaarige Witwen Ende fünfzig, und als ich sie sah, verstand ich, warum Bills Vettern nach Kalifornien geflohen und nie zurückgekehrt waren. Meine Schwiegertanten waren schmalhüftig und dünnlippig und hatten mich mit jener Wärme in die Familie aufgenommen, die man von zwei Frauen erwarten kann, deren Hoffnungen auf eine standesgemäße Heirat ihres Lieblingsneffen sich zerschlugen, als er mir den Heiratsantrag machte.
Sie hatten alles Mögliche gegen mich, aber der Hauptgrund ihrer Ablehnung schien zu sein, dass ich, obwohl ich zweiunddreißig Jahre zählte und schon einmal verheiratet gewesen war, immer noch keinen Beweis geliefert hatte, dass ich eine geeignete Zuchtstute für den Willis-Stall war. Sie drückten es zwar nicht ganz so krass aus, aber wenn Blicke schwanger machen könnten, dann hätte ich zu jedem Weihnachtsfest Zwillinge bekommen.
Die nüchterne Wahrheit war, dass ich als Zuchtstute wohl keine Preise gewinnen würde. Ich war das einzige Kind zweier Einzelkinder, die zehn Jahre gebraucht hatten, um mich zustande zu bringen, also waren meine Chancen im Fruchtbarkeitslotto nicht gerade überwältigend.
Mir machte es nichts aus. Nicht viel jedenfalls. Ich will gar nicht leugnen, dass ich so manchen Morgen auf die Delle in Bills Kopfkissen starrte und mich fragte, ob in unserem Haus jemals das Trippeln von Kinderfüßchen zu hören sein würde, wenn ich nicht einmal mehr seine Schritte im Schlafzimmer wahrnahm. Jedoch sprach ich nie davon, außer ein einziges Mal in einem Augenblick großer Schwäche gegenüber meiner Freundin Emma Harris in England, und Emma hatte mir versprochen, das Thema nie mehr zu erwähnen. Aber Honoria und Charlotte erwähnten es oft. »Hast du vielleicht eine freudige Mitteilung für uns, Lori?«, war eine Frage, die ich zu hassen lernte, denn ich hatte schon zwei lange Jahre keine freudige Mitteilung, für niemanden.
Aber auch wenn ich Drillinge produziert hätte – Bills Tanten hätten mich trotzdem abgelehnt. Dank Tante Dimitys Erbe konnten sie mich nicht direkt der Erbschleicherei bezichtigen, aber der Verdacht, ein Emporkömmling zu sein, lag immer in der Luft. Sie versäumten es nie, meine kleinen Ungeschicktheiten und Fauxpas aufs schärfste zu kritisieren.
Bills Freunde und Geschäftspartner gaben ebenfalls ihre Kommentare ab, aber sie nannten mich »erfrischend«. Der Gouverneur fand meine Beschreibung der primitiven Waschgelegenheiten in einigen irischen Jugendherbergen »erfrischend«. Ein Mitglied im Aufsichtsrat des Bostoner Museums of Fine Art fühlte sich von meiner Schilderung, wie ich eine seltene Erstausgabe eines Brontë-Romans aus einem Kuhstall in Yorkshire gerettet hatte, ebenfalls »erfrischt«. Es schien, dass ich jedes Mal, wenn ich etwas sagte, was eine wohlerzogene Dame in Gesellschaft nie über die Lippen gebracht hätte, »erfrischend« war.
Vielleicht wurde es auf die Dauer langweilig, eine »erfrischende« Frau zu haben. Vielleicht hörte Bill auf seine Tanten. Vielleicht waren die tieferen Dinge, die wir in unserem Cottage aneinander entdeckt hatten, nicht länger wichtig, wenn die Dinge an der Oberfläche nicht stimmten.
Wenn ich versuchte, mit Bill darüber zu sprechen, dann verwuschelte er mir nur die Haare und sagte, ich sei albern. Und meinem Schwiegervater konnte ich mich auch nicht anvertrauen. Willis senior war so entzückt von der Heirat seines Sohnes gewesen, dass ich es nicht übers Herz brachte, ihm zu gestehen, dass nicht alles wie geplant lief. Emma Harris war meine beste Freundin in England, und Meg Thomson wohnte hier in Amerika gar nicht so weit weg, und ich wusste, dass sie beide zugehört hätten, aber es war mir zu peinlich, als dass ich zu einer von ihnen auch nur ein Wort hätte sagen können. Menschen, denen drei Wünsche erfüllt worden sind, sollten eigentlich keine weiteren Wünsche haben. Und trotzdem saß ich hier und wünschte mir, dass jemand Bill mit einem metaphysischen Holzhammer eins überziehen würde und ihn zu Verstand brächte. Und zu mir zurück, ehe es zu spät war.
In meiner Verzweiflung organisierte ich eine Reise, die ich als unsere zweiten Flitterwochen bezeichnete. Bill überraschte mich, indem er sich einverstanden erklärte. Wir würden in meinem Cottage in England wohnen, den Telefonstecker herausziehen, alle Besucher wegschicken und den ganzen August damit verbringen, uns wieder kennenzulernen. Soweit der Plan, und es hätte funktionieren können, wenn die streitsüchtigen Biddifords nicht gewesen wären.
Nachdem sie sich dreißig Jahre lang wegen des Testaments des verstorbenen Quentin Biddiford in den Haaren gelegen hatten, hatte die Familie endlich beschlossen, über eine Einigung zu verhandeln. Sie hatten Bill gebeten, zu vermitteln, und es schien wie eine geplante Bösartigkeit, dass sie für das erste Gipfeltreffen den ersten August gewählt hatten, das Datum unserer geplanten Abreise nach England. Der Biddiford-Streit war der Pfirsich, auf den Bill gewartet hatte – dick, saftig und überreif –, und da er ihm statt seinem Vater in den Schoß gefallen war, gab es auch keine Diskussion darüber. Bill musste in Boston bleiben.
Mit schwerem Herzen flog ich nach England, und Willis senior flog mit mir, denn er hatte angeboten, mir Gesellschaft zu leisten, bis sein Sohn ankam. Bill hatte versprochen, nachzukommen, sobald er die Verhandlungen zu einem Abschluss gebracht hatte, aber ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass das Schicksal – in Form der schwachsinnigen Biddifords – gegen mich war. Dank dieser streitsüchtigen Clique war ich im Begriff, meine zweiten Flitterwochen mit meinem Schwiegervater zu verbringen.
Es war einfach zu viel. Mit Willis senior konnte ich darüber nicht sprechen, aber ich musste mich jemandem anvertrauen, und Emma Harris war gleich nebenan. Und genau aus diesem Grund hockte ich auf den Knien zwischen den Radieschen, und Bill war in Boston, als Willis senior verschwand.
Kapitel 2
EMMA HARRIS’ RADIESCHEN gediehen in der Südostecke ihres Gemüsegartens, der in Sichtweite des Landhauses aus dem vierzehnten Jahrhundert lag, das Emma mit ihrem Mann Derek und ihren Stiefkindern Peter und Nell bewohnte. Emma war gebürtige Amerikanerin, aber ihre Liebe zur Gärtnerei hatte sie nach England geführt, und ihre Liebe zu Derek, Peter und Nell hatte sie hier Wurzeln schlagen lassen.
Emmas Landhaus lag ungefähr auf halbem Wege zwischen meinem Cottage und Finch, einem kleinen Dorf im Westen Englands. Drei Tage zuvor waren Willis senior und ich hier angekommen. Nach einer Übernachtung in London hatte uns Paul, ein befreudeter Chauffeur der Familie, sicher hergebracht. Ich litt noch immer zu stark unter dem Jetlag, um mich an das Steuer eines Wagens zu setzen – besonders hier in England, wo das Autofahren eine ziemliche Herausforderung für mich ist –, aber ich war ausgeschlafen genug, um nach dem Frühstück zu Emma hinüberzulaufen und ihr mit den Radieschen zu helfen.
Und Emma konnte immer Hilfe gebrauchen. Sie war eine begnadete Gärtnerin, aber wenn es um Gemüse ging, hatte sie nie die Tugend der Mäßigung gelernt. Im Frühling, wenn sie pflanzte, kündigte sie mit düsterer Stimme Schäden durch Insekten, Trockenheit, Kaninchen und Krankheitsbefall an. Während des Sommers dann pflegte sie alles mit einer solchen Hingabe, dass auch die letzte Pflanze prächtig gedieh und folglich im Spätsommer die Ernte zum Problem wurde.
Preisgekrönte Zwiebeln, Kohlköpfe, Salat, Lauch – ich versuchte Emma einmal klar zu machen, dass die Kaninchen allein vom zehnten Teil ihres Gemüses so fett würden, dass sie in der Wildnis keine Überlebenschancen mehr hätten. Allerdings gehörte ich zu den Menschen, die jeden bewunderten, der auch nur einen Avocadokern im Glas zum Keimen brachte, also war mein Urteil vielleicht nicht kompetent. Ich wusste nur eines: Immer im August verwandelte sich meine sonst so ruhige und unerschütterliche Freundin in eine Erntemaschine, die Schubkarren um Schubkarren mit Bergen von Gemüse füllte.
Derek Harris nahm diese alljährliche Besessenheit seiner Frau gelassen hin. Er war, wie auch Emma, Mitte vierzig, aber während Emma klein und rundlich war, war er groß und hager, mit einem länglichen, wettergegerbten Gesicht, einem Kopf voll grauer Locken und so schönen dunkelblauen Augen, dass es einem den Atem verschlagen konnte. Um diese Augen lagen tiefe Falten. Derek hatte schwere Zeiten durchgemacht – seine erste Frau war jung gestorben und er war mit zwei kleinen Kindern zurückgeblieben –, aber er hatte diese schweren Jahre überwunden und in seiner Ehe mit Emma Trost für sein trauerndes Herz gefunden. Er war ein erfolgreicher Bauunternehmer, der sich auf Restaurierungsarbeiten spezialisiert hatte, aber im August ließ er oft alles liegen, um seiner Frau bei ihrer Gemüseorgie zu helfen.
Heute jedoch hatte er eine Ausnahme gemacht und war einem Auftrag gefolgt – von keinem Geringeren als dem Bischof, der ihn gebeten hatte, eine Notreparatur an dem beschädigten Dach der St.-James-Kirche in Chipping Campden vorzunehmen, die in zehn Tagen neu geweiht werden sollte.
Peter, Dereks siebzehnjähriger Sohn, war ebenfalls nicht zu Hause. Er war gar nicht in England. Er wollte in Oxford Medizin studieren und verbrachte den Sommer im brasilianischen Regenwald, wo er vermutlich mit Dschungelfieber und den Wasserfällen des Amazonas kämpfte, um einen neuen Wirkstoff gegen Krebs zu finden. Am Tag zuvor war ein Brief von ihm eingetroffen, Poststempel Manacapuru. Auf jemanden wie mich, der als Teenager die Sommerferien damit verbracht hatte, in der Leihbücherei die zurückgebrachten Bände wieder einzuordnen, wirkten Peters Abenteuer reichlich exotisch.
Mein Hilfsangebot wurde schnell, aber höflich abgelehnt, Emma hatte nämlich aus trauriger Erfahrung gelernt, dass ich kaum imstande war, ein reifes Radieschen von einer verfaulten Steckrübe zu unterscheiden.
Die zwölfjährige Nell, Emmas goldblonde Stieftochter, war zu unserem Haus hinübergewandert, um ihr Schachspiel mit Willis senior fortzusetzen, der, soweit ich wusste, in einem der beiden hohen Ledersessel vor dem Kamin saß, eine Tasse Tee neben sich, und eine Erstausgabe von F. W. Beecheys »Eine Entdeckungsreise zum Nordpol« in der Hand. Genau genommen saß er dort, wo Bill eigentlich hätte sitzen sollen.
Der Gedanke bedrückte mich.Ich seufzte tief und sah Emma dabei zu, wie sie Radieschen aus der Erde zog und sie geschickt in den Schubkarren warf.
»Das machst du jetzt schon zum dritten Mal«, bemerkte Emma. Sie steckte eine Haarsträhne zurück, die sich unter ihrem Strohhut gelöst hatte, und schob sich die runde Nickelbrille auf der Nase hoch. »Das war der dritte tragische Seufzer, den du über meinen Radieschen ausgestoßen hast. Die armen Dinger werden schon ganz welk vor Trauer.«
»Entschuldige.« Ich steckte die Hände in die Taschen meiner Jeans und ging langsam bis zu den Auberginen und wieder zurück, ehe ich mich auf dem Rand des Schubkarrens niederließ – zwischen den Griffen diesmal, damit er nicht wieder umkippte – und mürrisch zu dem Eichenhain hinübersah, der das Grundstück der Harris von meinem trennte. Ich fühlte mich alles andere als versöhnlich. Ich hatte Emma eine Stunde lang mein Herz ausgeschüttet, und ihr einziger Rat war gewesen, sofort nach Boston zurückzufliegen und Bill eins auf die Nase zu geben.
»Ich wette, du hast Derek noch nie eins auf die Nase gegeben«, murrte ich.
»Was aber nicht heißt, dass ich es nicht manchmal gern täte«, sagte Emma leichthin. »Man hat mir glaubwürdig versichert, dass dies das einzig zuverlässige Mittel ist, um die Aufmerksamkeit eines Mannes zu erhalten. Aber jetzt mal im Ernst, Lori, die zweiten Flitterwochen? Du hast doch gerade die ersten hinter dir. Vielleicht hält Bill dich für extravagant.«
»Das hat nichts mit extravagant zu tun«, erwiderte ich. »Ich wollte, dass dies eine besondere Reise wird. Ich wollte, dass Bill mal aus seiner Kanzlei rauskommt und sich entspannt und ...«
»Du bist diejenige, die sich entspannen muss.« Emma stand langsam auf und klopfte die Erde von den wattierten Knien ihrer Gartenhose. Während sie ihre Arbeitshandschuhe auszog und in die Taschen ihres Kittels mit dem Veilchenmuster steckte, trat sie einen Schritt näher und sah mich prüfend an. »Bist du schon bei Dr. Hawkings gewesen?«
Ich merkte, wie ich rot wurde, und schlug die Augen nieder. »Du hast versprochen, dass du nicht wieder davon anfängst.«
Emma legte die Hand auf meine Schulter. »Beruhige dich, Lori. Es bringt nichts, wenn man sich unter Druck setzt.«
Dr. Hawkings in London hatte dasselbe gesagt, und mein Gynäkologe in Boston ebenfalls. Entspanne dich, hatten alle gesagt. Lass der Natur ihren Lauf. Alles wird gut werden. Aber ich hatte meine Zweifel. »Was ist, wenn ich nach meiner Mutter komme?«, sagte ich, während ich Emmas Blick immer noch auswich. »Sie hat zehn Jahre gebraucht, ehe sie mich bekam.«
Emma zuckte die Schultern. »Dann wirst du noch zehn Jahre lang Ruhe und ungestörte Nächte haben. Ist das so schlimm?«
Ich lächelte schwach. Medizinische Fachleute auf beiden Seiten des Atlantiks waren sich einig, dass weder mir noch Bill etwas fehlte, aber ich hatte da meine Zweifel. Gleich nach unserer Ankunft in London hatte ich Dr. Hawkings für eine Routineuntersuchung und einen Test aufgesucht und ihm die Genehmigung gegeben, es von den Dächern ausrufen zu lassen, falls das Testergebnis positiv sein sollte, aber ich wusste, es würde nicht positiv sein. Ich brauchte weder Honoria noch Charlotte, um mich daran zu erinnern, dass Willis senior noch immer kein Enkelkind hatte.
»Du scheinst nicht zu verstehen«, sagte ich hartnäckig. »Bill arbeitet Tag und Nacht, und wenn er nicht arbeitet, dann ist er fast immer so müde, dass er kaum seinen Kopf hochhalten kann, geschweige denn ...«
Emma unterdrückte ein prustendes Lachen und schüttelte meine Schulter. »Du musst an etwas anderes denken«, sagte sie entschlossen. »Warum rufst du Stan Finderman nicht mal an? Oder noch besser, warum gehst du nicht ins Dorf und unterhältst dich mit Mrs Farnham? Sie war dreiundvierzig, weißt du, ehe sie ...«
Ich zuckte zusammen. »Hör auf!«, sagte ich. »Wenn du Mrs Farnham und ihre Wunderdrillinge noch einmal erwähnst, dann schmeiße ich mit Radieschen.«
»Ich versuche ja nur ...«
»Vielen Dank«, sagte ich kurz, »aber ich sehe nicht, wie der Gedanke, dass ich bis dreiundvierzig warten soll, ehe ich ein Kind bekomme, mich aufmuntern könnte!«
In dem Augenblick klingelte das Handy im Schubkarren, und froh über die Unterbrechung wühlte ich in den Radieschen. Es war ein robustes Modell, ein Weihnachtsgeschenk von Derek, zu dem ihn Bills Bemerkung inspiriert hatte, dass es für Derek leichter wäre, mit seiner Frau zu sprechen, wenn er im Garten eine Telefonzelle installierte.
Eine Telefonzelle wäre wirklich praktischer gewesen, da Emma als ehemalige Informatikerin eine ziemlich burschikose Einstellung zu dieser Art von High-Tech-Spielzeug hatte. Das Handy war mehr als einmal unter Hacke und Rechen geraten und auch schon mal gedüngt und beinahe kompostiert worden. Also war der Fundort in einem Schubkarren voller Radieschen ziemlich normal. Ich zog es aus dem grünen Gewirr und reichte es Emma, dann schlenderte ich zu den Gurkenbeeten hinüber, um dort zu warten, bis Emma ihr Gespräch beendet hatte.
»Das war Nell«, rief sie und warf das Handy wieder in den Schubkarren. »Sie sagt, dass William nicht im Haus ist.«
»Er war dort, als ich weggegangen bin«, sagte ich, während ich wieder zu ihr rüberkam.
»Ja, aber Nell sagt, jetzt ist er nicht da. Und übrigens ...« Emma bückte sich, um eine Plane über den Schubkarren zu ziehen, sie sah nachdenklich aus. »Wann hast du zuletzt etwas von Dimity gehört?«
»Wie meinst du das?«, fragte ich und blieb stehen. »Tante Dimity ist nicht mehr im Haus.«
Emma richtete sich auf. »Ja, aber Nell sagt, dass William verschwunden ist. Und sie scheint der Meinung zu sein, dass Tante Dimity mit ihm gegangen ist.«
Mein Magen schlug einen Purzelbaum, und die Erde schien unter meinen Füßen zu schwanken. »Tante Dimity?«, sagte ich schwach. »Wie ...?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Emma. »Jedenfalls fahren wir jetzt sofort zu dir rüber. Komm.« Sie nahm den Strohhut ab und warf ihn auf die Plane, wobei ihr aschblondes Haar ihr bis zur Taille fiel. Mit zügigen Schritten machte sie sich auf den Weg zum Hof vor ihrem Haus, wo ihr Auto stand.
Ich sah einen Augenblick sprachlos den Schubkarren an, dann rannte ich los, um sie einzuholen. »Wenn Nell mich zum Besten hält ...«, fing ich an, aber ich beendete den Satz nicht. Wenn Nell Harris mich zum Besten hielt, dann müsste ich es mir gefallen lassen. Nell Harris war kein Kind, mit dem man schimpfte.
Trotzdem, sagte ich mir, als ich in Emmas Auto stieg, es musste eine Art von Scherz sein. Mein Schwiegervater war ein freundlicher und sehr höflicher Mensch, ein Gentleman. Er war so zuverlässig wie der Sonnenaufgang. Er würde nie etwas so Rücksichtsloses tun wie einfach zu »verschwinden«. Er war kein Mensch, der zu spontanen Handlungen neigte.
Das sagte ich Emma, als wir ihre lange, azaleenbewachsene Zufahrt entlangfuhren. »William macht nicht einmal einen Spaziergang nach Finch, ohne mir Bescheid zu sagen«, erinnerte ich sie. »Und dass Tante Dimity mit ihm gegangen ist – unmöglich.«
»Warum?«, fragte Emma.
»Weil sie tot ist!«, rief ich ungeduldig.
»Das hat sie doch früher auch von nichts abgehalten«, gab Emma zu bedenken.
Ich spürte ein schwaches Kribbeln im Magen. »Stimmt«, sagte ich. »Aber ich meine wirklich tot. Nicht so wie früher.«
Emma sah mich von der Seite an. »Willst du damit sagen, dass es verschiedene Grade von Totsein gibt?«
»Ich will damit sagen, dass die Situation sich geändert hat«, erwiderte ich. »Es gab da etwas in Dimitys Vergangenheit, das noch unerledigt war, als sie uns das letzte Mal ... besuchte. Deshalb konnte sie nicht in Frieden ruhen. Aber das haben wir vor zwei Jahren in Ordnung gebracht. Es ist vorbei. Sie ist weg.«
»Vielleicht hat sie etwas Neues«, schlug Emma vor.
»Sei nicht albern«, sagte ich. »Dimity kann doch nicht einfach vom Diesseits ins Jenseits hin und her flitzen, wie es ihr passt.« Denn wenn sie es könnte, fügte ich in Gedanken hinzu, dann hätte ich schon längst einen sicheren Rat von ihr bekommen, wie ich meine Ehe retten kann. »Es muss auch dafür bestimmte Regeln geben, Emma.«
»Wenn es die gibt«, sagte Emma trocken, »dann gehe ich jede Wette ein, dass Tante Dimity neue aufstellt.«
Ich wollte gerade protestieren, blieb aber stumm. Emma hatte Recht. In meiner Beziehung zu Tante Dimity war bisher nichts auch nur annähernd konventionell gewesen. Zunächst waren wir weder durch Blutsbande noch durch Heirat verbunden, sondern durch ein Freundschaftsband. Dimity Westwood war die engste Freundin meiner Mutter gewesen. Die beiden hatten sich während des Krieges in London kennengelernt und hatten einen lebhaften Briefwechsel geführt, lange nachdem meine Mutter wieder in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt war. Als ich auf die Welt kam, wurde Dimity meine Tante ehrenhalber, und als kurz darauf mein Vater starb, tat sie, was sie konnte, um meiner Mutter die doppelte Last eines gebrochenen Herzens und eines schreienden Babys erträglich zu machen.
Dimity half immer jemandem. Sie arbeitete mit Kriegerwitwen und Waisen und verwandelte geschickt ein kleines Erbe in ein beachtliches Vermögen, mit dem sie den Westwood Trust gründete, einen Wohltätigkeitsverein, den es immer noch gab. Dimity hatte sich zu einer Zeit auf dem Finanzmarkt einen Namen gemacht, als Frauen dort noch nicht vertreten waren, und obwohl sie genug Geld verdient hatte, um sich zurückzulehnen und mit anderen reichen Leuten Champagner zu trinken, hatte sie zurückgezogen gelebt und still ihre guten Werke getan.
Dimity Westwood war weder als Frau noch als Tante oder Millionärin konventionell gewesen, warum also sollte sie nach ihrem Tod ein konventionelles Dasein führen? Sie hatte bereits bewiesen, dass Spuken nichts Unheimliches sein musste. Von ihr kam kein schauriges Heulen im Schornstein, sie manifestierte sich nicht in grünem Nebel und rasselte nicht um Mitternacht mit irgendwelchen Ketten. Wenn Tante Dimity sich aus dem Jenseits mit mir in Verbindung setzen wollte, dann schrieb sie ihre Botschaften in ein blaues Tagebuch, ein unauffälliges kleines Buch mit dunkelblauem Ledereinband.
Jedes Mal, wenn ich im Haus ankam, nahm ich das blaue Tagebuch vom Regal in der Hoffnung, Tante Dimitys elegante Kursivschrift auf einer der Seiten zu finden, aber meine Hoffnungen waren langsam geschwunden. Ich sagte mir, dass es dumm sei, wenn ich erwartete, wieder von Tante Dimity zu hören, denn die Probleme, die ihren Geist an das Cottage gebunden hatten, waren gelöst – so dachte ich wenigstens.
Warum sollte sie jetzt zurückkehren? Welche neuen Geschäfte sollten sie veranlassen, sich mit Willis senior auf den Weg zu machen? War er etwa in Schwierigkeiten? Aber in welche Art von Schwierigkeiten konnte ein angesehener fünfundsechzigjähriger Rechtsanwalt geraten, während er ruhig im Sessel saß und ein Buch las?
Von all den Fragen wurde mir etwas schwindlig. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Aber das Erste, was mir auffiel, als wir in meine Einfahrt einbogen, war, dass das Auto von Willis senior weg war.
Kapitel 3
ICH HATTE IN England zwei Autos: einen gebrauchten schwarzen Morris Mini für mich und einen silbergrauen Mercedes für meine Gäste. Wenn ich nicht da war, standen beide Autos in der Garage von Mr Barlow, einem Kraftfahrzeugmechaniker im Ruhestand, der sich etwas dazuverdiente, indem er die Dellen und Kratzer, die ich auf meinen Fahrten durch England sammelte, wieder ausbeulte und überlackierte. Mr Barlow hatte an diesem Morgen beide Autos aus Finch in meine Einfahrt gebracht, aber jetzt stand nur der Mini da.
»Williams Auto ist weg«, bemerkte Emma, als sie neben dem Mini parkte und ihren Motor abstellte.
»Vielleicht ist er nach Bath zu dem Buchhändler gefahren, von dem Stan ihm erzählt hatte.« Mein Schwiegervater, der sich leidenschaftlich für Polarforschung interessierte, besaß eine beachtliche Sammlung von Büchern zu diesem Thema und war immer auf der Suche nach neuen Entdeckungen. Deshalb war es durchaus denkbar, dass er dem Rat meines früheren Chefs gefolgt war und den Händler in Bath aufgesucht hatte.
Emma verhielt sich abwartend, aber ich stieg aus dem Wagen und schritt die Einfahrt ab bis dorthin, wo sie auf die Straße bog, und sah mir die Reifenspuren auf dem Kies an. Alle Spuren führten in Richtung Finch, bis auf eine, die in die andere Richtung ging.
»Siehst du das?«, sagte ich triumphierend und zeigte auf den Kies. »William ist nach Süden gefahren, in Richtung Bath. Ich bin sicher, dass er dort ist.«
»Hm-hm«, machte Emma unverbindlich.
Bis auf das fehlende Auto sah das Haus noch genauso aus wie heute Morgen, als ich es verlassen hatte. Die Steinmauern hatten die Farbe von Honig, auf den die Sonne scheint, das Schieferdach war ein Flickenteppich aus Moos und Flechten, und die Eingangstür war von einem Wasserfall aus Rosen umgeben. Selbst im grauen Licht des Winters, wenn die Rosensträucher kahl waren und das Dach mit Schnee überzuckert war, wirkte das Haus warm und einladend. Jetzt im August, wo die Sommersonne das Moos goldgelb gebacken hatte und der Duft von frisch gemähtem Heu von einem benachbarten Feld herüberwehte, war Tante Dimitys Cottage für mich der schönste Ort auf der ganzen Welt.
Trotzdem sah ich es mir genau an, als ich Emma auf dem gepflasterten Weg zur Haustür folgte. Ich war überzeugt, dass das Haus glitzern oder leuchten müsste oder auf irgendeine andere Weise Tante Dimitys Rückkehr ankündigen würde, aber ich sah nichts. Die Schwalben flitzten hin und her aus ihren kleinen, runden Nestern unter dem Dach, und aus dem Schutz des Fliederstrauchs beäugte uns ein Kaninchen. Sollte Dimity tatsächlich zurückgekommen sein, so ließ das Haus sich nichts anmerken.
Nell wartete im Wohnzimmer auf uns, wo sie und Willis senior den grünlackierten Spieltisch für ihren Wettkampf aufgebaut hatten. Nell und Willis senior waren als Schachspieler ungefähr gleich stark – ihre Duelle dauerten Wochen, manchmal Monate, was davon abhing, wie oft Willis senior zu Besuch kam. Sie waren auch gute Freunde, und obwohl es mir immer einen Stich ins Herz gab, wenn Willis senior Nell seine adoptierte Enkelin nannte, konnte ich es ihm nicht verübeln. Nell Harris war ein außergewöhnliches Kind.
Mit ihren zwölf Jahren schien Nell das ungelenke Stadium der Vorpubertät übersprungen zu haben und war, statt sich erst einmal zu verpuppen, gleich ein Schmetterling geworden. Sie war groß, schlank und graziös, ein Botticelli-Engel mit einem makellosen ovalen Gesicht, einem Mund wie eine Rosenknospe und den dunkelblauen Augen ihres Vaters. Im Sonnenlicht, das durch die Erkerfenster fiel, leuchtete ihr Haar wie Gold. Sie bewegte sich mit einer natürlichen Würde, die ihr selbst dann etwas Königliches verlieh, wenn sie, wie jetzt, in Khakishorts, einem hellblauen T-Shirt und abgewetzten Wanderstiefeln steckte.
Bertie, Nells schokoladenbrauner Bär, saß auf einem Stoß Kissen auf dem Sessel, auf dem eigentlich Willis senior hätte sitzen sollen, und betrachtete das Schachbrett mit beharrlichem Interesse, während Ham, Nells schwarzer Labrador, offenbar überwältigt von der Aufregung des Spiels, halb schlafend auf der Bank lag, die unter dem Fenster entlanglief. Sein Schwanz klopfte zweimal kurz, um seiner Herrin unsere Ankunft mitzuteilen, aber deren Aufmerksamkeit war, genau wie Berties, auf das Brett geheftet. Als Hams Schwanz ein drittes Mal klopfte, schob sie einen weißen Läufer drei Felder weiter und lächelte zufrieden.
»So, das sollte genügen«, sagte sie mehr zu sich selbst, ehe sie sich umdrehte, um uns zu begrüßen. »Hallo, Lori. Hallo ... Mama!«, rief sie aus. »Du hast ja noch deine Gummistiefel an. Ich dachte, du magst darin nicht Auto fahren.«
»Mag ich auch nicht«, erwiderte Emma, indem sie aus ihren schmutzigen Stiefeln schlüpfte, »aber wir hatten es eilig. Was soll das heißen, William ist verschwunden?«
»Er war nicht hier, als ich ankam«, sagte Nell. »Wir waren doch zu unserer Schachpartie verabredet. Und du kennst ja William – er vergisst nie eine Verabredung.«
Das war richtig. Was in Willis seniors Terminkalender stand, war in Stein gemeißelt, und er schrieb alles in dieses Buch. Eine Schachpartie mit Nell würde genauso gewissenhaft notiert sein wie eine Verabredung zum Essen mit einem Klienten, und beide würden mit dem gleichen Respekt behandelt werden.
»Ich habe geklingelt und geklopft«, erzählte Nell, »und als sich keiner rührte, sind Bertie und ich reingegangen.« Während die meisten Zwölfjährigen sich lieber den Kopf kahl rasieren lassen würden als zuzugeben, dass sie noch immer an ihrem Kuscheltier hängen, war es Nell keineswegs peinlich, dass sie ihren Teddybären immer noch liebte. Sie nahm Bertie überallhin mit, besprach alles mit ihm und erzählte ohne jede Verlegenheit von ihm, egal, ob sie zu Hause oder in Gesellschaft von Fremden war. Ich dachte an ein gewisses rosa Flanellhäschen, zu dem ich ein ähnlich inniges, wenn auch weniger öffentlich zur Schau gestelltes Verhältnis hatte, und bewunderte Nells Unverfrorenheit. »Wir haben uns ein bisschen umgesehen«, schloss sie, »dann fanden wir den Brief und haben euch angerufen.«
»Er hat einen Brief hinterlassen?«, fragte ich schnell.
Nell nickte. »Er liegt im Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch. Er ist an dich adressiert, Lori. Bertie denkt ...«
»Jetzt nicht, Nell«, unterbrach ich sie. Ich verließ das Wohnzimmer und lief ins Arbeitszimmer, wobei ich eine gewaltige Erleichterung verspürte. Willis senior hatte eine Nachricht hinterlassen. Nells Geschichte, dass er zusammen mit Tante Dimity verschwunden war, war nur ein Produkt ihrer lebhaften Fantasie gewesen. Ich hätte es mir denken können. Nell hatte einen Hang zum Dramatischen, und ich wusste besser als jeder andere, wie bereitwillig Fantasien in diesem Haus gediehen.
Das Arbeitszimmer war schummrig und still, der Kamin kalt, die Lampen ausgeschaltet. Die Sonne fiel durch den Efeu, der die Fenster umrahmte, auf den großen hölzernen Schreibtisch und warf Schatten auf die Bücherborde und die beiden Ledersessel, die vor dem Kamin standen.
Ich trat zum Schreibtisch, knipste die Lampe an und sah mitten auf der Schreibunterlage einen cremefarbenen Briefumschlag liegen. Ich griff danach, zögerte, dann drehte ich mich zum Kamin um, ich war leicht verunsichert. Der Sessel von Willis senior war leer; seine Tasse Tee stand unberührt auf dem kleinen Tisch, wo ich sie heute Morgen hingestellt hatte, und das Buch, in dem er gelesen hatte, lag offen mit dem Gesicht nach unten auf der Ottomane.
Es war das Buch, was mich beunruhigte. Diese Erstausgabe der Arktischen Memoiren von F. W. Beechey war ein Geburtstagsgeschenk von Stan gewesen und für Willis senior ein hochwillkommener Zuwachs für seine Sammlung. Er schätzte es sehr, und trotzdem war es hier so achtlos liegen gelassen worden wie ein billiges Taschenbuch vom Flughafen. Emma bemerkte es ebenfalls, als sie mir zusammen mit Nell, Ham und Bertie ins Arbeitszimmer folgte. Sie sah mich verwundert an, nahm das Buch, schloss es und legte es auf den Tisch neben die Tasse mit dem kalten Tee.
Ich drehte mich um, öffnete den cremefarbenen Briefumschlag und las schnell vor:
»Mein liebes Mädchen,
ich muss gleich abreisen, darum will ich es kurz machen. Ich bin unerwartet wegen einer dringenden Angelegenheit weggerufen worden. Es kann eine Weile dauern, und es kann sein, dass es etwas schwierig sein wird, dich über meinen Aufenthalt zu informieren, aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen.
Bitte richte Eleanor mein aufrichtiges Bedauern aus und sage ihr, ich hoffe, dass sie Zeit haben wird, unsere Partie nach meiner Rückkehr fortzusetzen.
Dein liebender und gehorsamer Diener
William«
Ich spitzte die Lippen. »Ich glaube, wir sind das Opfer von zwei unverschämten Spaßvögeln geworden«, sagte ich und sah Emma an. »Dieser Brief ist eine Fälschung.«
Emma wandte sich an Nell, die Augenbrauen hochgezogen.
»Es sieht William tatsächlich nicht ähnlich, so wenige Informationen zu hinterlassen«, sagte Nell, indem sie Hams Ohren kraulte.
Ich sah sie eindringlich an, dann ließ meine Spannung nach. »Okay, Nell. Bis jetzt war es ein ganz netter Witz, aber ich habe euch durchschaut.«
»Witz?«, sagte Nell. »Was für ein Witz?«
»Dieser Witz.« Ich klopfte ungeduldig auf den Brief. »Diese Nachricht ist unwahrscheinlich. William würde in tausend Jahren so was nicht schreiben. Es steht nicht drin, wo er hinfährt, noch warum, noch für wie lange ... und dann heißt es noch, ich soll mir keine Sorgen machen?« Ich schüttelte den Kopf. »Das glaube ich nicht. Und ich sehe auch nicht, was das alles mit Tante Dimity zu tun haben soll.«
Als Antwort zeigte Nell wortlos auf den Ledersessel gegenüber dem von Willis senior, auf dem halb im Schatten ein zusammengefaltetes Blatt Papier lag. Als Emma die Lampen über dem Kamin anknipste, sah ich, dass das Blatt weiß und unliniert war, der ungleichmäßige Rand deutete darauf hin, dass es irgendwo herausgerissen worden war, womöglich aus dem ...
Mein Blick fiel auf den Platz auf dem Regal, wo Tante Dimitys blaues Tagebuch immer stand.
»Es ist nicht dort«, teilte Nell mir mit. »Darum dachte ich auch, dass Tante Dimity mit ihm gegangen ist.«
Ich nickte geistesabwesend und ließ meine Augen schnell von der schmalen Lücke in der Bücherreihe bis zum Ende des Bordes wandern. Ein Kribbeln kroch mir den Rücken entlang, als ich eine weitere, etwas größere Lücke entdeckte.
»Großer Gott«, sagte ich leise. »Er hat auch Reginald mitgenommen.«
Kapitel 4
»WILLST DU DAMIT sagen, dass mein Schwiegervater mit Tante Dimity und meinem rosa Kuschelhasen durchgebrannt ist?«, fragte ich, indem ich mich zu Nell umdrehte.
Zum ersten Mal seit unserer Ankunft runzelte Nell leicht die Stirn, als sie zu der Stelle auf dem Bücherbord hochsah, wo mein rosa Flanellhase normalerweise saß.
»Ich weiß nicht«, antwortete sie. »Vielleicht kann Tante Dimity es dir sagen.«
»Richtig.« Ich ging zum Sessel und sah misstrauisch auf den Zettel. Es war eine Seite, die aus dem blauen Tagebuch herausgerissen, zusammengefaltet und sorgfältig mitten auf die Sitzfläche gelegt worden war. Ich hob sie auf, faltete sie auseinander und hielt überrascht die Luft an.
Kein Zweifel, es war Tante Dimitys Handschrift. In dieser schönen Schrift, kursiv und in königsblauer Tinte, hatte sie Worte des Trostes an meine Mutter gerichtet und Geschichten geschrieben, die mir meine Kindheit erhellten. Ich hatte stundenlang über dieser Handschrift gesessen. Jede Schleife, jedes Häkchen war mir vertraut, eine Fälschung hätte ich sofort erkannt.
»Es ist wirklich von Tante Dimity«, murmelte ich und setzte mich vorsichtig hin.
Nell nickte. »Das dachte Bertie auch.«
»Was schreibt sie?« Emma setzte sich mir gegenüber, während Nell auf der Ottomane Platz nahm, zu ihren Füßen hatte sich Ham zusammengerollt.
»Es geht um William«, antwortete ich. »Hört zu:
›Meine liebe Lori,
was um alles in der Welt ist denn nur seit meinem letzten Besuch passiert? Aber lassen wir das. Keine Zeit. William hat fast fertig gepackt.
Also um es kurz zu machen: William hat es sich in den Kopf gesetzt, einige Familienangelegenheiten aus Gegenwart und Vergangenheit zu untersuchen. Er muss daran gehindert werden. Es ist gar nicht auszudenken, was da alles zutage kommen könnte. Die Menschen sind oft sehr unnachgiebig, wenn es um große Geldsummen geht.
Er ist nach Haslemere gefahren, um mit seinem englischen Vetter Gerald Willis zu sprechen. Du musst hinterherfahren und den alten Dummkopf davon überzeugen, dass er seinen Geschäften auf etwas konventionellere Art und Weise nachgehen muss. Reginald und ich werden in Williams Aktenkoffer mitfahren. Wir werden uns nach Kräften um ihn kümmern, bis du ankommst.
Ich schreibe mehr, sobald ich mehr über die Angelegenheit weiß, aber jetzt muss ich weg. William hat es so eilig, dass ich‹«
Ich sah Emma an.
»Lies weiter«, sagte sie.
»Das ist alles«, sagte ich. »Mehr steht hier nicht. Es hört mitten im Satz auf.« Während ich das Blatt näher untersuchte und Emma ratlos auf den leeren Kamin sah, hob Nell das Buch auf, das Willis senior gelesen hatte, und blätterte es durch. Einen Augenblick lang hörte man nur das Rascheln der Seiten und das Ticken der Uhr auf dem Kamin.
Dann sprach Emma. »Ich frage mich, was Dimity meint mit ›was da alles zutage kommen könnte‹«, sagte sie nachdenklich.
»Ich frage mich, was sie mit ›Familienangelegenheiten aus Gegenwart und Vergangenheit‹ meint.« Nell sah grüblerisch das Buch an, das Willis senior gelesen hatte, ehe sie es wieder hinlegte. »Und Bertie möchte wissen, was es mit den großen Geldsummen auf sich hat.«
»Trotzdem sind wir jetzt besser dran als vorher«, bemerkte Emma. »Wenigstens wissen wir, wohin er gefahren ist.«
»Er besucht seinen Vetter Gerald«, sagte Nell. »Also weißt du jetzt, wo du ihn suchen musst, Lori.« Sie wartete auf meine Antwort, sah verstohlen ihre Stiefmutter an und wiederholte dann lauter: »Lori?«
Ich tat einen kleinen ratlosen Seufzer.
Emma legte die Hand auf Nells Arm, beugte sich zu mir herüber und fragte: »Du kennst Vetter Gerald doch, oder?«
Langsam schüttelte ich den Kopf. »Ich habe noch nie von ihm gehört. Ich wusste nicht einmal, dass es einen englischen Zweig der Familie Willis gibt. Bill hat niemals ...« Ich griff mir erschrocken an den Kopf. »O Emma, was soll ich Bill bloß sagen?«
»Ich glaube, du solltest ihm gar nichts sagen, wenigstens vorläufig«, riet Emma. »Nicht, bis wir ihm etwas Konkretes mitteilen können.« Sie griff nach der Tasse mit dem kalten Tee und stand auf. »Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich könnte jetzt einen Tee gebrauchen. Ich gehe und stelle den Kessel auf. Nell, du und Bertie könnt Feuer machen.« Emma ging zur Tür und rieb sich die Arme. »Plötzlich ist es gar nicht mehr so warm.«
Ein Feuer wäre eigentlich nicht nötig gewesen – es war fast elf Uhr, und am blauen Himmel war kein Wölkchen – aber ich verstand, dass es Emma kühl vorkam. Für mich war es ebenfalls ein Schock. Meine Hände waren eiskalt, mein Magen schien sich verknotet zu haben, und meine Gedanken rasten.