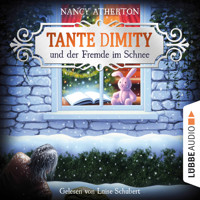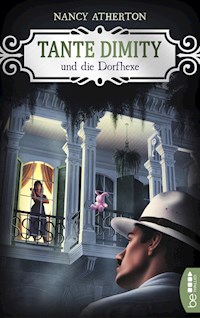5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
Auf einer Wandertour in den verschneiten Cotswolds gerät Lori Shepherd in einen heftigen Schneesturm und kommt vom Weg ab. Sie sucht Schutz in einem mittelalterlichen Kloster, in das sich auch zwei andere Wanderer verirrt haben. Doch in den düsteren Gemäuern von Ladythorne Abbey gehen seltsame Dinge vor sich. Seitdem ein wertvolles Diamantgeschmeide verschwunden ist, lastet ein rätselhafter Fluch auf der alten Abtei. Loris Interesse ist geweckt und sie stellt Nachforschungen an. Kann sie mit Hilfe von Tante Dimity den Fluch bannen?
Ein geheimnisvolles Abenteuer mit Tante Dimity. Jetzt als eBook bei beTHRILLED.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Catchpoles Aprikosenkompott.
"Geistreich und packend ... gerade das Richtige, wenn Ihnen mal alles über den Kopf wächst und sie sich am liebsten in ein gutes Buch flüchten möchten." Lincoln Journal Star
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
Catchpoles Aprikosenkompott
Über dieses Buch
Auf einer Wandertour in den verschneiten Cotswolds gerät Lori in einen heftigen Schneesturm und kommt vom Weg ab. Sie sucht Schutz in einem mittelalterlichen Kloster, in das sich auch noch zwei andere Wanderer verirrt haben. Doch in den düsteren Gemäuern von Ladythorne Abbey gehen seltsame Dinge vor sich. Seitdem dort ein wertvolles Diamantgeschmeide verschwunden ist, lastet ein rätselhafter Fluch auf der alten Abtei. Loris Interesse ist geweckt und sie stellt Nachforschungen an. Kann sie mit Hilfe von Tante Dimity den Fluch bannen?
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten »Tante Dimity« Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Amerikanischen von Monika Köpfer
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Alvaro Cabrera Jimenez | Montreeboy
Illustration: © Jerry LoFaro
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3500-2
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity: Snowbound« bei Penguin Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2004 by Nancy T. Atherton
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2007
by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Wendy Lindboe,
eine große Wanderin
Kapitel 1
DIE WEIHNACHTSZEIT BRACHTE mich beinahe um. Während mein kluger Mann, ein Rechtsanwalt, die Arbeit als Entschuldigung dafür nutzte, allen gesellschaftlichen Verpflichtungen, bis auf die allerwichtigsten, aus dem Weg zu gehen, stürzte ich mich kopflos wie ein Lemming von der Klippe in die vorweihnachtlichen Aktivitäten.
In unserem honigfarbenen Cottage verbarrikadierte Bill sich hinter meterhohen Aktenstapeln. Währenddessen stellte ich mich bereitwillig jedem Komitee zur Verfügung und ließ keine Party in Finch und Umgebung aus, dem kleinen englischen Dorf, das wir seit nunmehr sechs Jahren als unser Zuhause betrachteten. Ich schmückte die St.-George’s-Kirche mit immergrünen Zweigen, trällerte Weihnachtslieder auf nichts ahnenden Türschwellen, entwarf und realisierte das Bühnenbild für das Krippenspiel, bereitete unsere vier Jahre alten Zwillingsjungen auf ihr Debüt als singende Schäfer vor, backte so viele Angel Cookies, dass die Menge ausgereicht hätte, ein ausgewachsenes Rentier damit auszustopfen, und gab ungefähr genauso viele Partys – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene –, wie ich Einladungen wahrnahm.
Selbst im Januar, als die Weihnachtszeit vorüber war und wir nach Boston zu unserem alljährlichen Besuch bei Bills Familie flogen, gelang es mir nicht, all das Lametta aus meinem Haar zu schütteln, das sich in der Weihnachtszeit darin verfangen hatte. Während Bill seine Tage damit verbrachte, gemütlich mit seinem entzückenden Vater vor dem Kamin zu sitzen und zu plaudern, packte ich die Zwillinge ein und ging mit ihnen rodeln, Schlittschuh laufen oder Schlitten fahren. Und um das Maß meiner Verrücktheit vollzumachen, überredete ich Bill zu sentimentalen Unternehmungen, etwa zu Stippvisiten bei alten Freunden oder dazu, jeden Abend in einem anderen unserer ehemals bevorzugten Lieblingsrestaurants essen zu gehen.
Als wir Mitte Februar wieder in unser Cottage in England zurückkehrten, war ich eine schlaffe Hülle meines früheren fröhlichen Selbst. Sobald meine Söhne ein Liedchen anstimmten, zuckte ich zusammen, und beim Gedanken, noch ein weiteres Angel Cookie zu knabbern, schnürte es mir den Magen zu. Nur mit Mühe raffte ich mich dazu auf, die Weihnachtsdekoration abzunehmen, und das auch nur, weil mir allein schon bei ihrem Anblick der Kopf zu dröhnen begann. Kurz und gut, ich hatte mit den Nachwirkungen eines gehörigen Weihnachtsrauschs zu kämpfen, in den ich mich höchst freiwillig gestürzt hatte.
Emma Harris stellte auf Anhieb die richtige Diagnose. Als meine nächste Nachbarin und liebste Freundin in England hatte sie alles längst kommen sehen, und als sie mich apathisch auf der Bambus-Chaiselongue unter dem Apfelbaum im rückwärtigen Teil des Gartens liegend antraf, wusste sie ganz genau, was passiert war.
Auch wenn es zunächst den Anschein hatte, ruhte ich mich nicht einfach nur aus. Weil Bill in seinem Büro in Finch war, um den Papierberg abzubauen, der sich dort angesammelt hatte, und Annelise, unser unersetzliches Kindermädchen, den Nachmittag bei ihrer Mutter auf dem Bauernhof ihrer Familie verbrachte, hatte ich mich in den Garten zurückgezogen, um ein verschlafenes Auge auf Will und Rob zu haben, die eifrig dabei waren, Autobahnen in den gemulchten Gemüsegarten zu graben.
Ich war zwar nicht auf Besuch vorbereitet, aber ich freute mich immer, Emma zu sehen. Sie hatte einen Spaziergang von ihrem restaurierten Herrenhaus unternommen, um mich zu Hause willkommen zu heißen und mich auf den neuesten Stand zu bringen, was die Geschehnisse im Dorf anbelangte. Als sie Will und Rob einen fröhlichen Gruß zurief und sich in den Liegestuhl mir gegenüber fallen ließ, kam ich nicht umhin, sie um ihre Vitalität zu beneiden. Es war ein grandioser Tag, ungewöhnlich warm und sonnig für die Jahreszeit, und dennoch konnte ich kaum die Energie aufbringen, um ihren Besuch zu würdigen.
Emma unterzog mich einer kritischen Betrachtung, ehe sie bemerkte: »Du hast das Yule-Holzscheit an beiden Enden abgebrannt. Wieder einmal.«
Ich ließ den Kopf hängen, wohl wissend, was als Nächstes kommen würde.
»Was ist aus dem einfachen Weihnachtsfest im Kreis der Familie geworden, von dem du so geschwärmt hattest?«, fragte sie prompt. »Was ist aus deinem Vorhaben geworden, zu Hause zu bleiben und Angel Cookies zu backen ...?«
»Bitte kein Wort mehr von Angel Cookies«, murmelte ich, als ich spürte, dass mein Magen wieder rebellierte.
»... und Weihnachtslieder allenfalls am heimischen Herd zu singen?«, fuhr Emma unerbittlich fort. »Was ist aus dem schlichten Weihnachtsfest mit Bill und den Jungen im Cottage geworden?«
»Bill ist im Cottage geblieben«, rief ich ihr ins Gedächtnis zurück, »nur die Jungen und ich haben uns in den Weihnachtstrubel gestürzt.« Flehend streckte ich eine Hand aus. »Ich kann nichts dafür, Emma. Ich bin nun mal süchtig nach Weihnachten. Sobald ich Schlittenglöckchen bimmeln höre, ist es um mich geschehen. Dann kann ich einfach nicht anders, als neben den Weihnachtsmann auf die Kutschbank zu klettern und die Zügel in die Hand zu nehmen. Es ist wirklich eine lustige Fahrt, das kann ich dir sagen, und Will und Rob haben jede Sekunde genossen.«
»Das glaub ich gern«, sagte Emma. »Aber du bist jetzt ein Wrack.«
»Nun, putzmunter fühle ich mich tatsächlich nicht ...«
»Du bist ungefähr so putzmunter wie ein Toter, der über dem Gartenzaun hängt.« Emma schürzte die Lippen und starrte gedankenverloren zur Wiese jenseits der Gartenmauer. Eine angenehme Stille trat ein, die jäh durch das Schnalzen ihrer Finger zerrissen wurde, als sie ausrief: »Ich weiß, was dich aus deiner Lethargie reißen wird!«
»Eine große Tafel Schokolade?«, schlug ich vor.
»Nein, keine Schokolade.« Emma sprang auf die Füße, ging zwei Schritte und drehte sich zu mir um. »Du wirst eine Wanderung machen.«
Ich ließ mich tiefer in die Kissen der Chaiselongue sinken. »Schokolade wäre mir ehrlich gesagt lieber.«
Emma schüttelte vehement den Kopf. »Man muss Energie aufbringen, um Energie aufzutanken. Ich rede nicht davon, dass du an einem Marathonlauf teilnehmen sollst, Lori. Ich rede davon, eine gemütliche Wanderung durch die wunderschöne heimische Landschaft zu machen. Einsamkeit, frische Luft und Zwiesprache mit der Natur – das ist es, was du brauchst.«
Nachdrücklich starrte ich auf die kahlen Zweige der Bäume. »Scheint mir zu dieser Jahreszeit nicht gerade allzu viel Natur zu geben, mit der ich Zwiesprache halten könnte.«
»Lass dich überraschen«, sagte Emma. »Wenn du Glück hast, wirst du Hasen zu Gesicht bekommen, Rehe, Spechte, Eulen – und mit ein bisschen Glück vielleicht sogar den ein oder anderen Fuchs. Außerdem beginnt gerade die Lammsaison.« Sie atmete tief die frische Luft ein und ließ sie geräuschvoll wieder entweichen. »Es gibt nichts Besseres als den Anblick eines umherspringenden Lamms, um seine Lebensgeister zu wecken.«
»Du meinst, dass Lämmer im Schnee herumspringen?«, erkundigte ich mich trocken. »Emma, wir haben Februar. Ich habe mir sagen lassen, dass er nicht gerade der mildeste Monat des Jahres im guten alten England ist.«
»Das Wetter hat sich bisher nicht schlecht angelassen.« Emma machte eine ausladende Handbewegung zum blauen Himmel. »Seit Dezember haben wir keinen Tropfen Regen und keine einzige Schneeflocke gesehen, und die Meteorologen sagen gutes Wetter bis zum Ende des Monats voraus.«
»Ich kann nicht für den Rest des Monats verschwinden«, wandte ich ein.
»Und wie wäre es mit einem Tag? Sicherlich wirst du es einrichten können, wenigstens einen Tag zu verreisen. Bill hat bestimmt nichts dagegen, und Annelise ist durchaus in der Lage, sich allein um die Jungen zu kümmern, wenn du einmal nicht da bist.«
»Gut, ich werde es mir überlegen«, sagte ich und kuschelte den Kopf in die Kissen.
Emma sah mich ernst an. »Du tust den Zwillingen keinen Gefallen, wenn du hier so schlaff herumhängst.«
Indem meine beste Freundin das Gespräch auf die Jungen brachte, nutzte sie schamlos meine mütterlichen Instinkte aus, aber auf der anderen Seite wusste ich, dass sie recht hatte. Will und Rob hatten eine muntere, aktive Mutter verdient, eine Mutter, die in der Lage war, sich zu ihnen in die Erde zu knien und mit ihnen Lastwagen zu spielen, statt einer schläfrigen Drusilla, deren Aufmerksamkeit sich darauf beschränkte, ihnen vom Rand des Geschehens aus gähnend zuzuschauen. Vielleicht würde eine Wanderung mich tatsächlich wieder auf Vordermann bringen. Zumindest würde sie mich von der Chaiselongue herunterbringen.
Emma musste gespürt haben, dass sich eine Bresche in meiner Verteidigungslinie auftat, denn augenblicklich führte sie weitere Argumente auf. »Ich kenne die ideale Wanderung für dich. Letzten Sommer habe ich sie selbst unternommen. Die Wege sind nicht besonders steil, außerdem gut beschildert, und es ist nicht weit von hier. Es gibt viele schöne Stellen, wo du anhalten kannst, um eine Rast einzulegen. Ich werde dich am Anfang der Route absetzen und dich am Zielpunkt der Wanderung wieder abholen.«
»Warum kommst du nicht mit?«
»Weil du Ruhe und Frieden brauchst, darum.« Emma setzte sich wieder in den Liegestuhl. »Wir sind ja schon zusammen gewandert, Lori. Und ich weiß, was du unter Wandern verstehst. Reden, reden, reden, von Anfang bis zum Ende. Was du zurzeit brauchst, ist eine Auszeit von den Menschen, mich eingeschlossen.«
Ich kam nicht umhin zuzugeben, dass etwas dran war an dem, was sie sagte. Emma und ich hatten viele Gemeinsamkeiten – beide waren wir nach England verpflanzte Yankees und hatten zwei Kinder –, mit dem Unterschied, dass Emma zum einen mit einem Engländer verheiratet war und ich mit einem Amerikaner. Zum anderen waren Emmas Kinder fast erwachsen, während meine gerade mal dem Babyalter entwachsen waren. Des Weiteren wog sie jede Entscheidung gründlich ab, während ich meist impulsiv handelte. Und auch wenn wir die besten Freundinnen waren, waren wir nicht die besten Wandergefährtinnen.
Wandern bedeutete für mich, meinen Geist abzuschalten und meinen Sinnen freien Lauf zu lassen. Am liebsten streifte ich stundenlang ziellos durch die Natur und nahm alles in mich auf, was sie entlang des Weges an Überraschungen zu bieten hatte. Für mich war der Begriff sich zu verirren relativ, denn schließlich führten alle Wege irgendwohin, besonders in England, das trotz allem eine ziemlich kleine und dicht bevölkerte Insel war, wo man kaum zehn Schritte machen konnte, ohne über einen Pub zu stolpern oder ein Farmhaus oder ein nettes kleines Dorf. Ich hatte mich schon so oft verirrt, dass Emma angeboten hatte – und zwar nur halbwegs im Scherz –, einen Peilsender an meinem Rucksack anzubringen, aber ich hatte mich geweigert. Mich an einem wunderschönen Frühlingstag zu verirren war schließlich Teil des Spaßes.
Emma hingegen gehörte jener Spezies an, die keine Wanderung ohne Karte und Kompass unternahm. Sie verfügte über eine stattliche Bibliothek an amtlichen Karten des britischen Ordnance Survey und verließ das Haus niemals, ohne mindestens ein halbes Dutzend davon einzupacken. Für Emma war das Wandern eine intellektuelle Betätigung, eine Mission, die es zu erfüllen, ein Puzzle, das es zu lösen galt. Wenn sie auf einer Wanderung war, schien sie mehr Zeit damit zu verbringen, die Karten zu studieren, als die Schönheiten zu bestaunen, welche die Natur ringsumher zu bieten hatte. Wenn sie sich verirrte – und das geschah nicht nur, wenn ich dabei war und sie mit meinem Geplapper ablenkte –, hatte sie das Gefühl, versagt zu haben. Mir schien es bisweilen, als ob der einzige Vorteil ihrer Art der Fortbewegung gegenüber meiner darin bestand, dass sie am Ende des Tages sagen konnte, wo genau sie von der geplanten Route abgekommen war.
Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr leuchtete mir ihr Vorschlag ein: Wenn die vorgesehene Wanderung tatsächlich die erhoffte Wirkung erzielen sollte, dann konnte sie das nur, wenn ich auf Emmas Begleitung verzichtete.
»Wie lange dauert diese Wanderung?«, fragte ich sie.
»Es sind ungefähr fünfzehn Kilometer«, erwiderte Emma. »Das wirst du locker in fünf, höchstens sechs Stunden schaffen. Ich werde dir ein Lunchpaket mitgeben, ach was, ich werde dir sogar deinen Rucksack packen, mit allem, was du brauchst.«
Ich lächelte. »Vergiss nicht, ein paar hundert deiner Karten einzupacken, ja? Falls ich in Borneo oder Venezuela landen sollte ...«
»Ich werde eine Karte einpacken, und zwar jene, auf der die Route eingezeichnet ist.« Emma beugte sich vor und tätschelte mir den Arm. »Aber ich verspreche dir, dass du dich diesmal nicht verirren wirst. Im Ernst, der Weg ist so einfach, es geht fast immer geradeaus. Ich werde ihn dir auf der Karte zeigen. Es gibt nur eine Abzweigung, und ...« – sie plapperte munter weiter, ohne zu merken, dass sie den Fluch beschwor, der seit Jahrhunderten auf den Reisenden lastete – »... du kannst sie unmöglich verpassen.«
Ihr Enthusiasmus war so ansteckend, dass der Fluch an mir vorüberzog, ohne dass ich ihn bemerkte, und ich in aller Unschuld schwor, in den nächsten Tagen die von ihr ausgesuchte Wanderung anzugehen, die so einfach war, dass man nicht vom Weg abkommen konnte – vorausgesetzt, Bill befand, dass er einmal fünf Stunden ohne mich auskäme (höchstens fünf Stunden). Der dünnen Stimme, die sich in meinem Hinterkopf bemerkbar machen wollte, dass auch eine einfache Wanderung mindestens so tückisch sein konnte wie das Vorhaben, ein einfaches Weihnachtsfest zu verbringen, schenkte ich keine Beachtung.
Kapitel 2
ANNELISE NAHM MEINE Ankündigung, in den nächsten Tagen eine Wanderung zu unternehmen, gelassen auf. Und Bills denkwürdiger Kommentar zu der mir von Emma verordneten Kur gegen meinen Weihnachtskater war, dass er wünschte, er wäre selbst darauf gekommen.
»Geh nur«, sagte er beim Abendessen. »Nutze das gute Wetter aus, solange es noch anhält. Die frische Luft wird dir wieder den gewohnten Schwung verleihen. Aber versprich mir, dass du dein Mobiltelefon mitnimmst – für alle Fälle.«
»Für den Fall, dass ich mich hoffnungslos verirre?«, sagte ich und hob die Augenbrauen.
Die Antwort meines Mannes fiel eher galant denn aufrichtig aus. »Für den Fall, dass sich dir ein so grandioser Anblick bietet, dass du nicht umhinkannst, ihn mir an Ort und Stelle zu beschreiben.«
»Natürlich nehme ich mein Handy mit«, versprach ich und revanchierte mich für seine Liebenswürdigkeit mit einem Kuss. »Oder möchtest du gern mitkommen?«
»Nichts lieber als das, Lori, aber ich kann nicht. Du weißt ja, wie viel Arbeit während der Weihnachtferien liegen bleibt. Seit wir aus Boston zurück sind, habe ich noch nicht einen Quadratzentimeter meiner Schreibtischplatte zu Gesicht bekommen.«
Ich spürte einen Stich der Enttäuschung, bemühte mich jedoch, mir nichts anmerken zu lassen. Jetzt konnte ich keinen Rückzieher mehr machen – Emma hatte bereits meinen Rucksack mit allem Nötigen gepackt, und auch das Lunchpaket war schon fertig. Abgesehen davon gefiel Bill mein origineller Plan so sehr, dass ich es einfach nicht über mich brachte, ihm einzugestehen, dass ich mir meiner Sache doch nicht so sicher war.
Wollte ich wirklich einen ganzen Tag allein im Wald verbringen? Im Gegensatz zu den letzten Monaten, in denen ich kaum eine Minute allein gewesen war? Würde ich es ertragen, fünf, sechs Stunden allein zu sein, von ein paar herumspringenden Lämmern abgesehen, ohne mit jemandem reden zu können? Mit einem Mal hatte ich das Gefühl, als würden die Menschen, die mir am nächsten standen, mich mir nichts, dir nichts vor die Tür setzen.
»Lori«, sagte Bill, dem offensichtlich nicht entgangen war, dass ich die Stirn in Falten gelegt hatte, »du musst nicht gehen, wenn du nicht willst.«
»Ich will aber. Ich weiß nur nicht, ob ich allein wandern will.«
»Nimm doch Tante Dimity mit«, schlug er vor. »Mit ihr kannst du dich unterhalten, wenn du dich gar zu einsam fühlst.«
»Was für eine gute Idee!« Die Falten auf meiner Stirn verschwanden. »Mit der Natur Zwiesprache zu halten ist doch ganz nach ihrem Geschmack.«
»Und Reginald kannst du auch mitnehmen«, fügte Bill hinzu. »Setz ihn in deinen Rucksack und lass ihn den Kopf rausstrecken; Tante Dimity nimmt ohnehin nicht viel Platz ein. Außerdem wiegen beide nicht viel, und Emma muss auch das Lunchpaket nicht aufstocken.«
»Sie werden wunderbare Wanderkameraden sein«, stimmte ich ihm zu, während ich meinem Mann strahlend die Bratkartoffeln reichte.
Hätte ein Fremder unsere Unterhaltung belauscht, so hätte er uns womöglich für geistig umnachtet gehalten. Warum konnte Reginald nicht auf seinen zwei Füßen gehen, würde er sich fragen. Und wie um Himmels willen können sie die naturverbundene Tante Dimity in einen Rucksack zwängen?
Zweifelsohne wäre der Fremde erleichtert gewesen, zu hören, dass Reginald ein Stofftier war, das ich seit meiner Kindheit besaß, ein kleiner rosa Flanellhase, der absolut zufrieden damit war, die vorbeiziehende Landschaft von meinem Rucksack aus zu betrachten. Hätten wir dem Fremden hingegen erklären wollen, warum Tante Dimity so leicht zu transportieren war, hätten wir ihn in seiner Befürchtung, dass er es mit zwei Verrückten zu tun hatte, nur noch bestärkt.
Wenn es um Tante Dimity ging, so war jeder Versuch, ihre Existenz erklären zu wollen, äußerst heikel. Als Kind hatte ich sie als Hauptfigur in einer Serie von Gutenachtgeschichten kennengelernt, die meine Mutter sich für mich ausgedacht hatte. Als ich viele Jahre später erfuhr, dass die fiktionale Heldin meiner Mutter auf einer ganz und gar nicht fiktionalen Britin namens Dimity Westwood basierte, war ich doch sehr erstaunt.
Meine Mutter war Dimity Westwood in London begegnet, wo beide Frauen ihrem jeweiligen Heimatland im Zweiten Weltkrieg gedient hatten. Schnell waren sie während jener düsteren Jahre Freundinnen geworden, und nach dem Krieg hatten sie den Kontakt aufrechterhalten, indem sie sich ausführliche Briefe schrieben, die zu Hunderten über den Atlantik hin und her flogen.
Erst nachdem Dimity Westwood gestorben war, erfuhr ich von dieser Freundschaft und dass sie mir darüber hinaus nicht nur diese wertvolle Korrespondenz vermacht hatte, sondern auch ein honigfarbenes Cottage in den Cotswolds, ein ansehnliches Vermögen sowie ein merkwürdiges Notizbuch, das in dunkelblaues Leder gebunden war.
Durch dieses Notizbuch lernte ich die liebe Freundin meiner Mutter allmählich kennen. Sobald ich das blaue Büchlein aufschlug, füllten sich die weißen Seiten mit Dimitys anmutiger Schrift, einer altmodisch gestochenen Handschrift, wie man sie seinerzeit in der Dorfschule gelehrt hatte, als Automobile noch ein seltener und wunderlicher Anblick waren. Zwar wäre ich das erste Mal, als Dimitys Worte auf den Seiten erschienen, fast in Ohnmacht gefallen, aber seither hatte ich mich längst an ihre seltsame Gegenwart in meinem Leben gewöhnt.
Aber niemals würde ich auch nur den Versuch machen, diesen Umstand einem Fremden zu erklären.
»Nach dem Abendessen werde ich Reginald und das Notizbuch aus dem Büro holen«, sagte ich und füllte Bills Weinglas. »Außerdem werde ich den Akku des Mobiltelefons über Nacht aufladen, sodass ich morgen früh startklar bin.«
»Bravo.« Bill hob das Glas, um mit mir anzustoßen. »Auf die große Entdeckerin. Auf dass deine Wanderschuhe stets leicht bleiben mögen.«
Ich lachte und stieß mit ihm an. Jetzt war ich zuversichtlich, dass meine Wanderung genauso angenehm werden würde, wie jedermann zu erwarten schien.
Wie versprochen kam Emma bei Morgengrauen zu mir, um mich zum Ausgangspunkt meiner Wanderung zu bringen. Da ich ein Morgenmuffel bin, achtete ich nicht auf die Kurven und Abzweigungen, die sie fuhr, sondern gönnte mir ein zusätzliches Nickerchen. Als wir angekommen waren, weckte Emma mich.
»Ich weiß wirklich nicht, wie du es schaffst, an einem so schönen Morgen wieder einzuschlafen«, sagte sie. »Du bist ein hoffnungsloser Fall.«
»Ja, es ist tragisch, aber wahr«, stimmte ich gähnend zu.
»Hör mal, Lori, ich will dich nicht unter Druck setzen, also wenn du dich nicht in der Lage fühlst –«
»Doch«, fiel ich ihr ins Wort, »ich werde das schon schaffen.« Ich drehte mich um und nahm den Rucksack von der hinteren Sitzbank.
»Wenn du meinst.« Emma sah mich zweifelnd an. »Aber um Himmels willen bleib auf dem vorgesehenen Weg. Wenn du das Ziel erreicht hast, werde ich auf dich warten.«
Ich stieg aus dem Wagen und winkte, bis Emma aus meinem Blickfeld verschwunden war.
Es war ein wundervoller Tag. Die Morgenluft war frisch, aber nicht eisig, und nur ein leichtes Lüftchen bewegte die dunklen Locken, die unter meiner Zipfelmütze hervorschauten. Hoch oben am stahlblauen Himmel hing ein zerrissener Wolkenschleier, und als einziges Geräusch war das Rascheln vertrockneter Blätter zu hören, die sich noch an winterlich karge Äste klammerten.
Ein paar Meter entfernt zu meiner Rechten stand ein Wegweiser mit einem bunten Pfeil, der den Beginn des Wanderwegs markierte. Ich sah, dass ich über einen Zaunübertritt klettern musste, um den Weg zu erreichen, aber ich hatte nichts gegen ein wenig Frühgymnastik einzuwenden. Die frische Luft hatte meine Schläfrigkeit vertrieben. Ich fühlte mich wachsam, lebendig und bereit für alle Schandtaten.
»Emma wäre zufrieden mit mir«, versicherte ich mir. »Ihre Wanderkur scheint bereits Wirkung zu zeigen – dabei habe ich noch nicht einmal einen Schritt getan.« Grinsend streifte ich mir die gepolsterten Riemen meines Rucksacks über die Schultern, rückte ihn in eine bequeme Position, stopfte meine Wollhandschuhe in die Taschen meiner leichten Daunenjacke und zog den Reißverschluss auf. Es war so mild, dass mein cremefarbener Baumwollpullover und meine Jeans ausreichend warm sein würden, wenn ich mich erst einmal bewegte.
»Halt dich gut fest, Reg«, sagte ich und fasste nach hinten, um die Hasenohren zu kraulen. »Da vorn ist ein Zaun, der erklommen werden will.«
Ohne Pause wanderte ich drei Stunden. Der Weg führte an einigen Weiden vorbei, auf denen zu meiner großen Enttäuschung weit und breit keine Schafe zu sehen waren, ehe er langsam in ein bewaldetes Tal hinabführte. Als ich die ordentlich mit Hecken umgebenen Weiden hinter mir ließ, erfreute ich mich an der wohlgeordneten Sauberkeit, welche die englische Landschaft auszeichnet.
Im Verlauf der vergangenen tausend Jahre war in den Cotswolds jeder Fußbreit Erde irgendwann einmal entweder von Bauern gepflügt, von Schafen abgegrast oder von übermütigen Landschaftsarchitekten umgestaltet worden. Das Ergebnis ist eine kultivierte Landschaft, eine Landschaft, die beruhigend wirkt, und mögen einige sie auch als langweilig und zu sehr gezähmt empfinden, fühlte ich mich in ihr geborgen. Es gibt Menschen, die erst richtig aufblühen, wenn sie am Abgrund von unergründlichen Schluchten balancieren, während sie versuchen, eine Horde Grizzlys in die Flucht zu schlagen, und dann gibt es den Rest – Leute wie mich. Ich hatte kein Bedürfnis danach, in der Dunkelheit einen Pfad durch die Wildnis eines unbekannten Dschungels zu suchen. Ich zog es vor, auf Wegen zu gehen, auf denen Generationen vor mir gegangen waren, wo die Wahrscheinlichkeit, irgendwelchen blutrünstigen Tieren zu begegnen, relativ gering ist. Gut ausgetretene Pfade erlaubten es mir, meinen Tagträumen nachzuhängen.
Andererseits hat man, wenn man seinen Tagträumen nachhängt, nicht gerade die beste Voraussetzung, seinen Pfad zu finden. Als ich anhielt, um einen Blick auf Emmas Karte zu werfen, und bemerkte, dass ich dank des Wandererfluchs – oder vielmehr dank meiner Unaufmerksamkeit – die unübersehbare Abzweigung übersehen hatte, überkam mich ein vertrautes Gefühl des Verdrusses. Statt links abzubiegen und wieder den Anstieg aus dem Tal zu nehmen, war ich immer geradeaus weitergegangen, bis ich die Talsohle erreicht hatte.
Augenblicklich hätte ich kehrtmachen und den Weg zurückgehen müssen, aber die Abenteuerlust hatte mich gepackt. Mich in der Sicherheit meines Mobiltelefons wiegend, ging ich weiter und genoss den dumpfen Laut, den meine Wanderschuhe auf dem harten Boden erzeugten, die Stille der schlafenden Bäume und den gelegentlichen Anblick eines Vogels, der nicht in den wärmeren Süden aufgebrochen war. Ich war so eingenommen von dem physischen Hochgefühl des bloßen Voranschreitens, dass mir die Sturmwolken entgingen, die sich über mir zusammenbrauten. Erst als mich eine daunenweiche Schneeflocke an der Wange streifte, bemerkte ich auch die anderen, die plötzlich wie Distelwolle von einem bleifarbenen Himmel herabschwebten.
»So viel zu Emmas Fähigkeiten, das Wetter vorherzusagen«, murmelte ich und hielt an, um Reginald in den Rucksack zu stopfen. »Willst du wissen, warum es seit Dezember nicht mehr geschneit hat, Reg? Weil der Schnee warten wollte, bis ich auf Wanderschaft ging.« Die schwarzen Augen von Reginald strahlten mich mitleidig an, als ich die Rucksackklappe über seine Ohren zog. »Nun gut«, fügte ich hinzu, während ich den Rucksack wieder schulterte, »vielleicht wird der Wind ihn bald wieder wegblasen.«
Bei dem Wort wegblasen fuhr eine Windböe in die Baumwipfel. Grimmig lachte ich in mich hinein angesichts dieses kleinen Scherzes, den Mutter Natur sich mit mir erlaubte, und zog den Reißverschluss meiner leichten Daunenjacke zu. Dann machte ich kehrt, um den Anstieg aus dem Tal in Angriff zu nehmen, in der Hoffnung – auch wenn sie gegen jede Wahrscheinlichkeit war –, den Weg zurück zu der Abzweigung zu finden, die ich eigentlich hätte nehmen müssen, ehe die Laune der Natur noch launischer wurde.
Etwa zehn Minuten später schlug der Schneesturm zu. Er schien aus allen Richtungen gleichzeitig zu kommen und wälzte sich durch das Tal wie eine Schneelawine, sodass die Bäume am Wegesrand nur noch entfernt als graue bizarre Schatten wahrzunehmen waren und der Weg in Windeseile mit einer immer dicker werdenden Schicht Schnee bedeckt wurde. Ein gemeiner Wind blies durch meine Jeans, herumwirbelnde Flocken stachen mir ins Gesicht. Das Geheul des Windes ließ mich nahezu taub werden, die beißenden Schneeflocken machten mich blind – ich fühlte mich vollkommen allein auf der Welt. Es machte keinerlei Sinn, Bill einen Hilferuf zu senden. Was hätte ich ihm sagen sollen – »Ich weiß nicht, wo ich bin, aber bitte komm mich holen«? Entschlossen streifte ich mir die Wollhandschuhe über und stapfte weiter.
Ich war keine fünfhundert Meter weit gekommen, als eine schneebedeckte Wurzel mich zu Fall brachte und ich einen kleinen steilen Abhang hinabrutschte, wo ich in einem matschigen Haufen abgestorbener Blätter landete. Mit blauen Flecken übersät, erschöpft und äußerst verärgert rollte ich auf die Knie und stellte fest, dass ich nur um Armeslänge entfernt von einem imposanten, efeuüberwucherten steinernen Torpfosten gelandet war. Zusammen mit dem gegenüberliegenden Pfosten bildete er ein Paar, welches eine schmale Straße einrahmte. Als ich mich aufrappelte, fuhr der Wind in das Efeu, und durch eine Lücke in dem rankenden Grün erkannte ich ein dunkles Quadrat, das sich gegen den blassen Cotswold-Stein des Pfostens abhob. Ich machte einen Schritt vorwärts, schob das zitternde Efeu beiseite und sah ein bronzenes Schild, auf dem zwei Worte standen.
»Ladythorne Abbey«, flüsterte ich und dankte meinem Schutzengel.
Diese Worte hatte ich zuvor schon auf Emmas Karte gelesen. Dort waren sie in winzigen Buchstaben gedruckt, ein Hinweis darauf, dass Ladythorne Abbey nichts weiter als eine verlassene Ruine war. Aber auch wenn es sich nur um eine Ruine handelte, würde sie wenigstens etwas Schutz vor dem Sturm bieten. Und, was noch wichtiger war, ich würde Bill wenigstens einen Anhaltspunkt liefern können, wo ich mich befand. Ich könnte Bill anrufen und ihm sagen, wo ich war.
Bestärkt durch die Vision von meinem edlen Mann, der auf unserem kanariengelben Range Rover angeritten kam, um mich zu retten, beugte ich den Kopf, um dem Wind zu trotzen, und ging die Allee hinauf, die zu Ladythorne Abbey führte.
Kapitel 3
Es DAUERTE NICHT lange, bis ich das Ende der kleinen Straße erreicht hatte, die schnurstracks geradeaus lief und zu beiden Seiten von hohen Borden begrenzt war. Außerdem half der beißende Wind nach, der mich am Rücken schob wie die Hand eines Riesen, so als könnte er es nicht erwarten, mich loszuwerden. Nichtsdestotrotz reichte mir der Schnee bis zu den Schienbeinen, als ich endlich die geisterhafte Silhouette eines Gebäudes direkt vor mir aufragen sah.
Ladythorne Abbey schien keineswegs eine Ruine zu sein. Während ich mich vorwärts kämpfte, nahm ich durch einen Schleier von Schnee ein langes, niedriges Gebäude aus blassem grauen Stein wahr, das in mehrere seltsam anmutende Trakte unterteilt war. Es hatte Sprossenfenster, und die Dächer verliefen in unterschiedlichen Winkeln zueinander. Ein schlanker Glockenturm überragte eines der Gebäude, vor einem anderen sah ich einen Kreuzgang und in der Mitte eine ausladende Treppe, die zu einem Eingang hinaufführte, der von einem gotischen Spitzbogen eingerahmt wurde. Die Treppe war von einer unberührten Schneedecke überzogen.
Die Abtei sah aus, als wäre sie über mehrere Jahrhunderte hinweg erbaut worden, als wären je nach Laune der jeweiligen Epoche immer wieder neue Bestandteile hinzugefügt worden, statt dem Diktat eines einzigen großen Bauplans zu folgen. Ich nahm an, dass es sich um eines der Klöster handelte, die unter Heinrich VIII. konfisziert und im 16. Jahrhundert einem anderen Lehnsherrn übereignet worden waren. Im Geiste malte ich mir aus, wie die Mönche im Kreuzgang des mittelalterlichen Klosters meditierend ihre Runden drehten. Wenn es nicht so kalt und unwirtlich gewesen wäre, hätte ich gern einen müßigen Rundgang gemacht, um alle Nischen und Ecken zu erkunden.
Aber mir war schrecklich kalt, und meine Kleider waren durchnässt, und jede Minute ließ mir meinen Zustand unerträglicher erscheinen, also entschied ich, den müßigen Rundgang auf ein anderes Mal zu verschieben und mich stattdessen darauf zu konzentrieren, wie ich am besten in das Gebäude gelangte, um dem Sturm zu entkommen. Ich stolperte auf die schneebedeckte Treppe zu, als ich etwas Rotes im Kreuzgang aufblitzen sah. Es war der erste Farbfleck, den ich seit Beginn des Schneesturms entdeckte – und er bewegte sich.
»Hey!«, rief ich und stapfte in Richtung Kreuzgang. »Hey! Warten Sie bitte.«
Der rote Fleck blieb stehen. Als ich näher kam, erkannte ich eine formlose Gestalt, die einen großen Rucksack auf dem Rücken trug. Er bestand aus einem leuchtenden roten Material, dessen Rand von einem ungewöhnlichen Muster aus schwarzen Flammen eingerahmt war. Das unheimlich anmutende Muster des Materials schien mir eher für das Outfit eines Mountainbikers als für die Ausrüstung eines Wanderers angetan zu sein, doch der Rest der Aufmachung war dann doch wieder ganz gewöhnlich: schwere Wanderstiefel, ein unförmiger grauer Parka, eine weite, wasserabweisende Hose, eine schwarze Kapuzenmütze und eine an den Augenwinkeln geschlossene Sonnenbrille. Der Wanderer war so gut gegen Wind und Wetter geschützt, dass ich selbst aus der Nähe nicht zu sagen vermochte, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Nur die Nasenspitze war zwischen dem Brillensteg und der Kapuzenmütze zu sehen. Die Nase war fast ebenso rot wie der Rucksack.
»Hi«, sagte ich betont munter, während ich den Kreuzgang betrat. »Schönes Wetter heute, nicht wahr?«
»Ja, sehr schön«, sagte der Rucksackträger mit gedämpfter Stimme, sodass ich noch immer nicht sagen konnte, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelte. »Wohnen Sie hier?«
»Nein«, sagte ich, »allerdings hatte ich gehofft, dass Sie hier wohnen.«
»Nein.« Der Wanderer ging zum rückwärtigen Teil des Gebäudes. »Ich wollte gerade nachsehen, ob ich einen zweiten Eingang finde.«
»Haben Sie es schon an der Vordertür versucht?«
»Niemand hat geantwortet«, sagte der Wanderer. »Kommen Sie.«
»Also gut.« Während mein Leidensgefährte einen Pfad durch den Schnee für mich pflügte, fragte ich mich flüchtig, wie er zu dem vorderen Eingang gelangt war, ohne Spuren auf der jungfräulichen Schneedecke auf der Treppe zu hinterlassen.
Der Kreuzgang mündete in einen gepflasterten Hof, der von mehreren Nebengebäuden gesäumt war, die zusehends unter dem immer dichter werdenden Schneegestöber zu versinken schienen. Der Rucksackträger ließ die Nebengebäude links liegen und steuerte geradewegs auf eine einfache Holztür zu, die zum Haupthaus gehörte und auf den Hof hinausging. Als wir die Tür erreicht hatten, ergriff ich hoffnungsvoll die Klinke, doch sie ließ sich nicht bewegen.
»Abgeschlossen«, murmelte ich.
»Warten Sie, wir werden das Problem schon lösen.«
Ich trat etwas zurück und beobachtete mit wachsendem Erstaunen, wie er oder sie ein kurzes, handliches Stemmeisen aus einer Seitentasche des flammend roten Rucksacks hervorzog und die Spitze in den Spalt zwischen Tür und Türpfosten stemmte.
»Was machen Sie denn da?«, fragte ich verblüfft. »Sie werden die Tür beschädigen, nicht wahr?«
»Ziehen Sie es vor, hier draußen zu erfrieren?«, erwiderte mein furchtloser Wandergefährte.
»A-aber ... was ist, wenn doch jemand zu Hause ist?«, stammelte ich.
»Dann werden wir den Hausherrn raten, das nächste Mal besser die Tür zu öffnen, wenn jemand anklopft.« Mit einem Knirschen, das mir in den Ohren wehtat, gab das Schloss der hölzernen Tür nach, und der Rucksackträger schlüpfte hinein.
Ich warf einen Blick über die Schulter – so als fürchtete ich, dass jeden Moment ein Constable aus dem Schneegestöber hervortreten könnte, um uns wegen Einbruchs festzunehmen –, ermahnte mich dann, nicht ein solcher Feigling zu sein, und trat ebenfalls über die Türschwelle. Falls ich mich doch vor Gericht wiederfände, so sinnierte ich, dann würde es meinem Mann sicherlich gelingen, mildernde Umstände geltend zu machen.
Nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, hielt ich kurz inne, um das Gefühl zu genießen, durch solides Eichenholz vor dem beißenden Wind geschützt zu sein. Als ich jedoch versuchte, mein Gesicht von den Eiskristallen zu befreien, merkte ich, dass ich meinen Atem sehen konnte. Der gegenwärtige Besitzer von Ladythorne Abbey verschwendete kein Geld für unnützes Heizen.
Nicht dass ich ihm einen Vorwurf gemacht hätte; es musste ein Vermögen kosten, den Raum zu heizen, in den wir soeben eingedrungen waren. Es war eine Küche, eine riesige Küche mit einer Gewölbedecke, sechs Fenstern mit gotischen Spitzbögen, einem polierten, schwarz-weiß gefliesten Flur; an jeder Wand war eine Tür, die zu angrenzenden Räumen führen musste.
Unter einem der Fenster thronte ein großer Steintrog auf Ziegelsteinen, an dessen einem Ende eine steinerne Abflussrinne angebracht war und am anderen ein hölzernes Abtropfgestell für Geschirr. Dazwischen ragte ein Paar antiker Porzellanhähne aus der Wand, das an ein Geflecht aus kupfernen Leitungen angeschlossen war. Ich probierte aus, ob die Hähne funktionierten, und atmete erleichtert aus, als Wasser in das Becken rann – zwar nur kaltes Wasser, aber fließendes kaltes Wasser war besser als gar kein Wasser.
Zwei ausladende Anrichten standen einander an zwei Wänden gegenüber, die eine war weiß lackiert und mit Geschirr beladen, die andere war braun, und gehämmerte Kupfertöpfe und -pfannen sowie eine Reihe verschiedener Kochutensilien stapelten sich in ihren Regalen. Ein schwerer Eichentisch, der vom jahrelangen Gebrauch zerfurcht war, nahm die Mitte des Raums ein, und die Wand gegenüber dem Spülbecken wurde von einem großen viktorianischen Herd aus Gusseisen ausgefüllt, der in den Kaminsims eingelassen war.
Ein einfacher Messingkronleuchter hing von der Decke, und an den Wänden ragten Messinglampen in den Raum, doch als ich die Lichtschalter neben der Hoftür anknipste, tat sich nichts.
»Der Sturm muss die Stromversorgung lahmgelegt haben«, sagte ich, während ich den Schnee von meiner Jeans klopfte. »Übrigens, ich heiße Lori Shepherd.«
»Wendy Walker«, sagte die Rucksackträgerin.
Während ich weiterhin damit beschäftigt war, meine Kleidung vom Schnee zu befreien, streifte Wendy die Träger ihres Rucksacks von den Schultern und lehnte ihn gegen die weiße Anrichte. Sie war so klug, ihren Parka anzubehalten, nahm aber die Sonnenbrille ab, und ein Paar blaugrauer Augen kam unter einem flauschigen grauen Pony zum Vorschein. Als sie die Kapuzenmütze vom Kopf zog, befreite sie eine hüftlange Wolke grauer Haare, die ein rundes, vom Wind gerötetes Gesicht einrahmte. Sie schien ein paar Jahre älter zu sein als ich, Ende dreißig, Anfang vierzig, schätzte ich.
»Ich freue mich sehr, Ihnen begegnet zu sein, Wendy«, sagte ich überschwänglich. »Es war nicht gerade eine schöne Aussicht, dem Sturm allein die Stirn zu bieten.«
»Nein, ein Spaß wäre das bestimmt nicht gewesen.« Wendy verstaute das Stemmeisen und die Kapuzenmütze im Rucksack, schlang ihre langen Haare im Nacken zu einem Knoten und ging dann von Tür zu Tür, um einen Blick in die angrenzenden Räume zu werfen. Als sie die erste Tür öffnete, fragte sie über die Schulter zurück: »Sind Sie aus den Vereinigten Staaten?«
»Ja.« Ich entledigte mich ebenfalls meines kleinen Wanderrucksacks und legte ihn auf den Eichentisch. »Ich bin in Chicago aufgewachsen, aber seit sechs Jahren lebe ich in England. Und Sie?«
»Ich komme aus Long Island, New York.« Sie spähte in einen dunklen Flur, schloss die Tür wieder und ging zur nächsten. »Leben Sie hier in der Nähe?«
Da ich mich nicht mehr genau an die Strecke erinnern konnte, die Emma gefahren war, sagte ich nach bestem Wissen: »Ich lebe in einem kleinen Dorf ungefähr ...« – im Geiste legte ich mir willkürlich eine Entfernung zurecht – »... dreißig Kilometer von hier. Allerdings war ich noch nie zuvor in Ladythorne. Ich wusste nicht einmal von seiner Existenz, zumindest nicht, dass die Gebäude der Abtei erhalten sind. Ich dachte, es sei eine Ruine.«
»So ist sie auf der Karte auch eingezeichnet«, sagte Wendy. »Aber Karten können irreführend sein.«
»Haben Sie sich ebenfalls verirrt?«
»Der Sturm hat mich von meiner Route abgebracht.«
»Mich auch«, sagte ich, auch wenn das nur die halbe Wahrheit war. »Glücklicherweise ist die Farbe Ihres Rucksacks so ... hell. Ansonsten hätte ich Sie womöglich nicht entdeckt. Ich habe noch nie so einen Rucksack gesehen.«
»Ich habe ihn selbst gemacht.« Wendy zuckte mit den Schultern. »Das heißt, ich habe die Hülle genäht, den Rahmen habe ich mir von einem Online-Versand schicken lassen.«
»Ah«, sagte ich und rieb die Hände aneinander, um sie warm zu bekommen, »Sie sind also eine passionierte Wanderin. Folgen Sie einem der zahlreichen Fernwanderwege, die es hier in England gibt?« Von Emmas Kartensammlung wusste ich, dass ein ganzes Netz aus Wanderwegen England durchzieht, sodass man das Land der Länge und Breite nach durchwandern kann.
»Das habe ich, bis ich heute vom Schneegestöber überrascht wurde.« Wendy öffnete die Tür, die sich neben dem viktorianischen Herd befand, spähte in die Dunkelheit des angrenzenden Raums, förderte eine Taschenlampe aus ihrer Jackentasche zutage und murmelte: »Das 20. Jahrhundert hält Einzug.«
»Tatsächlich?«
»Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst«, sagte sie und trat über die Schwelle.
Ich folgte ihr in den Raum, der sich als eine zweite Küche entpuppte. Sie war sehr viel kleiner als die andere, und ihre Einrichtung war alles andere als viktorianisch. Der Lichtkegel von Wendys Taschenlampe glitt über glatte Teakholzflächen, über auf Hochglanz polierte Granitarbeitsflächen, zwei Mikrowellengeräte, eine Kocheinheit mit Marmorumrandung in der Mitte der Küche, einen Kühlschrank aus Edelstahl, Edelstahlregale, die vom Boden bis zur Decke reichten und mit allen möglichen Küchenutensilien gefüllt waren, und einen buttergelben Hightech-Gasherd.
»Ich wette, dass hier gekocht wird«, sagte ich. »Die Eigentümer müssen die andere Küche als museales Objekt erhalten haben.«
Wendy ging an den Schrankflächen entlang, zog eine Schranktür nach der anderen auf und warf einen Blick in den Kühlschrank.
»Wenn das die Küche ist, wo üblicherweise gekocht wird, dann müssen die Bewohner streng Diät halten«, lautete ihr Kommentar, »denn die Vorratsschränke sind gähnend leer.« Sie seufzte und rieb sich mit einer behandschuhten Hand die Nase, um sie zu wärmen. »Ich weiß nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich könnte jetzt eine Tasse Tee gebrauchen.«
»Ich würde mich sogar mit einer Tasse heißen Wassers zufriedengeben«, sagte ich und berührte den ultramodernen Gasherd. Er war kalt. »Das Gas muss abgestellt sein. Und die Mikrowellengeräte werden ebenfalls nicht funktionieren, weil kein Strom da ist.«
»Sieht so aus, als müssten wir auf die historische Technik zurückgreifen«, sagte Wendy, während sie in die viktorianische Küche zurückging.
Ich trottete hinter ihr her. »Wollen Sie den Herd ausprobieren? Er sieht so aus, als hätte er mindestens hundert Jahre auf dem Buckel. Wissen Sie, wie er angeht?«
»Noch nicht.« Wendy hob einen leeren Kohleneimer von dem gekalkten Kaminsims, deutete auf einen übergroßen Wasserkessel auf der Herdplatte und ging auf den fast dunklen Flur hinaus. »Würden Sie inzwischen den Wasserkessel mit Wasser füllen? Ich versuche, Kohlen aufzutreiben.«
Eingeschüchtert von ihrer zupackenden Art und ihrer augenscheinlichen praktischen Kompetenz tat ich, wie mir geheißen. Um den komplizierten Herd machte ich einen Bogen, aber mit einem Wasserhahn würde ich schon fertigwerden, sagte ich mir.
Ich war noch immer dabei, Wasser in den Kessel laufen zu lassen, als Wendy mit einem vollen Eimer zurückkehrte und Kohle in den Schlund des altmodischen Herds füllte.
»Der Kohlenkeller ist neben dem Boilerraum«, erklärte sie. »Vom Flur gehen die Zimmer der ehemaligen Bediensteten ab, und er führt zum Hauptteil des Hauses. Ich glaube nicht, dass außer uns noch jemand hier ist.«
Ich stimmte ihr zu. Da der Gasofen kalt und es in der Küche eisig war und es kein fließendes warmes Wasser gab, nahm ich an, dass die Bewohner von Ladythorne Abbey momentan nicht zugegen waren. Ich drehte den Wasserhahn zu, wuchtete den schweren Wasserkessel auf den Herd und sah zu, wie Wendy mit Streichhölzern, Zunder und Rauchabzug hantierte. Binnen Kürze strahlte der Herd einen ersten Hauch von Wärme ab.
»Ich bin sprachlos«, sagte ich, während ich die Hände über den Herd hielt.
Wendy warf einen Blick auf meine leichte Daunenjacke. »Sie sind zu leicht angezogen für dieses Wetter, finden Sie nicht auch?«