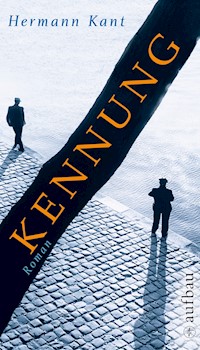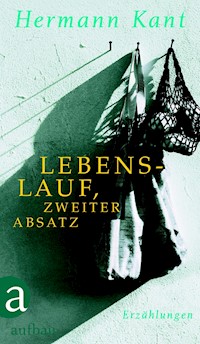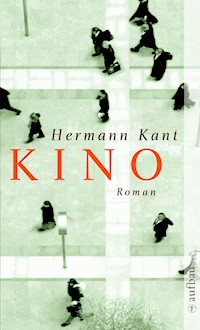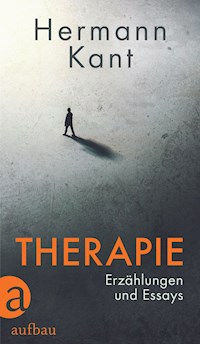
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die unbekannten Erzählungen Hermann Kants – mit seinem letzten, bislang unveröffentlichten Interview. Als Hermann Kant 2011 schwer erkrankte, bereitete ihn sein Arzt auf eine lange Therapie vor. Er riet ihm, sich seine Computer ins Krankenhaus bringen zu lassen. »In diesen sieben Wochen habe ich versucht, jeden Tag ein bisschen zu schreiben. Ich bin gerade mal zur Hälfte des Textes gekommen, aber der Arzt hatte den klugen Blick dafür, wie mir zu helfen war«, sagte Kant hinterher. Es wurde seine letzte literarische Arbeit. Die Herausgeberin Irmtraud Gutschke hat sie zusammen mit jenen Erzählungen, die bisang nur in Zeitschriften erschienen und daher zu Unrecht übersehen wurden, zu einer literarischen Zeit- und Lebensreise zusammengestellt. Den Abschluss bildet das letzte, bislang unveröffentlichte Interview, das Hermann Kant im Winter 2014 gab. »Literatur, das ist ein anderes Wort für Ausweg.« Hermann Kant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Die unbekannten Erzählungen Hermann Kants – mit seinem letzten, bislang unveröffentlichten Interview.
Als Hermann Kant 2011 schwer erkrankte, bereitete ihn sein Arzt auf eine lange Therapie vor. Er riet ihm, sich seine Computer ins Krankenhaus bringen zu lassen. »In diesen sieben Wochen habe ich versucht, jeden Tag ein bisschen zu schreiben. Ich bin gerade mal zur Hälfte des Textes gekommen, aber der Arzt hatte den klugen Blick dafür, wie mir zu helfen war«, sagte Kant hinterher. Es wurde seine letzte literarische Arbeit. Die Herausgeberin Irmtraud Gutschke hat sie zusammen mit jenen Erzählungen, die bisang nur in Zeitschriften erschienen und daher zu Unrecht übersehen wurden, zu einer literarischen Zeit- und Lebensreise zusammengestellt. Den Abschluss bildet das letzte, bislang unveröffentlichte Interview, das Hermann Kant im Winter 2014 gab.
»Literatur, das ist ein anderes Wort für Ausweg.« Hermann Kant.
Über Hermann Kant
Hermann Kant wurde 1926 in Hamburg geboren. Er machte eine Lehre zum Elektriker. Im Zweiten Weltkrieg war er Soldat, befand sich von 1945-1949 in polnischer Kriegsgefangenschaft. Der Mitbegründer des Antifa-Komitees war im Arbeitslager Warschau und Lehrer an der Antifa-Zentralschule. Ab 1949 besuchte er die Arbeiter- und Bauern-Fakultät Greifswald und studierte von 1952 bis 1956 Germanistik in Berlin. Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent und Redakteur. Als freier Schriftsteller lebte er seit 1962 in Berlin und war von 1978 bis 1989 Präsident des Schriftstellerverbandes der DDR. Er starb 2016 in Neustrelitz.
Irmtraud Gutschke, 1950 in Chemnitz geboren, ist verantwortliche Redakteurin für Literatur beim »Neuen Deutschland« und hat unzählige Texte über Autoren und ihre Werke publiziert. Im Aufbau Taschenbuch sind von ihr »Hermann Kant. Die Sache und die Sachen« und »Eva Strittmatter. Leib und Leben« lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Hermann Kant
Therapie
Erzählungen und Essays
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Irmtraud Gutschke
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Ich habe gelesen
Die Zeit und ihre Zeugen
Über Schriftstellerei. Rede im Warschauer Königsschloss am 19. Mai 1989
Isa
Bronzezeit und Südsee. Ein Briefwechsel zwischen Hermann Kant und Hermann L. Gremliza über die Internet-Enzyklopädie Wikipedia, Dichtung und Wahrheit
Namedropping
Heusers Signatur
Ein Vorkommnis
kleines fragment zur kritik der arbeitstherapie
Ein strenges Spiel
Das Leben ist ein »strenges Spiel«. Hermann Kant im Gespräch mit Irmtraud Gutschke über Befriedigung, Befürchtungen und über das, was Jüngere gern von sich wegschieben
Anhang
»Literatur, das ist ein anderes Wort für Ausweg« – Nachwort von Irmtraud Gutschke
Textnachweis
Impressum
Ich habe gelesen
Einem Schriftsteller, und einem Funktionär des Schriftstellerverbandes schon gar, werden öfter, als ihm lieb sein kann, Bücher mit der Bemerkung zugestellt oder zugesteckt, die hätten Drucklegung und Verbreitung auch in seiner Heimat verdient und ersucht werde er, sich entsprechend einzusetzen.
Da es bei mir zu Hause an Leuten und Einrichtungen nicht mangelt, die gedacht sind, den Literaturverkehr in Gang zu halten, nehme ich derlei Eingesandtes nicht ohne die Frage entgegen, warum man statt eines Verlages oder Verlegers mich zum Adressaten machte, und ich vermute, die Angelegenheit, sprich das Buch, habe einen Haken.
Also ist gesorgt, dass ich die Drucksache wirklich lese, und manchmal konnte ich sorgen, dass auch andere sie zu lesen bekamen. Lieber ist es mir dennoch, selber zu bestimmen, worauf ich meine Lesezeit wende. Ich bin in dieser Hinsicht eher vergnügungssüchtig als bildungsbeflissen, und da ich mich nicht gerade asozial aufführe, erlaube ich mir beim Umgang mit Literatur eine Menge Egoismus.
Egozentrismus kommt auch vor, hier gleich ein Beispiel: Letzte Woche hat mir einer Jochen von Langs Bormann-Buch »Der Sekretär« über den Tisch geschoben und dazu gesagt, dieses Werk müsse, siehe oben. Schon des Untertitels wegen, »Der Mann, der Hitler beherrschte«, riss es mich nicht in die Lektüre, und überdies wusste ich, wie wenig sich unsere Historiker und die dazugehörigen Verleger für derart personalisierte Zeitgeschichte begeistern können. Sie sind auf Gesetzmäßigkeiten aus und weniger auf deren Sekretäre, und auf Darstellungen des Faschismus, wie er in Schwerin, Parchim, Halberstadt oder Bernau, in der heutigen DDR also, vorgekommen ist, sind sie, scheint es, auch nicht so scharf. Womöglich ist diese Haltung gedacht, die Wissenschaftlichkeit von Geschichtsbetrachtung zu stärken – ob sie aber geeignet ist, Geschichtsbewusstsein zu vertiefen, weiß ich wirklich nicht. Und schon gar nicht weiß ich, ob man auf diesem Felde zwischen Wissenschaft und Bewusstsein so sehr unterscheiden darf.
Aber das Buch von Jochen von Lang las ich, und zwar aus quasi privaten Gründen, denn in Parchim, wo Bormann an einem Mord beteiligt war, habe ich ein paar Jahre gelebt. Bei Lektüre des »Sekretärs« erfuhr ich, wie sehr Martin Bormann mein Nachbar gewesen ist. Und nicht nur der, auch ein gewisser Höß, nachmals Kommandant von Auschwitz, hat sich in Parchim, meinem Parchim, herumgetrieben. Dank der Nachforschungen von Langs weiß ich, es haben sich Hößens und meine Spur, wenngleich bei einiger Zeitverschiebung, gekreuzt. Er ist Freikorpsmann, Fememörder und Landarbeiter auf dem Rittergut Neuhof bei Parchim gewesen, und als er zwanzig Jahre später in Auschwitz Massenmord betrieb, habe ich sehr oft auf dem Rittergut Neuhof bei Parchim gearbeitet. Genau gesagt, verbrachte ich den allerersten Tag meiner Elektrikerlehre beim Chausseehaus von Neuhof, und 33 Jahre später, auf dem Weg zum Poetenseminar im nahegelegenen Schwerin, musterte ich meinen Tatort und nervte anschließend die kommenden Dichtersleute mit dem Spruch, die von mir gefertigte Anlage sei noch in Betrieb, und den von ihnen gefertigten Versen wünschte ich ähnlich langen Gebrauchswert. – Was ich den versammelten Lyrikern bis heute verarge, ist, dass sie nicht fragten, wie hoch wohl der Anteil eines Ersttagslehrlings an einem Werkstück zu veranschlagen gewesen sei. Und mir verarge ich, dass ich erst 1988 aus einem bei Herbig in München erschienenen Buch erfuhr, in wessen Nähe ich mich aufhielt, als ich bei Parchim auf Elektromonteur studierte.
Von Bormann immerhin wusste ich schon, dass es ihn in meinem Parchim gegeben hatte, denn einmal habe ich Tür an Tür zu einer Wohnung gearbeitet, von der man raunte, es sei dort die Geliebte des Reichsleiters Bormann zu Hause, und den hohen Herrn habe man hier des Öfteren gesichtet. Nun war ich damals in einem Alter, in dem man sich für Geliebte jeder Art heftig interessiert und auf höchste Herren ganz anders sieht, als diese wohl wünschen. Dennoch habe ich mir den Platz nur deshalb gemerkt, weil meine Arbeitsstelle nebenan von grässlichster und schönster Eigenart gewesen ist. Der Wohnungsinhaber dort war bei einem Schnapsabfüller als Buchhalter beschäftigt, auf einer Ebene also, die mir hochgelegen vorkam. Umso mehr verwunderten mich die häuslichen Verhältnisse des Mannes: Seine Frau und ein kleines Kind lagen die ganze Zeit, während der ich in der Wohnung beschäftigt war, bis an die Nasenspitzen zugedeckt im Bett und beobachteten mich mehr als verängstigt, und alle Wäsche im Schlafzimmer hätte längst wieder einmal geteert gehört. Tatsächlich bin ich weder vorher noch nachher an einem ähnlich verschmutzten Ort gewesen, was etwas heißen will, da ich durch eine vergleichsweise ruppige Gefangenschaft musste.
Um aber im Schlafzimmer des Buchhalters zu bleiben: Auf dem Kleiderschrank, den ich wegen meiner Strippenzieherei abrücken musste, lagerte flockiger Dreckmull, aus dessen geologischen Schichten sich lesen ließ, wann zum letzten Mal Möbel und frische Luft ins Haus gekommen waren. Der Ekel machte mir Gänsehaut und würde mir bald Pickel wachsen lassen, und um hin und wieder halbwegs atembare Luft zu holen, floh ich in Abständen ins Nebenzimmer, das auch verstaubt war, aber wenigstens nicht bewohnt. Vor allem gab es einen Bücherschrank dort, der seit Jahrzehnten auf einen Benutzer gewartet hatte. Ich holte Trittleiter und Werkzeug, wählte, wenn schon, denn schon, einen Goldschnitt-»Faust«, nahm auf der Leiter Platz und las.
Klar, dass dies niemand glauben kann, nur ist es genau so gewesen. So ausgeklügelt widersinnig, so aufdringlich symbolisch, so literarisch und so doof. – Als ob es nicht reichte, den »Faust« bei ungewöhnlicher Gelegenheit entdeckt zu haben, muss es auf der Trittleiter sein in der katastrophal verdreckten Wohnung eines Schnapsbuchhalters, dessen Frau wahrscheinlich nicht bei Sinnen ist, und nebenan hat Martin Bormanns Geliebte gewohnt, nein danke.
Wahrscheinlich komme ich mit der Geschichte gerade noch durch, wenn ich sie in der Abteilung »Ich habe gelesen« darbiete und mit der Beteuerung versehe, ich wisse, wie ertüftelt sie klingt. In einem Roman dürfte ich sie so, wie sie sich abgespielt hat, nicht stattfinden lassen, denn der will Glaubwürdigkeit, und das unbearbeitete Leben ist manchmal nicht recht zu glauben. Tatsächlich, das Leben, so wie es ist, taugt selten für Literatur, es muss erst bearbeitet werden. Wenn es ein Spruch sein darf: Literatur ist Leben auf hoher Verarbeitungsstufe.
Aber die Sache mit Herrn von Langs Buch, den Nachbarn Höß und Bormann und dem »Faust« auf der Trittleiter ist noch nicht zu Ende erzählt. Ich bin nämlich, da ich hin und wieder doch meinem Elektrikerauftrag nachzugehen hatte, bei Feierabend mit dem Buch nicht fertig gewesen und habe es mir ausgeliehen, und eine Woche später musste man mich ins Krankenhaus schaffen, wo ich vier Monate verblieb. Bei einer Visite habe ich mir den rätselhaft sarkastischen Spruch des Chefarztes zugezogen: »Faust – auch eine Krankenhauslektüre!« Bis heute frage ich mich, was dieser Mensch damit hat sagen wollen – aber vermutlich wollte er sich nur bei den Schwestern als ein Kenner des Belletristischen herausstellen, und als Arzt war er ein Könner. Er hat mich so kuriert, dass ich Soldat werden durfte und im Gefängnis Warschau dann die Chance bekam, meinem Mitinsassen Höß zu begegnen. Es ist mir dergleichen jedoch nicht erinnerlich, obwohl ich ihm in diesen Lehrtagen entschieden näher war als an meinem ersten Lehrtag in Neuhof bei Parchim.
Einen gemeinsamen Bekannten allerdings traf ich in besagtem Krankenhaus, wo ich den »Faust« ausstudierte. An meinem Spitalsbett erschien Theo von Haartz, dessen Namen in Parchim niemand aussprach, ohne »Öle und Fette« hinzuzusetzen. Ich hatte Theo von Haartz, Öle und Fette, nie zuvor gesehen und staunte nicht wenig über seinen Besuch, und über seine Ansprache staunte ich noch mehr. »Herr Kant«, lautete die, »ich werde seit Monaten von einem gruseligen Kurzschluss verfolgt. Er taucht auf und verschwindet wieder. Immer wenn ich Elektriker im Hause habe, verschwindet er. Ich habe fast alle Elektriker von Mecklenburg verbraucht, Sie sind meine letzte Hoffnung. Noch sind Sie krank, aber eines Tages werden Sie gesund sein, und dann kommen Sie bitte und befreien mich von diesem gruseligen Kurzschluss!« – Auf die geläufige Art von Leuten, die wissen, an welche Stellen Öle und Fette gehören, setzte er in gemütvollem Plattdeutsch hinzu: »Herr Kant, Sei doen mi een Gefallen, ik do Sei een Gefallen!«
Worin die Gefälligkeit, mit der er mir meine Gefälligkeit vergüten wollte oder vergütet hat, bestand, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch von meinem Staunen über einen stadtbekannten Handelsmann und Fabrikbesitzer, der einen Elektrikerlehrling im Krankenhaus aufsuchte, mit »Herr Kant« anredete und in eine Verabredung zog, die von gegenseitigem Vorteil schien und geschlossen zwischen Gleich und Gleich. Ich weiß auch noch, natürlich, dass ich den gruseligen Kurzschluss beseitigt habe, eine schleichende Störung, die nur auftrat, wenn schwere Fuhrwerke durch den Torweg der Firma Theo von Haartz, Öle und Fette, donnerten, und ich weiß, wie ich dazu komme, dieses Döntje in einen Bericht zu rücken, der »Ich habe gelesen« überschrieben ist und allenfalls von Jochen von Langs Bormann-Buch, meinen Begegnungen mit Höß und dem »Faust«, meinen Vorstellungen von Geschichtsschreibung und Zeitgeschichte und von der Art handeln sollte, in der ich so manches Mal an Lektüre gerate. In dem zeitgeschichtlichen Werk »Der Sekretär, Martin Bormann: Der Mann, der Hitler beherrschte« nämlich kommt auch Theo von Haartz, Öle und Fette, vor, und zwar als Führer der Völkischen Partei in Parchim, der an jenem Abend, an dem Höß und Konsorten den von Bormann befohlenen Fememord an einem gewissen Kadow vorbereiteten, die Schlagetote vom Freikorps Roßbach mit völkischen Reden und Freibier traktierte. – Wer weiß, vielleicht hat er ihnen gesagt: »Ick do juch een Gefallen, ji doot mi een Gefallen!«
Es ist nicht wichtig; wichtig ist nur, dass eine zufällige und ganz und gar nicht von mir herbeigeführte Begegnung mit einem Buch mir wieder einmal die Verquickungen gezeigt hat, in die gerät, wer zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten zu tun hat. Seltener wahrscheinlich kommt es dabei zu einem Gemengsel aus Bormann, Höß, Theo von Haartz, Öle und Fette, dem Faust und einer verrückten Buchhaltersgattin sowie einem Elektrikerlehrling, der dann Schriftsteller wurde, aber zu einem Gemengsel aus verschiedenerlei Leben und zu Berührungen mit Mördern und Opfern, mit stinkendem Schmutz und glänzendem Wort kommt es immerzu und an allen Plätzen.
Ich mag Bücher, die einen auf solche Gedanken bringen. Ich habe gerade eines von ihrer Art gelesen.
Die Zeit und ihre Zeugen
Eine Skizze in Martin Gilberts Geschichtswerk »Second World War« zeigt auf engem Raum mit Koło, Chełmno, Dąbie und Łódź jene polnischen Orte, die im chronologischen Register der Vernichtungsstätten vorderste Plätze einnehmen. Nur einen Fußmarsch von Koło nach Osten, in der ungefähren Mitte zwischen Poznań und Warszawa, also auf der Straße von Berlin nach Moskau, liegt das Städtchen Kłodawa.
Mich hat es viele Fußmärsche gekostet, von Kłodawa nach Koło zu gelangen. Vom 12. bis zum 20.Januar 1945 bin ich, zuerst vor den Sowjettruppen her und bald in ihrem Rücken, nach Westen gerannt oder gekrochen. Vor allem im Kreis, wie es in schlimmen Geschichten steht. Wäre mir bekannt gewesen, was dort geschehen war, wo meine Flucht enden sollte, hätte ich wohl schon in Kłodawa die Hände gehoben. Oder an seinem östlichen Stadtrand im dürftigen Graben dürftig bewaffnet auf die Panzer der 1.Belorussischen Front gewartet.
Doch hat man mich erst sieben Tage später bei Chełmno ergriffen und in einem Amtsraum von Koło als Gefangenen eingetragen. Von dort ging es ins gerade wieder polnische Gefängnis von Konin und danach in sowjetischem Gewahrsam auf Nebenstraßen über Chełmno und Dąbie zum Gefängnis von Łódź. Am zweiten Tag mussten wir im Laufschritt, dem es nicht an Anfeuerung durch die Posten fehlte, an einem schlossähnlichen Herrenhaus vorbei. Die Eile erklärte sich Jahrzehnte später. In Claude Lanzmanns unübertrefflicher Tatortbesichtigung und Zeugeneinvernahme »Shoa« kann man das Gutshaus und die Kirche von Chełmno wieder und wieder sehen. Dort wurden die zunächst aus Koło und Konin verschleppten Juden eingesperrt, ehe man sie direkt an den Portalen in Fahrzeuge pferchte und auf dem Weg zu den Massengräbern im Wald von Chełmno mit Auspuffgas umbrachte. Solcherart mörderische Effizienz hat Bertolt Brecht wohl mit seinem bösen »Hut ab, die Herren sind technische Genies« im »Anachronistischen Zug« gemeint.
Ich kannte weder Bertolt Brecht noch das Wort Effizienz und wusste nicht, was ein Vernichtungslager war, als man uns durch Chełmno trieb, nachdem man mich zwischen Koło und Chełmno aufgetrieben hatte. Zu meinem Glück ahnte ich nicht, dass die Straße von Koło nach Chełmno jene war, auf der am 7.Dezember 1941 beim Ersteinsatz der rollenden Gaskammern siebenhundert Juden aus Koło ermordet wurden. Siebenhundert, denen bis 1945 in stationären Mordgehäusen an die dreihunderttausend folgten. Sowie dreitausend damals Zigeuner genannte Roma und tausend Polen und Russen.
Am Morgen der Abgas-Probe fand Japans Überfall auf Pearl Harbor statt. Das nahm ich gebührend zur Kenntnis, auch wenn es mir drei Jahre danach beinahe entfallen war. Von allen Angriffen hielt mich zu dieser Zeit die Offensive der Sowjetarmee besetzt, die mit meiner Ergreifung nicht endete. Lanzmann und Gilbert sorgten dafür, dass mich, wenngleich Jahre danach, genaue Bescheide erreichten. In denen wie auch im Eichmann-Prozess-Protokoll kommt der Häftling Shimon Srebrnik vor, der einem Flüchtigkeitsfehler sein Leben verdankte. Als die Lager-SS ihre jüdischen Sklaven und möglichen Belastungszeugen beim Nahen der Roten Armee beseitigen wollte, traf sie ihn nicht tödlich. Er konnte fliehen und sich bei einem polnischen Bauern verbergen.
Vom 17. Januar, an dem er aus Chełmno entkam, vergingen zehn Tage bis zur Auschwitz-Befreiung. Die fand, wie man seit den Gedenkfeiern wieder weiß, am 27. Januar vor sechzig Jahren statt. In der Mitte zwischen beiden Daten bin ich fliehend um den Ort geschlichen und gefangen an seinem Herrenhaus vorbeigerannt. Hätte Shimon Srebrnik mich in Chełmno, das nun nicht mehr Kulmhof hieß, mit bösen Worten begrüßt, hätte ich ihn nicht verstanden. Oder nur in Hinsicht auf unser beider Unverträglichkeit.
Ein Status, der ähnlich vorlag zwischen den sowjetischen Posten und mir. Hätten sie mir den Überfall auf Polen oder den auf Russland angelastet, wäre ich ihnen mit Unschuld gekommen, nicht aber mit Unverständnis. Über Pearl Harbor wusste ich so Bescheid, wie ich vom September 39 und vom Juni 41 etwas wusste. Vom mobilen Gasmord 41 aber und von Todesfabriken, in denen bis zum Dezember 44 gemeuchelt worden war, hatte ich, als ich im Januar 45 durch den Tatort rannte, keinen blutigen Schimmer.
Was mir Shimon, wäre er in Chełmno unter denen gewesen, die uns Deutsche einmal in anderer Formation sehen wollten, kaum geglaubt hätte. Schließlich hatten ihn welche, die aussahen und sprachen wie ich, anfangs gezwungen, die Knäuel der toten Juden aus den Gaskammern zu reißen, und später benutzt, die Feuerlöcher einzuebnen, um Spuren zu verwischen.
Soweit ich weiß, stand er nicht im Spalier und wussten die Posten nicht, warum es aufgeregt zuging auf der Straße durch Chełmno. Ihr Kommandeur könnte es gewusst haben. Ihm kann befohlen worden sein, uns beeilt durch den Ort zu treiben. Womöglich sagte man ihm nichts von der Mordgrube, womöglich wusste er nicht, was hier seit drei Jahren und bis vor kurzem geschehen war. Vielleicht hießen die Kommandanten den Kommandeur nur, dafür zu sorgen, dass wir Deutschen das Herrenhaus zur Kenntnis nähmen. Auch solle er sehen, dass die Polen erfassten, unter wessen Aufsicht wir jetzt stünden. Überdies habe er für jeden, der unter seinen Augen erschlagen werde, einen Ersatzmann aufzutreiben, damit die Zahlen stimmten.
Wie auch immer, wir sind wie immer, wenn Laufschritt galt, wie ums Leben gelaufen. Wieder einmal wusste ich nicht, warum geschah, was geschah. Dank eines Unwissens, das dem Reiter über den Bodensee böser als mir ausgegangen ist, ahnte ich nicht, dass Chełmno den Winkel eines Dreiecks bildete, dessen andere Winkel Koło und Kłodawa hießen.
Aus Koło und Kłodawa kamen die ersten Juden, die man zuletzt in Chełmno sah. Aus Koło, wo man mich in die Gefangenenliste eintrug; aus Kłodawa, wo ich in großdeutscher Schießkunst unterwiesen wurde. Kłodawa trug noch den großdeutschen Namen Tonningen, als ich dort einrückte. Ich blieb bis zu der Stunde am Platz, in der er seinen polnischen zurückbekam. Wohingegen ich nach Koło erst gelangte, als es schon nicht mehr Warthbrücken hieß.