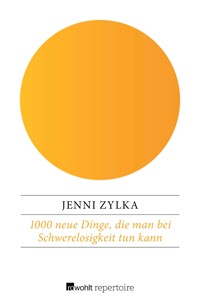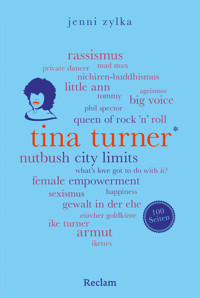
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Reclam 100 Seiten
- Sprache: Deutsch
Alles über die Ikone mit der großen, unverwechselbaren Stimme »Ich nehme Tina beim Wort und bei der Note. Und will so viel wie möglich über sie – und von ihr lernen.« Tina Turner ist eine Superheldin: In ihrer sechs Jahrzehnte währenden Karriere überwand sie Sexismus und Rassismus, kämpfte sich aus Armut und Gewalt heraus. Ihr Leben als Musikerin und Ikone, Tänzerin und Autorin, Mutter und Partnerin steht für eine beispiellose feministische Erfolgsgeschichte. Jenni Zylka porträtiert einfühlsam Leben und Werk dieser faszinierenden Ausnahmekünstlerin, die mit Songs wie »Private Dancer« oder »What's Love Got to Do With It« zeitlose Songklassiker erschaffen hat. Mit 4-farbigen Abbildungen und Infografiken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jenny Zylka
Tina Turner. 100 Seiten
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962368
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: zero-media.net, München
Bildnachweis siehe Anhang
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962368-9
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020718-5
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Tina Turner, Renaissance Woman
Nutbush City Limits: Das Dorf, die Kirche und die Familie – und nicht mal der Mississippi kennt die Grenzen.
Ausflug 1: Gospel
Box Top: Schnelle Autos, brutale Männer, beschlagene Fenster
Ausflug 2: Wer hat nochmal den Rock’n’Roll erfunden?
I’ve been loving you too long: Große Talente, ruchlose Männer und eine hochambivalente Beziehung
Motherless Child: The times they are a-changing – und das gilt erst recht für Zwischenmenschliches
Private Dancer: Wie man den richtigen Weg findet, indem man umkehrt und die entgegengesetzte Richtung einschlägt
Ausflug 3: Playlist (20 Songs)
Literaturtipps
Bildnachweis
Über die Autorin
Über dieses Buch
Leseprobe aus ABBA. 100 Seiten
Tina Turner, Renaissance Woman
Leicht zu erkennen: an der Stimme, der Frisur, den Beinen. In dieser Reihenfolge. Wobei nach der Stimme zunächst lange gar nichts kommt. Und die Äußerlichkeiten sich spät eingliedern, zwischen einer Ikonisierung und dem Bedürfnis, die »Tina«-Figur, ihre »Bühnenpersona«, wie eine Perücke auf- und abzusetzen.
Jene Bühnenpersona, die seit mindestens 40 Jahren zu unserem Kulturkanon gehört. Es gibt sogar ein T-Shirt mit dem Aufdruck »Teenage Mutant Tina Turners«. In den Farben der »Teenage Mutant Ninja Turtles«, Figuren aus einer seit 1984 (rein zufällig dem Jahr von Tina Turners Comeback) durchlaufenden Comicserie mit vier sprechenden, mutierten Schildkröten, ist Tina Turner viermal zu sehen – mit eben jenen ikonischen Merkmalen Mikrophon, Frisur, Beine.
Leicht zu erkennen: an ihrer Resilienz.
Tina Turner heißt so, weil sie so heißen will. Schließlich: Was gibt es Selbstermächtigenderes, als einen Namen, den man von jemand anderem, einem Feind, einem Täter übergestülpt bekommen hat, zu seinem eigenen Ding zu machen? Tina Turner ist eine lebende Dysphemismus-Tretmühle – sie hat einen Begriff genommen, der durch den Nachnamen ihres gewalttätigen Ex-Mannes negativ belastet war und ist, und hat dafür gesorgt, dass er eine Bedeutungsverbesserung erfährt: Tina Turner ist nun positiv besetzt. Und Ike Turner ist es nicht.
In diesem Buch geht es zunächst um Anna Mae (oder Ann Mae oder nur Ann), wenn es um die Prä-Tina-Turner-Geschichte der 1930er, 1940er und 1950er Jahre geht. Ich nenne sie nur Tina, wenn ich aus einer ihrer rückblickenden Biographien zitiere.
Nach 1958, als Ike der jungen, wahnsinnig talentierten Anna Mae Bullock den Namen Tina aufzwingt, mit dem Hintergedanken, sie austauschbar zu machen, bleibt es bei Tina. Denn Tina hat sich ihres Namens ermächtigt, sie trägt ihn mit Stolz. Und: Sie ist alles andere als austauschbar.
(Für Freund:innen und Verwandte blieb sie natürlich Ann oder Anna – aber ich habe sie nie kennengelernt und möchte nicht übergriffig sein.)
Der kanadische Musiker Chilly Gonzales hat im Frühling 2024 eine Petition auf den Weg gebracht. Darin fordert er, die Kölner Richard-Wagner-Straße in Tina-Turner-Straße umzubenennen. Der Komponist Wagner war Antisemit. Tina dagegen ist eine Ikone, ein »Survivor«, hat sich den Namen erkämpft – und lebte tatsächlich eine Weile in Köln. Falls die Umbenennung stattfinden sollte, werde ich nach Köln fahren und mitfeiern.
Leicht zu erkennen: an ihren vielen Talenten.
Auf den folgenden 100 Seiten will ich mich an ihrem musikalischen Werk entlanghangeln. Ich nehme sie beim Wort und bei der Note, will herausfinden, wieso der R’n’B ihr so verhasst war; wieso die frühen Ike-und-Tina-Songs ihr später geradezu in den Ohren wehtun. Es geht also um die Musik: Wie wirkt sie damals, was macht Tinas Neustart mit neuem Sound musikalisch interessant?
Andererseits sind Song- und weitere Texte meine Quellen. Denn auch wenn Tina nur wenige Lieder selbst geschrieben hat, glaube ich daran, dass sie die Songs so singt, wie nur sie es kann, weil die Worte in ihr resonieren. Selbst und erst recht die schlimmen Zeilen, die Ike ihr in den Mund gelegt hat. Die Sätze, die seine Gewalt rechtfertigen, sein untragbares Verhalten unter dem Deckmantel von »Liebe darf alles« akzeptierbar machen sollen. Hinzu kommen Artikel und Bücher über sie, Interviews, Kommentare und Kritiken. Tinas Texte sind größtenteils nicht ihre eigenen Worte – und doch kommuniziert sie darüber. Und auch die Bilder auf den Plattencovern verbergen eine Art Botschaft – mal allegorisch, mal deutlich.
Eine ihrer Botschaften ist allerdings sehr einfach zu verstehen: An ihrer späteren Schweizer Residenz hat sie ein Schild anbringen lassen, mit der Aufschrift: »No bell before 12:00« (ich lasse mir das Schild gerade nachmachen).
Leicht zu erkennen: und das sogar postum.
Im Januar 2025, fast zwei Jahre nach ihrem Tod, tauchte plötzlich ein unveröffentlichter Tina-Turner-Song von 1984 auf (man fragt sich immer, wie solche Songs eigentlich »auftauchen« – verstauben große, schwere Mehrspur-Magnetbänder jahrzehntelang in den dunklen Kellern der Capitol-Studios, komplett vergessen von allen Beteiligten, bis sie zufällig bei einer Umräumaktion gefunden werden und man aus der hingekrakelten »Tina 1984«-Kuli-Beschriftung das Richtige schlussfolgert!?). »Hot For You Baby« schaffte es damals nicht auf das Private Dancer-Album, nun bekommt der Track, den George Young und Harry Vanda einst für das »Love is in the Air«-One-Hit-Wonder John Paul Young geschrieben hatten, mehr Aufmerksamkeit, als sich je jemand erträumt hätte. Denn gegen die Klassiker des Albums, »Private Dancer« und »What’s Love Got to do With it«, hätte er damals in seiner fröhlichen, etwas schlichten Rockbanalität wohl ziemlich abgestunken. Die verlässlich abliefernde Tina hat den Rechteinhaber:innen mit diesem Stück somit ein spätes Geschenk gemacht.
Leicht zu erkennen: an ihrer Weisheit und Weitgereistheit.
Tina selbst scheint alles auf einmal gewesen zu sein, ein lebender Widerspruch in sich: verletzlich und dickhäutig. Liebevoll und nachlässig. Mutig und feige. Geschäftstüchtig und unachtsam. Spirituell und bodenständig. Reich und arm.
Haben Steuergründe etwas damit zu tun, dass sie in die Schweiz gezogen ist, oder lag das am schönen Zürichsee und am Job ihres Mannes? Wusste sie, dass die Familie des Vermieters ihrer Villa ihr Geld mit Kolonialgeschäften (Kaffee) gemacht hatte, und falls ja, wäre das wichtig gewesen? Hat sie die Musikrechte an ihren Songs am Ende ihrer Karriere aus finanziellen Gründen verkauft? Auch, weil sie diese Fragen nicht mehr beantworten kann, setze ich den Schwerpunkt auf die musikalischen Fakten.
Leicht zu erkennen: an ihrem Schmerz.
Über die Gewalt, die sie erlebt hatte, sprach sie oft, fragte sich, wieso sie nicht früher aus der missbräuchlichen Beziehung ausgebrochen war.
Doch sie hat mit allem irgendwann ihren Frieden gemacht – vielleicht auch, indem sie später einen ganzen Ozean zwischen sich selbst und das Land der Ungerechtigkeiten brachte.
Über den strukturellen und direkten Rassismus, dem sie bereits als Kind ausgesetzt war, sprach sie selten. Dass sie das Opfer von Intersektionalität wurde, war ihr hingegen klar – in einem Interview von 2011 sagt sie, sie könne nicht beurteilen, ob ihr Problem, einen Plattenvertrag als Solokünstlerin zu bekommen, mit ihrer Hautfarbe oder ihrem Geschlecht zusammenhing.
Während des Schreibens habe ich mich immer wieder gefragt, ob es für mich als weiße Frau, als nicht von Rassismus betroffene Person, in Ordnung ist, die Auswirkungen von Rassismus zu beschreiben. Darf ich das? Kann ich das überhaupt verstehen? Doch im Sinne der inkludierenden Kraft von Kultur möchte ich mich auch als weiße Musikjournalistin Schwarzer Musik und Schwarzen Musiker:innen nähern, die ich bewundere, möchte sie und die Umstände beschreiben, in denen sie leben, und sie vielleicht zumindest ein bisschen besser kennenlernen. Ich will nicht Tinas Geschichte erzählen – das hat sie selbst getan, zweimal sogar. Ich möchte weder sie noch ihre Musik definieren. Sondern ich will mich damit beschäftigen, was sie bedeuten könnte. Und so viel wie möglich über sie – vor allem aber von ihr lernen.
Nutbush City Limits: Das Dorf, die Kirche und die Familie – und nicht mal der Mississippi kennt die Grenzen.
1. We all work while the white folk play
Der Mississippi kommt herum. Von Norden nach Süden fließt er durch die USA, sanft und plätschernd verbindet er zehn Bundesstaaten des Landes. In der Sprache der von den weißen Siedler:innen gemeuchelten indigenen Völker, die Tausende von Jahren an seinen Ufern lebten, bedeutet sein Name »großer Fluss«. Einen anderen Spitznamen trägt er seit 1927, als der Librettist Oscar Hammerstein II und der Komponist Jerome Kern das Buch Show Boat der Autorin Edna Ferber zu einem Musical adaptierten. Und sich damit der Herausforderung stellten, als kaum von den behandelten Themen betroffene Weiße einen Roman für die Bühne aufzuarbeiten, ohne ihm seine Dringlichkeit zu nehmen: In Show Boat geht es um Alkoholismus, Untreue, Klassismus – und um Rassismus.
Der musikalische Höhepunkt, das Kernstück der Broadwayshow, ist das Lied »Ol’ Man River«, gesungen von einem Schwarzen Schiffsarbeiter, der sich mit dem Mississippi, dem »Ol’ Man River«, vergleicht und desillusioniert auf sein von Arbeit, Diskriminierung, Gewalt und Ungerechtigkeit geprägtes Leben blickt. Darin heißt es: »Here we all work while the white folk play / Pullin’ them boats from the dawn till sunset / Gettin’ no rest till the judgment day.«
Wir arbeiten uns zu Tode, singt er, von morgens bis abends kümmern wir uns um die Boote. Die Weißen dagegen haben Spaß.
In einer 1928 aufgeführten Fassung des Musicals sang der US-amerikanische Vokalist und Bürgerrechtsaktivist Paul Robeson den Song mit leicht geändertem Text – und machte ihn mit seinem voluminösen, mitreißenden Bassbariton zum Höhepunkt der Show. An seiner Interpretation wurden alle folgenden Versionen gemessen. »I must keep fightin’ until I’m dyin’«, singt Robeson, ich muss weiterkämpfen bis zum Ende. (Und auch fast 100 Jahre später sind die USA noch immer ein von tiefsitzenden rassistischen Strukturen geprägtes Land.)
Im Frühling 1939, ein knappes Jahrzehnt nach Robesons Fassung von »Ol’ Man River«, hatte die Jazzikone Billie Holiday den Song »Strange Fruit« aufgenommen, ihre musikalische Interpretation eines erschütternden Gedichts des Poeten Abel Meeropol, das bei der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung eine wichtige Rolle spielte. Die »Strange Fruit«, die seltsamen Früchte, die im Südstaatenwind von den Pappeln hängen, sind die Körper Schwarzer Menschen, ermordet von Weißen. Die USA sind »segregiert« – ehemalige Sklavenhalter und ehemalige Sklaven, Herrscher und Beherrschte mischen sich kaum untereinander.
In diese angespannte Zeit wird am Morgen des 26. November im Haywood County Community Hospital in Brownsville, Tennessee, unweit des Mississippi ein Mädchen namens Anna Mae hineingeboren. Ein Mädchen, das viele Jahre kämpfen wird, gegen viele verschiedene Übel – lange bevor Begriffe wie »intersektionale Diskriminierung« die Umstände beschreiben, die Anna Maes Leben prägen: Sie ist Schwarz, arm und weiblich. Doch sie wird triumphieren.
Ehrenbriefmarken aus dem ostafrikanische Burundi, 2011
2. Auf dem Tina Turner Highway
In der ersten Etage des Brownsville-Krankenhauses, dessen Betreiber:innen schon lange unter der nicht ausreichenden Gesundheitsversorgung ächzen, gibt es seit einiger Zeit ein Café namens »Anna Mae’s«. Auch der eine Stunde Autofahrt von Memphis entfernte Abschnitt der State Route 19, der von Brownsville nach Nutbush führt, bekam vor über zwei Jahrzehnten einen neuen Ehrennamen. Dieser Teil der Staatsstraße, die durch die klitzekleine Siedlung in Tennessee führt, in der heute noch knapp 259 Menschen wohnen, heißt seit 2002 »Tina Turner Highway«.
Denn aus Anna Mae Bullock, das weiß nicht nur ganz Brownsville und fast jeder im angrenzenden Nutbush, in Tennessee, in den USA, ja auf der ganzen Welt, wurde eine der großen Sängerinnen der Geschichte: Tina Turner.
Die Eindrücke, die Tina zwischen 1939 und 1954 in Nutbush machte, als sie noch »Anna Mae Bullock« war, schildert sie Anfang der 70er Jahre in ihrem Signature Song so: »A church house, gin house / A school house, outhouse / On Highway Number Nineteen / The people keep the city clean / They call it Nutbush […] Call it Nutbush city limits.«Tina setzt in der ersten Strophe ihres Songs »Nutbush City Limits« autobiographische Erinnerungen um: der größte Hit für das R’n’B-Duo »Ike & Tina Turner«, das Bild einer typischen Gemeinde in den Südstaaten – inklusive allem, was dort wichtig ist: Kirche (»church house«), Schnaps (»gin house«), Schule (»school house«), Sauberkeit (»keep the city clean«).
Die zweite Strophe beschreibt die Beschaulichkeit, Eintönigkeit und den strikt geregelten Glauben des dörflichen Lebens: »Twenty-five was the speed limit / Motorcycle not allowed in it / You go t’the store on Fridays / You go to church on Sundays.«
Schneller als 25 mph, also etwa 40 m/h, darf nicht gefahren werden. Motorräder, das rollende Symbol für Individualität, sind nicht erlaubt. Freitags geht man einkaufen, jeden Sonntag in die Kirche – genauer: in die Woodlawn Baptist Church, ein Gebäude aus roten Backsteinen, umgeben von weißen Holzsäulen.
Familie Bullock lebt in einem sogenannten »Shotgun Shack« – schmale, einfache, meist eingeschossige Häuser, die wie Schuhschachteln nebeneinanderstehen. Angeblich, so will es eine urbane Legende, heißen sie so, weil der Schrot einer in Richtung Tür abgefeuerten Flinte durch das ganze Gebäude und rückwärts wieder hinausfliegen kann – in dem schlichten und kleinen Holzbau gehen die Zimmer ineinander über.
Die dritte Strophe beschreibt das mit der strengen Religionsauffassung und den traditionellen gesellschaftlichen Regeln verbundene Verbot von hartem Alkohol – erst 1933, sechs Jahre vor Tina Turners Geburt, war das Prohibitionsgesetz aufgehoben worden. Während der 13 Jahre andauernden Prohibition, die man auch als »The Noble Experiment« bezeichnete, hatte die illegale Schnapsherstellung geboomt:»No whiskey for sale / You get caught, no bail / Saltpork and molasses / Is all you get in jail.«
Beim illegalen Verkauf von Whiskey droht Gefängnis, und dort muss man sich mit gepökeltem Schweinefleisch und Zuckerersatz herumärgern.
3. Family Rules
Schon vor ihrer Geburt gab es Probleme in der Ehe von Anna Maes Eltern, Zelma Priscilla und Floyd Richard Bullock. Floyd Richard arbeitet als Aufseher von Pächtern der nahegelegenen Baumwollfelder und folgt als Dekan der lokalen Baptistengemeinde strengen religiösen Regeln. Seit Anna Maes Geburt (ihre Schwester Alline ist damals drei Jahre alt) hält sich das Gerücht, Anna Mae, deren Haut heller als die ihrer Schwester ist, sei ein Kind aus einem Seitensprung. Zudem ärgert sich