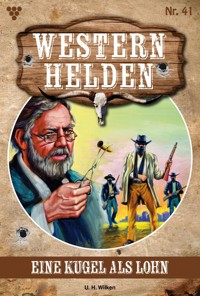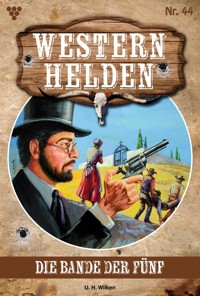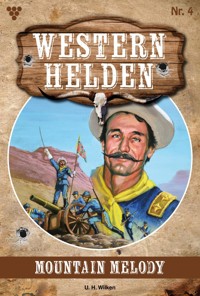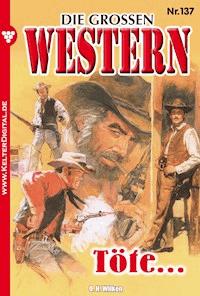
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Gewehre schoben sich aus dem dichten Grün der Strauchgruppen hervor. Sonnenschein brach sich auf den Läufen der Winchester. In den Baumkronen raunte der Wind. Bösartig peitschten die Schüsse auf. Mündungsfeuer versengte die Blätter. Fauchend gingen die Kugeln ins Tal und klatschten in die Körper von Menschen … O Herr, sieh auf dieses Land! Warum gibt es kein Ende mit diesem Morden! Siehst du es nicht, hörst du es nicht, wie sie schreien und flehen? Pulverrauch stieg über den Strauchgruppen empor und in die Bäume. Pferde stampften unruhig und zerrten an den Zügeln. Beißender Qualm wehte in die vor Hass verzerrten Gesichter weißer Männer. Gnadenlos schossen sie ins Tal. Einer lachte röhrend, wie irre. Erbarmungslos schickten sie die Bleistücke zwischen die zerschlissenen Zelte. Sie schossen auf alles, was sich bewegte … Und unten liefen die Apachen umher und versuchten, dem Tod zu entrinnen. Sie schossen zurück, doch ihre Waffen waren alt und schlecht; die Schüsse blieben wirkungslos. Röchelnd brachen sie zusammen, krallten ihre Hände in den Boden. Frauen rissen ihre Kinder an sich. Schreiend und weinend fielen sie auf die Knie. Die Kinder starben in ihren Armen. Sie alle entkamen nicht dem tödlichen Hass der Weißen. Krieger fielen im Feuer der Schüsse. Greise kippten um wie alte dürre Bäume. Squaws krochen umher. Kugeln fuhren in die Glut des Lagerfeuers und wirbelten das Holz und die Asche hoch. Kinder schrien gellend, blickten mit geweiteten Augen auf ihre Eltern und starben unter den Schüssen … Und dann kamen die Männer unter den Bäumen hervorgeritten. Sie trieben die Pferde ins Tal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 137 –Töte …
U.H. Wilken
Gewehre schoben sich aus dem dichten Grün der Strauchgruppen hervor. Sonnenschein brach sich auf den Läufen der Winchester. In den Baumkronen raunte der Wind.
Bösartig peitschten die Schüsse auf.
Mündungsfeuer versengte die Blätter. Fauchend gingen die Kugeln ins Tal und klatschten in die Körper von Menschen …
O Herr, sieh auf dieses Land! Warum gibt es kein Ende mit diesem Morden! Siehst du es nicht, hörst du es nicht, wie sie schreien und flehen?
Pulverrauch stieg über den Strauchgruppen empor und in die Bäume. Pferde stampften unruhig und zerrten an den Zügeln. Beißender Qualm wehte in die vor Hass verzerrten Gesichter weißer Männer. Gnadenlos schossen sie ins Tal. Einer lachte röhrend, wie irre. Erbarmungslos schickten sie die Bleistücke zwischen die zerschlissenen Zelte. Sie schossen auf alles, was sich bewegte …
Und unten liefen die Apachen umher und versuchten, dem Tod zu entrinnen. Sie schossen zurück, doch ihre Waffen waren alt und schlecht; die Schüsse blieben wirkungslos.
Röchelnd brachen sie zusammen, krallten ihre Hände in den Boden. Frauen rissen ihre Kinder an sich. Schreiend und weinend fielen sie auf die Knie. Die Kinder starben in ihren Armen. Sie alle entkamen nicht dem tödlichen Hass der Weißen. Krieger fielen im Feuer der Schüsse. Greise kippten um wie alte dürre Bäume. Squaws krochen umher. Kugeln fuhren in die Glut des Lagerfeuers und wirbelten das Holz und die Asche hoch. Kinder schrien gellend, blickten mit geweiteten Augen auf ihre Eltern und starben unter den Schüssen …
Und dann kamen die Männer unter den Bäumen hervorgeritten. Sie trieben die Pferde ins Tal und jagten auf das Lager der Apachen zu. Während das Echo der Schüsse in den Tälern brüllte, taumelten die letzten Apachen davon. Doch die Reiter holten sie ein.
Sie schlugen mit den Gewehrkolben zu, sie warfen sich auf die Apachen, stachen zu, würgten und wüteten unter höllischem Gelächter … Der Wind trug den Knall der Schüsse weit davon, durch Täler und über kalte Höhen, über bizarre Felsklippen, durch Canyons und zu dem Mann Cheyenne …
Hoch aufgerichtet stand er am Feuer und horchte. Der Wind bewegte sein sandfarbenes, fast graues Haar. Sonnenschein lag auf dem wettergebräunten verwitterten Gesicht. Die grauen Augen waren fast geschlossen.
Ein Mann und seine Legende … An den langen Beinen waren Chaps. Lederschnüre hingen herunter. Aus den glühenden Holzscheiten stieg schwacher Rauch und in das harte Gesicht.
Fernab verloren sich die Schüsse, und es war wieder still in weiter Runde. Die Wipfel der Bäume wiegten sich im Wind, die Sonne flirrte durch die Baumlücken.
Jäh kam Leben in den großen Mann. Mit den Stiefeln stampfte er durch die Glut, erstickte das Feuer und packte die Winchester. Mit großen Schritten ging er zu seinem Pferd, zog sich in den Sattel und ritt an.
Auf windiger Höhe verhielt er und witterte wie ein Wolf. Nichts war zu hören und zu sehen. Der Tag schien so friedlich zu sein. Die klare Luft füllte die Täler, der Himmel war von seidiger Bläue.
Hart trieb Cheyenne sein Pferd an und ritt durch die Täler. Der alte Stetson hing am Kinnriemen im Nacken und schlug auf und ab. Die Chaps an den Beinen flatterten. Schnell trug ihn das Pferd nach Süden.
Als er das Tal des Todes erreichte, waren die Mörder schon verschwunden.
Steif saß er im Sattel, verhielt am Talrand und starrte auf die entseelten Körper. Das Feuer schwelte noch schwach …
Langsam ritt er ins Tal. Sein Gesicht war wie aus Stein, und in seinen Augen war es seltsam dunkel. Vor den Toten saß er ab, stand mit gesenkter Winchester still und atmete schwer.
Kein Wort kam über die rauen Lippen. Er schloss einen Atemzug lang die Augen – dann ging er steif um die Toten.
Jeden sah er genau an. Er blickte in starre Augen, in die Gesichter von Kindern – und er konnte sich seiner Gefühle nicht wehren. Die Hand krampfte sich um die Winchester. Die Stiefel rieben durch den Sand. Plötzlich vernahm er leises Schluchzen. Sofort stand er still und blickte über die Toten hinweg.
Hufspuren führten durch das Todeslager, Squaws und Männer lagen halbnackt im zerstampften Gras. Der Tod zeigte seine Fratze. Es war still, doch es war kein Frieden.
Und dort drüben im Gras, wo der Boden aufgewühlt war, wo ein verzweifeltes Kampf stattgefunden und der Apache sich mit letzter Kraft gewehrt hatte – dort lag ein abgerissenes Sporenrad.
Cheyenne ging hin und hob es auf.
Es war aus Stahl, ganz billig, verschrammt und verdreckt. Und wo es gelegen hatte, da waren auch die Hände des Apachen …
Wieder schluchzte es irgendwo. Der Mann schob das Sporenrad in die Tasche der langen Lederjacke und ging umher. Vor dem zerfetzten Zelt blieb er stehen. Kugeln hatte die Zeltplane durchlöchert. Er packte die Plane und riss sie zur Seite, blickte in das Zelt und sah einen Jungen. Der wohl vierzehnjährige Indianerjunge lag unter buntbestickten Decken, hatte sich sammengekrümmt und stierte Cheyenne voller Todesangst an. Sein Gesicht war grau wie Asche. Aus dem Oberarm sickerte Blut. Die Decken waren blutverschmiert … Langsam legte Cheyenne die Winchester zu Boden. Tief beugte er sich hinunter und kroch ins Zelt.
Der Junge wich zurück und zitterte am ganzen Körper. Das Grauen war in seinem Gesicht.
»Ich bring dich weg von hier«, murmelte Cheyenne ernst, und in seinen blauen Augen, die sonst immer so hart und kalt blickten, wurde es seltsam weich. »Du lebst – und du sollst noch viele Jahre leben. Ich will, dass du alt wirst und dass du eines Tages erzählst, was hier geschehen ist, was Weiße getan haben …«
Er streckte die Hand aus, hielt sie dem Jungen hin und wartete.
»Ich gehör nicht zu diesen Schweinehunden, Junge. Kannst du mich verstehen?«
Der Boy lauschte dem Tonfall dieser ruhigen dunklen Stimme. Tränen waren auf seinem Gesicht. Er krümmte sich wie ein getretener Wurm zusammen und weinte.
Da sprach Cheyenne in spanischer Sprache zu ihm, und der Junge horchte auf.
»Mein Pferd steht draußen. Wir beide reiten aus diesem Tal. Ich muss mir deine Wunde ansehen. Du sollst leben.«
Die sehnige Hand war noch da. Der Junge blickte auf sie – und auf einmal kroch er zu Cheyenne. Und der Mann ging hinaus und wartete. Der Junge kam aus dem Zelt und starrte auf die Toten.
»Komm«, murmelte Cheyenne. Tränen rannen über das graue Gesicht des Jungen. Er ging zu einer Squaw und küsste sie, und dann küsste er einen der Apachen. Schluchzend krümmte er sich zusammen.
Cheyenne legte die Hand auf den Rücken des jungen Apachen.
»Die Sonne geht bald unter. Wir müssen weg.«
Er wollte den Jungen aus dem Tal haben, denn er sollte nicht länger die Toten sehen. Der Anblick der Toten war zu schlimm. Er könnte sich zu tief in das Erinnerungsvermögen dieses Jungen eingraben und ihn nie wieder loslassen. Dann wäre der Hass zeit seines Lebens in ihm.
Sanft zog Cheyenne ihn hoch und geleitete ihn zum Pferd. Er wollte einmal ausweichen, doch Cheyenne ließ es nicht zu. Er drückte den Jungen hoch und aufs Pferd, und dann stieg er selber aufs Pferd.
Langsam ritt er mit dem jungen Apachen aus dem Tal.
Weitab zwischen den Hügeln verhielt er, rutschte vom Pferd und zog den Jungen herunter. Der Apache ließ ihn nicht aus den Augen, als er Holz für das Feuer sammelte und es aufschichtete. Wenig später leckten die Flammen um das Holz. Die Sonne sank hinter den fernen Bergen im Westen. Cheyenne holte Verbandszeug aus der Satteltasche und kniete sich vor dem Apachen hin.
»Du wirst sehr tapfer sein, Junge. Wenn ich die Wunde nicht ausglühe, wird der Arm anschwellen, du wirst Fieber bekommen und sterben.«
Der Boy sah ihn mit dunklen geröteten Augen an. Er spürte wohl, dass dieser große und hagere Mann ihm helfen wollte, und er versuchte nicht, zu fliehen. Er zuckte nur zusammen, als Cheyenne seinen Arm umfasste.
Die Kugel hatte den Oberarm aufgerissen. Der ganze Unterarm war blutverkrustet. Dreck war in der Wunde.
Cheyenne holte die Blechflasche und goss Wasser auf die Wunde. Mit einem Stück saubernen Verbandes säuberte er die Wunde. Dann zog er das Messer und hielt es in die Flammen. Langsam begann die Klinge zu glühen.
Mit flackernden Augen stierte der Apache auf das Messer. Immer wieder schluckte er würgend. Schweiß rann übers Gesicht.
»Es ist ein schlimmer Schmerz«, sagte Cheyenne leise, »aber es muss sein. Bist du bereit, Junge?«
»Si.«
Zum ersten Mal hatte der Junge gesprochen. Er hockte am Feuer und sah Cheyenne an. Langsam rückte Cheyenne an ihn heran und hielt das glühende Messer bereit.
»Schrei, wenn du willst.«
Dann drückte er die glühende Klinge auf die Armwunde. Der Junge schrie gellend auf und wurde bewusstlos. Als er zu sich kam, war der Arm verbunden. Der Schmerz ließ ihn zittern. Er sackte zurück und weinte stumm. Der Mund zuckte heftig, er starrte in den Himmel der unzähligen Sterne und atmete flach.
»Du hast es bald überstanden, Amigo«, sagte Cheyenne und lächelte ernst. »Nur keine Angst.«
Der Apache sah in das raue und faltige Gesicht des weißen Mannes, Cheyenne war wie die Wildnis dieses Landes. Er roch nicht nach Zivilisation, nicht nach Saloons. Vielleicht war es das, was den Jungen beruhigte und was ihm die Angst vor Cheyenne nahm.
»Du bist ein guter Weißer«, flüsterte er.
»Ich bin nur so lange gut, wie mir niemand auf die Füße tritt«, erwiderte Cheyenne. Sein Haar schimmerte im Sternenlicht silbern. Er stocherte im Feuer herum und kochte in der Pfanne Kaffee.
»Wir waren unterwegs zum Aravaipa Creek«, sagte der junge Apache. »Wir wollten zu Eskiminzin.«
»Das ist ein großer weiser Häuptling«, nickte Cheyenne und kippte den heißen Kaffee in den Becher. »Ein weiter Weg bis dorthin. Du gehörst nicht zu Eskiminzins Stamm.«
»Ich bin ein Apache«, flüsterte der Apache und starrte in die Flamme. »Wir haben seit langer Zeit nicht mehr gegen die Weißen gekämpft. Wir hatten Frieden mit den Blauröcken.«
Cheyenne antwortete nicht, schlürfte den Kaffee und blickte gedankenversunken über das Feuer hinweg. Schweigend reichte er dem Jungen schließlich den Becher, richtete sich auf und holte die Decke.
Bald lagen der Mann und der Junge am Feuer. Lange waren sie wach und sahen in den Himmel. Keiner sprach ein Wort. Die Flammen des Feuers sanken zusammen …
*
Blutrot flammte der Himmel im Westen, als gellendes Geschrei durch die kleine Ortschaft San Xavier schallte. Auf keuchenden Pferden tauchten ein Dutzend Apachen aus der Dämmerung auf und jagten die Straße hinauf.
Brüllend stürzten Männer auf die Straße und feuerten auf die Reiter. Staub schlug ihnen entgegen und nahm ihnen die Sicht. Kugeln zertrümmerten die Fensterscheiben. Glassplitter regneten auf die Gehsteige. Am Stadtrand brach das Holz des Corrals. In fieberhafter Eile trieben die Apachen Pferde und Rinder aus dem Corral. Schon tobte die Herde davon, und die Apachen ritten hinterher und trieben Pferde und Rinder davon. Schüsse peitschten durch die Dämmerung, Mündungsflammen stachen hervor.
Zuckend ging mitten auf der Straße ein Mann in die Knie. Stöhnend presste er die Hand auf die Brust. Das Gewehr entfiel ihm. Er kniete im Staub und stierte den Rindern, Pferden und Apachen nach, die nur schemenhaft im wallenden Staub zu erkennen waren.
Noch fielen Schüsse, doch der unheimliche Spuk war fast schon vorbei. Das gellende Geschrei verlor sich hinter den Felsklippen. Irgendjemand läutete die Glocke im Turm so heftig, als wäre Feuer ausgebrochen.
Männer rannten zu ihren Pferden.
Frauen schrien nach ihren Kindern und eilten über die Straße. Zwei Männer hasteten zu dem knienden Mann.
»Ich kann – schon gehen«, krächzte der Mann und nahm die blutverschmierte Hand von der Brust. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er in die graue Wand der Dämmerung hinein.
»Apachen«, flüsterte er, »elende, verfluchte Apachen! Der Teufel soll sie holen! Wir werden sie alle abknallen wie räudige Hunde!«
Mühsam richtete er sich auf, lehnte jede Hilfe ab und torkelte zum Haus des Arztes.
Reiter jagten aus der Stadt, folgten den Apachen. Allmählich begannen die Sterne kalt zu strahlen. Der Staub hatte sich gelegt, und zu kleinen Gruppen standen die Einwohner zusammen und sprachen erregt miteinander.
Das war der 10. April des Jahres 1871.
Schon drei Tage später kam es zum erneuten Überfall der Apachen. Diesmal war es nicht San Xavier, diesmal geschah es nahe San Pedro, ostwärts von Tuscon.
Vier Weiße starben …
*
Scheu und ängstlich kauerte der junge Apache auf Cheyennes Pferd und blickte mit flackernden Augen zur Stadt hinüber.
»Das ist Tucson«, murmelte Cheyenne.
»Tucson ist schlecht für Mangas«, flüsterte der Junge. »Mangas darf nicht nach Tucson.«
Ernst sah Cheyenne über Mangas’ Schulter hinweg und nach den Lichtern und Häusern hinüber. Der Wind brachte die Stimmen herüber, das Gebrüll angetrunkener Männer und das schrille Geschrei von Frauen.
»Ich muss in diese Stadt, Amigo«, sagte er leise. »Ich brauche Proviant, Tabak und Munition.«
»Ich bleibe hier«, raunte der junge Apache. »Die Stadt der Weißen ist böse. Die Weißen hassen die Apachen.«
Cheyenne schwieg. Langsam ritt er weiter, bis er das erste Haus erreicht hatte. Hier saß er ab. Der Apache glitt vom Pferd und verharrte im Schatten eines alten Stalls.
Sie waren viele Meilen geritten und müde. Cheyenne wollte nicht lange in Tucson bleiben. Er war ein Mann der Wildnis, er schlief nachts immer unter freiem Himmel Nachdenklich sah er in das Gesicht des Jungen.
»Ich lass das Pferd hier«, sagte er mit schleppender Stimme. »Du wirst es bewachen, Mangas. Ich vertraue dir.«
»Du wirst dein Pferd wiedersehen«, versprach Mangas ernst. »Bueno, Amigo.«
Cheyenne zog die Winchester aus dem Scabbard und wandte sich ab. Er sah nicht mehr zurück, als er langsam zur Straße ging. Vor ihm waren die Häuser, die erleuchteten Saloons und Bars, die angeleinten Pferde und die Einwohner, die miteinander heftig diskutierten.
Der Staub des langen Rittes fiel von Cheyennes Schultern. Langsam schritt er über den Gehsteig und hielt lässig die Winchester in der sehnigen Rechten. Unter dem tief in die Stirn gezogenen Stetson schimmerten seine Augen. Er beobachtete alles kühl und abschätzend. Immer wieder fing er Wortfetzen auf. Die Leute redeten über die letzten Überfälle der Apachen. Aus all ihren Worten sprach unseliger Hass.
Unbeeindruckt ging Cheyenne vorbei und betrat den Store. Der Mann hinter dem Tresen sah ihn fragend an.
Ruhig bestellte er. Während er wartete, hörte er zwei Frauen, die abseits zwischen den Ständern mit Kleidern standen.
»Mr Oury hat ja recht«, sagte die eine erbittert. »Man sollte alle Apachen in die Wüste jagen. Nur ein toter Apache ist ein friedlicher Apache. Das ganze Gerede hilft uns nicht weiter. Wir müssen endlich was tun! Wenn das so weitergeht, werden die Apachen auch Tucson überfallen und unsere Kinder niedermetzeln!«
»Keine Nacht kann ich schlafen«, klagte die andere. »Ich muss immer wieder von den Apachen träumen. Vor Angst wach ich dann auf. Es ist schrecklich. Diese Unmenschen sollte man töten. Erst dann haben wir wirklichen Frieden hier.«
Dunkel war es in Cheyennes Augen. Kalter Zorn war in ihm. Wenn schon Frauen so sprachen, dann war es schlimm. Der Hass erstickte jeden guten Gedanken. Doch er sagte kein Wort. Er war nicht der Mann, der sich mit hysterischen Frauen unterhielt.
Schweigend nahm er die Sachen vom Tresen, zahlte und verließ grußlos den Store.
Wieder durchquerte er Tucson. Vor einem Saloon hatten sich viele Männer eingefunden. Sie alle hörten einem bärtigen und knochigen Mann zu, der vor ihnen die Fäuste ballte und mit böser Stimme sagte: »Wir müssen die Apachen ausrotten! Ihr alle wisst, dass ich verdammt lange Indianerhaut gerochen habe. Mir können diese Hundesöhne nichts vormachen, ich weiß, wie hinterlistig sie sind. Der Atem der Apachen vergiftet den Wind! Sie müssen sterben!«
»Du findest genug Leute, Oury, die mit dir reiten«, rief ein Mann aus der Menge. »Du brauchst nur den Tag zu bestimmen, wann es losgehen soll!«
William S. Oury winkte ab.
»Es sind nicht genug! Wir müssen viele sein, damit wir die Apachen umzingeln können! Keiner dieser Hundesöhne darf uns entwischen. Es muss ein einziger großer Schlag sein. Aber wartet, mir wird schon noch was einfallen.«
Cheyenne ging weiter, vorbei an den Goldgräbern, Einwohnern, Spielern. Er sah viele Frauen, die Ourys Worten andächtig und begeistert lauschten. Angewidert verzog er das Gesicht. Hier wurde Hass gesät. Dass es zu einem der schlimmsten Massaker der Geschichte kommen sollte, ahnte er an diesem späten Abend nicht…
Mangas, der Pinal-Apache, wartete neben Cheyennes Pferd. Er hätte zu Pferde fliehen können – doch er war geblieben.
»Ich höre viele schlimme Worte«, sagte er leise und bedrückt. »Die Weißen rufen wieder zum Krieg gegen die Apachen auf. Sie brechen ihr Wort. Mangas ist noch kein Krieger, sonst würde er diesen Weißen die Kehle durchschneiden für ihren Verrat!«
»Hör nicht hin, Junge«, murmelte Cheyenne und verstaute die Sachen in der Satteltasche. »Hass macht blind.«
Mit starren Augen blickte der Apache die Straße hinauf. In der Lichtbahn des Saloons sah er all diese Männer, die nach Rache und Totschlag schrien, die jeden Apachen umbringen wollten.