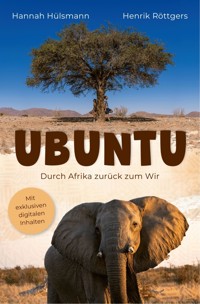
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ihre langjährige Beziehung steht am Scheideweg, als sich Hannah und Henrik eines Sommers entschließen, alle Zelte in Deutschland abzubrechen und stattdessen auf unbestimmte Zeit mit ihren Rucksäcken durch Afrika zu reisen. Die beiden wandern sich in den südafrikanischen Drakensbergen in eine lebensgefährliche Situation, helfen in einem sozialen Projekt für Kinder in einem Township in Namibia, campen zwischen wilden Löwen und Elefanten in Botswana, fahren mit dem Kanu über den großen Sambesi, bleiben mit dem Bus im Nirgendwo in Kenia liegen und leben für einige Tage in einem Dorf der Massai. Was Hannah und Henrik dabei von Mensch und Natur lernen? Sowohl das Leben im Mikrokosmos einer Partnerschaft als auch das Lösen wachsender globaler Herausforderungen ist nur mit grenzenlosem Gemeinschaftssinn möglich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannah Hülsmann & Henrik Röttgers
UbuntuDurch Afrika zurück zum Wir
Die Autoren
Hannah Hülsmann (1995) studierte International Sports Management, bevor sie ihre Leidenschaft im Schreiben und Fotografieren fand. Seit einigen Jahren ist sie als Autorin, Reisebloggerin, Fotografin und Speakerin tätig. In ihrem ersten Buch Pachamama – Reise ins Unbekannte (2021) erzählt sie ihre persönliche Geschichte als Volunteer in Peru – der Reise, auf welcher sie Henrik kennengelernt hat.
Henrik Röttgers (1992) arbeitete nach seinem Master an der Deutschen Sporthochschule Köln zunächst als Sportwissenschaftler, ehe sein Drang nach Reisen und Abenteuer ihm ein gänzlich anderes Leben bescherte. Heute ist er freier Autor, Reiseblogger, Content Creator, Speaker und führt mit Hannah eine kleine Reise-Content-Agentur.
Auf ihrem Reiseblog Generation World und dem gleichnamigen Pod-cast berichten die beiden über ihre weltweiten Abenteuer.Ohne Enddatum reisen sie derzeit mit ihren Rucksäcken um die Welt – stets auf der Suche nach Geschichten aus fremden Ländern und Kulturen.
Website: www.generation-world.de
Instagram: generation_world_
Hannah Hülsmann & Henrik Röttgers
UBUNTU
Durch Afrika zurück zum Wir
1. Auflage
Copyright © 2024 Hannah Hülsmann und Henrik Röttgers
Lektorat/Korrektorat: Sina Blanke
Covergestaltung/Kartografie: Jessica ZennerFotos: Hannah Hülsmann
Verlag: Generation World GbR,
Stiftsstraße 20, 53225 Bonn
www.generation-world.de
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH
Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Die Verwendung und Vervielfältigung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne die Zustimmung der Autoren urheberrechtswidrig und strafbar.
Dieses Buch ist interaktiv und multimedial!
Tausende Fotos und Videos, Tausende Erinnerungen an unsere prägende Afrika-Reise liegen auf unserer Festplatte. Die eindrucksvollsten, atemberaubendsten, wunderschönsten und auch ehrlichsten davon möchten wir mit dir teilen. Deshalb haben wir für dich eine virtuelle Reise kreiert, die unsere Geschichte schmückt und dich intensiv eintauchen lässt. Diese zum Buch passenden digitalen Galerien sind exklusiv und in dieser Form nicht über unsere anderen Kanäle abrufbar.
SO GEHT‘S:
Am Ende jedes Landes wirst du auf QR-Codes stoßen. Wenn du diese mit deinem Smartphone scannst, gelangst du direkt zu einer digitalen Galerie, die Impressionen passend zu den vergangenen Kapiteln für dich bereithält. Wir empfehlen dir, diese direkt an der vorgegebenen Stelle anzusehen, damit du die Geschichten Revue passieren lassen kannst und damit deine Lesereise durch Afrika noch intensiver und lebhafter wird.
UNSER FOTOSHOP:
Du möchtest dir Afrika nach Hause holen? Dann schau doch mal in unserem Foto-Shop vorbei! Dort kannst du dir einige unserer Werke als Wandbild, als Postkarte oder in anderen Varianten bestellen.
Botschaft an dich
Wenn alles um uns herum karg und leblos aussieht. Wenn es tausend verschiedene Wege gibt und doch jeder einzelne davon ausweglos erscheint. Wenn jeder Ruf in der stillen Welt der Wüste verhallt und nichts bleibt außer einem ungehörten Echo. Wenn wir jeden Sinn krampfhaft hinterfragen und drohen bis zum Ende unseres Daseins in aller Sturheit gegen uns selbst zu kämpfen. In ebendiesen Momenten scheint die Erde uns ein Zeichen zu schenken. Aus dem tiefen Inneren der Natur, auf deren verborgenen und zugleich kraftvollen Wurzeln wir wandeln und unser Leben vollbringen. Das uns als Menschen auf magische Weise zusammenbringt. Das uns Schutz gewährt, wenn alles über uns zusammenzubrechen scheint. Denn selbst wenn uns nur eines verbindet, ist es doch etwas Essenzielles: Am Ende sind wir alle eins.
Liebe Leserin, lieber Leser,
auf diesen Seiten, die gerade vor dir liegen, erzählen wir unsere persönliche Geschichte einer für uns sehr besonderen Reise. Nun, einen scheinbar mikroskopisch kleinen Teil unserer ganzen Lebensreise, der für seine zeitliche und räumliche Winzigkeit doch mit einer eindringlichen Botschaft daherkommt. Uns liegt es am Herzen, dass die kommenden Zeilen bei deiner Lesereise dein ständiger Begleiter sind. Wir sind nur zwei von vielen (nicht mehr ganz so) jungen Menschen, die die Sehnsucht verspüren, die Welt zu bereisen und versuchen, das Beste aus ihrer begrenzten Zeit zu machen. Sowohl als Paar als auch als Individuen werden wir dauernd von Fragen und Herausforderungen heimgesucht, die auch du vielleicht kennst: Was sind meine Träume? Was kann ich eigentlich? Habe ich den richtigen Job? Den richtigen Partner? Werde ich genug Geld haben? Bin ich überhaupt glücklich? Will ich einmal Kinder haben? Bin ich im Inneren nicht selbst noch eins? Wie können wir Kriege beenden, den Klimawandel stoppen und die Welt retten? Und können wir unsere Welt, wie wir sie erleben, überhaupt noch genießen?
Jede Begegnung, jedes Erlebnis, jede Erkenntnis, jedes Abenteuer unserer siebenmonatigen Reise durch das südliche und östliche Afrika beruht auf wahren Begebenheiten, die wir aus unseren persönlichen Perspektiven ungefiltert – und vielleicht an der ein oder anderen Stelle auch unreflektiert oder in klischeehaftem Unwissen – erzählen. Wir teilen diese sehr private Geschichte mit dir in absoluter Ehrlichkeit, im Vertrauen und in der Hoffnung, dass sie dich nicht nur unterhält und dich zum Lächeln oder zum Staunen bringt über zwei Durchschnittsdeutsche, die sich mit ihren Rucksäcken als selbsternannte Autoren und Fotografen ins Abenteuer Afrika stürzen. Sondern dass sie dich darüber hinaus dazu anregt, weiter zu schauen als auf das eigene Leben. Dass sie dazu anregt, die Perspektive zu wechseln.
Wir sind dir unendlich dankbar, dass du uns und unserem ersten gemeinsamen Werk deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst. Was dieses Endergebnis in Form eines Buches für uns bedeutet, wirst du schon bald beim Lesen verstehen. Dass wir zwei Sturköpfe das hier tatsächlich gemeinsam zustande gebracht haben, ohne uns an die Gurgel zu gehen, erforderte eine große Portion Verständnis, eine Menge Kompromissbereitschaft und eine doppelte Prise Geduld. Zutaten der Liebe, die wir erst in Afrika gefunden haben.
Reisen, wie wir es gewöhnlich verstehen, ist ein Privileg, das bei Weitem nicht jedem Menschen zuteil ist. Mit diesem Privileg Geld verdienen und sich zeitgleich einen Traum erfüllen zu können, ist im Grunde ein Beweis der Ungleichheit auf unserer Welt. Dies wurde uns auf dem afrikanischen Kontinent beinahe tagtäglich vor Augen geführt. Gleichzeitig führten einige Konversationen mit Menschen, die wir vor Ort getroffen haben, dazu, dass nicht nur wir unsere tief verwurzelten Vorurteile hinterfragt haben – sondern auch umgekehrt. Das ist Reisen für uns. Also, bist du bereit für ein Abenteuer, welches dich von Südafrika über Uganda bis zum Wir bringt? Bist du bereit für Ubuntu?
Hannah & Henrik
1 | Schrei nach Freiheit
Hannah | Es war August. Ich saß allein in einer Wohnung, deren Mietvertrag ich zwar mitunterzeichnet hatte, aber die ich nicht mein Zuhause nannte. Die Jalousien bis auf wenige Zentimeter heruntergefahren, um die drückende Hitze dieses Hochsommertages abzuschotten. Mich abzuschotten von dieser toxischen Umgebung, die meinen Lebens-und Arbeitsmittelpunkt bildete. Oder war es eher eine Existenz als ein Leben?
Tagein, tagaus verbrachte ich in diesen vier Wänden tippend oder labernd vor dem Bildschirm, während mein Mitbewohner, der gleichzeitig mein Freund und einziger sozialer Kontakt in dieser mir fremden Kleinstadt war, in seiner Welt von der Arbeit zum Fußballtraining und von dort aus ins Bett ging. Warum ich hier war und was mich hierhergebracht hatte? Ich fürchte, ich hatte den Grund verloren.
Ich lief nervös in der Wohnung auf und ab, wie ein Vogel im Käfig, der nach Freiheit ächzt. Ein Vogel, der selbst auf dem Schlüssel des Käfigschlosses sitzt. Denn ich könnte ja …
Der Gedanke an das Ende unserer Beziehung riss mich nach unten auf den Boden, weinend und schreiend saß ich gekrümmt dort wie ein Häufchen Elend. Tränen des Schmerzes, Tränen der Erleichterung.
Wo ist diese ach so einzigartige Beziehung hin? Wo ist dieser Mann hin, den ich vor acht Jahren bei meinem Abenteuer in Peru kennengelernt habe? Wo sind unsere Gemeinsamkeiten hin?
Mir wurde schlagartig bewusst, wie stark uns die Zeit in die Eigensinnigkeit getrieben und in unseren Grundzügen verändert hatte. Damals in Peru hatten wir uns als Volunteers engagiert. Für andere. Nun gut, vielleicht auch aus einem gewissen Selbstzweck heraus. Aber mich ließ der Eindruck nicht los, dass wir damals mit zwanzig Jahren mehr Weitsicht gehabt hatten als jetzt.
Ich starrte mit leerem Blick in den dunklen Raum. Aus dem kleinen Zwischenraum der Jalousie fiel ein Lichtstrahl auf unsere Fotos, die eingerahmt auf dem Regal standen. Wir nahmen unsere vermeintlich besondere gemeinsame Geschichte als Ausrede für unsere problematische Beziehung. Als Garantie, auf ewig gemeinsam glücklich zu sein. Doch was nutzt es, ständig zu sagen, wie schicksalsträchtig wir zusammengekommen sind, wenn all das in der Gegenwart keinen Sinn mehr ergibt?
Es hatte alles keinen Sinn mehr! Ich fühlte mich so gelähmt, als könnte mir jemand ein Messer ins Bein rammen und ich würde es nicht spüren.
Mit meinen gesprochenen Worten wäre Krieg ausgebrochen. Wie jedes Mal, wenn ich am Abend mal wieder zu ehrlich war und meinem Frust zu viel Raum ließ. Wie jedes Mal, wenn wir mit unterschiedlichen Meinungen und Bedürfnissen direkt aufeinandertrafen. Doch ich kenne keine Person, die schlechter ihre Gefühle verstecken kann, als ich. Die Wut, der Frust, die Verzweiflung, die Einsamkeit, die in dieser Bude steckten, brachten die Fenster bald zum Zerbersten. Ich goss mir ein Glas Weißwein ein – weitaus mehr als das, was die Eichung als Glas bezeichnet – und ließ meine Emotionen fließen. In einer Form, die mir wohl besser liegt, als sprechen. Ich schrieb:
Damit es nicht wieder zu einer Konfrontation kommt und du den Freiraum hast, zu reagieren.
Aus Gemeinsam werde Ich – Vom Weg zur Einzelkämpferin:
»Du musst aufpassen, dass du nicht bald komplett allein bist.« Ein Satz, mit dem du bedenkenlos jede unserer Diskussionen im Keim erstickst und nicht weißt, was du damit auslöst. Aus vielem, was gemeinsam begonnen hat, ist mittlerweile ein einseitiger, unausgeglichener, selbstverständlicher Kampf von mir geworden. Dinge, an denen wir früher einmal als Team gearbeitet haben, entziehen sich scheinbar deinem Interesse. Du ziehst dich raus, weil du deinen eigenen Dingen mehr Priorität beimisst als unseren gemeinsamen. Seien es Pflichten, seien es Träume.
Die gemeinsame Arbeit im Haushalt stößt nur noch auf Missmut bei dir, während du nicht realisierst, dass du immer weniger zu dieser Teamarbeit zusteuern musst. Gemeinsames Saubermachen der Wohnung kostet mich Überredensarbeit, Feingefühl, Angst vor Ablehnung, weil du keine Priorität darin siehst. Ob es eine für mich ist, spielt aber keine Rolle. Ich weiß, dass du bei diesem banalsten aller Beispiele jetzt die Augen rollst, aber dieses ausgelutschte Thema ist so exemplarisch. Wir wohnen gemeinsam hier und doch wohne ich allein, an einem Ort, der für mich Einsamkeit bedeutet. Das meine ich nicht nur physisch, sondern vor allem emotional.
Ein Team funktioniert nur, wenn alle Fugen, alle Schrauben vorhanden sind, die dem Konstrukt Halt, Stabilität, Balance geben. Ich kümmere mich um mich und um unser Team – tagein, tagaus. Du kümmerst dich aktuell nur um dich, deine Interessen und Prioritäten. Ich bin es leid, dich mehrfach zu bitten, etwas für uns beizutragen. Auf die Idee, selbst etwas zu tun, aktiv zu werden, kreativ zu werden, kommst du nicht mehr. Ich weiß, dass du zeitlich und nervlich sehr eingespannt bist. Aber ich habe auch einen Job. Nein, sogar mehrere. Trotzdem gestalte ich meinen ganzen Alltag so, dass all deine Wünsche unter einen Hut zu bringen sind. Nicht, weil du mich bittest, sondern, weil du es mir wert bist. Weil ich möchte, dass unser Team funktioniert. Aber es reicht nicht mehr, wenn ich dir den Rücken freihalte. Meine Sorgen, Zweifel, Probleme? Mit denen musst und willst du dich nicht beschäftigen, denn es ist ja selbstverständlich, dass ich kämpfe und funktioniere. Du flüchtest in ruhigere Gewässer, weil es ja sonst ungemütlich werden könnte. Du müsstest vielleicht Verantwortung übernehmen. In dem Moment flüchtest du vor uns und damit auch vor mir – als Mensch.
Ist es am Ende nicht logisch, dass ich zur Einzelkämpferin geworden bin? Dass ich Mauern baue, um mein wegbrechendes Fundament zu schützen, weil ich keine Kraft mehr habe, für unser Team zu kämpfen? In einem Team braucht jeder Einzelne seinen Freiraum. Sobald dieser Freiraum aber auf Kosten des anderen genutzt wird, geht das Team kaputt. Alles im Leben basiert auf Entscheidungen. Entscheidungen haben Konsequenzen und erfordern Selbstverantwortung. Es war meine Entscheidung, mir mein Leben so aufzubauen, wie es gerade ist und ich trage diese Entscheidung mit allen Konsequenzen, positiven wie negativen, wie du vielleicht merkst. Deinem Hobby Fußball in dem Maße und in dieser Lebensphase nachzugehen, ist DEINE Entscheidung. Es ist eine Ausrede, zu sagen, dich hätte jemand anders gedrängt. Fang endlich an, Verantwortung für dich und uns zu übernehmen und suche die Ursache nicht immer in anderen!
Ein Team funktioniert nur mit gemeinsamen Zielen, Visionen und Träumen. Wenn du tief in deinem Herzen spürst, dass wir kein gemeinsames Ziel verfolgen, keinen gemeinsamen Traum haben, ist das okay. Es ist eine Entscheidung. Jeder von uns hat die Entscheidungsgewalt über sein Leben. Aber es hat auch etwas mit Verantwortung zu tun, das zu erkennen, damit bewusst umzugehen. Aus Respekt vor dem anderen. Haben wir ein gemeinsames Ziel? Sind wir noch ein Team? Ich bin am Ende meiner Kräfte und hisse die weiße Flagge. Mein Kampf ist zu Ende. Meiner? Oder unserer?
Ich füllte mir den Rest des kalten Weißweins in eine Thermoskanne, ergänzte meinen Brief um ein »P.S. Ich bin am Entenfang«, ließ die Tür sanft ins Schloss fallen, damit mich niemand von den miesepetrigen Nachbarn, die mich nicht ausstehen konnten, in diesem Zustand sah. Dann schwang mich aufs Rad, stoppte erst neben einer Parkbank am einzigen friedsamen Ort, der mir in näherer Umgebung einfiel, und stellte mir die Frage, ob ich den Moment, wenn Henrik mich hier finden würde, wirklich ehrlich herbeisehnte. Oder ob ich es insgeheim vielleicht nicht sogar von ihm erwartete.
2 | Hallo Wach
Henrik | Puh. Das Blatt entglitt meinen Fingern und ich sackte im Stuhl zusammen. Ich atmete tief durch, meine Gedanken ratterten. Soweit hatte ich es also kommen lassen. Mich verloren in den Pflichten meiner immer stärker an mir zehrenden Arbeit und in der Wiederaufnahme meines alten Hobbys Fußball, welches ich auf Biegen und Brechen in den ohnehin schon minutiös durchgetakteten Alltag presste, um irgendwie zwischendurch mal den Kopf abschalten zu können. Zuhause zu zweit war das zuletzt kaum noch möglich gewesen. So viel kalte Abgrenzung, so wenig Liebe und Fürsorglichkeit. Zuhause? Ich schaute mich in der Wohnung um, die wir erst vor gut einem Jahr bezogen hatten. Neu und schick war sie, der Ort etwas wahllos, aber doch gut gelegen zwischen meinem Elternhaus und meiner Arbeit. Gut gelegen wohl nur für mich …
War es das jetzt? Gehen so über sieben Jahre Beziehung zu Ende? Müssen wir uns ehrlich eingestehen, dass wir uns »auseinandergelebt« haben? Das hört man doch sonst immer nur von anderen. Aber wir? Wut und Trotz kochten in mir hoch und der Drang, mich zu rechtfertigen. Doch niemand war da, ich saß hier ganz allein.
»Wirklich kluger Schachzug«, gestand ich ihr zu. Gezwungen erst einmal umso intensiver zu reflektieren, wusste ich gleich, auch ich würde so einen Brief schreiben. Ganz in Ruhe, ohne den Sturm, ohne das Feuer des ausartenden Konflikts. Aber jetzt musste ich erstmal nach Hannah schauen.
Ich schlüpfte wieder in meine Sneaker, zog die Tür zu und machte mich voller wirrer Gedanken über das Bevorstehende auf den Weg. Die kurze Strecke durch die Straßen zum Park beträgt keine zwei Kilometer. Zwei Kilometer, die wir sonst oft in flottem Tempo gemeinsam gelaufen waren. Gemeinsam – oder doch nur nebeneinanderher? Nun kamen mir die zwei Kilometer endlos vor. Schließlich erblickte ich Hannah auf einer Parkbank sitzend. Traurig. Allein. Und plötzlich war da überhaupt keine Wut mehr, sondern vielmehr tiefe Trauer, die mich übermannte. Fast schon vorsichtig setzte ich mich neben sie. Stille. Da war kein Geschrei, keine Vorwürfe, keine Konfrontation. Gemeinsam saßen wir einfach nur da, umarmten uns und ließen den Tränen freien Lauf. Vielleicht war es das Erste seit Wochen, das wir wirklich gemeinsam machten.
Einige Tage später nahm ich mir die notwendige Zeit, setzte mich an den Tisch, sammelte all meine Gedanken und schrieb:
»Du musst aufpassen, dass du nicht bald komplett allein bist.«
Ja, der Satz ist gefallen. Und ja, ich bereue ihn, aber es steckt auch Wahrheit darin, wenn wir nicht aufpassen und beide so weitermachen.
Seit Wochen versuche ich zu dir vorzustoßen, nachzubohren, was da ist und wie es dazu kam. Doch du blockst ständig ab. Ich komme einfach nicht mehr durch deinen Schutzwall durch, egal, wie sehr ich mich bemühe. Immer habe ich dich ermutigt, supportet und bestärkt in dem, was du tust. In dem starken Wandel, den du durchgemacht hast. Habe immer respektiert, wie du bist und was du willst. Doch davon preis-oder gar zurückgegeben hast du zuletzt immer weniger … Du sagst, du hältst mir den Rücken frei? Ich sehe es eher andersherum. Du hast dir den Freiraum erarbeitet, den ich nicht habe. Ja, ich stecke in einem Vollzeitjob und bin nicht viel zu Hause. Aber ist das so schlimm? Für viele andere Paare ist das normal und ich möchte auch wirklich nicht den ganzen Tag zu Hause hängen, wie du. Das würde mir nicht guttun, so wie es dir nicht guttut.
Ich habe zuletzt versucht, wieder Anschluss zu finden und ein soziales Umfeld aufzubauen. Etwas, was wir beide die letzten Jahre versäumt haben.
Ja, ich habe wieder mit Fußball angefangen, da ich gefragt wurde, zu helfen. Ich habe mich bewusst entschieden, dem nachzugehen, auch wenn es zeitlich eng ist. So finde ich wenigstens etwas Ablenkung, Zerstreuung, ja, Freiheit, die ich sonst nirgendwo in meinem Alltag habe. Im Gegensatz zu dir bin ich nämlich nie allein. Meine Momente für mich sind beschränkt auf zehn Minuten Autofahrten von A nach B. Ich weiß, das ist das andere Extrem und ich weiß, das ist auch nicht gut. Du hattest die letzten Jahre viel mehr Zeit für dich und hast sie genutzt, um dich kennenzulernen, dich zu entwickeln, dich zu verändern. Das hast du mir vielleicht voraus. Doch ist es zum Guten für uns beide oder primär für deine Selbstverwirklichung? Da bin ich mir unsicher. Daher habe ich versucht, dich zu motivieren, es mir gleichzutun, einen Freundeskreis aufzubauen. Doch du blockst ab, bist nicht offen, machst immer nur dein Ding! Frage dich einmal ehrlich: Möchtest du meine Hilfe, meine Unterstützung überhaupt oder kommst du nicht ohne mich viel besser klar? Denn tagtäglich gibst du mir das Gefühl, dass du mich eigentlich gar nicht brauchst und dass ich derjenige bin, der dich hierhergebracht hat, der dich hier festhält und deine Freiheit einschränkt. Ein stummer Vorwurf, der aber ständig mitschwingt … Du wirfst mir vor, mich zu wenig oder gar nicht im Haushalt zu engagieren, aber schaffst dermaßen hohe Anforderungen, die mit deinem maßlos überzogenen Ordnungswahn zu tun haben. Ich brauche das nicht, um mich wohlzufühlen, engagiere mich selbstverständlich, wie eh und je, aber für dich ist es immer zu wenig oder gar falsch. Mittlerweile lässt du mich gar nicht mehr helfen. Machst es selber, nur um es mir dann vorzuwerfen. Und ich stehe chancenlos und vor allem nutzlos daneben.
Wann hast du mir zuletzt wirklich zugehört? Ich erzähle doch schon gar nicht mehr von der Arbeit, wo ich aktuell übrigens deutlich mehr Wertschätzung erfahre als von dir, weil du mit den Gedanken sowieso ganz woanders bist. Nicht hier. Nicht bei mir!
Dabei fiebere ich schon unserer gemeinsamen nächsten Reise entgegen und damit unbeschwerten Tagen, weil du da einfach so anders bist. So voller Freude, so lebensfroh, so offenherzig bist du in einem anderen Umfeld. Liegt es nur daran? Haben wir uns ein falsches Umfeld geschaffen, in dem wir zusammen einfach nicht mehr funktionieren? In dem keiner so sein kann, wie er eigentlich möchte? Passt das Team nicht mehr zusammen?
Lass es uns bitte herausfinden! Ich möchte definitiv den ungemütlichen, harten Weg gehen und GEMEINSAM daran arbeiten. Herausfinden, was mit uns passiert ist, was wir für Ziele, Visionen und Träume haben. Das ist mir mehr wert als alles andere. Dafür brauchen wir Zeit. Oberste Priorität hat jetzt, dass wir beide uns stark einbringen, dass wir uns die Zeit und die Kraft nehmen, alles zu versuchen. Wir müssen uns wieder neu miteinander auseinandersetzen. Das wird zwangsläufig zu Diskussionen führen, zu großen und kleinen Konflikten.
Ob wir noch ein Team sind? … Eine klare Antwort habe ich noch nicht. Vielleicht müssen wir uns verändern, vielleicht müssen wir das Umfeld verändern, vielleicht müssen wir uns am Ende aber einfach genau dieses Scheitern eingestehen. Dann ist es schlussendlich auch besser für uns beide. So weit ist es aber noch nicht. Wir müssen da jetzt durch. Challenge accepted!
3 | Scherbenhaufen
Hannah | »Hier passt absolut nichts mehr rein, Henry. Nada!«
Seit Stunden hockte ich entweder gekrümmt im Fersensitz auf dem Boden und spielte Tetris in Umzugskartons oder brachte mein Gehirn zum Explodieren, indem ich von ihm verlangte, sich bei jedem Gegenstand unseres mickrigen Hausrates für ein klares Ja oder Nein zu entscheiden. Abgestumpft all dem neutralen Alltagskram gegenüber, furchtbar sentimental bei scheinbar funktionslosen Erinnerungsstücken, die mich die letzten Monate und Jahre gedanklich zu meinen Liebsten und meiner Familie gebracht hatten. Allmählich erschien mir diese Wohnung noch fremder. Noch kälter. Henrik öffnete die große Terrassentür, um frische Luft hineinzulassen. Eine Brise eisiger Januarluft legte sich wie ein Schauer über meinen Rücken.
»Ach komm‘, der Obstteller hier geht noch.«
Henrik streckte mir den viereckigen, grün und rot bemalten Tonteller entgegen, den ich aus meinem Urlaub mit meiner Mama in der Dominikanischen Republik mitgebracht hatte. Sachte legte ich den leicht gebogenen Teller umgedreht auf eine Salatschüssel und schloss den Karton mit Paketband.
Klirrrr. Henrik schaute mir wortlos und mit zusammengepressten Lippen in die Augen.
»Ne, oder?«, schnaufte ich augenrollend mit monotoner Stimme. Während ich mich verzweifelt wieder auf den Boden sinken ließ, im Wissen, dass ich eines der wenigen ideell wertvollen Stücke, von denen wir uns bei der Wohnungsauflösung nicht trennen wollten, zerstört hatte, erwischte ich ein Weinglas auf dem Boden mit meinem Ellenbogen, das daraufhin ebenso zersprang. Für einen Moment herrschte Stille.
»Es ist ein Ende in Sicht. Wir haben es bald geschafft«, brach Henrik das Schweigen. Mir liefen Tränen die Wangen herunter. Meine Kraftreserven waren aufgebraucht. In meinen Gedanken fühlte ich mich zurückversetzt an jenen heißen Sommertag vor nicht mal fünf Monaten, an dem ich mir meinen Frust von der Seele geschrieben hatte. Um mich herum, zwischen Henrik und mir, ein Scherbenhaufen. Ob wir in der Lage sein würden, die Teile wieder zusammenzufügen, fragte ich mich. Wir hatten eine krasse Entscheidung getroffen. So, als ob wir mit diesen Glasscherben hier ein Märchenschloss bauen wollten.
»Hilfst du mir, Henry?«, blickte ich ihn aus meinen feuchten Augen an und dachte an unsere Abmachung vor vier Monaten.
»Okay, wir machen das jetzt!«, hatte Henrik entschlossen gesagt, als er sich eines Samstagsnachmittags im Spätsommer – nur wenige Tage nach unserer emotionalen Eskalation – neben mich auf unsere Pallettencouch im Garten gesetzt hatte, während ich im Begriff gewesen war, konzentriert einen beauftragten Reisebericht in den Laptop zu tippen.
»Hä? Was machen wir?«, fragte ich beinahe beiläufig, wenngleich verwirrt von dieser banalen Aussage.
»Ja … ‘ne Weltreise oder so. Also ich meine, wir lösen hier die Wohnung auf und reisen eben.«
Jetzt hatte er es geschafft, mich aus meinem Schreibfilm zu reißen. Ich legte den Laptop neben mir aufs Polster und blickte ihn stirnrunzelnd an. Das reichte scheinbar als Aufforderung.
»Wir reden doch schon so lange darüber. Und finden immer wieder Ausreden. Dabei wissen wir doch, dass es an uns selbst liegt, was zu verändern und Träume zu erfüllen. Jedes verdammte Mal, wenn wir für zwei oder drei Wochen in der Welt unterwegs sind, fragen wir uns, warum wir nicht länger bleiben. Wir haben uns beim Reisen kennengelernt. Was, wenn nicht das, soll uns auch wieder zusammenbringen? Ey, du verdienst mittlerweile Geld damit, Reisen ist dein Job und unsere Leidenschaft. Und ich kündige.«
»Aber…«
»Nix aber!«
»…du bist gerade Teamleiter geworden.«
»Was habe ich davon, wenn ich im wichtigsten Team keine Rolle spiele? Also, wo sollen wir starten?«
Ich blickte kurz in die Ferne, die keine vierzig Meter weiter von einer Straßenlaterne und einer Hauswand limitiert wurde.
»Afrika!«
Jetzt war es Henrik, der mich verdutzt und stirnrunzelnd von der Seite anschaute.
»Afrika? Echt? Ich hatte jetzt mit was Lateinamerikanischen gerechnet, wenn du schon so aus der Hüfte heraus antwortest.«
»Aber da waren wir schon an so vielen Orten. Ich bin für etwas ganz Neues. Etwas Unbekanntes. Für einen Neuanfang, weißt du? Ich will ja noch andere Länder sehen und nicht immer dahin, wo es für uns vielleicht gemütlich ist. Lass uns da starten!«
Henrik griff meine Hand, zog mich zwischen den Umzugskartons nach oben und wir begannen, die Glasscherben aufzusammeln.
»Ich bin ja wirklich gespannt, wie wir nicht nur 24/7 zusammen verbringen, sondern auch noch zusammen arbeiten sollen. Eins ist klar: Du musst dir ausnahmsweise mal von mir was beibringen lassen«, neckte ich meinen oftmals besserwisserischen und unbelehrbaren Freund und stieß ihn von der Seite in den Bauch. Für einen Moment verhallten die Worte im offenen Wohnzimmer und kamen durch die Leere der Wohnung in leichtem Echo zurück.
»Wird schon.«
Wir grinsten uns kopfschüttelnd an.
4 | Zwischen den Welten
Henrik | 10. März – ein Datum, das seit Monaten fett in unserem Kalender markiert war, sich aber stets weit entfernt angefühlt hatte.
Ein starker Sturm und prasselnder Regen führten zu heftigen Turbulenzen, als das Flugzeug mit knapp einer Stunde Verspätung endlich das Rollfeld des Frankfurter Flughafens gen Südafrika verließ. Was für ein Start! Jetzt waren wir unterwegs, wir hatten es wirklich getan. Genau in diesem Moment flog ich buchstäblich einem ganz neuen Leben entgegen.
So lange hatten wir auf dieses Datum, diesen konkreten Tag, hingearbeitet, ja, hingefiebert. Viel zu lange hatten wir zwischen einem bereits beendeten, alten Leben und einem bald beginnenden, neuen Leben gehangen. Diese seltsamen Wochen wieder Zuhause bei den Eltern ohne geregelten Tagesablauf und mit so vielen neuen Herausforderungen waren für mich mental alles andere als einfach gewesen. Meine Gefühlslage waberte nach wie vor irgendwo zwischen komplett gescheitert und der Realisierung eines ewigen Traums.
Auf dem Programm unserer letzten Monate hatten Punkte gestanden wie Kündigung, Wohnungsauflösung, übergangsweise Arbeitslosigkeit, Gründen eines gemeinsamen Unternehmens, die dazugehörigen Steuerthemen und nicht zuletzt das mühsame Beenden aller Verträge sowie das Abschließen der notwendigen Versicherungen.
Doch dies war nun vorbei, endlich geschafft! Emotionale Tage des Abschieds und unzählige »letzte Male« lagen mit jeder Meile des fortschreitenden Fluges weiter und weiter hinter uns.
»Wir wandern ja nicht aus … Wir kommen ja dieses Jahr noch zurück … Wir sind ja nicht aus der Welt …«
Dies haben wir uns, unseren Freunden, unserer Familie immer wieder gesagt. So lange bis wir, und hoffentlich auch sie, es glaubten. Neben der Skepsis einiger, schlug uns auch viel Verständnis und Unterstützung entgegen. Und wurde nicht nur gesagt, dass es für uns das absolut Richtige sei, sondern auch, dass viele andere diesen Weg gerne selbst gehen würden, aber denken, sie könnten eserst irgendwann in Zukunft umsetzen und es daher beim Träumen belassen. Und so fühlte es sich nicht ausschließlich nach einem Abschied an. Vielleicht sogar vielmehr nach einer Ankunft. Ganz konkret morgen in Kapstadt, unserem neuen Zuhause für mindestens zwei Wochen. Aber vor allem eine Ankunft zurück auf unserem gemeinsamen Weg. Einem Weg, für den wir so viel gearbeitet und gekämpft hatten, um ihn nun auch wirklich zu gehen. Ich reflektierte all die Jahre, die uns an diesen Punkt geführt hatten, an demletztlich alles auf der Kippe gestanden hatte. Die Entscheidung und die letzten Monate der Vorbereitung. All das war überwunden und ich war glücklich darüber, aber auch sehr gespannt, was alles auf uns zukommen würde. Tief im Inneren glaubte ich zu spüren, dass das jetzt genau das Richtige für uns war. Es war unser Weg und wir beide vertrauten ihm.
Aber war ich mir wirklich so sicher? Es hätte so schnell auch anders laufen können. Ich blickte auf Hannah neben mir, deren Augen bereits zugefallen waren, und kämpfte gegen all die Bedenken in meinem Hinterkopf. Verdammt, ich war in meinem Job gerade zum Leiter eines kleinen Instituts für Bewegungsanalyse und Trainingsdiagnostik ernannt worden. Inhaltlich genau mein Ding, sowohl Diagnostik-und Trainingspraxis als auch die Organisationsarbeit drumherum. Dazu ein kleines Team unter mir und endlich auch finanziell entsprechend vergütet. Klar hatte es nervige und stressige Punkte gegeben. Unser ganzes kapitalistisches Gesundheitssystem, in dem an Patienten (oder sollte ich besser sagen Kunden) Diagnostiken, Behandlungen oder gar Operationen durchgeführt werden, nur für den Umsatz, denn die Krankenkasse bezahlt ja schon. Also die private, vielleicht …
Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich so weiter gemacht hätte, ob ich einfach abgestumpft wäre und das Ganze irgendwann nüchtern als Business betrachtet hätte. Aufgrund des unschönen Abgangs würde das Thema nach zweieinhalb größtenteils sehr guten Jahren noch lange in meinem Kopf herumgeistern.
Stopp! Ich riss mich aus der Gedankenspirale und fokussierte mich zurück auf das Hier und Jetzt. Unsere Vergangenheit lag nun hinter uns, die Zukunft irgendwo in den Wolken da draußen versteckt. Ist gut jetzt, Henry, lieber nochmal ablenken, sonst kommst du nie zur Ruhe. Ich griff zum E-Book-Reader, um noch etwas zu lesen und im besten Fall in eine andere Geschichte, eine andere Welt mit anderen Themen einzutauchen. Doch bereits nach ein paar Seiten fielen mir die Augen zu und ich glitt hinüber in einen unruhigen Schlaf, der mir kaum Erholung und Kraft schenkte.
Kraft, die ich in den nächsten Wochen bitter brauchen würde. Gefühlt nur einen kurzen Moment später, stupste mich jemand von rechts an. Mehrmals.
»Früüühstück«, hörte ich Hannahs vertraute Stimme, wie sie den typischen morgendlichen Ruf meines Vaters imitierte, während ich langsam die Augen öffnete und mich orientierte. Ich musste doch ganz gut geschlafen haben. Die Nacht war bereits vorbei, ein neuer Tag hatte begonnen und mein Hunger meldete sich prompt. Wir stärkten uns mit dem überraschend opulenten Frühstück und kurze Zeit später begann auch schon der Landeanflug auf Kapstadt.
»Wow, das ist mal ein Panorama!«
Staunend blickte ich aus dem Fenster. Bei klarstem Sonnenschein kristallisierten sich dort immer mehr Umrisse dieser für uns in diesem Moment bereits ganz besonderen Metropole hinaus. Die Küste, der Lions Head und der berühmte Tafelberg. Hannah kam aus dem Staunen nicht heraus. Auch wenn wir uns natürlich gut vorbereitet hatten, mit so einem optisch schönen und spektakulären Landeanflug hatten wir nicht gerechnet. Doch ein Punkt kam noch dazu, der uns beide für diesen einen Moment andächtig und still werden ließ: Die Realisierung, dass es kein Zurück mehr gab. Dass es hier und jetzt losgehen würde. Nicht nur mit den ersten Schritten auf afrikanischem Boden, sondern mit einem neuen Lebensabschnitt. Einem, der gewagt und unsicher war, der uns jedoch der einzige logische Ausweg aus unserem Dilemma schien …
In diesem Moment wurden wir beide kurz durchgeschüttelt, während die Maschine am Boden aufsetzte und bremste. Als wir stillstanden und das Leuchtsymbol des Anschnallgurtes erlosch, griff Hannah meine Hand und drückte sie fest.
»Auf geht’s!«
Noch am Tag der Ankunft verließen wir unser kleines Apartment mitten im District Six, einem eher untouristischen Viertel mit der vielleicht unrühmlichsten Apartheidgeschichte Südafrikas.
Im Jahr 1966 wurde hier die gesamte schwarze Bevölkerung durch die Deklarierung einer »Whites only area« komplett verbannt. Trotz des Endes der Apartheid in meinem Geburtsjahr 1992 wird der District Six erst heute langsam wieder das bunte, pulsierende Viertel mit Cafés, Galerien und Museen, welches es einst gewesen war.
Um auf Nummer Sicher zu gehen, nahmen wir erstmal ein Taxi, um an die berühmte Waterfront zu kommen. Davor hatten wir uns bei unseren ersten Besorgungen gleich abzocken lassen und bei einem findigen Kioskbesitzer viel zu viel für unsere SIM-Karten bezahlt. Zumindest hatten wir nun bereits funktionierendes Internet.
An uns vorbei rauschte der Verkehr. Echt ordentlich, wenig Durcheinander und kaum Gehupe.
Ehe wir uns versahen, waren wir da. Vor unseren Augen erstreckte sich eine in all seiner Architektur imposant schöne Hafenanlage voller prächtiger Jachten und Segelschiffe zwischen bunten Backsteinbauten.
»Ein bisschen wie in Hamburg, oder?«, fragte ich Hannah und erinnerte sie an ihre deutsche Lieblingsstadt, die wir schon oft gemeinsam besucht hatten.
»Na, ja«, lachte sie auf, »das hier ist schon etwas anderes. Lass uns eine Runde drehen hier am Ufer, bevor wir später dann noch essen gehen, okay?«
Ohne meine Antwort abzuwarten, machte sie sich schnellen Schrittes auf den Weg und mir blieb nichts anderes übrig als zu folgen.
Als wir am Wasser entlang spazierten, bemerkten wir in der Straße zu unserer Linken einen wachsenden Menschenauflauf. Noch bevor wir rübergehen konnten, um zu gucken, was passierte, setzten auch schon typisch afrikanische Rhythmen von Trommlern ein und es formierte sich eine Gruppe zur Tanzperformance.
»Los, das muss ich sehen!«, rief Hannah euphorisiert, während sie mich schnell rüber zerrte, um eine gute Sicht auf das Spektakel zu haben. So konnten wir verfolgen, wie zusätzlich noch Gesang einsetzte und eine ganze Crew von zwanzig Personen ihre Performance begann.
Immer wieder stießen Einzelne aus dem singenden und vibenden Pulk nach vorne, um ihr Solo zu performen. Ab und zu beteiligten sich auch Passanten aus dem Publikum und wurden Teil der großen Choreografie. Alle ließen sich anstecken. Auch Kinder waren dabei, Groß und Klein, Alt und Jung, alle machten mit. Überall blickten wir in vor Freude strahlende, lachende Gesichter und so durchfuhr auch uns eine unglaublich freudige Stimmung. Ich schaute rüber zu Hannah. Just in diesem Moment rollte eine Träne ihre Wange herunter. Als ehemalige Tänzerin ist sie mit einer ganz besonderen Leidenschaft für Musik und Tanz beseelt. Und auch wenn es eher eine moderne, künstlerische Darbietung für das touristische Publikum an der Waterfront und keine authentische afrikanische Kulturvorführung war, deren Zeuge wir da gerade wurden, so packte es uns doch direkt.
Leise drückte nun ich Hannahs Hand und flüsterte fragend in ihr Ohr: »Angekommen?«
»Angekommen!«, antwortete sie bestimmt.
5 | Kontrollverlust
Hannah | Sie nannten mich mutig und ich wollte es nicht glauben. Die Arzthelferin, die mir die letzten Impfungen in die Muskeln gejagt hatte. Die Sachbearbeiterin auf dem Amt, die erst gedacht hatte, meine Ummeldung auf meine Heimatadresse hätte mit einer Scheidung zu tun gehabt. Meine Freundinnen, die allesamt bereits Kinder hatten. Für mich hatte sich die Entscheidung, unsere Wohnung an dem Ort, den ich nie Heimat nennen konnte, zu kündigen, alle Möbel zu verkaufen, meinen Teilzeitjob an den Nagel zu hängen, nie mutig angefühlt. Sondern logisch.
»Ist das nicht gefährlich?«, hatten sie gefragt.
»Ist das nicht gefährlich, seine Wünsche immer weiter bis zum Ende des Lebens aufzuschieben, ohne zu wissen, wann dieses Ende ist?«, hatte ich geantwortet, obwohl ich natürlich immer wusste, auf was mein Gegenüber hinauswollte.
Ich war mit neunzehn Jahren allein in Peru und Rio de Janeiro gewesen, hatte in Guatemala einen aktiven Vulkan bestiegen und war mit dem Auto durch palästinensische Gebiete in Israel gefahren.
Das Schlimmste was mir passiert war: Ein Diebstahl meines Portemonnaies und Handys. Und zwar in Köln. Meinem damaligen Wohnort.
All diese Gedanken schossen mir in diesen Millisekunden durch meinen Kopf, als ich dem faltigen alten Mann tief in die Augen blickte und seine Handgelenke fest in meinen Händen hielt.
Wenige Sekunden vorher hatte ich ein Ziehen an meinem Rucksack gespürt, als wäre mein Gepäck plötzlich schwerer geworden. Henrik war ein paar Schritte vor mir gegangen, als wir diese große Kreuzung in einem geschäftigen Viertel in Kapstadt überquert hatten. Mein Gehirn war umgehend in Alarmbereitschaft gesprungen. Shit – meine Kamera ist in dem Rucksack!
Instinktiv hatte ich mich ruckartig umgedreht und war nun in einer misslichen Situation gefangen. Mit aufgerissenen Augen starrte mir der Mann in die Augen. Schuldig, aber gefühllos. Ich blickte erst in die eine, dann in die andere Hand. Er schien nichts gegriffen zu haben. Um uns herum hektisches, alltägliches Treiben. Auch Henrik war mittlerweile darauf aufmerksam geworden. Langsam meldete sich mein Verstand zurück und fragte sich, wie wir uns am besten aus dieser Situation befreien könnten. Ich hatte die Kontrolle. Aber was, wenn ich die Kontrolle losließ? Wie würde er reagieren? Was wäre, wenn er ein Messer in der Tasche hätte? Oder eine Pistole? Ich sah Willen und Enttäuschung zugleich in seinem Blick. Zuversichtlich genug, aber unwissend, ob er handgreiflich werden würde, ließ ich meinen Griff los. Schneller als ich gucken konnte, verschwand der Dieb in der Menschenmasse auf der Straße. Ich versuchte, ihn mit meinen Augen zu verfolgen, verlor aber schnell seine Spur. Eine südafrikanische Frau kam plötzlich mit besorgtem Blick auf uns zugeeilt.
»Alles okay? Hat er was erwischt?«
Ich öffnete den halbgeöffneten Reißverschluss meines Rucksacks, tastete mit meiner Hand und ging eine imaginäre Checkliste durch.
»Alles gut. Alles da«, antwortete ich stakkatoartig, aber erleichtert.
»Seid vorsichtig! Alles Gute euch!«, flüsterte mir die Frau zu, streichelte mir die Schulter und verschwand mindestens genauso schnell im Treiben Kapstadts wie der Dieb.
Die Situation kam wie ein Schlag, der meine selbstüberzeugte, heldenhafte Unversehrbarkeit auf Reisen in ihren Grundzügen zu erschüttern drohte. Mit ein paar Minuten Abstand und der immer noch anhaltenden Gewissheit, dass nichts passiert war, verschaffte sich meine abenteuerlustige innere Stimme aber wieder Gehör: Ha, schließlich sind wir in Afrika! Afrika, Baby! So, als ob sich mein Gehirn zwischen all den topmodernen, hübschen Ecken Kapstadts genau nach diesen dreckigen, klischeehaften Momenten gesehnt hätte. Und es sollte nicht der letzte bleiben …
Es war der lebhafte Kontrast zwischen Schmutzig und Elegant, zwischen Arm und Reich, zwischen den Bergen, die die Stadt umarmen und dem Meer, das die Stadt erfrischt. Vom peitschenden Wind, der uns auf der wolkenumschlungenen Spitze des Tafelbergs beinahe umwehte, an die Küste nach Camps Bay, an der wir Surfer beim Wellenreiten beobachteten. Vom magischen Sonnenuntergang am Signal Hill zu watschelnden Brillenpinguinen am Boulders Beach. Als wir am puderweißen Sandstrand von Blouberg auf die unverkennbare Bergkulisse, vor der das südafrikanische Leben pulsierte, blickten, wusste ich, dass ich in keiner anderen Großstadt dieses Abenteuer hätte starten wollen.
Raaaaatsch! Henriks lautes »Achtung!« kam zu spät. Und schon begann ein nervtötendes Hupkonzert. Ich bekam kein Wort heraus, als ich sah, dass ich soeben den linken Seitenspiegel unseres ersten Mietwagens in Südafrika – einem klapprigen Toyota, dessen Gaspedal sich so lose anfühlte wie so mancher Deckenventilator – an einem am Straßenrand parkenden Bus zerstört hatte. Kaum fünf Minuten nach der Abholung.
»Ja, komm. Ich fahr erstmal«, hatte ich zu Henrik gesagt, als wir auf dem Weg zur Autovermietung gewesen waren, um unseren Roadtrip entlang der Garden Route zu starten, »ich bin wenigstens schon einmal im Linksverkehr gefahren.«
Wie konnte ich mich, die sich und ihre Fähigkeiten sonst chronisch unterschätzt, so täuschen? Ich fühlte mich gelähmt. Scheiße.
Dass zwischenzeitlich zwei Locals von ihrem anliegenden Werkzeuggeschäft angelaufen kamen, um die zerborstenen Teile des Spiegels aufzusammeln, und Henrik bereits ausgestiegen war, hatte ich nicht mitbekommen. Ich starrte nur teilnahmslos auf die Windschutzscheibe und beobachtete den vorbeiziehenden Verkehr gleichgültig. Dieses kleine, dumme Blondchen denkt, dass sie Autofahren kann? Ich hörte Stimmen, die zwar nicht laut waren, aber leise in mir selbst schlummerten, weil ich die Blicke um mich herum so deutete. Ich schämte mich. Abgrundtief.Noch nie in meinem Leben hatte ich auch nur eine Schramme in ein Auto gefahren. Gottverdammt, nie!
Im Rückspiegel sah ich, wie der Fahrer des stehenden Busses ausstieg und auf meine Fahrerseite zulief. Nein, nein, nein! Am liebsten hätte ich mir eine riesengroße Decke übergeworfen und wie ein Kind so getan, als könne man mich nicht sehen. Schneller als ich mir einen Fluchtweg oder wenigstens eine Kommunikationsstrategie überlegen konnte, klopfte es auch schon an die Scheibe.
»Geht’s euch gut?«, erkundigte sich der füllige Busfahrer.
»Uns ja, dem Spiegel weniger«, warf ich unüberlegt schlagfertig zurück. Am liebsten hätte ich ihn gefragt, warum er auf einer derart belebten Hauptstraße seinen breiten Bus so bescheuert geparkt hatte.
»Dem Bus ist nichts passiert«, informierte er mich, ohne dass ich an diese relevante Frage gedacht hätte, »der ist sowieso alt und keine Schönheit mehr. Von meiner Seite aus müssen wir also nicht die Polizei rufen.«
Polizei?!
»Oh, ähm … das ist gut zu wissen! Danke vielmals!«, stammelte ich.
»Und…sorry…«, murmelte ich, als der Mann bereits auf dem Absatz kehrtgemacht hatte.
Henrik kaufte den zwei Männern im Werkzeuggeschäft Tape ab, die damit den Spiegel behelfsmäßig fixten. Daraufhin öffnete er wieder die Beifahrertür und ließ sich auf den Sitz fallen. Ich wusste, was jetzt kommen würde. Er würde sich wieder einmal bestätigt fühlen, dass er klüger, fähiger, besser ist als ich. Er würde mir die Verantwortung zuschreiben. Meinen Fehler aussprechen und mich noch tiefer in den Matsch drücken. Ich hatte die Verantwortung – immer. Ich hörte schon den Satz: »So, du setzt dich jetzt hier hin und lässt mich ans Steuer«, bevor er überhaupt ausgesprochen war. Aus Selbstschutz kam ich Henrik zuvor.
»Tut mir leid … fahr du.«
»Nein.«
Verwirrt fand ich nach einigen Minuten der aktiven Vermeidung wieder Augenkontakt, brachte aber immer noch kein Wort heraus.
»Das passiert! Und jetzt war es das erste Mal. Hätte mir genauso passieren können. War auch ein Warnsignal für mich als Beifahrer, die linke Seite besser im Blick zu haben.«
Okay, das kam überraschend.
Ob wir es wollten, oder nicht – wir mussten wohl oder übel zurück zur Autovermietung und den Schaden melden. Dass wir eine Versicherung abgeschlossen hatten, schenkte mir einen kleinen Funken Hoffnung. Obwohl ich nun in Schneckentempo hochkonzentriert durch die Vorstadt Kapstadts gurkte und jedes parkende wie fahrende Auto genau analysierte, sortierte mein Kopf meine falsche Erwartung an Henrik.
Hat er mir gerade wirklich keine Vorwürfe gemacht? Mir nicht die Schuld für diesen Kackmist gegeben? Und stattdessen ohne Bitte die Initiative ergriffen, die Situation zu lösen?
Wie untypisch. Alles davon. Noch bevor ich die ungewöhnliche Situation zu Ende denken konnte, stand ich auf dem Parkplatz. Und hatte gar keine Lust darauf, jetzt meiner Pflicht nachzugehen. Hannah, du musst jetzt den Arsch in der Hose haben und selbstbewusst sein. Es war unmissverständlich dein Verschulden!
Mit gesenktem Kopf trat ich vor den Mitarbeiter: »Ich habe den Spiegel beschädigt.«
Für fünf Sekunden sagte er nichts, musterte mich und nickte dann ernüchternd. Als hätte er es bereits geahnt, als er mich und nicht Henrik ins Auto einsteigen sah. Komm schon, sei kein Arsch.
»Ich seh’s. Ihr habt das Auto erst vor zehn Minuten bekommen.« Danke.
»Aber ihr habt Glück. Ich habe noch einen anderen Kleinwagen da. Einen Renault Kwid.«
»Okay. Und, ehm … müssen wir was zahlen?«
»Nope, trägt eure Versicherung.«
Ich blickte mit breitem Grinsen und aufeinandergepressten Zähnen zu Henrik, der mir mit seiner Hüfte einen Stups in die Seite gab und mein Grinsen erwiderte. In diesem Moment war mir wieder klar, warum ich ihn liebte. Und ich nahm diese Aktion als Lehrstunde für mich, in einer umgekehrten Situation genauso besonnen zu reagieren. Ohne diese tödliche Schuldfrage, die uns zuletzt immer weiter auseinandergetrieben hatte.
Rasch packten wir unser Gepäck um und saßen wenige Minuten später in einer unversehrten Renault-Knutschkugel.
»So…«, stimmte Henrik auf dem Beifahrersitz melodisch und motiviert an, »jetzt aber!«
»Ich wollte nur diese Toyota-Schrottkarre nicht und uns ein ordentliches Auto besorgen!«
Wir lachten, drehten die Musik auf und machten uns nach zwei Wochen in Kapstadt – mit Rio für mich die coolste Großstadt der Welt – auf unseren ersten Roadtrip unserer Reise. Vom kalten Atlantik gen Indischen Ozean. Immer der Küste entlang. Wir sprangen vom Boot eines Meeresforschungsinstituts in das eisigkalte Wasser, um im Schutze eines Käfigs mit Haien zu schnorcheln. Wir fuhren zum Sonnenuntergang ans Cape Agulhas, dem südlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents, stampften durch die pulverigen, weißen Sanddünen des De Hoop Nationalparks, wanderten stundenlang durch einen für meine Begriffe unspektakulären Wald bei Knysna, während mich eine Million Moskitos auffraßen. Wir chillten am Strand von Wilderness und sprangen im Tsitsikamma Nationalpark wagemutig von Stein zu Stein, um einen Wasserfall zu sehen, der direkt ins Meer fließt. Jeden zweiten oder spätestens jeden dritten Tag fuhren wir weiter. Angetrieben vom Gedanken, dass wir nun endlich die Zeit hätten, alles zu sehen. Erst ganz am Ende der Garden Route, in Jeffreys Bay, nahmen wir uns die Zeit, zu verweilen und liegengebliebene Arbeit aufzuholen. Ich liebte es, nun die volle Kontrolle über mein Leben zu haben.
Doch es gibt Momente im Leben, in denen unsere Kontrolle endet. Besonders dann, wenn wir uns der Kraft der Natur hingeben. Nie zuvor in meinem Leben hatte ich so bewusst die immense Kraft dieses einen Elements wahrgenommen: Wasser. Hier an der malerischen Küste Südafrikas, wo zwei Ozeane aufeinandertreffen, bündelt die Natur all ihre Macht. Auf die von zerklüfteten Klippen gesäumten Küsten, geschliffen von scheinbar messerscharfem Wasser, prallen die Wellen mit einer derartigen Gewalt, dass mir vom Echo des Aufpralls das Blut in den Adern gefror. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen hier an der Küste der Garden Route ihr Leben in den Tiefen des Ozeans verloren haben. Aus Kontrollverlust. Und aus Pech.
Ich habe unglaublichen Respekt vor Wasser. Wieso ich mich jetzt voller Entschlossenheit und Vorfreude in Jeffreys Bay in einen Wetsuit schmiss und mit einem Surfbrett zwischen Hand und Hüfte gepresst auf das azurblaue, rauschende Meer blickte, zeugte wohl wieder einmal von meinen Grenzgängersehnsüchten.
Papperlapapp, Angst vor Wasser!
Nachdem wir uns in der besten Surfschule des Ortes für einen Kurs angemeldet hatten, begutachteten wir die Wellen vom Strand aus. Sah machbar aus, ähnlich wie in Huanchaco an der Pazifikküste in Peru, wo wir im Jahr zuvor erstmals auf dem Brett gestanden hatten.
Also, rein da! Beim Rausschwimmen spürte ich einen enormen Sog, der das Erreichen einer ausreichenden Distanz vom Ufer zum Kraftakt machte.
»Wie krass ist bitte die Frequenz der Wellen?«, rief ich Henrik zu, der augenscheinlich auch etwas zu kämpfen hatte.
Xaver, unser Surflehrer, fixierte mein Brett, damit ich mich in Bauchlage begeben konnte. Das Wasser unter mir erhob sich plötzlich – viel schneller als ich mich mental hätte bereitmachen können. Den Moment, um zum Stehen zu kommen, hatte ich längst verpasst. Und so schlitterte ich wie eine faule Robbe am Strand auf Grund. Cool, der Weg nach draußen war also schonmal umsonst.
Keine Zeit zur Ruhe zu kommen, keine Zeit, sich auf eine Welle zu konzentrieren. JBay – wie die Locals ihren chilligen Surferort nennen – ist tough! Entweder du nimmst sie oder deine Arbeit ist für die Katz‘.
Die nächste gehört mir! Blick nach vorne, Oberkörper hochdrücken, Bein anziehen, Schritt. Ich stehe! Für genau drei Sekunden. Da traute sich doch ernsthaft schon die nächste Welle, mich ins salzige Wasser zu bugsieren. Das Salzwasser sorgte dafür, dass ich nur noch mit halbgeöffneten Augen agierte. Da Xaver gerade bei anderen Surfanfängern war, beschloss ich, einen Eigenversuch zu unternehmen. Ich wusste ja, wie es theoretisch ging. Theoretisch. Geduldig wartete ich drei Wellen ab, die mir nicht recht gefielen. Dann legte ich mich mit Blick Richtung Strand aufs Brett und begann mit dem Blick nach hinten zu paddeln. Das muss sie jetzt sein! Blick nach vorne, Oberkörper hochdrücken, Bein anziehen, Schritt und…
Verdammt. Das kühle Wasser schüttelte mich durch wie eine Waschmaschine im Schleudergang. Gut, dann eben die Nächste … Wieso hört das hier nicht auf? Hallo … Waschmaschine fertig!?
Ich verlor die Orientierung. Panik. Ich rang. Wie ein zappelnder Fisch im Netz.
Bäm! Ein warmer Schmerz. Alles um mich herum fühlte sich dumpf an. Meine Lungen begannen zu brennen. Fuck, meine Luft ist leer! Fuck, fuck, fuck!
Instinktiv stoppte ich meine Bewegungen. Im Strudel meines Endgegners. Gab mich ihm hin. Versank beinahe in Trance.Dann spürte ich plötzlich Grund unter meinen Füßen und stand ruckartig auf. Unaufhörlich hustete ich mit zusammengepressten Augen, während meine Lungen zwischen Hustenattacken jede Luft in sich saugten. Ich öffnete die Augen. Wo genau bin ich? Tot? Lebendig?
»Alles ok?«, hörte ich eine entfernte vertraute Stimme. Ich drehte mich um, sah Henrik im Wasser und schüttelte mit dem Kopf.
Der Husten zerfetzte mir beinahe die Lungen.
»Du warst sehr lang unter Wasser. Alles ok?«
Ich spürte Henriks Hand an meiner Schulter.
»Nein. Mein Kopf. Das Surfbrett.«
Dann erst merkte ich, dass meine Schläfe im Takt meines hohen Pulses pochte. Mein Schädel dröhnte. Sachte legte ich meine Hand auf die schmerzende Stelle. Schwindel.
»Ich weiß nicht mal, ob es mein eigenes Brett war.«
Im Wasser tummelten sich mindestens zwanzig andere Bretter, deren vorrübergehende Besitzer scheinbar – und glücklicherweise – nichts von meinem Überlebenskampf mitbekommen hatten. Ich atmete einmal tief ein. Und wieder aus.
»Ok! Weiter geht’s!«, prustete ich nach dem Atemzug, bereit das Geschehene in meinem Kopf ungeschehen zu machen.
»Nix geht hier weiter!«
Henrik zog mich am Arm zurück und blickte mir eindringlich in die Augen.
»Du Dickkopf! Weißt doch gut genug, dass du dir damit schadest. Beim nächsten Mal zeigst du den Wellen, wer das Sagen hat, okay? Nicht heute.«
Nun saß ich eingesandet und eingesalzen auf meinem Surfbrett, die Ellenbogen auf meinen Knien abgestützt. An jener Stelle, wo ich eine halbe Stunde zuvor noch selbstbewusst mit demselben Surfbrett unterm Arm gestanden hatte. Das Pochen ließ allmählich nach, während Henrik bereits wieder für mehrere Sekunden auf der perfekten Welle ritt. Auf dem Brett ist jeder Individualist.
6 | Elefanten zum Geburtstag
Henrik | Die Tage an der Garden Route neigten sich allmählich dem Ende zu. Wir kamen runter vom Rush der letzten Tage und nahmen uns mehr Raum für unsere Arbeit, die ja schließlich unser Leben hier finanzieren sollte. Viel hatte sich angestaut. Generell waren wir zwar deutlich langsamer unterwegs als sonst, doch allein durch unseren Mietwagen fühlten wir uns auch unter Druck, voranzukommen. Das hieß zum einen, alle zwei, drei Tage den Ort zu wechseln, und zum anderen, in der Zeit möglichst alle Sehenswürdigkeiten mitzunehmen, weil wir erstmal nicht zurückkommen würden. Schließlich ist genau dies das notwendige Futter für unsere Arbeit: Keine Erlebnisse bedeutet kein Material zum Schreiben, kein Schreiben bedeutet kein Geld. In diesen letzten Tagen mit all den verschiedensten Wanderungen, Ausflügen und Aktivitäten wurde es uns alles zu viel.





























