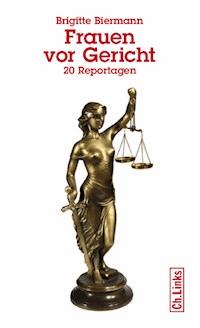Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Andreas Ehe ist ein Desaster. Demütigung und Gewalt sind an der Tagesordnung. Ihre Versuche, vor ihrem Mann zu fliehen, scheitern. Er findet sie überall, und sie fällt auf seine Beteuerungen, dass er sich bessern werde, rein. Als sich die Lage zuspitzt, er sie bedroht und sie keinen Ausweg mehr sieht, bringt sie ihren Mann um und stellt sich sofort der Polizei. Wegen Mordes zu 12 Jahren Haft verurteilt, schreibt sie Briefe an ihre Tochter, die sie ihr geben will, wenn diese erwachsen ist. So wird der Leser Zeuge, wie Andrea im Gefängnis an Selbstbewusstsein gewinnt und – auch in der Auseinandersetzung mit ihrer Tat – den aufrechten Gang lernt. Viel Feingefühl und Sachverstand zeichnen diese berührenden Briefe aus, die Brigitte Biermann in Anlehnung an die wahre Geschichte Andreas verfasst hat. Sie regen auch zur Diskussion über Schuld und die Gerechtigkeit von Gerichtsurteilen an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brigitte Biermann
Ums Leben gebracht oder Der Terror in meiner Ehe
Patmos Verlag
Inhalt
Sonntag, Februar, 2007
Zwei Stunden später
Ein Samstag später, Vormittag, es regnet
Samstagabend, Anfang März 2007
Samstagabend, Ende März 2007
Sonntagnachmittag, Mai 2007
Montagabend, Mai 2007
Mittwochabend, Mai 2007
Samstagabend, Juni 2007
Sonntagnachmittag, Juli 2007
Samstagabend, September 2007
Ein Mittwochabend im September 2007
Oktober 2007
Donnerstag nach Weihnachten 2007
Montagvormittag, Ende Januar 2008
Einen Tag später
Freitagabend, März 2008
Samstagabend, Juni 2008
Montagabend, Juli 2008
Ende Juli 2008
August 2008
Dienstag, 2. September 2008
Sonntag, 28. September 2008
Sonntag, Februar 2009
März 2009
April 2009
Juni 2009
Einen Tag später
Ende Juli 2009, Samstagvormittag
Dienstagabend, August 2009
Oktober 2009
Sonntag, 15. November 2009
Februar 2010
Mai 2010
Dezember 2010, Samstagmittag
Einen Tag später
Nach Neujahr 2011
Februar 2011
Ostersamstag 2011
August 2011
September 2011, Montagabend, erster Schultag
Dezember 2011, vierter Advent, Nachmittag
Freitag, 6. Januar 2012
Pfingstsonntag 2012
Juni 2012
Drei Tage später
Ende Juli 2012, Samstagnachmittag
August 2012
September 2012
Sonntag, 7. Oktober 2012, Erntedankfest
Samstagabend, 17. November 2012, abends
Drei Tage später
Montag, 17. Dezember 2012
Nachtrag am Dienstag, zwischen Schule und Gymnastik
Sonntag, 6. Januar 2013, kurz vor Mitternacht
Samstag, 26. Januar 2013
Mittwoch, 13. Februar 2013, kurz vor Mitternacht
Ostersonntag, 31. März 2013, Nachmittag
Montagabend, 15. Juli 2013
Donnerstag, 25. Juli 2013
Donnerstag, 3. Oktober 2013
Sonntag, 22. Februar 2014
Montag, 16. Juni 2014
3 Tage später, kurz vor Mitternacht
Montag, 14. Juli 2014
Die handelnden Personen
Danksagung
Erste Hilfe
Über die Autorin
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Der Weg zum Ziel beginnt mit dem Tag,
an dem du die hundertprozentige Verantwortung für dein Tun übernimmst.
Dante Alighieri
I see my light come shining
From the west unto the east.
Any day now, any day now,
I shall be released.
Bob Dylan
Die Geschichte ist wahr, nur wurden alle Namen, Orte und Daten verändert. Auch wenn sie in keiner bestimmten Justizvollzugsanstalt spielt – Strafvollzugsordnung ist Ländersache –, ist jedes Detail authentisch.
Sonntag, Februar, 2007
Es ist vorbei. Vorbei das zermürbende Warten, vorbei die Ungewissheit. Eineinhalb Jahre U-Haft sind genug. Vergangene Woche war endlich die Urteilsverkündung. Das Schlimmste: Die Verantwortung für Julia muss ich nun für sehr lange Zeit abgeben. Und was das bedeutet, darüber kann und will ich jetzt nicht nachdenken, sonst werde ich verrückt. Mein einziger Trost ist, dass Julia es gut hat bei meinem Bruder Michael und seiner Frau, die mein Kind lieben wie ihre eigenen. Als klar war, dass es mit mir länger dauert, haben sie ihr die Geschichte so behutsam wie möglich beigebracht, haben es wohl einen Unglücksfall genannt. In der Nacht meiner Verhaftung war Julia bei ihnen. Wenn sie mich besuchen und die Kleine mitbringen, lasse ich sie meinen Schmerz natürlich nicht spüren. Ich begegne ihnen so heiter und zuversichtlich wie möglich. Das fällt mir unglaublich schwer. Auch meine Schuldgefühle behalte ich für mich. Es reicht, wenn die mich fast jede Nacht als Albträume quälen.
Ich habe mir überlegt, meine liebe, kleine Julia, dass ich für dich aufschreibe, was ich hier erlebe, was mich beschäftigt. Dafür werde ich mir ein Heft kaufen. Denn die Briefe, die man abschicken will, darf man nicht zukleben, nur die an meinen Anwalt. Wenn ich einen Brief bekomme, muss ich ihn vor einer Bediensteten öffnen und auseinanderfalten, damit sicher ist, dass er keine verbotenen Dinge enthält. Was ich dir zu sagen habe, muss niemand anderes lesen. Auch wie ich mit deinem Vater gelebt habe, geht nun niemanden mehr was an. Irgendwann, wenn du groß bist, werde ich dir dieses Heft, vielleicht werden es auch mehr, geben. Du wirst mein Handeln sicherlich nicht gutheißen, vielleicht kannst du mich nicht einmal verstehen. Aber möglicherweise kannst du es irgendwann einmal akzeptieren. Und – mein allergrößter Wunsch – mir verzeihen.
Also, liebe Julia, dann fange ich jetzt bei der Gerichtsverhandlung an.
Die Kammer, so heißen Richter, die über Menschen wie mich urteilen, besteht aus einem Vorsitzenden, zwei beisitzenden Richtern und zwei Schöffen, das sind Laien, die sonst anderen Berufen nachgehen. Nur eine Frau war unter den Berufsrichtern, aber von der hatte ich nicht viel zu erhoffen.
Der Prozess dauerte fünf Tage. Von früh neun Uhr bis in den Nachmittag saß ich auf der Anklagebank, die ein Stuhl war, und hörte zu, wie über mein ganzes Leben geredet, mein Innerstes nach außen gekehrt wurde.
Bei der Kindheit haben sie angefangen mit ihrer Fragerei. Mein großer Bruder, dein Onkel Helmut, arbeitet wieder im Ausland, den konnten sie nicht herbeizitieren, aber dein Onkel Michael und deine Tante Sandra mussten als Zeugen aussagen. Michael erzählte von unserer Kindheit, wie heiter und schön sie war, obwohl wir nicht viel Geld besaßen. Es gab zwar keine großen Kindergeburtstagsfeste, wie sie heute üblich sind, aber unsere Freundinnen und Freunde durften jederzeit kommen, und wir spielten im Garten. Und zu essen gab es auch immer genug. Mama hatte uns zu Höflichkeit erzogen und zu Achtung vor allen Lebewesen. Tätiges Mitgefühl sei das Wichtigste im Leben, hieß das bei ihr, und so hat sie auch gelebt. Als unser Opa krank wurde und Oma keine Kraft mehr hatte, ihn zu pflegen, umsorgte sie auch die beiden.
Natürlich hat das Gericht haufenweise Fragen über meine Ehe gestellt. Michael hat nur gesagt, dass er Jochen, deinen Vater, von Anfang an nicht mochte und wusste, dass unser Zusammenleben alles andere als harmonisch gewesen sei.
Sandra hat viel mehr geredet. Als Frau kann sie sich besser in meine Situation einfühlen. Sie hat rundheraus gesagt, dass sie Angst vor Jochen gehabt habe: »Über jeden Schritt musste Andrea Rechenschaft ablegen, sie konnte nicht mal schnell zu uns auf einen Kaffee, da kam er hinterher und brüllte rum. Und wie der brüllte, da wackelten die Wände!« Deshalb habe sie dich und mich nicht bei sich aufgenommen, als ich von zu Hause abhauen wollte, damals warst du noch ein Baby, sie hatten schon den kleinen Sebastian, und Sandra war mit deiner Cousine Nora schwanger. Wenn der Jochen die Hand gegen sie gehoben hätte, wäre sie an die Wand geflogen, hat sie dem Gericht erzählt. Und dass von Vertrauen und Zusammenhalt in meiner Ehe keine Rede gewesen sein konnte. Sie sagte: »Ich habe oft versucht, Andrea klarzumachen, dass so ein Verhalten nicht normal ist. Deshalb wäre eine vernünftige Scheidung, wie ich mir das vorstelle, mit dem gar nicht möglich gewesen. Andrea und Julia waren sein Eigentum. Wie sein Haus und sein Auto. Liebe, Zuneigung, Verstehen – das waren wohl Fremdworte für ihn. Er wollte besitzen und mit seinem Besitz angeben. Ich weiß, dass Andrea am Anfang oft versuchte, mit ihm zu reden, aber Jochen ließ sich von nichts und niemandem überzeugen, da hätte sogar der Papst nichts ausrichten können! Ich habe Andrea kennengelernt als eine liebenswerte, hilfsbereite Person, hinnahmefähig bis zum Gehtnichtmehr. Sie kann ja nicht mal ne Fliege totschlagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen!«
Von den anderen Zeugen war Jochens Schwager der Einzige, der bestätigte, ein paar Mal Prügel von ihm eingesteckt zu haben wegen irgendwelcher Streitigkeiten. Einmal sei dabei die Stehlampe zu Bruch gegangen.
All die anderen, Jochens Bruder, sein Chef und seine Kollegen aus der Autowerkstatt, haben ein Loblied gesungen mit immer demselben Refrain. Ich hab gedacht, die reden von einem ganz anderen Menschen: Der Jochen habe seine Frau, also mich, so sehr geliebt, sie war sein Ein und Alles. Er hatte feste Ziele im Leben. Er setzte immer seine Meinung durch. Nein, gewalttätig ist er nie geworden.
Einer will erlebt haben, wie Jochen mir Aufträge gegeben hat, aber das sei ja wohl normal unter Verheirateten.
Da hat Sandra dazwischengerufen: »Du elender Wicht, sag die Wahrheit, ich war doch dabei, als du dir von ihm einen Satz warme Ohren eingefangen hast! Und beim Osterfeuer hat er ein volles Bierglas nach dir geschmissen!«
Der Richter hat Sandra daraufhin angedroht, sie des Saales zu verweisen, wenn sie noch mal dazwischenriefe.
Nur einer hat eingeräumt, gehört zu haben, dass er mich ein paar Mal angebrüllt und beschimpft habe. Aber so was käme schließlich in jeder Ehe vor. Jochen sei jedenfalls niemals beleidigend geworden. Und nie habe er mich geschlagen.
»Stimmt das?«, hat mich der Richter gefragt.
»Stimmt«, hab ich gesagt. »Ich hab zwar gelegentlich eine geklatscht gekriegt oder einen Schuh im Hintern gehabt, aber richtig verprügelt hat er mich nie.«
All das wurde vor den Leuten ausgebreitet, kein Detail ausgelassen. Okay, Richter hören so was alle Tage. Und in den Akten vom Staatsanwalt und von meinem Verteidiger steht es auch. Aber diese Gaffer im Saal! Sie saßen dicht an dicht, meine Schwiegermutter, Jochens Schwester mit Mann, der halbe Ort, ich mag gar nicht aufzählen, wer alles da war. Ich fühlte mich so nackt, so beschämt, habe selten hochgeschaut. Ich war auch kaum imstande, dem Gericht zu antworten. Immer wieder wurde ich ermahnt: »Sprechen Sie bitte lauter, Frau Schwarz, wir verstehen Sie nicht.«
Einmal habe ich meine Schwiegermutter, deine Oma Herta, angesehen. Ich weiß, dass sie dich und mich sehr mochte, wenn es ihr auch schwerfiel, Gefühle zu zeigen. Sie saß da mit versteinertem Gesicht. Was mag sie gedacht haben? Ihre Schwester hatte mir mal erzählt, dass der Jochen sehr nach seinem Vater geraten sei; Herta hatte es wohl auch nicht gut gehabt in ihrer Ehe. Du hast den Opa Horst nie kennengelernt, er starb, als du ein Baby warst. Dennoch: Sie wird mir niemals verzeihen können.
So sehr es mich schmerzt, dass meine Mutter nicht mehr lebt und mein Papa mit seinen fast Achtzig nicht mehr fit ist, so froh war ich, dass sie das alles nicht mitanhören mussten. Es reicht, wenn Papa in der Zeitung liest, was und wie über mich und über Jochen geredet wird.
Nach meiner Verhaftung rief ich Papa von der U-Haft aus an. Ich wusste nicht so recht, was ich sagen sollte, stammelte irgendwas in den Hörer, aber er rief gleich: »Andrea, mein Mädchen, wie geht es dir?«
»Es geht mir gut, ich hab jetzt meine Ruhe, hier werde ich nicht gedemütigt, ich vermisse nur mein Kind.«
»Ich verstehe gut, dass du die Kleine vermisst. Aber ich weiß, wie du all die Jahre gelitten hast, hab es oft genug miterlebt. Wenn es dir jetzt besser geht, will ich zufrieden sein, Gott behüte dich!«
Nach diesem Telefonat war ich völlig fertig. Welche Überwindung müssen ihn diese Worte gekostet haben! Wie wird man wohl im Gemeinderat über mich – und über ihn – reden? Wie unter den Nachbarn? Ich wünsche ihm so sehr, dass man ihm auch weiterhin die Achtung entgegenbringt, die er sein Leben lang verdient hat! Zu seinen früheren Kollegen von der Druckerei der Kreiszeitung hat er wohl keinen Kontakt mehr, und die Neuen kennen ihn nicht. Aber all die anderen – Papa ist im Ort schließlich bekannt wie ein bunter Hund.
Zwei Stunden später
Ich musste erst mal eine Pause machen, so viel hab ich ewig nicht mehr mit der Hand geschrieben. Es gab inzwischen Abendbrot. Eine Inhaftierte geht mit dem Essenwagen von Zelle zu Zelle und verteilt Brot, Butter oder Margarine, Wurst, Käse, Marmelade, manchmal Obst für jede von uns. Das ist für abends und das nächste Frühstück gedacht. Nun ja, man wird satt. Ich weiß, dass das hier kein Nobelhotel ist.
Aber zurück zum Prozess. Vieles hab ich gar nicht richtig mitgekriegt. Sieben Stunden da sitzen und zuhören, was alles ausgebreitet wird bis hin zu meinen Nächten mit deinem Vater – manchmal hab ich einfach abgeschaltet.
Michael empörte sich in einer Pause gegenüber meinem Verteidiger, dass der Staatsanwalt von Jochens erheblicher gesundheitlicher Belastung gesprochen hätte: Unglaublich, jeder habe doch gesehen, dass er zu viel Bier gesoffen, Zigaretten und Marihuana geraucht und damit geprahlt habe, er müsse nur abspritzen, dann sei alles okay. Und wieso der Druck zu allabendlichem Geschlechtsverkehr nicht als Vergewaltigung in der Ehe gewertet worden sei, was seit 1997 ein eigenständiger Straftatbestand ist? Der Verteidiger beruhigte ihn, all das würde er in seinem Plädoyer anmerken.
Der Staatsanwalt sagte in seinem Plädoyer, Jochen Schwarz schien mich und unsere Tochter zwar all die Jahre als seine Leibeigenen betrachtet zu haben, deshalb sei er jedoch kein schlechter Mensch gewesen! Schließlich entspräche solches Verhalten seiner Persönlichkeitsstruktur.
Das hat Sandra und Micha mächtig empört, wie sie mir später erzählten. Sollte das etwa eine Entschuldigung sein? Als ob eine Persönlichkeitsstruktur Entschuldigung für alles sei, Grobheiten und Gewalt rechtfertigen könne!
Auch Herr Brandes, mein Verteidiger, ging darauf ein. Eine permanent ausgeführte Straftat – nämlich Demütigungen, physische und psychische Gewaltausübung, tägliche sexuelle Nötigung – könne man nicht mit Persönlichkeitsstruktur entschuldigen. Nur vier Prozent aller vergewaltigten Ehefrauen würden ihren Mann anzeigen, dass Frau Schwarz es nicht getan hat, könne man ihr nicht vorwerfen.
Zuvor hatte Herr Brandes lange mit mir gesprochen. Bei ihm konnte ich mir alles von der Seele reden, meinen Frust, meine Ängste, meinen Ekel, ich konnte auch von meinen Bemühungen erzählen, diesem Dilemma zu entkommen. Er hörte mir zu, von ihm fühlte ich mich verstanden. So klang jedenfalls sein Plädoyer. Einige im Saal wischten sich sogar verstohlen über die Augen, so berührt schienen sie von seinen Worten. Aber es hat wenig genützt.
Dass Jochens sogenannte Persönlichkeitsstruktur normal ist, hatte ich mir auch lange schöngeredet. Ich hatte einmal Ja gesagt, also müsse ich mein Schicksal annehmen, dachte ich. Große Liebe und Zärtlichkeit und Füreinander da sein, wenn die erste Verliebtheit vorbei ist, gibt’s eben nur im Film. Andererseits: Weder bei meinen Eltern noch bei meinen Großeltern hörte ich jemals hässliche Worte! Auch Micha und Sandra sind gut zueinander. Aber als ich endlich aufgewacht bin, klemmte die Karre schon zu sehr im Dreck.
Ob die Richter und die Schöffen wirklich begriffen haben, wie es mir ergangen ist? Einmal hab ich gesehen, wie der Kopf der beisitzenden Richterin hochzuckte, sie war wohl eingenickt. Sandra erzählte mir, sie habe mehrmals erkennbar gegen den Schlaf angekämpft.
In der Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter, ich sei haarscharf an einer lebenslangen Haftstrafe vorbeigeschrammt, darüber seien sich der Staatsanwalt und die Kammer schon vor der Verhandlung einig gewesen. Ich habe erst viel später kapiert, dass so was eigentlich ein Unding ist: Die einigen sich auf ein Strafmaß, ohne mich vorher gesehen und meine Meinung gehört zu haben? Aber in dem Moment hab ich gar nicht alles begriffen, was er geredet hat. Hab es später erst in Ruhe nachgelesen. Schwarz auf Weiß steht da im Namen des Volkes: »Die Kammer sieht als strafmildernd die überdurchschnittliche Haftempfindlichkeit der Angeklagten an, die hauptsächlich darauf beruht, dass sie auf Jahre hinaus von ihrer geliebten Tochter getrennt ist und nicht für sie sorgen kann. Nicht außer Acht gelassen hat die Kammer den bisherigen rechtstreuen Werdegang der Angeklagten und dass sie ihre wirtschaftliche Existenz verloren hat.«
Nun liegen »nur« zwölf Jahre Gefängnis vor mir, statt lebenslanger Haft, wie der Richter sagte.
Das sind zwölf Sommer und zwölfmal Advent und Weihnachten. Das sind 288 Monate, 105120 Tage … Vor allem aber sind es zwölf Jahre ohne dich, meine geliebte Kleine. Wenn ich rauskomme, bin ich fünfundvierzig, du bist zwanzig. So viele Jahre ohne Mutter, wie sollst du das ertragen? Kann dir abends nicht mehr vorlesen, nicht mehr mit dir singen; kann dir nicht beistehen bei Prüfungen – Vokabeln abfragen, Gedichte abhören, Diktate üben, unbekannte Gleichungen lösen. Kann dich nicht trösten beim ersten Liebeskummer, dir nicht bei Grippe eine Hühnersuppe kochen, Medikamente besorgen, kann dir nicht raten bei Konflikten mit deinen Freundinnen, nicht zuhören beim ersten Verliebtsein, nicht helfen bei der Berufswahl … Lieber Gott, wie soll ich das aushalten? Aber viel schlimmer: Wie wirst du das aushalten ohne meine Zärtlichkeit und Fürsorge? Wie wirst du über mich denken? Wie reagieren, wenn irgendjemand – und es gibt immer und überall Leute, die nichts für sich behalten können – wenn also irgendjemand hässliche Bemerkungen macht über deine Mutter, die im Knast sitzt, wie wirst du es schaffen, damit umzugehen? Ich bete jeden Abend zu Gott, dass das Band zwischen uns nicht reißt. Und dass Sandra dir Mutterersatz sein kann und dich stark macht, dass mein Bruder dir die Liebe gibt, die dein Vater vermissen ließ, dass Sebastian und Nora dir liebevolle Geschwister sind! Wie ich ihnen das jemals danken kann, ist mir schleierhaft.
Sie haben sofort richtig gehandelt, haben dich in deiner Schule ab- und in Sebastians und Noras Schule angemeldet. Nun liegen 35 Kilometer und ein Fluss zwischen deiner alten und deiner neuen Umgebung, und ich wünsche sehr, dass das reicht, um dich so weit wie möglich unbelastet von der Tat deiner Mama leben zu lassen. Es ist schlimm genug für dich, ohne mich aufzuwachsen. Und schwer, immer darauf zu achten, wem du was erzählst. Diese Heimlichtuerei und vielleicht auch Lügerei muss als ein fürchterlicher Druck auf dir lasten – wie wirst du den nur ertragen können? Oh, Gott, warum kann ich dir nicht helfen? Warum habe ich dir das alles nicht ersparen können?
Bei uns zu Hause wurde nie viel geredet. Die Eltern verstanden sich offenbar ohne viele Worte, meine Brüder sind auch nicht gerade geschwätzig, und so habe ich viel mit mir alleine abgemacht. Mein Vater arbeitete in der Druckerei im Schichtdienst, meine Mutter kam am Nachmittag von ihrer Arbeit in einer Gärtnerei nach Hause. Dann kümmerte sie sich um den Haushalt. Sie fragte zwar immer nach der Schule und ob wir die Hausaufgaben erledigt hätten, das war’s dann aber auch. Micha und ich kamen gut allein zurecht. Helmut machte damals schon eine Lehre und lebte im Internat. Wenn ich wirklich mal ein Problem hatte, hörte meine Mutter zu und gab sich Mühe zu helfen. Jetzt habe ich dicke Probleme, und sie lebt nicht mehr. Hätte mir aber auch nicht helfen können. Ich bin sicher, sie schaut mir von da oben zu und behütet dich und mich auf irgendeine Art und Weise. So habe ich auch dich zu trösten versucht, als du nicht begreifen konntest, dass deine Oma nicht mehr für dich da war. Für dich hatte sie viel mehr Zeit gehabt als für ihre eigenen Kinder, aber als du auf die Welt kamst, war sie ja längst Rentnerin.
Meine liebe kleine Julia, ich habe so schreckliche Sehnsucht nach dir! Wie soll ich die Zeit ohne dich überstehen? Hier muss ich meinen Kummer, meinen Schmerz für mich behalten. Zähne zusammenbeißen und durch. Meiner Mitbewohnerin ergeht es schließlich nicht anders. Deren Gejammer würde ich mir auch ungern anhören wollen. Wer hier drin ist, sitzt zu Recht, so viel habe ich immerhin begriffen.
Ich muss heulen. Nein, das soll niemand sehen. Ich schreibe später weiter.
Ein Samstag später, Vormittag, es regnet
In der Untersuchungshaft hatte ich ja schon mitgekriegt, in welch gemischter Gesellschaft ich mich künftig befinden würde. Dass auch Irre darunter sein würden, kam mir nicht in den Sinn, aber der Garten des Herrn ist groß, wie meine Mutter oft sagte. Ich war erst in der Aufnahmestation untergebracht, in einer Doppelzelle. Wir bleiben hier etwa zwei Wochen. Nach dem Aufnahmegespräch, in dem alles festgehalten wird, was die jeweilige Frau betrifft – von der Straftat bis zu der Frage, ob irgendeine Therapie beabsichtigt oder erforderlich ist – lernt man das Innere der Anstalt kennen: Psychologischer und Sozial-Dienst, Beratungsstelle für Süchtige und für Schuldner, Arbeitsstätten, Schule, Krankenabteilung. Eine Gefangenenvertreterin gibt es auch, das ist eine Langstraflerin, also eine, wie ich es nun bin.
Meine Mitbewohnerin ging mir fürchterlich auf die Nerven. Sie lässt ihre Sachen liegen, wo sie gerade steht, das feuchte Handtuch über der Stuhllehne, darüber das Nachthemd, auf dem Sitz müffelnde Socken, die sie plattsitzt. Gäbe es nicht die Vorschrift, morgens die Betten ordentlich zu machen, würde sie abends in die zerwühlten Decken steigen. Auf so engem Raum funktioniert Zusammenleben nur, wenn jede Rücksicht nimmt, aber davon hat sie offenbar noch nie gehört. Das Schlimmste: Sie brabbelt ununterbrochen vor sich hin, redet mit Vögeln, mit Gott, mit dem Teufel, mit irgendwelchen abwesenden oder eingebildeten Personen. Zuerst hab ich gedacht, das legt sich irgendwann, aber sobald sie morgens die Augen öffnet, geht auch der Mund auf. Ich dachte, ich kriege einen Knall, wenn ich das noch lange aushalten soll.
Gestern quasselte sie wieder mit einem Vogel, den nur sie sah. Erst hab ich auf Durchzug geschaltet, aber auf einmal wurde ich hellhörig: »Du kommst auch noch dran, wart’s nur ab, du denkst wohl, du bist hier sicher, aber du bist auch eine von denen, du kommst mir nicht davon …« Dabei piekte sie mit ihrem Zeigefinger in meine Richtung.
Ich hab sie angeschaut und ganz leise gesagt: »Geht es dir nicht gut? Kann ich irgendwas für dich tun?«
Da ist sie plötzlich wie eine Furie auf mich losgegangen: »Ich warte nur bis zum Einschluss, dann zeige ich dir, was ich mit dir mache!« Und sie fuhr mir mit ihren Krallen ins Gesicht. Jetzt hab ich eine Schramme auf der Backe.
Gott sei dank war die Zellentür offen, so dass ich rausrennen konnte. Auf dem Flur unterhielten sich drei, auf die bin ich zu und hab um Hilfe gebeten: »Was soll ich machen, meine Zellennachbarin ist offenbar wirr im Kopf, sie will mir an die Wäsche!« Eine hat den Notknopf gedrückt, der ist zwar in jeder Zelle, aber ich war zu durcheinander, um ihn zu finden. Dann kam ein Beamter. Unter seinem Schutz konnte ich meine Siebensachen packen. Er brachte mich in eine Einzelzelle, als Ausnahme, hat er gesagt, morgen oder übermorgen würde ich ohnehin auf meine Station verlegt werden. Um die Kranke kümmerte sich der Psychiatrische Dienst. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Bin nur froh, ihr entkommen zu sein.
Samstagabend, Anfang März 2007
Die Zeit verging wie im Flug, meine liebe kleine Julia. Die paar Tage allein in einer Zelle fand ich gar nicht so schlecht. Ständige Gesellschaft von Menschen ist nicht mein Ding, noch dazu, wenn ich mir die Leute nicht aussuchen kann. Aber daran muss ich mich gewöhnen. Nach der Erfahrung mit der Irren wünsche ich mir nur, dass sie einigermaßen normal sind.
Seit zwei Tagen wohne ich mit drei anderen Frauen zusammen. Die Zelle ist etwa so groß wie unsere Küche zu Hause. Rechts neben der Tür, hinter einer dünnen Wand, sind Toilette und Waschbecken. Aus dem Hahn kommt nur kaltes Wasser, man soll schließlich morgens wach werden. Darüber ist eine Ablage für die Zahnputzbecher. In der ersten Zeit hab ich auf der Toilette überhaupt nichts hingekriegt, man hört nebenan jeden Pups. Jetzt mache ich morgens im Bett Bauchgymnastik, nun geht es besser. An den beiden Längswänden steht ein Spind, für jede von uns eine Hälfte, dahinter jeweils ein Doppelstockbett. Neben den unteren sind winzige Ablagen angebracht, wer oben schläft, kann ein paar Sachen auf ein Brett an der Wand stellen. Unter dem Fenster ist ein Tisch mit vier Stühlen.
Mir blieb ein unteres Bett. Ich hasse es zwar, in so einer Art Höhle zu schlafen. Aber wer hier wählerisch ist, hat ein Problem. Und ich brauche nicht noch ein Problem. Das Kopfkissen ist eine Art Keilkissen, die Matratze ebenfalls hart. Zwei Wolldecken werden in einen blau-weiß-karierten Bezug gezogen. Kuschlig fühlt sich anders an, aber alles ist sauberer und gepflegter als in den Aufnahmezellen.
Die anderen Frauen haben Fotos neben und über ihren Betten, von Kindern, von Männern, von Eltern und Freundinnen. Ich habe nicht mal ein Foto von dir, Julia. Ich trage die Bilder in mir, sie gehen niemanden etwas an. Das ist die einzige Form von Privatheit, die ich mir hier leisten kann.
Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich ein Stück Mauer von der Kirche und durch das Gitter geviertelten Himmel. Keinen Baum. Wie hab ich in jedem Frühjahr auf das erste Grün an den Bäumen, auf das erste Amselgezwitscher gewartet! Aber auch daran darf ich nicht denken, ich schiebe solche Gedanken ganz schnell beiseite, wenn sie angeflogen kommen. Wenn wir das Fenster öffnen, hören wir morgens und am späten Nachmittag Krähengekreisch. Die haben wohl in der Nähe ihren Versammlungsbaum. Ob die eine innere Uhr haben? Pünktlich 17 Uhr kommen sie von überallher angerauscht, hocken im Baum und krakeelen.
Ich habe wieder angefangen zu rauchen, was ich in der U-Haft problemlos lassen konnte. Weil meine drei Mitbewohnerinnen rauchen, würde ich ohnehin zugeräuchert werden. Ist nur schade ums Geld. Die Beamtin, die mich eingewiesen hat, meinte, Langstraflerinnen leben in einer Wohngruppe, da sind nur jeweils eine oder zwei Frauen in einer Hütte, so nennt man die Zellen hier. Sobald ich umziehen darf, will ich mir das Rauchen wieder abgewöhnen.
In der Untersuchungshaft ging es lockerer zu, die Bediensteten begegneten uns fast freundschaftlich. Aber da waren wir auch viel weniger Frauen. Hatte man irgendein Anliegen, ging man direkt ins Büro. Hier muss man für jeden Quark einen schriftlichen Antrag stellen. Und in der U-Haft konnten wir die eigenen Klamotten anziehen, auch eigene Bettwäsche benutzen. Sandra war so lieb und hat meine schmutzigen Sachen an der Pforte abgeholt, gewaschen und die sauberen gebracht. Was sie schon alles für mich getan hat, könnte ich nicht mit Gold aufwiegen!
Als ich hierherkam, wurde ich zur Effekte gebracht, das ist der Raum, in dem unser privater Kram, der hier Habe heißt, in Tüten verplombt, lagert. Ich musste mich vor einer Beamtin splitterfasernackt ausziehen. Das ist schon ziemlich demütigend. Dann bekam ich Anstaltssachen: Bettwäsche, Geschirr (Plastik), Besteck (Alu), Anziehsachen. Die Jeans, T-Shirts und das Sweatshirt sind okay, auch mit den Plastiklatschen komme ich klar. Aber du solltest diese Arbeitsschuhe sehen: Hartes, schwarzes Leder, derbe Sohlen, starr wie ein Brett, schiefgelaufene Absätze, der Schnürsenkel des linken einmal geknotet, am rechten kleinen Zeh ein Lederflicken. Außerdem scheuern sie an den Hacken.
»Nehmen Sie die erst mal, Frau Schwarz, sicher finden wir später passende«, hat die Beamtin gesagt.
»Soll ich im Steinbruch arbeiten?«, hab ich gefragt. »Die Schuhe wären gut dafür!«
»Natürlich nicht. Vielleicht erst mal als Hausmädchen.«
Hausmädchen hört sich vornehm an. Ist aber so vornehm wie diese Schuhe, erfuhr ich: Flure und Treppen reinigen und bei der Essenausgabe helfen, je nachdem, wo Not am Mann ist. Beziehungsweise an der Frau.
Hauptsache, ich muss nicht den ganzen Tag tatenlos rumsitzen.
Noch ekliger als die Schuhe ist die Unterwäsche. Buchsen hätte meine Mutter diese Unterhosen genannt; Achselhemden, BH, alles aus kochfester Baumwolle. In die Wäsche hatte ich Namensschilder zu nähen, denn gewaschen wird der Kram aller Frauen in Riesenwaschmaschinen, sagte die Beamtin. Oh nee, das darf ich mir nicht ausmalen. Andererseits will ich nie mehr sogenannte Dessous anziehen. String-Tangas, die in der Pofalte klemmen. Spitzen, die bei jeder Bewegung pieken und jucken. Aber das ist Vergangenheit.
Da fällt mir das erste Weihnachtsfest nach unserer Hochzeit ein, als ich Jochen einen dunkelblauen Kaschmirpullover schenkte. Jede von uns Verkäuferinnen durfte sich ein Stück aussuchen und zu einem dicken Mitarbeiterrabatt kaufen. Die Chefin war erstaunt, dass ich etwas für meinen Mann ausgesucht hatte und nichts für mich. »Nehmen Sie doch die Jacke, Andrea«, hat sie gesagt, »dieses Rot würde an Ihnen toll aussehen! Oder diesen Oversize-Pullover, den Sie zu Leggins oder zu einem engen Rock anziehen können!«
Aber nein, ich wollte Jochen eine Freude machen. Was gründlich schiefging.
Glücklicherweise haben meine Eltern nicht miterlebt, wie Jochen getobt hat: So ein teures Geschenk, zieht er sowieso nie an, braucht nicht solchen Kram, er braucht eine Frau, die ihn anmacht, für das Geld hätte ich mir supertolle Dessous kaufen können, da gäbe es doch jetzt so geile Spitzenbodys, ich solle das gleich nach Weihnachten umtauschen und nicht wagen, für so einen Kram jemals wieder Geld auszugeben …
Ich habe den Pullover wirklich umgetauscht. Ich lief wohl dunkelrot an vor Scham, als meine Chefin das mitbekam. Sie hat mich ganz eigenartig angesehen, aber taktvoll geschwiegen.
Ach, Julia, ich hätte deinen Vater nie heiraten dürfen. Aber welche Tochter hört schon auf die Ratschläge der Mutter? Wirst du eines Tages auf Tante Sandras oder gar mein Urteil achten? Meine Mama hatte nichts verurteilt, nur immer gefragt: »Bist du sicher, dass er der Richtige für dich ist? Liebst du ihn ehrlich? Möchtest du mit ihm alt werden?«
»Nein, nein, nein!!!«, hätte ich am liebsten geantwortet. Hab stattdessen genickt und den Mund gehalten, wie so oft.
Es hat lange gedauert, bis ich mir eingestanden habe, dass Jochens Bemühungen um mich mir lediglich geschmeichelt haben. Seit der Pubertät, als die Mädchen in meiner Klasse anfingen, sich zu schminken und aufzubrezeln, habe ich mich klein und hässlich gefühlt – Busen und Hüften zu dick, die straßenköterblonden Haare zu dünn, schiefe, vorstehende Zähne und ein Segelohr. Und dann, ich war gerade siebzehn geworden, erschien Jochen auf der Bildfläche: zwei Jahre älter als ich und einen Kopf größer, ein Kerl wie ein Schrank, dichtes, schwarzes Haar. Er nahm mich mit auf den Fußballplatz und ins Kino, ging mit mir in die Disco, immer liefen wir Hand in Hand, er tat, als müsse oder wolle er mich beschützen. Aber wovor nur? Blicke ich heute zurück, sehe ich mich als sein Spielzeug, nicht als seine gleichberechtigte Freundin. Andererseits imponierte er mir. Er arbeitete als Schlosser in einer Autowerkstatt, fuhr einen roten Golf, und seine Küsse zeugten von mehr Übung als Jürgens unbeholfene Zärtlichkeiten.
Jürgen war mein erster Freund gewesen. Da war ich 16, und es dauerte nur einen Sommer. Jürgen brachte mir auf der Betonpiste hinter dem Sportplatz das Skaten bei, wir hockten stundenlang vor Opas ehemaligem Schafstall, tranken Cola, erzählten uns Geschichten, knutschten und fummelten ein bisschen rum, mehr kam uns beiden nicht in den Sinn, mir zumindest nicht. Diese erste Liebe endete, als seine Familie wegzog. Ich glaubte damals, die Welt geht unter, so hab ich gelitten. Aber dann tauchte Jochen auf. Er war lustig und lieb, drängte mich erst mal zu nichts, wollte ständig mit mir zusammen sein. Ich dachte, ich sei in ihn verliebt. Dabei gab es Zeichen, die mich hätten stutzig machen sollen.
Einmal wartete Jochen vor dem Geschäft auf mich, als ich mit einem Kunden aus dem Laden trat. Der Kunde hatte mir irgendwas Lustiges erzählt, ich weiß nicht mehr, was, ich musste jedenfalls herzhaft lachen. Kaum saß ich neben Jochen im Auto, hat er mir eine geklatscht und mich angeherrscht, ich solle gefälligst nicht mit anderen Kerlen rummachen, ein für alle Mal solle ich mir das merken, das könne er nämlich überhaupt nicht vertragen.
»Ich habe nicht rumgemacht, und so lasse ich nicht mit mir umgehen, das kenne ich nicht von zu Hause, und das will ich nicht, ich will dich nie mehr wiedersehen!«, hab ich ihn angeschrien, bin ausgestiegen und nach Hause gerannt.
Ein paar Tage gelang es mir, ihm aus dem Weg zu gehen, dann hat er mir aufgelauert und sich entschuldigt und versprochen, nie wieder würde das vorkommen, ich solle nur bitte wieder zu ihm zurückkehren, er würde mich doch so sehr lieben. Und ich dumme Kuh bin drauf reingefallen, und es musste sehr viel geschehen, bis ich wieder den Mut hatte, ihm Paroli zu bieten.
Dass die meisten Jungen im Ort ihm aus dem Weg gingen, hab ich damals nicht gemerkt.
Sogar mein Bruder Michael hatte mich gewarnt: »Schick den zum Teufel, du findest allemal einen anderen!« Aber genau das konnte ich nicht glauben, wenn ich mich im Spiegel sah. Außerdem hatten meine früheren Schulkameradinnen alle einen festen Freund, zwei waren sogar schon verlobt, eine hatte ein Baby.
Ein Jahr später, kurz nach meinem achtzehnten Geburtstag, haben wir geheiratet. Spätestens vor dem Standesamt hätte ich HALT schreien und davonlaufen sollen. Ich sehe noch die entsetzten Blicke meiner Mama: Vor versammelter Verwandtschaft und Bekanntschaft trat mir Jochen in den Hintern, nur weil ihm irgendwas nicht gepasst hatte. Was er dazu sagte, hab ich nicht verstanden. Ich glaube, er hatte vor dem Rathaus den Jürgen gesehen. Ich dachte, mich rammt ein Bus. Und niemand wagte, ihn zur Rede zu stellen. Seine Mutter hatte wieder ihre Duldungsmaske aufgesetzt. Und sein Vater, wie meistens, wenn er unter Menschen war, auf seine Füße gestiert. Ich spürte, wie irgendjemand, ich glaube, es war Tante Hillu, hektisch hinten an meinem Kleid rumwischte, um den Fußtritt unsichtbar zu machen. Und ich schnappte nach Luft und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, was mir nicht gelang. In dem Moment ging es in meinem Kopf zu wie im Schleudergang der Waschmaschine: Ich soll jetzt auf dem Standesamt Ja sagen und nachher in der Kirche auch – wenn ich mich nun umdrehe und davonlaufe, was würde der Pfarrer sagen? Und die Gäste, die kann man doch nicht wegschicken. April, April, ich heirate nicht! Die haben Geschenke gekauft, sich fein gemacht, den ganzen Aufwand können die doch nicht umsonst betrieben haben, die Gaststätte, das Essen, alles umsonst bestellt? Das geht doch nicht. Was sollen die Leute im Ort von mir denken? Ich kam mir vor wie in dem Märchen vom Räuberbräutigam, das ich dir oft vorgelesen habe: Kehr um, kehr um, du junge Braut … Doch ich brachte es nicht fertig umzukehren.
Ich sagte auf dem Standesamt brav JA, und in der Kirche schien mir ohnehin alles zu spät. Ich sagte wieder JA wie in Trance.
»… ihn lieben und ehren in guten wie in schlechten Zeiten …«, heute gestehe ich es, ich hatte wirklich Angst vor der Zukunft. Und ahnte nicht, dass die guten Zeiten bereits vorbei gewesen waren.
Ach, mein Liebling, du bist das einzig Gute, das mir geblieben ist. Aber du bist mir ja nicht geblieben, ich kann dich nicht mehr beschützen. Michael und Sandra haben das nun für mich übernommen. Du fehlst mir wahnsinnig, und ich weiß, wie sehr ich dir fehle. Ich kann nur beten … Nein, ich will jetzt nicht heulen, nicht vor den anderen, die hier herumsitzen, rauchen, quatschen und Kreuzworträtsel raten. Ich muss sehen, wie ich hier zurechtkomme.
Die Frauen sehen nicht aus, als ob sie sich gegenseitig das Duschgel oder die Zigaretten klauen würden. Aber das weiß man ja nie. Die Jüngste ist 23, die Älteste 51, so viel weiß ich bis jetzt, ich bin mit meinen 33 Jahren also in der Mitte. Keine Ahnung, warum sie hier sind. Man bindet das niemandem auf die Nase, jedenfalls nicht, bevor man sich mit einer vertraut gemacht hat. Schon die Zeit in der U-Haft hat mich gelehrt, dass im Knast Vertrauensseligkeit total fehl am Platze ist.
In der U-Haft besuchte mich mal ein Pfarrer. Ein rundlicher, gemütlich wirkender Mann, nicht viel größer als ich. Er reichte mir seine Hand, und ich zögerte, ihm meine zu geben. Er sah mich mit seinen hellen Augen fragend an, und ich stammelte: »Niemand wird mir die Hand geben wollen, wenn er erfährt, was ich getan habe.«