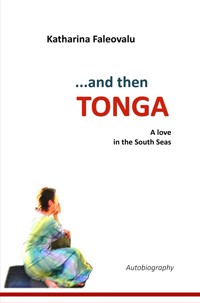12,31 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookmundo
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Katharina reist 1999 gemeinsam mit ihrer Freundin Angelika als Touristin nach Tonga und ahnt nicht, dass sie schon bald, der Liebe wegen, für immer bleiben wird. Der Liebe zu ihrem Mann Semisi, den sie in einer Disco am Hafen der Insel Vava'u kennenlernt, und zur neu gewonnenen Freiheit im Inselparadies. Die weniger sonnigen Seiten auf einer kleinen Insel mitten im Pazifik schälen sich schnell heraus: Einschränkungen, Entbehrungen, Erdbeben, zerstörerische Zyklone, Corona fernab medizinischer Versorgung, der gewaltige Ausbruch des HungaTonga-HungaHa'apai-Vulkans im Januar 2022, der die Inselwelt in ein Katastrophengebiet verwandelt und die Verbindung zur Außenwelt abreißen lässt, wirtschaftliche und existentielle Not. Und zu allem Überfluss droht die Ehe mit dem 20 Jahre jüngeren Semisi beinahe zu scheitern. Katharina Faleovalu, Jahrgang 1955, beschreibt, jenseits der Traumstrände und ohne Kitsch und Klischees, wie es ihr unerschrocken gelingt, in der Südsee Fuß zu fassen und mit ihrem Mann ein Haus und ein Heim zu errichten. Und wie sie und Semisi einen Zipfel vom Glück erhaschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
…und dann TONGAEine Liebe in der Südsee
…und dann Tonga
Katharina Faleovalu
Impressum
Copyright: Katharina Faleovalu
Pangaimotu, Island of Vava’u, Königreich Tonga, Polynesien
Jahr: Juli 2025
ISBN: 97 89 40 38 13 165
Erste Edition
Umschlaggestaltung: Katharina Faleovalu
Photos: Copyright Semisi Faleovalu
Veröffentlicht über: Bookmundo, Delftsestraat 33, 3013AE Rotterdam, NL
Publiziert in Deutschland
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Verfasserin unzulässig.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Diese Edition ist auch als Taschenbuch (ISBN 97 89 4038 03 357) erhältlich.
Die englische Edition ist verfügbar als ebook unter dem Titel:
‘‘… and then Tonga. A love in the South Seas‘‘. (ISBN 87 89 40 38 13 158);
und als Taschenbuch (97 89 40 37 69 851).
1993. KÖLN.
. Barbarossaplatz. BAUHAUS-Hochhaus.
Ich haste die Treppen hinauf und weiß, dass ich wegen des Staus auf der Severinsbrücke zu spät kommen werde...wohin jetzt, nach rechts oder links? Das hat mir gerade noch gefehlt, am ersten Tag zu spät kommen, macht gleich den richtigen Eindruck. Ein Empfangsbereich, eine unausgeschlafene Person plinzelt ärgerlich über ihre Schulter in meine Richtung.
"Der Olivetti-Kurs für Desk-Top-Publishing! Wo soll ich hin?" röchele ich sie an.
Die Person fährt einen Arm mit einem spitzen Zeigefinger aus: "Da lang, Raum 45." Und zischt spitzmündig gleich hinterher: "Sie sind aber zu spät!"
Ich nehme die Klinke in die Hand und atme einmal feste durch. Ich knete ein Lächeln in mein Gesicht. Auf diesen Kurs habe ich vier Monate sehnsüchtig warten müssen.
Ich klopfe kurz, öffne die Tür, trete in den schon leicht stickigen Raum. Die Seminarleiterin verschluckt den Rest ihres Satzes, alle Augen der 25 Kursteilnehmer schwenken zu mir, an meine Handtasche gekrallt stelle ich mich kurz namentlich vor und…
"Einen Platz haben wir noch hier frei, dort hinten. Am Fenster, ja bitte, setzen Sie sich doch zu der Dame, sie hat noch keinen Partner am PC!".
Einen Kurs beginnen und sich den Partner, mit dem man sich dann neun Monate einen PC teilen wird, nicht vorher aussuchen oder anschauen zu können, das ist ungünstig, aber es ist meine Schuld. Ich gehe durch den Raum zu dem mir zugewiesenen Platz.
Meine PC-Partnerin ist eine großgewachsene, schlanke, leicht maskulin wirkende Frau in meinem Alter mit flinken, fröhlichen Augen, kurzen Haaren und sympathischen, kräftigen Händen. Sie trägt Jeans und einen Pullover mit einem Hemd drunter.
Sie lächelt mich an, und, da die Dozentin mit ihrer Einführung fortfährt, raunt sie mir zu: "Setz dich links von mir, ich bin Linkshänderin, wir müssen uns ja die Maus teilen, da kommen wir uns weniger ins Gehege."
"Ich heiße Angelika," wispert sie dann, "ich bin Setzerin."
Sie kommt, genau wie ich, aus der Druckbranche, welch ein unglaublicher Zufall! Wir werden die gleiche Sprache sprechen.
Ich schaue in ihr offenes Gesicht und flüstere: "Und ich heiße Katharina-masel tov, und ich bin Buchherstellerin!"
"Ha!" rutscht es Angelika raus, "Dann werden wir ja jede Menge Spaß hier haben!".
DER FINGERZEIG
Mittagspause. "Katharina...? Komm, lass’ uns ein bisschen den Ring rauf und runter, es ist Frühlingswetter, bisschen die Beine vertreten."
Wir verlassen das BAUHAUS-Gebäude am Barbarossaplatz und gehen langsam den Kölner Ring rauf, wir genießen die Sonne. Bald ist der Kurs zu Ende und wir werden wieder auf Arbeitssuche gehen können.
"Sag' mal..." fängt Angelika nachdenklich an. Und verstummt.
"Was? Was ist denn?" hake ich nach.
"Also. Wir verstehen uns doch gut, und ich dachte...wenn eine von uns mal in Urlaub fahren will...wir haben ja niemand Festes...und ich könnt' mir vorstellen, dass wir gut miteinander auskämen, also was meinst Du, wenn wir mal beide Zeit und wieder etwas Geld haben? Sollten wir das mal machen? Einfach so, irgendwo hin? Zusammen?" spricht sie nach vorne und zu ihren Schuhen.
Ich bin im ersten Moment perplex. Aber mir gefällt der Gedanke.
"Ja, das sollten wir, das ist eine schöne Idee, ja. Und wohin? Ich fürchte, wir werden kaum einen Ort finden, den wir nicht in Grund und Boden giften!" lache ich sie an. "Lass uns gleich mal schauen, träumen kostet nix. Lass uns zu Gleumes gehen, die haben Bücher und Karten über jeden Ort der Welt, lassen wir uns inspirieren!"
Urlaubswillig ziehen wir ein Buch nach dem anderen aus den Regalen, Bildbände, Reiseberichte, Reiseführer. Pauschalreisen sind uns ein Greuel, Resorts und Hotels ebenso. Indien? Zu heiß, und wahrscheinlich jede Menge lila Latzhosen aus der Uni und der alternaiven Ecke der Südstadt. Mittelmeer fällt wegen steigendem Prollfaktor gleich durchs Sieb. China? Wegen des Essens gerne, sprachlich eher weniger ergiebig, wir werden kaum die Einheimischen verstehen. Was bleibt übrig? Alles, wo man sich mit Englisch durchwursteln kann. USA? Um Gottes Willen, Dumpfbacken und Fanatiker haben wir hier auch genug zu besichtigen. Ach nee.. Russland? Njet mit Englisch.
"Angelika! Ich geb's auf, ich weiß nicht, das passt alles irgendwie nicht. Ich will ja nicht wohin, wo es zugeht wie bei uns hier und einige Länder find’ ich einfach öde, wir wollen ja was Neues sehen. Das wird ein Problem, meine Liebe!".
Nichts passt, kein Name eines Landes zündet einen Funken. Wir stecken alle Bücher wieder in die Regale.
"Na prächtig, die Welt ist nicht groß genug für uns, wir haben ja an allem was zu meckern." nörgele ich und schaue mich um.
In einer Ecke am Ende des Verkaufsraums steht ein großer, hölzerner Globus.
"Dahin jetzt, aber etwas lebhaft!" rufe ich Angelika zu und zeige auf den Globus. "Ah!" meint Angelika, stellt sich an den Globus und starrt ihn an, "Und jetzt?"
"Und jetzt," verkünde ich mit erhobenem Zeigefinger, "werden wir eine höhere Macht darüber entscheiden lassen, wohin wir reisen sollen. Du drehst den Globus und ich mach die Augen zu und wo immer ich hintippe...”
Angelika schaut mich ausdruckslos an: "Das allerdings verkürzt den Entscheidungsprozess erheblich."
Ich schaue ausdruckslos zurück: "Ruhe jetzt. Du drehst. Ich stippe den Finger.".
Sie dreht den Globus, ich kniee davor, schließe die Augen und warte, bis der Globus austrudelt.
Ich stippe.
Ich öffne die Augen, Angelika kniet sich neben mich. "Und..?” frage ich. "Moment mal," nuschelt sie, "irgendwie bist Du mitten im Meer gelandet, das ist aber ‘ne Ecke weg von hier!"
Jetzt sehe ich es auch, mein Finger steckt mitten in einem riesigen blauen Gebiet.
"Damit hat sich das erledigt, wir werden wohl kaum eine Bötchentour dahin machen...warte mal," Angelika greift sich meinen Stipp-Finger, "vielleicht ist ja noch was drunter?"
Ich drehe die Fingerspitze langsam zur Seite und tatsächlich kommt dort ein winziger brauner Fleck zum Vorschein, flankiert von ein paar fliegenbeinigen Buchstaben.
"Was steht da? Kannst Du das lesen? Warte...da steht TONGA. Wo sind wir überhaupt? Oh Gott, mitten im Pazifischen Ozean, in der Südsee? Was ist TONGA?"
Nelson Mandela wird Präsident von Südafrika, O.J. Simpson wird angeklagt. Es ist 1994.
NACH TONGA? ECHT?
Fast 5 Jahre später. Köln. Sommer. Autobahnkreuz Köln-Süd. Der obligatorische abendliche Berufsverkehrstau. Ich komme aus Bonn, von meiner Arbeit in einem Institut der Universitätskliniken als Multimedia-Expertin und Übersetzerin auf dem Venusberg, ich bin müde und will nur noch heim, alle Türen und Fenster öffnen und mich endlich in den kühlen Garten setzen und ein bisschen Sonne genießen. Die Katze streicheln, in den Beeten zupfen, den Piepmätzen lauschen.
Die Augen brennen, die rechte Schulter sticht, mein Bauch krampft, die konzentrierte Bildschirmarbeit macht mich steif. Es ist heiß in meinem kleinen Twingo, die Sonne geht riesig und eigelb direkt vor mir am Ende der Blechschlange am Horizont ganz langsam unter. Ich zünde mir eine Zigarette an, mein Mund ist pelzig, ich versuche, mich ein bisschen zu strecken, lockere den Gürtel meiner Jeans, ich klebe. Alle Autos kommen zum Stillstand. Ich schaue bewusst in die anderen Autos. In jedem sitzt nur ein Mensch. Tausende von Autos, in jedem hockt ein Mensch und kommt von der Arbeit. Wie völlig absurd, abstrus, unwirklich, bizarr. Alle schauen nach vorne, alle wollen nur weg hier. Keiner lächelt. SWR3 verbreitet zwanghaft gute Laune und die neuesten Nachrichten über Monica Lewinsky und Amerikanische Botschaften in Afrika, die eine nach der anderen in die Luft gejagt werden. In Oklahoma hat ein Irrer ein Bürohaus in Schutt und Asche gebombt.
Mir langt es. "Schluss jetzt!" fahre ich das Radio an und knipse es mit einer Grimasse aus. Es stinkt nach Abgasen und heißem Teer und Gummi, mein Aschenbecher quillt über, ich habe Durst.
Aus meiner Handtasche krose ich mein Handy, ich bin eine der wenigen, die überhaupt eins hat. Die Biester sind überteuert und klobig und eine Einheit kostet fast zwei Mark und dazu kommt noch die horrende Grundgebühr. Sie firmieren unter "Yuppyknochen".
Angelika hatte es mir zum 42. Geburtstag geschenkt. Und dabei wehmütig gelacht: "Meinst Du, wir schaffen es jemals noch, nach Tonga zu kommen? Entweder hast Du keinen Urlaub oder ich nicht...und alle unsere Freunde ziehen uns weiter durch den Kakao wegen dieser Schnapsidee, wir hätten es eben niemandem erzählen sollen! Jedesmal, wenn ich Jörg anrufe, blökt er mich an 'Na, immer noch nicht in Tonga?'. Na, lass mal, war ein netter Running Gag. Aber langsam kann ich's nicht mehr hören!"
Ich auch nicht.
"Mama...? Ich steh schon wieder im Stau. Ich muss mit jemand sprechen, sonst dreh’ ich durch!"
Meine Mutter lacht herzhaft: "Ja, Kind, dann mach mal! Wolltest ja in Köln wohnen bleiben! Dann musst Du das eben in Kauf nehmen.".
Sie amüsiert sich: "Erinnere Dich an meine Staus? Jahr um Jahr vom Venusberg hierhin nach Siegburg und Sankt Augustin, weißt Du noch? Sei nicht so mäsig, hast doch eine schöne Wohnung, eine tolle Arbeit und bist auch bald zuhause. DU hast doch keinen Grund zu klagen!".
"Ja, schon." schiebe ich, mich windend, ein, "Jaaa. Besser könnte es kaum sein. Ich weiß ja!"
"Also ruf mich an, wenn du angekommen bist und dich umgezogen hast und einen Moment Ruhe hast. Und noch was...sei froh, dass du zu Hause keinen Mann hocken hast, der jetzt auch noch bekocht werden will!" wimmelt sie mich liebevoll ab.
Meine Mutter hat die Eigenschaft, mich schnell wieder auf die Schiene zu setzen, überflüssiges Geschwätz abzuwürgen und massive Nervereien in kleine Unpässlichkeiten zu verwandeln. Recht hat sie, wie fast immer.
Mein Leben als Single habe ich mir recht passend gemacht, kein Mann stört meine Kreise in der Wohnung. In einer Großstadt kann man beziehungstötenden Untiefen elegant aus dem Weg gehen. Sogenannte "Beziehungen": Ja; Zusammenleben: Nein.
Und Heiraten steht völlig außer Frage, das werde ich mir im Leben nicht antun.
Im Schneckentempo krieche ich schwitzend die Abfahrt Frechen rein, jetzt nur noch ein paar hundert Meter auf dem Nadelöhr Aachener Straße in Richtung Weiden und ich kann aufatmen. Am Einkaufszentrum vorbei, an kühlenden Grünanlagen und blühenden Gärten vorbei, ab in die Tiefgarage und hinein in meine geliebte Wohnung.
Ich ziehe die Rollladen an der Terrassentür, den Fenstern im großen Wohnzimmer mit Erker und im Schlafzimmer hoch, öffne alle Türen und Fenster, alle gehen nach Süden in Richtung Garten. Warm-würzige Luft und milde Sonnenstrahlen durchfluten mein Apartment. Meine Katze wacht verschwiemelt auf und begrüßt mich wie ein Schaf mit einem klagenden "Mäh!", streckt sich, streift mir um die Beine und hoppelt wie angestochen in den großen Garten. Sie inspiziert jeden Grashalm einzeln, so, als wär er gestern noch nicht dagewesen. Sie beginnt ihre "Inspektionstour".
Was für eine glückliche Katze; welch ein Unterschied zu der Zeit, als ich sie bekam. Sie war schlecht behandelt worden vom Vorbesitzer, durfte nur ein Mal am Tag kurz fressen und war gezwungen worden, nur auf einer Stelle auf dem Sofa zu hocken und lediglich dekorativ auszusehen. Sie durfte sich nicht frei bewegen. Man hatte sie täglich eingepudert mit fetthaltigem Talkumpuder und dann den Puder mit einem lauten Staubsauger wieder aus dem Fell gesaugt. Ich erfuhr dies vom Halter, der stolz war, dass die Katze so "gepflegt" ausschaute und wohlerzogen war.
Das alles nur, weil sie als Perserkatze geboren worden war. Als sich ihre Fellfarbe änderte, wollten die Besitzer sie loswerden, denn sie war "nichts mehr wert". Ich habe ihr damals als erstes die langen klebrigen Haare ratzfatz bis auf einen Zentimeter runtergeschnitten.
Sie fand heraus, dass sie sich selbst nach Katzenart putzen konnte. Und essen durfte, wann immer sie wollte. Und aufstehen und herumlaufen. Sie konnte es anfangs kaum glauben und bei der kleinsten Bewegung, die ich machte, huschte sie geduckt zurück in ihre Sofaecke und sah mich angstvoll an.
Und weil sie so grimmig aussah, bekam sie den Namen Bruno.
Raus aus den Schuhen, dem Seidenblüschen und den farblich passenden Jeans und rein in meine Flickenjeans und das ärmellose T-Shirt. Das ist besser! Barfuß, Schläppchen an und ein kleines Abendessen machen, Knäckebrot und gekochter Schinken, dazu eine Riesentasse Earl Grey. Bloß raus, raus auf die luftige Terrasse. Ich räkele mich in meinem Gartenstuhl, die Beine liegen auf dem Tisch, ich spreize die Zehen.
Licht, Luft, Sonne, Sommer.
Ich esse langsam mein Knäckebrot und blinzele in die Bäume, 13 Meter hohe Robinien, durch deren fedrige, helle Blätter ab und zu Sonnenstrahlen fallen, ein Eichhörnchen huscht in der Krone und der Gesang der Vögel wird niemals langweilig. Hinter der Hecke spielen Kinder, sie kreischen und lachen, irgendwo rattert ein schwachbrüstiger Rasenmäher. Bruno sitzt in meiner Blumenrabatte und schaut schielend und kopfzuckend einem zappelnden Schmetterling hinterher.
Ich schließe die Augen und möchte dies nur noch genießen. Endlich habe ich das, worauf ich viele Jahre lang gehofft hatte: eine interessante und abwechslungsreiche Anstellung, endlich eine ohne Mobbing und Missgunst, ein gutes Gehalt, eine schöne Wohnung mit Garten. Gesundheit. Ich bin rundum zufrieden, keine großen Sorgen, ich bin glücklich. Mit geschlossenen Augen lasse ich noch einmal mein Leben Revue passieren:
Der Weg war lang und steinig gewesen nach dem Tod meines Vaters, ich war gerade 11 Jahre alt. Meine Kindheit war sehr behütet, und auch meine Jugend. Nicht, dass ich mit Materiellem verwöhnt worden wäre. Mama und Papa waren arm und sehr jung, als ich geboren wurde. Es hat mir nie gefehlt an Liebe und Verständnis, Urvertrauen. Mama kochte Schweinepfoten aus, damit wir eine Soße zu den Kartoffeln hatten; es hat immer geschmeckt, es war immer genug. Papa konnte sich freitags eine Flasche Bier gönnen. Apfelsinen und Äpfel waren rar, weil teuer.
Ich habe nie etwas vermisst.
Ein Kapital, das einen ein Leben lang haushalten lässt.
Aber Papa starb 1966 als ich 11 wurde.
Er war Geschäftsführer mehrerer Eisenhüttenwerke geworden. Wir lebten im Saarland, in einer großen Wohnung mit Garten und Pool. Ich stromerte auf den Äckern, streichelte Kühe, baute im Regen Schlammdämme, erntete Haselnüsse und durchstreifte den Wald mit meinem Hund Tessi, tobte mit meinen Spielkameraden im Heuschober. Fahrradrennen, tote Frösche in der Lederhosentasche, Kirschbäume hochklettern, nackte Füße in warme Kuhfladen stecken und sauber waschen im Bach. Kinderglück.
1966 strudelte Commander McLane in RAUMPATROUILLE in seinem Raumschiff Orion aus einem Badewannenausgusswirbel in das Weltall. Der erste Spatenstich für das World Trade Center wurde gemacht, der Vietnam-Krieg war in vollem Gang, Captain Kirk übernahm die Brücke der Enterprise.
Noch hatte kein Mensch den Mond betreten.
Aber dann starb Papa.
Meine Mutter musste wieder arbeiten gehen, wir zogen um, vom Saarland in das Rheinland, nach Siegburg. Mama mietet eine kleine Wohnung unterm Dach, sie arbeitet von morgens sechs bis sehr spät abends. Meine Verzweiflung, Trauer und Hilflosigkeit scheinen grenzenlos, es ist niemand da, mit dem ich reden kann. Ich bin so alleine. Meine beste Freundin, meine Hündin Tessi, können wir nicht mehr versorgen, wir geben sie an Verwandte mit einem Garten. Sie kümmern sich mehr schlecht als recht. Ich habe Albträume, wache nachts schreiend auf, falle aus dem Bett.
Ich bin in der kleinen Wohnung wie eingesperrt, keine Äcker, keine Bäume, keine Kühe. Ich ersticke. Ich muss mich alleine zurechtfinden, morgens ist Mama schon fort wenn ich aufstehe, ich mache mir Frühstück, ziehe mich an, schließe die Wohnung ab und trotte zum Bus, durch die halbe Stadt.
Ich bin jetzt ein Schlüsselkind.
Ich muss in eine Klosterschule als Halbinterne, wenigstens Mittagessen und Hausaufgabenaufsicht sollte ich haben. Ich komme spät nachmittags wieder heim, schließe die Wohnung auf, bin wieder alleine mit mir und meiner Haltlosigkeit. Ich finde keinen Halt, alles schwimmt. Oft sahen Mama und ich uns tagelang nicht, sie verließ das Haus vor mir und kam heim, wenn ich schon schlief.
Plötzlich bin ich kein Kind mehr, ich bin ein Teenager, die Hormone spielen verrückt, ich werde eine Frau. Ich sitze in einem Karussell, es dreht sich schneller jeden Tag.
Mit den massiven Problemen einer "Ungläubigen", weil evangelisch, in einer katholischen Nonnenschule, musste ich alleine fertig werden. Seitdem habe ich eine tiefe Abscheu gegen alles, welches das Wort "christlich", und besonders "katholisch”, in seinem Banner trägt. Für mich klebt an diesem Wort der Geschmack von “bigott, verlogen, falsch, raffgierig, ungerecht und menschenverachtend”.
Die großen Schulferien sind kein Grund zur Freude für Mama, sie hat keinen Urlaub, was soll mit mir geschehen, ich wäre wochenlang unbeaufsichtigt. Mama kennt meine Liebe zu Tieren, insbesondere zu Pferden, sie weiß, wie sehr ich mich quäle in der Stadt ohne Garten. Sie hat einen Vorschlag: “In Elmshorn gibt es eine Reit- und Fahrschule. Dort würdest du alles über Pferde lernen, aber auch anpacken müssen, auch Ställe ausmisten. Du würdest dort die Ferien über wohnen, bist versorgt. Da kannst du auch das Reiterabzeichen machen oder einen Kutschenführerschein, es liegt ganz an dir. Du müsstest morgens um sechs aufstehen und hast Stalldienst, und dann hast du erst um fünf nachmittags wieder frei.”
Ein Traum für mich. Ich bin begeistert. Mit vielen anderen gleichaltrigen Pferdeliebhabern schlafe ich in Etagenbetten in einfachen Sechs-Bett-Zimmern über den Ställen, miste morgens und abends den Stall aus. Voltigieren, Dressurreiten, Springen, Tagesausritte. Nachmittags Theorie, Pferdekrankheiten, Sattelpflege, wie spannt man ein Pferd in eine Kutsche, wie lenkt man einen Zweispänner auf der Straße, Terminologie, rechtliche Aspekte.
Ich schaffe das kleine Reitabzeichen, erwerbe den Kutschenführerschein für den Straßenverkehr. Ich bin ein bisschen stolz. Zwei Mal verbringe ich die Sommerferien in Elmshorn. Ich verspreche mir, irgendwann einmal ein Pferd zu besitzen. Ich liebe den Duft der Pferde, ihre samtigwarmen Nüstern und ihre großen, sanften Augen.
Zurück in Siegburg kehrt der einsame Alltag wieder ein.
Der Marktplatz in Siegburg mit seinen Bänken ist Treffpunkt der Jugend. Ich beginne, die Schule zu schwänzen, suche Freunde, Gesellschaft. Hippiezeit. Lange Haare, Fellmäntel. Aufbegehren. Billiger Rotwein, Feten in dunklen Kellern, Garagen, Lagerhallen. Meine Clique zieht mit Kreidler-Mopeds durch Siegburg, mit mir auf dem Rücksitz, ich habe einen “boyfriend”.
Mama ist alarmiert. Meine Schulnoten sind schlecht. Sie fragt mich, ob ich so weitermachen möchte. Ich bin ehrlich und sage “Nein!”. Wir beraten. Ihr Vorschlag: raus aus Siegburg, raus aus dem Kreis. Wie wäre es mit einem Internat? Ein neuer Anfang? Und wo? Nahe bei oder weit weg? “Weit weg, Mama, bitte weit weg!”
Ich ziehe um, in das Jugenddorf in Versmold, Norddeutschland. Ich fühle mich besser. Mein Internatsfreund schenkte mir die erste LP von Neil Young und ich war vollkommen hingerissen. Für unter 10 Mark gab es Konzertkarten für Jethro Tull, Ten Years After, Deep Purple. Die Rolling Stones verlangten 15 Mark. Ich ging trotzdem hin. An vielen Wochenenden brausen wir mit seinem VW-Bulli nach Amsterdam. Gefangen habe ich mich noch lange nicht. Nach zwei Jahren schaffe ich das gesetzte Ziel nicht, ich rassel durch die Prüfung für die Mittlere Reife.
Sitzengeblieben. Mama tobt. Und weint.
Ich muss zurück ins Rheinland. Ich will nicht mehr in eine Schule.
“Gut,” sagt Mama, “dann schauen wir mal nach einer Anstellung für dich, denn wenn du nicht zur Schule gehst, dann musst du arbeiten.”
Mir ist alles egal. Ich habe Mama bitter enttäuscht.
Schmerzende Scham. Ratlosigkeit.
Sie nimmt mich mit nach Siegburg, meint, ich könnte ja gleich mal vorstellig werden, irgendwo halt. Wir gehen den Marktplatz hinauf.
“Hier,” sagt sie und deutet auf ein großes Schuhgeschäft, in dem ich gerne meine Schuhe kaufe, “hier gehen wir jetzt rein und fragen, ob du als Schuhverkäuferin anfangen kannst. Vielleicht hast du Glück.”
“Mamaaaa…!”
Ich begreife. Endlich. Ich bin ein rücksichtsloser Trampel geworden.
Ich umarme sie, mitten auf der Straße, weine. “Nein, ich will zur Schule. Ich will lernen.”
In Bonn will ich die Mittlere Reife nachholen. Der Schulweg ist lang, fast zwei Stunden hin, zwei zurück. Einkaufen, Essen kochen. Hausaufgaben. Haushaltspflichten. Ich schaffe die Mittlere Reife. Weiter.
Das Gymnasium in Sieglar nimmt mich auf. Die Schulleiterin: “Dir ist bewusst, dass du nochmal sitzen bleiben wirst? Dein Wissen ist sehr lückenhaft. Willst du es trotzdem tun? Willst du ackern und das Abitur schaffen?”
Ich will. Und bleibe noch mal sitzen, und gehe vorwärts, aufgeben gilt nicht. Die Noten bessern sich.
Mama wird eine neue Stelle angeboten, mehr Verantwortung. Sie wird “das Vorzimmer” in einer Klinik der Universitätskliniken. Ihre Arbeitszeiten sind geregelter, wir haben mehr Zeit füreinander.
Endlich wieder ein Familienleben.
Wir ziehen nach Sankt Augustin in ein großzügiges Einfamilienhaus mit Garten. Das Haus ist mit Efeu bewachsen, Vögel nisten dort. Ich lege einen kleinen Teich an, Frösche ziehen ein. Wir haben Äpfel und Pfirsiche im Garten. Die Jahre vergingen. Wir waren glücklich, hatten keine großen Sorgen; einen Garten, eine Katze. Eine Terrasse. Oft sitzen wir an den Wochenenden bis zum frühen Morgen im Wohnzimmer und reden, erzählen, arbeiten viele Jahre auf.
Ich gehe nach Siegburg abends, ins Zamamphas, der angesagten Kneipe. Man trifft sich, kennt sich seit vielen Jahren, ratscht, bandelt an.
Ich treffe einen Afrikaner. Beide vorsichtig. Tastend.
Ein Nigerianer, die Nationalität ist kein guter Leumund. Und doch. wir reden. Mama mag ihn. Er spricht nur Englisch, mein Schulenglisch ist “ausreichend”, somit eben nicht ausreichend. Ich quäle mich, er auch. Es funkt. Er ist Pilot, fünf Jahre älter als ich, auf einem Ausbildungskurs in Rotterdam, nur in Siegburg, weil ein Freund ihn eingeladen hat. Er muss wieder nach Rotterdam.
Ich zuckel jedes Wochenende nach Rotterdam.
Er muss zurück nach Nigeria.
Ich fliege nach Nigeria. 1975, 1976, 1978. Kulturen und Weltanschauungen kollidieren krachend. Er hat im Biafra-Krieg gekämpft; er ist Ibo, die Wunden heilen nicht. Wir durchleben einen Militärcoup. Wir trinken zu viel. Wir fühlen zu tief, zu heftig. Wir streiten. Versöhnung. Er wird mich später in Köln besuchen, ich werde ihn in England bei einer weiteren Fortbildung besuchen. Der Weg zueinander ist zu weit. Die Lebenswege werden durch Kontinente getrennt. Die Zukunft ist nicht für uns bestimmt.
Menschen sind Bestien. Der Fäkalgestank der Kloake des offenen Rassismus’ blubbert hoch und öffnet sich aus stinkenden Blasen. Freunde wenden sich ab, die Verwandtschaft zerreißt sich das Schandmaul.
Wir werden uns jahrzehntelang nicht aus den Augen verlieren. Telephonieren, mailen.
Bedauern; jedes Mal.
1977 schaffe ich das Abitur und will studieren. Tiermedizin, mein Traum, ist mir durch den Numerus Clausus versperrt, ich bin kein Einser-Abiturient.
Um meinem Grundsatz "...immer für eine Überraschung gut!" auch in diesem Falle gerecht zu werden, entschied ich mich kurzfristig für das Studium Afrikanischer Sprachen, der Völkerkunde und der englischen Sprache.
Mama war nicht sonderlich begeistert gewesen und brummelte etwas von "brotloser Kunst". Doch je mehr Informationen ich sammeln konnte, desto sicherer war ich, dass ich genau das alles lernen wollte. Ich wollte wissen, warum und wie andere Menschen die Welt sehen, ordnen und werten. Ein solches Studium gab mir die Möglichkeit, meine eigenen kulturellen Werte erneut zu analysieren und neu zu ordnen.
Für meinen Lebensunterhalt muss Mama nicht mehr aufkommen, ich erhalte eine kleine Rente durch meinen Vater während meiner Ausbildung an der Uni; sie reicht mir für das Nötigste. Ich lerne den Umgang mit Geld. Für “Extras” gehe ich Putzen, werde Nachtwächter, Küchenhilfe, Bedienung.
In unserem Swahili-Sprachkurs saßen ganze vier Studenten, einer davon war ein emeritierter Professor aus Tansania.
Ich zog bei meiner Mutter aus und in das Studentendorf Hürth-Efferen ein. Meinen alten rostroten VW-Käfer mit undichtem Schiebedach, immerwährender Heizung und regelmäßiger Nackendusche nahm ich mit. Auch mein Aquarium. Außerdem meinen festen Willen und eine gehörige Portion Unrast, Neugier und Tatendrang. Ich ging in eine neue Welt.
Im ersten Semester fuhr ich jede Woche einmal in das größte Kino auf dem Kölner Ring und schaute mir begeistert an, wie Luke Skywalker im ersten "Krieg der Sterne" das Universum von galaktischen Asthmatikern befreite, das Kino war immer gerammelt voll. Ich bekam nicht genug von den Spezialeffekten.
Ich schnupperte zum ersten Mal in die Politik, nahm an Demos gegen Pershing-Stationierungen teil, stampfte eine "Dorfzeitung" mit dem ASTA als Sponsor aus dem Boden und organisierte die ersten Wahlen im Studentendorf. Ich war schwer stille zu bekommen, war bekannt wie ein bunter Hund.
Die "Rocky Horror Picture Show" riss mich in ihren Bann, jedes Wochenende schleppten wir Wasserpistolen, Klorollen, Reis und uns -verkleidet natürlich! - in das Kino im Unicenter. Ich glaube, ich war die einzige Studentin an der Uni, die es gewagt hat, unter dem Thema "Zeitgenössischer englischer Film" eine Seminararbeit im Fach Anglistik über diesen Film vorzulegen.
Zusammen mit dem fertigen Seminarpapier übergab ich dem Professor eine Kinokarte, denn er musste sich den Film ja ansehen. Er war ein unauffälliger "Durchschnittstyp", immer im Anzug, ein bisschen steifgedreht. Wohlweislich hatte ich ihm eine Karte für eine der schwach besuchten Nachmittagsvorstellungen gegeben. Als ich die Seminararbeit in seinem Zimmer mit einer runden "2" zurückbekam, schaute er mich schmunzelnd und fast verschwörerisch an: "Sie studieren aber doch sicher nicht auf Lehramt...oder?". Mir rutschte ein: "Um Gottes Willen! Nein!" heraus, worauf er fast übermütig meinte, er wünsche mir dann noch viel Erfolg, insbesondere mit dem Papierkram, denn bisher hätte kein Anglistikstudent auf Magister studiert, ich solle die Institutsverwaltung mal mit der Nase drauf stoßen, sonst könnte es Probleme beim Examen geben. Dank seines Hinweises gab es keine Probleme. Die Verwaltung kam aber leicht ins Schwitzen.
Eines Nachmittags, während eines seiner Seminare: ich sitze in meiner ausgewaschenen Jeans zwischen Gaberdinhosen und Schnürschuhen, Kostümchen und Pumps. Und kleinen Ledertäschchen, in denen PARKER-Kulis wohnen. Ich bin umzingelt von angehenden Lehrern, die ihre Beihilfezahlungen, langen Ferien und fetten Pensionen schon in greifbarer Nähe haben. Mein übergroßes Flanell-Holzfällerhemd passt farblich zu den knallroten Rollschuhen, die am Ende meiner dezent übergeschlagenen Beine haften. Die habe ich aus New York mitgebracht, der neueste Hit.
Vorne geht es um Literatur, um Politik, der Prof hätte gerne eine Diskussion. Ich schaue ihn an und drehe gaanz langsam meinen Kopf hin und her. Das wird nicht hinhauen, ich denke, er hat's nicht mitbekommen.
Plötzlich läuft er puterrot an, schnappt nach Luft, beugt sich mit einem Ausfallschritt kämpferisch nach vorne und speit die Pumps und Schnürschuhe an: "Wenn ich euch mit eurer Scheiß-Beamtenmentalität da sitzen sehe, dann kommt mir die kalte Kotze hoch!" Ich sitze verblüfft da und brauche einen Moment, um zu begreifen, was jetzt gerade passiert ist. Bevor ich es richtig begreife, entfärbt er sich wieder, lächelt fein und raschelt mit seinen Unterlagen "Und nun weiter mit dem Text, ja?".
Das wird nicht mein letztes Seminar bei ihm gewesen sein.
Nach bestandener Zwischenprüfung flog ich mit einer Studienkollegin nach New York. Wir haben ein bisschen gespart dafür, suchen einen Billigflieger, ergattern ein Retourticket für 500 Mark. Uns fällt nicht auf, dass es entschieden zu preiswert ist. Der Abflug erfolgt nicht in Deutschland, sondern in Holland. Noch immer klingeln bei uns keine Alarmglocken. Wir holen die Tickets dort am Flughafen an einem Schalter ab, wir stehen weit vorne in einer Schlange aus genauso jungen und auch nicht sonderlich begüterten Menschen. Verschlissene Rucksäcke, Turnschuhe. Wir bekommen unsere Tickets. Plötzlich Unruhe. Das letzte Drittel der Schlange fängt an zu zetern, ein kleiner Aufruhr. Es gibt keine Tickets mehr, der Billigflieger ist überbucht. Wir ducken uns, umklammern unsere Tickets und hasten mit unseren Rucksäcken zum Check-in. Wir treten von einem Bein auf das andere. Geschafft. Bloß los und rein in den Flieger.
In New York angekommen nehmen wir die U-Bahn nach Manhattan, wir wollen dort eine Bleibe finden, mittendrin. Würden wir ein Hotelzimmer nehmen, dann wäre unser Budget nach drei Tagen erschöpft gewesen. Wir sind etwas ratlos, stromern durch die Straßen, fragen. Man sagt uns, dass das YMCA ideal wäre, sehr preiswert, ideal für Backpacker, zentral, 42. Straße. Natürlich kein Komfort, aber voller Menschen aus aller Herren Länder. Das hört sich gut an. Wir checken ein. Petra nimmt ein Zimmer mit Bett für drei USD pro Nacht, ich möchte im Luxus schwelgen, nehme eins mit abgestoßenem Waschbecken und rostiger Armatur, der flackernde schwarzweiß Fernseher liegt in den letzten Zügen. Dafür muss ich fünf USD zahlen. Das Gebäude wimmelt vor Ratten und stinkt erbärmlich. Macht nichts, wir kommen eh nur zum Schlafen dorthin. Wenn wir das Licht anknipsen, huschen die Kakerlaken in die Risse in den Wänden und unter das Bett. Wenn das Mama wüsste!
Wir durchstreifen Manhattan. Manhattan bei Nacht vom Empire State Building. Gegessen wird billig in Chinatown. Greenwich Village. Augen füttern in Konsumtempeln. Im YMCA mit hoffnungsfrohen Musikern im Gemeinschaftsraum zusammensitzen, Menschen treffen. Dann folgen wir Einladungen von Petras Verwandten, wir schlingern mit AMTRAK nach Chicago, erklimmen den Sears-Tower. Schlafen im Gästezimmer, essen mit der Familie. Wir fühlen uns wohl. Es wird Zeit, wieder nach New York zu gehen. Das Geld geht zur Neige, ich kaufe noch schnell ein Paar Rollschuhe, der Abflugtermin steht. Mit dem kläglichen Restgeld von 20 USD in der Tasche erscheinen wir im Flughafen und gehen zu unserem Schalter.
Dort erkennen wir unsere Mitflieger aus Holland wieder, aber irgendwie ist die Gruppe unruhig, diskutiert, gestikuliert. Man teilt uns mit, dass unser Billigflieger pleite sei, die Tickets nichts mehr wert. Wir müssen ein normales Ticket kaufen, wenn wir wieder nach Deutschland wollen. Das wird sich mit 20 USD für zwei Personen kaum bewerkstelligen lassen, wir schauen dumm aus der Wäsche. Wir besitzen keine Kreditkarten. Wir kauern uns in eine Ecke, warten ab. Einige haben genug Geld und kaufen sich Tickets. Die restliche Hälfte aber ist genauso abgebrannt wie wir. Das Personal versucht zu helfen, fragt diverse Airlines um Hilfe, Pakistan Air, andere. Alle winken dankend ab. Wir alle beraten. Einer aus der Gruppe hat einen Draht zu Regierungsstellen in Deutschland, es folgen lange Telephonate. Deutsche gestrandet im Ausland, kein Geld, Airline pleite. Stunden vergehen, wir haben Hunger, Durst. Wir werfen unser letztes Geld einem Hamburger-Stand in den Rachen, wenigsten nicht hungrig sein. Dann die erlösende Nachricht: Lufthansa wird uns am nächsten Tag nach Frankfurt fliegen, auf deren Kosten. Wir übernachten alle im Flughafen in einer Schalterhalle.
Das Lufthansa Personal ist wenig begeistert, als eine Horde ungewaschener, hungriger Langhaariger den Flieger stürmt. Man lässt uns spüren, wie unerwünscht wir sind. Solange wir Essen bekommen und keine Prügel ist uns das eigentlich schnuppe. In Frankfurt angekommen fische ich ein paar deutsche Münzen aus meiner Jeans und rufe meine Mutter an, sie muss uns abholen. Sie findet uns über unsere Rucksäcke drapiert schlafend in der Ankunftshalle. Sie schleift uns in ein Restaurant: “Esst, Kinder, esst, und erzählt mir alles im Auto!”
Die 80er Jahre hatten begonnen, die ersten Popper, angepasste Karrieremenschen mit Papas Porsche, wagten sich in die Öffentlichkeit.
Ich flitzte in den Rollschuhen durch die heiligen akademischen Hallen. Ich färbte meine hüftlangen Haare hennahexenrot und bemalte meinen Käfer in Knallfarben.
Ich liebte Köln und seine Kneipen, die Offenherzigkeit, die Schwulen- und Lesbenszene. Das Studentendorf mit seinen Feten und Menschen aus allen Ecken der Welt. Hier konnte man atmen. Und das beste Bier der Welt trinken. Und ich habe nie mehr in meinem Leben so viele Packungen Miracoli für 1,99 Mark, "Eine Portion", mit anderen geteilt, und sie mit mir!
Ich lernte Boris kennen, einen untypischen BWL Studenten, er lebt mit seinem Partner Michael zusammen, in einer kleinen Wohnung unterm Dach. Wir zwei lieben es, durch das Kölner Nachtleben zu streifen. Wir lästern über alles und jeden. Wir versacken im TIMP, im Stiefelknecht, in schrillen Diskos. Frühmorgens poltern wir gackernd die Treppe hoch in die Dachstube, ich röchele meinen Rausch in der Sofaecke aus. Während Boris und ich dann am nächsten Tag mit einem Monsterkater auf der Suche nach Kaffee und fettigem Essen marodierend in die Küche einfallen und uns am Tisch festklammern, sitzt uns vis-a-vis ein uns stumm und vorwurfsvoll mit glühenden Augen maßregelnder Michael, er raschelt indigniert mit dem Handelsblatt und schaut uns abschätzig an: “Diese Geldverschwender schmeißen gutes Geld für Trinkgelage raus, führen ein unproduktives Lotterleben, sind nachts laut, riechen nach Zigarettenqualm und essen mir hier die Haare vom Kopf!” steht quer auf seiner Stirn. Recht hat er. Michael wird später Controller der Finanzen eines großen Textilunternehmens; er konnte seine Obsession zum Beruf machen. Nicht jeder kann dies, ohne im Gefängnis zu enden.
Dann hatte ich meinen Magister. Ich habe viel gebummelt an der Uni. Ein wenig zu viel. Aber wenigstens lag ich Mama nicht auf der Tasche. Will es auch weiterhin nicht, aber meine Ausbildung ist beendet. Und jetzt? Dr. phil. werden? Nein. Mir hatte es gereicht, das Kleine Latinum in drei Monaten ohne Atempause zu absolvieren, mir fehlte die Kraft für das Große Latinum. Ich wollte "was machen", etwas Neues. Ich wollte eine normale Arbeit, nicht mehr, wie im Studium, für ein paar Mark die Stunde Restaurantküchenhilfe, Nachtwächterin, Putzfrau und Hamburgerbräterin sein, um mir ein paar Sonderwünsche zu erfüllen. Mama musste mir raten, ich war unentschlossen.
Mama wusste Rat: "In Bayern ist ein medizinischer Verlag, die suchen dringend jemanden. Das würde aber bedeuten, dass du erst mal ganz unten da anfängst bei denen, die wollen sehen, ob du ordentlich arbeiten kannst. Meinst du, dass du das könntest? Schau dich dort um, vielleicht interessiert dich ja Verlagsarbeit!".
Zwei Tage später war ich in Gräfelfing, drei Stunden später hatte ich meinen ersten Arbeitsvertrag. Mein Einstiegsgehalt betrug 2.400 Mark. Brutto. Ich war selig. Mama verkaufte mir ihren verlässlichen VW Golf und legte sich wieder einen BMW zu.
Ich bin “gut unter”, Mama ist erleichtert. Wir haben es zusammen geschafft. Bevor ich nach Fürstenfeldbruck umziehe, schaue ich mir noch den brandneuen Terminator 2 im Kino an.
Ich wurde in den Vertrieb des Verlages gesteckt und fristete meine ersten drei Monate als Bestellpostkartenleserin zusammengesunken in einem dämmrigen, halboffenen Kabuff vor einem winzigen, dickglasigen, flackernden Mini-Bildschirm, auf dem echsengrüne Buchstaben in gefriererbsengrünen Tabellenrahmen flimmerten. Name des Bestellers eingeben, Adresse, was er denn haben will, wie viele Exemplare. Von viertel vor acht morgens bis viertel vor fünf nachmittags. Eine halbe Stunde Pause mittags. Drei bis vier Tassen Kaffee. Von Jedem misstrauisch beäugt ("Des is fei die aus Preißn, gell?"), von Rückenschmerzen geplagt, von abgestumpften Vorgesetzten getriezt: "Mei, des Oarbet'n do is halt net so schee wias rumstudier'n!".
Ohne Freunde oder Bekannte, in einem möblierten Zimmer unterm Dach. Ich kaufe mir meine erste eigene Waschmaschine. Ich setze mich vor das Glasauge und schaue ihr beim Waschen zu, als wenn es ein Krimi wäre. Dann eine andere Wohnung, ohne Möbel, aber mit großen Fenstern und einem Balkon. Alle Geschäfte schlossen um sechs Uhr. Jeden Abend stehe ich in einem trostlosen, langen Stau vor einer zu engen Unterführung. Ein Nadelöhr, das alle Berufspendler jahrelang foltern wird.
Ich musste samstags zu IKEA, um mir wenigstens ein paar Möbel zu kaufen, weit draußen im Industriegebiet. IKEA öffnete um neun Uhr und schloss um 14 Uhr. Ich war nicht die einzige, die dort hin wollte. Zweimal stand ich so lange im Stau dorthin, dass ich einfach wieder umkehren konnte, weil es 14 Uhr wurde.
Die Lebensmittelgeschäfte schlossen samstags um 12 Uhr; meine einzige Gelegenheit, mich für die kommende Woche mit Lebensmitteln einzudecken. Ich war übermüdet. Ich hatte Hunger und einen leeren Kühlschrank. Ich schlief bis auf Weiteres auf einer alten Schaumgummiunterlage.
Jeden Morgen musste ich um halb sechs raus. Um halb sieben spätestens aus dem Haus, bei Bedarf Schnee vom Auto schaufeln bei 25 Grad minus, Eisplacken hacken, Türschlösser enteisen, mein dickes Palästinensertuch fest um Kopf und Nase gewickelt, der eisige Wind schnitt wie Messer in die Lungen. Fürstenfeldbruck ist ein Kälteloch, der Winter ist lang. Beten, dass die Batterie es schafft.
Abends kam ich oft erst um sieben Uhr nach Hause. Hungrig, alleine. Ich brauche acht Stunden Schlaf, musste also um zehn Uhr spätestens schlafen. Auch im Sommer, wenn es draußen noch hell war, die Vögel sangen und man das Lachen von den Grillparties hörte.
Es blieben also täglich etwas über zwei Stunden für den Haushalt, Abendessen, Nachrichten im Fernsehen. Und telephonieren. Meine Telephonrechnung betrug 600 Mark. Mamas auch.
Ich bin so einsam.
Bruno, die verstörte Perserkätzin, kommt zu mir. Wir machen uns das Leben gegenseitig etwas leichter.
In meinem kleinen Fernseher sehe ich, wie 1989 Menschen in der DDR rebellieren; die Mauer fällt. Ich beobachte, wie sie in den Westen strömen. Die DDR ist pleite. Ich bin kein Wirtschaftsfachmann, kann mir aber denken, dass die BRD ausbluten wird, wenn alle diese Menschen versorgt werden sollen. Ich habe keine Verwandtschaft “drüben”, ich kann mich nicht freuen. Ich habe keinerlei Beziehung zu den Menschen der DDR. Der einfache Mensch hier im Westen wird das alles finanzieren müssen, somit auch ich. Ich bin fuchtig.
Zurück zum Anfang meiner ersten Anstellung.
Nach drei Monaten gebeugter Knechtschaft mit roten Knopfaugen im bayerischen Anfänger-Kabuff beschließt die Verlagsleitung, mich (wegen guter Führung?) in die Abteilung mit leichtem Freigang bei Tageslicht zu versetzen. Ich soll eine bald ausscheidende Buch- und Zeitschriften-Herstellerin ersetzen, soll von ihr in ihre Aufgaben eingeführt werden. Sie wird bald 60. Und hat ihre sehr eigene Art. Ich muss mir oft auf die Zunge beißen, einfach tun, was sie will, ihr Laufmädchen sein. Nach zwei Monaten vertraut mir die Verlagsleitung ein eigenes Projekt an. Nach fünf Monaten übernehme ich sämtliche Projekte der Pensionärin und werde von meiner gleichaltrigen Zimmerkollegin, die mir gegenüber sitzt, mit forsch nach hinten geworfenem Kopf hasserfüllt angegiftet: "Ich hab' hier 5 Jahre gebraucht, um mein erstes eigenes Projekt zu bekommen! Da denkt die Verlagsleitung, nur weil eine von der Uni kommt, kann die's besser. Das werden wir ja sehen...! Das alles schaffen Sie ja niemals. Ich hab' ein Auge drauf, wir wollen ja nicht, dass eine ganze Auflage wegen Ihrer Fehler eingestampft werden muss, gell?".
Und das alles auf kläglich verbrämtem Bayerisch.
Es wird noch mit Papier umbrochen, die Manuskripte türmen sich auf meinem Schreibtisch, Röntgenaufnahmen, Dias, Photos, maschinengeschriebene Manuskriptseiten. An Umbruchtagen versinke ich in Bergen von Schnipseln von ausgeschnittenen Papierfahnen, auf deren Rückseiten ich klebriges Wachs auftragen muss, damit ich die außer Haus gesetzten Texte in mein Layout einfügen kann. Es ist hektisch, Korrekturlesen, Anzeigenabteilung, Druckerei, Versand, Satzstudio, alles muss ineinandergreifen.
Ich liebe diese Arbeit.
Nach einiger Zeit ruft mich die Verlagsleitung. Warum ich keine Überstunden machen würde? Ich begreife nicht schnell genug. Man erklärt mir, dass alle Hersteller hier ständig Batzen von Überstunden machten, weil sie so viel Arbeit hätten...aha, denke ich, so ersitzt man sich einen schönen langen Jahresurlaub. Ich stelle mich ein wenig dumm. Ob es Klagen gegeben habe? Ob ich etwas versäumt habe? “Nein,” wird mir geantwortet, “ganz im Gegenteil.” Ich sehe meinen Weizen blühen. Ich bitte um ein weiteres zu betreuendes Projekt. Ich möchte auch eine kräftige Gehaltserhöhung. Und bekomme beides. Mein Verantwortungsbereich wurde ausgeweitet, redaktionelle Tätigkeiten und Übersetzungen kamen hinzu: das Korrekturlesen englischer Manuskripte. Weiterhin keine Überstunden.
Den Kollegen schmeckt das nicht. Mir schmecken die Kollegen nicht.
Ich habe täglich stoisch meine Arbeit gemacht, und bin müde nach Hause gefahren. Nach zwei Jahren war meine Gastritis so schlimm, dass sehr schmerzhaftes Magenbluten eintrat und ein angehendes Darmgeschwür diagnostiziert wurde. "Gehen Sie wieder zurück ins Rheinland," riet mir mein Arzt und schaute mich besorgt an, "hier werden Sie nie wieder gesund. Denn hier können Sie nicht glücklich werden."
Ich habe mein Handwerk gelernt, bin ausgelernt. Dieser Verlag kann mir keine weiteren Aufstiegschancen bieten. Man hört von Computern, die erstmals für Layout und Druck eingesetzt werden. Dieser Verlag wird den Anschluss verpassen. Ich will ihn nicht verpassen. Ich stellte eine Bewerbungsmappe zusammen und schickte sie an jeden Verlag im oder in der Nähe des Rheinlands, welcher in der Zeitung eine freie Stelle angeboten hatte. Für die geplanten Vorstellungsgespräche hatte ich mir drei Wochen Urlaub aufgespart, ich terminierte die Gespräche auf je zwei bis drei pro Tag. Ich nahm jedes Angebot für ein Gespräch an, auch wenn ich bereits wusste, dass der Verlag oder die Position eigentlich nicht in Frage kämen. Meine Erfahrungen in Bewerbungsgesprächen waren bisher nicht groß gewesen und ich hatte sicher noch einiges zu lernen.
Mit leichtem Herzen fuhr ich nach Sankt Augustin, um während dieser Zeit meine Mutter wiederzusehen und auch von dort aus meine Fahrten zu erledigen. Es bewegte sich etwas in meinem Leben, ich konnte endlich wieder mit Hoffnung nach vorne schauen.
Die Gespräche, die ich führte, waren allerdings ernüchternd. Das Spektrum an Betrieben, bei denen ich vorstellig wurde, reichte von Großverlagen über Heilpraktiker bis zu Kleinstverlagen in Einfamilienhäusern.
Ich traf auf Gesprächspartner, die nicht wussten, welche Aufgaben sie mir übertragen sollten; also eine Stellenanzeige geschaltet hatten, ohne ein Konzept für die angebotene Stelle zu haben.
Werbeagenturen, die von jedem Bewerber eine vollständig ausgearbeitete Werbekampagne anforderten (natürlich zu einem Auftrag, den sie gerade an Land ziehen wollten) mit dem Versprechen, den Bewerber dann "auch bei der Auswahl für die offene Position zu berücksichtigen". Dies war, neben dem Heilpraktiker in der Eifel mit dem überlebensgroßen Ölgemälde seines Gurus an der Wand, der mir einige Tage nach der mündlichen Vertragsvereinbarung offenbarte, dass seine "Frau das Gehalt zu hoch fände und um tausend Mark gekürzt habe - ob das so OK ginge?" das Frechste, mit dem ich konfrontiert wurde.
Ein Verlag verlangte, dass ich die Kochrezepte in deren herzustellendem Magazin bitte auch auf Kochbarkeit und Geschmack hin überprüfen sollte. Ich: sprachlos.
Die Denkweise dieser Menschen ekelte mich. Warum meinten sie, Menschen, die ihre Kenntnisse auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellten, so herablassend, respektlos und ohne Anstand behandeln zu können? Natürlich wusste ich es: kindische Machtspielchen jeglicher Couleur, verrührt mit einem kräftigen Schuss "Schlechte Kinderstube", abgeschmeckt mit einer Prise Skrupellosigkeit.
Auf eine weibliche Personalchefin bin ich während dieser Gespräche nicht gestoßen.
Mir wurde offen gesagt, dass man mich meiner Fähigkeiten entsprechend nicht einsetzen könnte: "Sie sind ja völlig überqualifiziert!" und mich daher nicht anstellen würde, da ich ja nach kurzer Zeit mich von dort wieder fortbewerben würde, um eine meiner Qualifikation eher entsprechende Anstellung zu finden.
Hatte irgendjemand überhaupt vorab meine Mappe gründlich gelesen? Fiel ihnen das erst auf, als ich zum Gespräch erschien?
Ein Software-Riese drückte mir einen bereits unterschriebenen Vertrag in die Hand, ich sollte schnell gegenzeichnen. Auf dem Weg zurück saß ich in einem Stau fest und las das fingerdicke Vertragswerk durch. Ich traute meinen Augen nicht. Dort fehlten nur noch Klauseln über öffentliche Auspeitschungen und Einkerkern bei Wasser und Brot.
Schließlich jedoch fand ich einen kleinen Verlag in der Eifel, der meinen Vorstellungen am ehesten entsprach und einen korrekten Eindruck machte. Es wird bereits an Computern gearbeitet, allerdings nur auf der DOS-Ebene, Textverarbeitung. Kein Internet. Keine Layoutprogramme.
Ich leite und organisiere medizinische Seminare; Dienstreisen, es ist turbulent, es macht Spaß.
Ich zog in die Nähe in eine große Wohnung, hatte nur 10 Minuten zu Fuß zur Arbeit. Mittags mit dem Rad schnell nach Hause, ein bisschen ausspannen und Bruno streicheln. Welch ein gravierender Unterschied zu Bayern. Mein Magen erholte sich, meine Seele befand sich fast wieder im Gleichgewicht.
Die LPs von Neil Young, die mich während meiner langen Einsamkeit oft getröstet hatten, verstaute ich erst einmal hinten im Schrank. Telephonat aus Bayern mit Mama: "Hörst Du schon wieder diesen Eunuchen? Der wimmert und knödelt immer so schrecklich...kannst Du nicht was anderes hören? Was findest Du nur an dem?".
Jetzt stand mir der Sinn eher nach wummernder und fröhlicher Musik.
Ich traf alte Freunde und Bekannte wieder, war wieder daheim und fühlte mich nicht mehr einsam und unerwünscht. Boris und ich nehmen unser nächtliches Lotterleben wieder auf, wir treffen uns alle paar Wochen, Michael rollt verstärkt mit den Augen und wirft sich wieder wehrhaft vor die Kühlschranktür, bewaffnet mit einem druckfrischen Handelsblatt. Der Mann ist zäh. Und verliert doch jedes Mal.
Das Arbeitsklima wurde entspannter; aber nach einiger Zeit wirkten die Arbeitsabläufe konfus und unausgegoren. Es entstand bei mir der Eindruck, als ob blind in alle Richtungen experimentiert würde, ein Stochern im Nebel. Wir waren Teil einer Unternehmensgruppe, die einem namhaften Großverlag angehörte, ich hielt ein Missmanagement für unwahrscheinlich, vielleicht sah ich nur das Ziel nicht?
Mein Bauchgefühl aber hatte Recht. Die Großverlagsgruppe aus Süddeutschland, dem dieser Verlag scheinbar noch immer angeschlossen gewesen war, hatte sich bereits vor einiger Zeit aufgrund diverser Unstimmigkeiten von meinem Arbeitgeber getrennt. Die Personalabteilung des Mutterkonzerns in Süddeutschland teilte mir mit, dass ihnen meine Einstellung erst verspätet mitgeteilt worden wäre und aufgrund fehlender bewilligter Budgets für meine Position eine Kündigung unausweichlich sei, es täte ihnen leid. Mein Verlag sei im Übrigen außerdem pleite.
Man hatte mich kalt über den Tisch gezogen.
Mama war am Boden zerstört, sie litt mehr als ich. Ich war arbeitslos geworden.
Ich klagte eine gute Abfindung ein und ging leicht beklommen zum ersten Mal zu dem Arbeitsberater meines Vertrauens in Siegburg, der sich meine Geschichte geduldig anhörte.
"Ja...jede Menge Nieten da draußen...!" war sein einziger Kommentar.
Und dann: "Ihre Arbeit als Herstellerin wird ja nun doch so langsam auf Computer umgestellt, ich hätte da was, hier in Köln, da würden Sie Herstellung am Computer lernen können, nennt sich Desk-Top-Publishing, das wird die Zukunft in Ihrem Beruf werden. Wir haben hier einen großen Topf für Fortbildungen, allerdings fängt der Kurs erst in vier Monaten an und dann dauert er fast ein Jahr. Vollzeit, versteht sich. Der ist stramm, da gibt es strenge Zugangsbestimmungen, Sie würden aber ohne Probleme reinkommen. Wenn Sie wollen, melde ich Sie sofort an. Ich gebe Ihnen dann gleich noch die Zahlen über das Geld, das Ihnen während der Zeit zur Verfügung steht, und eigentlich brauchen Sie erst wiederzukommen, wenn Sie den Kurs absolviert haben. Auch, wenn Sie dann schon wieder Arbeit haben, aber wir müssen dann noch Papierkram machen.
Also, was meinen Sie?”
Ich war Feuer und Flamme. Dies war der ideale Weg, um meine Chancen für eine Anstellung zu erhöhen.
Zwei Wochen später bat ich einen entfernten Freund aus Jugenddorf-Tagen, mit mir in ein Computergeschäft zu gehen und einen Computer zu empfehlen. Kaum jemals hatte ich vorher einen “richtigen” PC gesehen und auch überhaupt keine Vorstellung, was man damit anstellen konnte. Ich wusste nur, dass ich einen kaufen musste. Computer waren sehr teuer, ich wurde auf einen Schlag knapp 9.000 Mark los. Computerkurse waren extrem rar gesät.
Der durchgeistigte Computer-Priester (als Verkäufer getarnt) zu der Computer-Novizin: "…und diese riesige 350-MegaByte Festplatte kriegen Sie niemals voll! Als Leckerbissen haben wir hier noch einen 17-Zoll Monitor von MIRO, Spitzenklasse, für 2.800 Mark und auch eine Netzkarte mit einem Datendurchsatz von 9600 Baud, damit kann man schon Faxen und in dies neue Internet. Und eine gute Graphikkarte mit 526 Kilobyte Speicher, da können Sie auch Photos mit bearbeiten; die neuesten Karten haben jetzt schon 2 MB, aber die sind wirklich teuer. Wäre das nicht was für Sie? Und hier noch ein Single-Speed-CD-ROM Laufwerk, nur 370 Mark, das neueste jetzt, ein paar Programme gibt es ja schon auf CD! Und mit dem neuesten CPU mit 55 Megahertz haben sie eine richtig flotte Maschine."
Ich hatte nicht die blasseste Ahnung, was er da redete. Man drückte mir zwei Floppies und ein "DOS 3 Handbuch" in die Hand; mein Freund gab mir 11 Floppies, auf denen "Windows 3" gekritzelt war und sagte etwas von "...die musst Du aber installieren!" Die musste ich WAS ?
Ich gab meine schöne große Wohnung auf und zog wieder in meine alten Zimmer im 1. Stock in Sankt Augustin in Mamas Haus. Ich musste mit meinem Geld haushalten. Ich wusste nicht, wie lange ich ohne feste Anstellung sein würde.
Bruno kam mit mir.
Vor dem Kurs saß ich Tag um Tag und Nacht um Nacht an meinem neuen PC und versuchte, mir DOS 3 und Windows selbst beizubringen; nachdem ich begriffen hatte, was eine "Installation" war.
Ich wollte die Zeit nutzen, nicht tatenlos rumsitzen. Wollte den Computer beherrschen lernen, die ersten Hürden nehmen. Ersteres war anfangs ziemlich aussichtslos: kaum war Windows wieder einmal erfolgreich installiert, hatte ich es unter DOS durch einen falschen Befehl schon wieder zerdeppert. Die "ersten Hürden" türmten sich zu unüberschaubaren Gebirgen.
Ich lernte, was ich NICHT tun durfte und begann, das Gebirge Stein für Stein abzutragen. Kein Internet konnte helfen (gab es so noch nicht), kein Freund hatte einen Computer. Die Fehler, die ich damals gemacht habe, brannten sich tief in mein Gedächtnis.
Mehr und mehr tat der Computer, was ich von ihm wollte, mehr und mehr wuchs mein Selbstvertrauen. Das klobige DOS-Handbuch, durch das ich mich wie durch unverständliche chinesische Schriftzeichen hatte hindurchwühlen müssen, hüte ich heute noch wie eine Reliquie.
Mama war entsetzt über meine Verbissenheit, sie sah mich kaum noch, ich saß nur vor dem Monitor und antwortete auf ihr Rufen immer wieder nur "Jaha! Ich komme gleich! Nur noch eben das hier, Moment...!"
Ich war fasziniert von Computern, von ihren Möglichkeiten, ihrer Logik, dem Geist in der Maschine, den es manchmal mit Intuition auszutricksen galt. Dies sollte immer meine Leidenschaft bleiben.
Nach vier langen Monaten begann endlich der Kurs in Köln. Ich war in Aufbruchstimmung, aufgeregt und heiter, endlich ging es voran, endlich lernte ich etwas Neues. Am ersten Tag stand ich prompt in einem dicken Stau auf der Kölner Severinsbrücke.
Und lernte eine Stunde später Angelika kennen.
Genug der Rückblicke. Vorbei. Endlich vorbei.
Ich öffne meine Augen wieder, verlagere mein Gewicht in dem Gartenstuhl und atme die schon abendlich-feuchte Gartenluft tief ein.
Das Knäckebrot ist aufgegessen, der Rest Tee ist mittlerweile kalt geworden, die spielenden Kinder hinter der Hecke werden heimgerufen und der Rasenmäher hält inne. Bruno schnürt gelangweilt an der Hecke entlang, immer auf der Suche nach etwas, das sie dann ausgiebig beriechen kann. Leuchtend blaue Vergissmeinnicht blühen um die Vogeltränke.
Das Telephon klingelt.
Es ist Angelika. Sie druckst ein bisschen herum und versucht, mir etwas zu erzählen. "Was ist denn los? Wieder Ärger mit den Mädels?"
Ja, hat sie.
"Komm' zu mir, lass den Schlafsack da, ich hab' ja alles hier; dein Lieblingssoffi wartet. Mach mal eine Pause und sei unauffindbar. Du weißt ja, Du kannst immer kommen. Ach...und bring ein paar kalte Kölsch und Kippchen mit!".
Bei mir kann sie immer unterschlüpfen und ihre Gedanken ordnen. Sie wohnt in der Innenstadt, nach knapp einer Stunde ist sie bei mir im grünen Gürtel. Durch die Hecke hindurch sehe ich, wie sie ihren Wagen parkt und unser Überlebenspaket aus Kölsch und Zigaretten entnervt herauszerrt. Sie windet sich durch die Hecke und atmet sichtlich auf, hier ist es kühl und wir haben reichlich Licht und Luft.
Es ist Freitagabend, ich brauche mir um die Kopfschmerzen, die ich morgen wahrscheinlich haben werde, heute keine Gedanken zu machen.
Wir setzen uns an den Terrassentisch, köpfen zwei Kölsch und beginnen mit ein bisschen Small-Talk. Ich schaue sie genauer an. Sie sieht müde aus, fast erschöpft. Und blass. Sie ist vier Jahre jünger als ich.
Als ich vorhin im Bad in den Spiegel geschaut hatte, sah ich auch müde aus. Und ein bisschen verkniffen. Das hat mir nicht gefallen. Mein Alter? Eher weniger. Aber was sonst? Ich schiebe die Gedanken, die langsam meinen Rücken hochkriechen wollen, schnell weg. Ach, was soll's. Ist doch alles bestens.
"Und, Kind, wie läuft's so?". Pflichtfrage.
"Arbeit ist normal, " berichte ich, "kann nicht klagen. Gut zu tun und immer was Neues. Wird ja auch Zeit...! ".
Nach der Ausbildung bei Olivetti fand ich Anstellungen in verschiedenen Verlagen im Kölner Raum, meist waren sie geprägt von Missmanagement und Mobbing. In keinem hält es mich lange. Ich verdiene gut, bilde Rücklagen. Mama ist mittlerweile pensioniert. Zu ihrem 70. Geburtstag schenke ich uns beiden eine Reise nach Fuerteventura, miete eine große Villa, wir genießen die Zweisamkeit, die Sonne, die Ruhe. Vor Jahren hatte sie einmal erwähnt, dass mein jetziger Name nicht der ist, den sie sich für mich gewünscht hatte. Sie hatte sich aber bedauernd den Wünschen meines Vaters gebeugt. Alle Frauen in ihrer Familie hätten immer Doppelnamen getragen, ihrer ist Anna-Johanna, eine Schwester heißt Emma-Dorothea, eine andere Anna-Elise. Sie hätte mich so gerne auf den Namen Anna-Katharina taufen lassen. Am Tag ihres Geburtstages überreichte ich ihr als Überraschung ein offizielles Dokument, die amtliche Bestätigung meiner Vornamensänderung in Anna-Katharina. Mama verdrückt sich eine Träne; ich strahle. Umarmung.
"Erinnerst Du dich noch an diese Endlos-Dramolette mit dem Verlag mit dieser Altherrenriege?".
"Ach Gott, ja!" Angelika lehnt sich zurück und lacht, "am Ebertplatz, stimmt's?".
Ich nicke. "Die mit dem 60er-Jahre 'Onteriör'. Die probten dann den Quantensprung. Mit einer Frau und einem Computer..."
Wir erinnern uns beide lebhaft und hetzen über verkrusteten Hierarchien und eine offensichtlich weit verbreitete Frauenphobie in Chefetagen. Auch mobbende Kollegen kriegen ihr Fett weg.
"Und diesmal?" fragt sie, "Ich habe den Eindruck, als wenn es zum ersten Mal richtig gut läuft mit der Arbeit bei Dir, ich meine die Kollegen und so...".
"Zum ersten Mal, ja." bestätige ich. "Kein Mobbing, keine Missgunst, keine glitschigen Vorgesetzten mit Egostörungen. Ich fühle mich wohl und kann einfach meine Arbeit machen. Einfach die Arbeit machen. Es ist eben Öffentlicher Dienst, die Gehälter sind vorbestimmt. Die Kollegen sind keine Wadenbeißer und der Chef widmet sich seiner Wissenschaft, die Atmosphäre ist ganz anders. Besser."
Sie schaut mich nachdenklich an.
"Zu meiner Ebertplatz-Zeit hattest du es ja schon aufgegeben mit den Verlagen und dich aufs BWL-Studium konzentriert", sinniere ich "obwohl ich ja BWLer normalerweise gar nicht ab kann, aber ich nehme dich als zwangsweisen Quereinsteiger, das schwächt ab und gibt ein paar Pluspunkte!"
Ich bekomme einen Tritt unter dem Tisch.
"Geht's denn noch?" raunzt sie und fummelt dann aus ihrer Tasche ein paar Blatt Papier heraus, "Hier hab' ich was, wollte ich letzte Woche schon bringen. Deine Papiere, die du bei mir bei meiner Vermögensberatung angelegt hast...Stand der letzten Monate...".
Ich raufe mir gespielt die Haare und schaukele wie ein Klageweib hin und her." ...sind nix mehr wert und ich werde am Hungertuch nagen..." vervollständige ich wimmernd ihren Satz.
"Quatsch! Schau mal hier..." Sie schiebt mir mit Zahlenkolonnen vollgedruckte Papiere über den Tisch und sieht mich erwartungsvoll an. "Na, ist das nicht toll?"
"Junge Frau," bemerke ich, "zum einen bin ich ohne meine Lesebrille, zum zweiten will ich nur wissen, ob das Geld Junge bekommen hat und vor allem bitte: wie viele?"
Angelika brummelt. "Es hat sich karnickelhaft vermehrt. Man glaubt es kaum. Endsumme mit Stand von gestern ist...Moment..."
Sie sagt es mir. Vor meinem geistigen Auge schwebt glitzernd das dezente Diamantarmband, das ich schon immer haben wollte. Mit Weißgoldfassung.
"Ja, schön...äh, darauf bitte noch ein Kölsch!" Sie lacht, ich auch. Zumindest finanziell brauchen wir uns im Moment keine Sorgen zu machen, auch sie hat ihr Geld gewinnbringend angelegt.
Das Internet boomt; der DAX ist auf dem Höchststand.
Sie sucht das nächste Kölsch im Kühlschrank.
'‘Ich glaub' einfach nicht, dass du diese Küche hast," ruft sie von drinnen und lärmt im Kühlschrank, "die ist ja sowas von Schickimicki! Hätt' ich nie gedacht, dass du sowas kaufst! Und ein Cerankochfeld, ich glaub es ja nicht! Aber passt, irgendwie. Fehlt eigentlich nur noch so ein Noppenfußboden aus dem Designerstudio, möglichst in Rot..."
"Lass’ mich in Ruhe!" rufe ich zurück, "Die hat mir gefallen und fertig! Das ist meine erste richtige eigene Küche. Sonst waren ja immer so Trümmerteile schon in den Wohnungen oder ich hab' meine alten Kindermöbel mitgeschleppt. Jetzt gönn’ mir doch mal, dass ich einfach zugelangt habe! Und wie darf ich das verstehen mit dem 'Passt irgendwie'?"
Sie lästert. "Weiß, alles weiß! Sogar die Spüle!"
"Die knallrote Armatur! Das reißt's wieder raus!" rechtfertige ich mich lachend, lehne mich zurück und nehme einen Schluck. "Und komm mir bloß nicht mit Schickimicki. Wer sitzt denn in einem BMW? Na? Ich jedenfalls nicht! Von deiner Sitzanwärmapparatur will ich schon gar nicht anfangen, die ist ja sowas von..."
"Jetzt nu das wieder! Aber als wir letztens so durchgefroren waren, da hast du..." will sie, mit der Flasche drohend, einwerfen.
"Schusch! Schluss jetzt. Komm, setz dich hin!" Wir sind beide schon ein bisschen beschwipst.
Ich zünde ein Windlicht an und wir fangen an, ein paar private Dinge zu besprechen. Angelika versucht gerade, eine Beziehung aufzubauen und das übliche Anfangs-Repertoire von Eifersucht, Machtspielen und anderem in erträglichen Grenzen zu halten. Sie ist jedenfalls bis über beide Ohren verknallt. Und leidet dementsprechend.
Ich habe keine feste Beziehung und kann daher nicht mitklagen.
Dumpf beschleicht mich der Verdacht, dass ich genau das aber auch gerne tun würde.
Nach einigen weiteren Bieren, Käsebroten und Nachotüten sind wir uns einig: alle Weiber sind dösige, hinterhältige Zippen und alle Männer sind dumpfe Tiere. Für jeden von uns ist die Welt vorerst wieder eingerenkt.
"Wir sollten mal wieder eine Kneipentour machen," meint sie und hält ihr Glas hoch, “gezapftes Kölsch ist was Feines und wir könnten wieder Geisterbahn gucken gehen."
"Japp," stimme ich zu und versuche schielend, den letzten Nacho aus der Tüte zu ergattern, "ist schon einige Zeit her, seit wir raus waren."
Wir schauen in den dunklen Garten, unsere Gedanken schlingern ziellos.
"Oder nach Tonga fliegen!" platzt sie plötzlich in die Dunkelheit.
Wie kam sie gerade jetzt auf Tonga?
"Südsee! Ich bitte dich! Das ist doch völlig abwegig. Nur wegen dieser ollen Globus-Geschichte bei Gleumes?"
Ich habe kalte Füße und kalte Hände. An meiner Nase wird sich gleich ein kalter Tropfen bilden.
Stille.
"Da ist es immer warm, reichlich Sonne und viel Meer."
Sie nickt.
"Mal was anderes als Grau in Grau und all die Müffelköpp hier..."
Sie nickt.
"Wir sind doch nicht normal, über so einen Blödsinn zu reden!" bäume ich mich noch einmal schwach auf.
"Sind wir auch nicht," stimmt sie mir, schon etwas schwerfällig nickend, zu, "wir sind nicht dicht. Oder nicht normal? Was ist normal?”
"Wir sollten schlafen gehen," würge ich die sich anbahnende fruchtlose Diskussion ab und puste das Windlicht aus, "es ist wieder mal früh geworden.".
Angelika kuschelt sich in das grüne Sofa, ich wanke in mein warmes Wasserbett. Wir sind beide froh, dass wir so gute Freundinnen geworden sind.
Bruno kringelt sich auf meinem Kopfkissen ein. Ihr Fell duftet nach Sommer und Heu.
Licht. Sonne. Meer.
NACH TONGA. ECHT.
1999. Viele Monate später. Ich sitze in meinem Büro am PC, mein Chef, der Professor des Instituts, platzt herein.
"Sie haben noch jede Menge Urlaub vor der Brust, über sechs Wochen. Die sollten Sie nehmen bis Mitte des Jahres, sonst verfällt er. Wir können unsere Projekte gerne schon mal vorplanen, dann entsteht keine Hektik. Also, überlegen Sie, wann Sie wie lange weg sein werden und wir setzen uns dann zusammen. Schönen Tag noch!"
Ich bin überrumpelt. Sechs Wochen Urlaub, was soll ich mit der vielen Zeit machen? Und alleine in Urlaub macht mir absolut keinen Spaß.
Ich blicke auf meinen tropischen Ficus Benjamini, der sich mit rissigen Ästen, mickrigen grünen Blättern und vielen abgefallenen Blättern auf der staubigen Blumenerde gierig der trüben Wintersonne jenseits des großen Fensters entgegenreckt. An einem kränklichen Ästlein hängt ein verstaubtes Spinnweb, das sich sachte in der aufsteigenden trockenen Heizungsluft wiegt.
Licht. Sonne. Meer.
Ich greife zum Telephon.
"Angelika...? Ja, sag mal...wie sieht's mit deinem Urlaub aus, wieviel hast Du noch? Fünf Wochen, gut. Und genug Geld auf dem Konto? Wieso 'Komische Frage!'. Pass mal auf: ich muss meinen Urlaub nehmen und wenn du auch Zeit hast dann...sollen wir nicht beide endlich mal nach Tonga? Zeit wird's! Was Besseres fällt uns ja doch nicht ein."
Stille am anderen Ende, dann ein prustendes Lachen: "Echt? Du spinnst ja! Der Flug alleine kostet doch sicher ein Vermögen, Tonga liegt am anderen Ende der Welt, weiter weg kann man von hier nicht fliegen! Und wir haben doch gar keine Infos über Tonga."
"Das kann man ändern, also, du hast Zeit? Gut. Ich schau mal eben, was so ein Flug kostet, hab ja schnelles Internet hier. Limit bei 4.000 Mark für den Flug, ist das ok? Ja...mach ich...ruf dich gleich zurück!".
Rein in das Internet und schnell zwei Telephonate mit Reisebüros.
"Ja, also hör zu. Hin und zurück kostet der ganze Sums 2.400 Mark, allerdings Hühnerfarm hinten und nicht Erste Klasse. Das können wir uns doch wohl leisten, oder?".
Kurzes Überlegen am anderen Ende, die Leitung brummt.
"Du suchst alle Webseiten und Infos zusammen. Im Mai könnte ich länger weg, du auch?"
Ich auch.
"Gebongt. Wir machen das!"
“Aber wir brauchen genaue Info über den Flug und wohin denn nun in Tonga, da ist ja mehr als nur eine Insel. Ich habe gerade ein bissel Leerlauf hier, und du hast ja kein Internet, soll ich da mal dann schauen jetzt?”