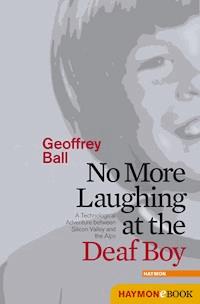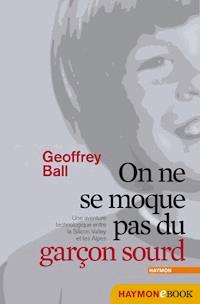Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Geoffrey Balls außergewöhnliches Technologieabenteuer begann im legendären Silicon Valley Kaliforniens und führte ihn schließlich in die österreichischen Alpen, wo er heute lebt und arbeitet. Schon als Kind erkannte Ball, dass Zeichensprache, Hörgeräte und Lippenlesen keine befriedigende Antwort auf seine Schwerhörigkeit boten. So beschloss er kurzerhand, selbst eine Lösung zu suchen. Ohne sich von seiner Behinderung je einschränken zu lassen, entwickelte er ein weites Interessenspektrum gepaart mit einem untrüglichen Sinn für Unternehmer- und Erfindertum. In diesem Buch erzählt Ball seine unglaubliche Geschichte: Wir lernen seine Familie und Freunde kennen, Surfkameraden, Laborratten, Geschäftspartner, Erfinderkollegen, Computer- und Internetlegenden, seinen herausragenden Mentor, der ihm den Start ermöglichte, und jene Frau, die letztlich seine Erfindung rettete. Mit seinen bahnbrechenden Mittelohrimplantaten wird heute überall auf der Welt die Lebensqualität von unzähligen hörgeschädigten Menschen verbessert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Geoffrey Ball
... und ich höre doch!
Ein technologisches Abenteuer zwischen Silicon Valley und den Alpen
Zitate
“He usually never writes enough stuff down. He thinks if he knows it, then that’s good enough … not for the rest of us.”
Dr. Richard L. Goode, Stanford School of Medicine, Professor Emeritus Otolaryngology, Head and Neck Surgery
„Große Erfindungen brauchen große Geschichten. Unser Leben ist von den Geschichten bestimmt, die wir leben und die wir schaffen. Wir wählen unseren Weg, manchmal wird er für uns gewählt. Unsere Handlungen und Reaktionen bestimmen unser Sein, unsere Sicht der Welt und unseren Beitrag. Der Anfang unseres Weges bereitet unser Ziel vor. Mein Weg begann in der Stadt Sunnyvale, Kalifornien, im Herzen von Silicon Valley.“
Geoffrey Ball, Axams, Österreich
Widmung
Dieses Buch ist allen gewidmet, die noch immer unter Hörverlust leiden, meiner liebevollen Frau, meinen Söhnen, meinen Eltern und meinem Mentor Dr. Richard Goode sowie Ingeborg Hochmair, die meine Erfindungen rettete.
Ankunft in Sunnyvale
„There is a road, no simple highway, between the dawn and the dark of night.
And if you go, no one may follow. That path is for your stepsalone.“
Jerry Garcia
Ich werde nie meine Ankunft in Serra Park vergessen. Man schrieb das Jahr 1969 und ich war fünf. Mein Vater saß am Steuer unserer purpurnen 190er Mercedes-Benz Limousine, Modell 1961, mit der wir gerade die ganze Strecke von Massachusetts quer durch die Vereinigten Staaten gefahren waren. Er war sehr stolz auf seinen Mercedes, obwohl er purpurfarben war. Aber das Auto hatte bequeme Sitze, die für mich und meinen zweijährigen Bruder ausreichend Platz boten, um die ersten fünf Bundesstaaten unserer Reise raufend hinter uns zu lassen. Danach setzte sich unsere Mutter nach hinten, um für Frieden zu sorgen, während wir den Highway 48 entlangkrochen.
Wir hatten genügend Zeit, die Fahrt zu genießen, da mein Vater einer strikt binären Fahrphilosophie anhängt. Seiner Meinung nach steht ein Auto oder es fährt 54 Meilen in der Stunde, egal ob auf einer vielspurigen Autobahn oder in Seitengassen auf der Parkplatzsuche. Es fährt immer 54 Meilen pro Stunde. Als daher endlich verkündet wurde: „Wir sind da“, waren wir sehr erleichtert.
Wir schauten unser neues Heim in 1526 Kingsgate in Sunnyvale, Kalifornien, an. Sunnyvale war das Zentrum der später als Silicon Valley bekannten Gegend. Im Einklang mit dem eigenartigen Geschmack unserer Familie bzw. dem völligen Fehlen eines solchen, was Farben anbelangt, war das Haus, das wir gewählt hatten, in kräftigem Rosa gehalten, obwohl ich später gelernt habe, dass die richtige Farbbezeichnung Lachs lautet. Soll sein, aber für alle anderen war es rosa. Was mögen sich da wohl die Nachbarn gedacht haben, angesichts des purpurnen Autos vor dem rosa Haus. Nachdem wir mit dem ehemaligen Bewohner geplaudert und die tolle Schaukel im Garten ausprobiert hatten, fuhren wir in der Gegend herum. „Kinder, hier ist der Park“, verkündete unser Vater.
Ich schaute aus dem Fenster, als wir hinfuhren und das Auto parkten. Vor mir lag Serra Park. Nie zuvor hatten meine fünfjährigen Augen etwas so Wunderschönes gesehen. Die Sonne ging hinter den Santa-Cruz-Bergen im Westen unter, und der schöne kalifornische Abendhimmel stellte eine atemberaubende Kulisse dar. Die Parkwächter hatten die hohen Laternen angeschaltet, die die Wege im Park säumten. Die Spielgeräte leuchteten frisch gestrichen. Auf den Klettergerüsten, die die Form einer Mini- Spielstadt und eines Dampfers hatten, tummelten sich Scharen fröhlicher Kinder. Hunderte fünf bis acht Feet große, neu gepflanzte Redwood- und Sequoiabäume wurden von Stöcken aufrecht gehalten. Die mit Waschbeton gepflasterten Wege waren neu angelegt und boten ein Labyrinth von Möglichkeiten. Der künstliche See, der von einem künstlichen Bach gespeist wurde, war klar und sauber, und das sprühende Wasser der Springbrunnen zauberte Hahnenkämme in die Luft. Die Brücken über den sanften Wirbeln waren neu und der Tupfen auf dem I. In der Sandkiste türmten sich Berge von frischem, sauberem Sand. So einen Platz hatte ich nie zuvor gesehen, ja ich hatte mir nie auch nur vorstellen können, dass so ein Platz überhaupt existieren könnte. Für mich, der aus dem grauen, düsteren Lowell in Massachusetts kam, war das ein echtes Aha-Erlebnis. Ein Eldorado für Fünfjährige, ein Paradies. Genau das war es. Es war Sunnyvale.
Ich bin aus Sunnyvale und sehr stolz darauf.
Kingsgate Drive
A stream begins
Beneath a stone
Water flows
The path well known
Over and over
Again and again
To repeat the path
Never to end
Um heranzuwachsen, gab es für ein Kind in der ganzen Welt keine bessere Straße als Kingsgate Drive im südlichen Teil von Sunnyvale nahe dem Serra Park und der Volksschule. Wie viele andere erinnere ich mich liebevoll an das Haus meiner Kindheit, und mit gutem Grund. 1969 hatte Sunnyvale ungefähr 50.000 Einwohner, die meist in einstöckigen Vorstadthäusern lebten. Dazwischen lagen große Obstgärten mit Marillen, Birnen und Kirschen und ein paar Blumenfelder. Die Hauptstraßen waren im Osten Sunnyvale Saragota Boulevard, im Süden Homestead Road, im Norden Fremont Road und im Westen der fertiggestellte Teil des Highway 85. Gleich in der Nähe lag Serra Park mit seinem schönen, künstlichen Bach und dem tollen Spieldampfer, der sogar ein Steuerrad hatte. Die Volksschule von Serra war neben dem Park.
Zwischen 1969 und den späten 1970ern hatte Sunnyvale seine beste Zeit. Der Moffett-Field-Marine-Flughafen, ursprünglich als Piste für Luftschiffe errichtet, lieferte den zündenden Impuls zur Grundlagenforschung und Entwicklung für dieNASA, Lockheed Space und Missiles, Northrop und viele andere. Angetrieben durch die Entwicklung des Transistors, der die Vakuumröhre ablöste, erlebte die Rüstungsindustrie eine Hochblüte. Dazu kamen noch die Nähe zur Luftwaffenbasis Onizuka mit ihrem „Blauen Würfel“ und der durch den Kalten Krieg verstärkte Hunger nach Hochtechnologie und Spitzenelektronik.Hewlett Packard war eine, wenn nichtdiedominierende Firma der Elektronikindustrie, die im Valley boomte. Es war die Zeit, bevor die Gegend als Silicon Valley bekannt wurde. Sunnyvale galt bereits als das Mekka für Elektronikingenieure, und so wie mein Vater gierte jeder Ingenieur, der sein Geld wert war, nach einem Job im Valley. Sunnyvale zog Spitzentechniker aus der ganzen Welt an. So gewann die Familie Ball gute Freunde aus der Schweiz, die Camenzinds, und die Sigs, ebenfalls aus der Schweiz, und die Heinemanns aus Deutschland. Das Valley war attraktiv für die Besten und Tüchtigsten aus der ganzen Welt, und es war eine multikulturelle Gemeinschaft.
Der Einfluss der Stanford-Universität auf die Entwicklung des Valleys kann gar nicht genug hervorgehoben werden. Stanford brodelte vor Aktivität, und an vielen Samstagen gingen mein Vater und ich über den Campus und schauten, was sich in den Labors und außerhalb so tat. Das war natürlich noch in der Zeit vor den strengen Sicherheitsvorschriften. Man konnte also problemlos herumschlendern und Studenten und Forschern bei der Arbeit an ihren Projekten zusehen. Mein Vater und ich verbrachten viele Stunden in den Stanford-Bibliotheken und in der Buchhandlung, wo mein Vater in den neuesten Publikationen über integrierte Schaltkreise und Elektronik schmökerte. Damals platzte Stanford vor Leben und war aufgeladen mit Energie. In den frühen 70ern war es echt sehenswert. All diese langhaarigen Studenten in ihrer Hippiekleidung, die diese unglaublichen Zaubergeräte herstellten und Erfindungen machten, von denen viele zukunftsweisend waren, faszinierten mich.
Stanford und die nahe San Jose State University konnten bald den Bedarf an hochqualifiziertem Personal nicht mehr decken, das die explodierende Elektronikindustrie, die Zulieferindustrie und die Dienstleister für ihr Wachstum brauchten. So wurden die De Anza und Foothill Junior Colleges unentbehrliche Ausbildungsstätten für die Fächer Elektronik, Maschinenbau, Produktion, Mechanik und Computertechnologie. Auch diese Institutionen wurden in den frühen 1970ern vom Geist der Innovation beflügelt. An den „De-Anza-Tagen“ konnten die Studenten ihre neuesten Projekte ein ganzes Wochenende lang der Öffentlichkeit präsentieren. Diese Vorführungen boten Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche, und wir versäumten sie nie. Von Kunsthandwerk bis zum Vorläufer moderner digitaler Computerspiele konnte man alles sehen, unter anderem einen Computer, der mit einem Schwarz-Weiß-Bildschirm verbunden war und endlose Runden von Tic Tac Toe spielte, ohne je zu verlieren. Unter den ausgestellten Geräten war auch ein Seismograph, der die Erdstöße der San-Andreas-Falte aufzeichnete und uns faszinierte. Wir waren viel mehr daran interessiert, Erdbeben zu verstehen, als dass wir uns vor ihnen fürchteten, hatte doch jeder, der einige Zeit in Sunnyvale lebte, schon ein paar ordentliche Erdstöße erlebt.
Kingsgate war voll mit den Kindern der Ingenieure und Techniker, die Silicon Valley zu dem machten, was es heute ist. Die Familien in Kingsgate stellten einen guten Querschnitt des Valleys zur damaligen Zeit dar. Einige unserer Nachbarn arbeiteten in der Rüstungs- oder Raumfahrtindustrie, andere in den Bereichen Elektronik und Immobilien, es gab Rechtsanwälte, einen Lebensmittelhändler und jemanden, der Rasenbewässerungsanlagen installierte. Und die meisten von ihnen hatten viele Kinder. Zwei Häuser weiter wohnten die Bankers mit vier Töchtern, neben ihnen die Stevensons mit drei, deren Nachbarn, die Schenones, hatten vier Töchter und einen Sohn. Also insgesamt gab es in den fünf Häusern mit mir und meinem Bruder 15 Kinder. Kingsgate war eine ganz kleine Straße, die Dallas mit Lewiston verband, und 1970 gab es dort in den 22 Häusern insgesamt 47 Kinder im Schulalter. Es herrschte also kein Mangel an Spielgefährten oder potentiellen Babysittern. Meine Favoritin war Erin O’Connor, die mich oft beschützte und mir meine ganze Highschoolzeit hindurch mit gutem Rat und Tipps half.
Als der Übersiedlungslaster unser Hab und Gut auf der breiten Einfahrt von 1526 auslud, war es für mich die tollste Ankunft, die ich mir vorstellen konnte. Alle Bewohner der Straße schienen aus dem Haus zu laufen, um zuzuschauen. Die Spediteure konnten sicher nicht besonders lange gebraucht haben, um unsere Sachen auszupacken und ins Haus zu tragen, da wir ja in Massachusetts nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung hatten, aber irgendwie schafften sie es, den ganzen Tag damit zu verbringen. Als sie fertig waren, hatte ich bereits Matt Schenone kennengelernt und so einen neuen „besten Freund“.
Während der ersten Woche in unserem lachsfarbenen Haus in der Mitte von Kingsgate begriffen mein Bruder und ich bald, dass es ein Magnet für alle Kinder der Straße war. Es mochte rosa sein und ein purpurnes Auto in der Einfahrt stehen haben, doch es hatte einige absolute Vorteile: Zunächst hatten wir die größte Betoneinfahrt, die perfekt zum Rollschuhlaufen, für Fahrradkunststücke und Dodge Ball war. Auch die Schenones hatten eine große Einfahrt, doch die war ständig blockiert durch den dort geparkten Dodge von Mr. Schenone. Diesen wollte er reparieren, was aber nie geschah, bis er ihn Jahre später abschleppen ließ. Außerdem hatten sie die Garage in ein zusätzliches Zimmer für die zwei älteren Mädchen umgewandelt, sodass es kein geeignetes Garagentor gab, gegen das man einen Ball hätte schießen können. Der Hof hinter dem Haus jedoch war ein Ausgleich zur rosa Farbe unseres Hauses. Er war zwar klein, doch äußerst attraktiv.
Die Vorbesitzer von 1526 hatten irgendwie von der Sunnyvale Park- und Freizeitverwaltung das alte Dschungel-Gym-Klettergerüst und die Schaukeln erworben, die vor der Neuausstattung im Serra Park standen. Dieses riesige Klettergerüst und die Schaukeln befanden sich nun hinter unserem Haus, da sie zu schwer waren, um abtransportiert zu werden. Anders als die Klettergerüste, die man im Geschäft kaufen kann, war dieses wirklich äußerst massiv. Außerdem hatten die Vorbesitzer einen kleinen Goldfischteich zurückgelassen, der voll mit Fischen und Seerosen war. Dazu kam noch ein großer Holzapfelbaum in unserem Garten, der zum Lieblingskletterbaum sämtlicher Kinder in der Nachbarschaft wurde. Man konnte hinaufklettern und von hoch oben Apfelbomben auf bewegliche Ziele wie Rollschuhfahrer in der Einfahrt werfen. Sobald wir aufwachten, wurden mein Bruder und ich von den Kindern der Nachbarschaft belagert, die zu uns spielen kamen. So mussten wir nicht die mühsame Phase der New Kids durchmachen, sondern fühlten uns wie die „Rockstars“ von Kingsgate, da wir in so einem tollen Haus wohnten, auch wenn es rosa oder lachsfarben oder was auch immer war. Es war einfach das Beste.
Bald spielte ich Football mit Matt Schenone. „Quarterback“, schrie er immer, „hab es zuerst gerufen“ (was er immer tat), aber ich war auch zufrieden damit, sein Wide Receiver zu sein und manchmal zurückzulaufen, obwohl ich keine Ahnung hatte, was das eigentlich bedeutete. Bald hatten Matt und ich das Stadium erreicht, wo wir uns mit den größeren Kindern der Straße messen konnten. Joe Walker und Kent Bates, beide älter als wir und schon zwei Klassen über uns, waren unsere Gegner. Wir wurden immer haushoch geschlagen, da wir nicht wirklich gegen „Big Joe“ antreten konnten, der doppelt so groß war wie wir und den Ball auch viel schneller werfen konnte. Kent war nicht so ein Footballtalent wie Joe, aber er war schneller. Joe kannte auch all die eigenartigen und unverständlichen Regeln des American Football, und da Matt und ich jünger waren, konnten wir auch nie Protest gegen Joes Schiedssprüche einlegen. Wenn ich den Ball schnappte und zu Matt spielte und irgendwie frei wurde, Matts Pass fing und dann einen Touchdown erzielte, wie wir glaubten, kam Joe unweigerlich mit einem Strafruf daher wie „Regelverstoß! Regelverstoß! Behinderung des Verteidigers nach der Zehn-Yard-Linie. Fünf Yard Regelverletzung! Punkteverlust!“ In den 273 Matches, die wir gegen Joe und Kent spielten, hielten Matt und ich den Rekord von einem Gewinn zu 272 Niederlagen. Sie waren nett genug gewesen, uns ein Spiel an Matts Geburtstag gewinnen zu lassen.
Matt lebte drei Häuser von uns entfernt. Er hatte vier ältere Schwestern, sein Vater Tony Schenone war Immobilienmakler. Zusammen mit seiner Mitarbeiterin Mrs. O’Connor verkaufte er Immobilien in Sunnyvale und Umgebung. Mrs. O’Connor lebte vier Häuser von uns entfernt und hatte drei Kinder. Ihr jüngstes, Erin, erwies sich als beste und schönste Babysitterin, die meine Brüder und ich je hatten. Matt liebte seine Schwestern und Eltern über alles, aber danach kamen gleich Football und Basketball. Jeden Tag nach der Arbeit konnte man Matt und Tony sehen, wie sie Baseballs und Fußbälle hin und her warfen.
Matt und ich waren jahrelang die besten Freunde (und ich sein bester Wide Receiver). Da hatten sich die zwei Richtigen getroffen. Später, als ich so zehn oder elf war, änderte sich Matt irgendwie, wurde böse auf mich, und wir fingen zu raufen an. Es wurde immer schlimmer. Schließlich wichen wir einander zu Hause und in der Schule aus. Ich gewann neue Freunde und Matt neue Wide Receivers wie Pat Selami und Mark Marino, die ein paar Straßen weiter wohnten. Erst später fand ich heraus, dass Matts Mutter, Mrs. Schenone, die man nur selten sah, an Sklerodermie litt, einer schlimmen Hautkrankheit, gegen die es kein Mittel gibt. Sie starb um diese Zeit herum. Ich hoffe, dass ich Matt helfen konnte, etwas von seiner Wut und Frustration abzubauen, und wenn es ihm geholfen hat, das an mir auszulassen, freut es mich. Matt war mein erster bester Freund, der erste, den ich getroffen habe, und der erste, der mich in Sunnyvale willkommen geheißen hat. Matt machte später große Karriere als Leiter der Public Relations Gruppe des medizinischen Zentrums des Valleys. Er starb 2003 ebenfalls an Sklerodermie. Er fehlt mir sehr.
Die breiten Gehsteige der Straßen in Sunnyvale waren bestens zum Radfahren und Skateboarden geeignet, und die asphaltierten Einfahrten boten phantastische Möglichkeiten für Verfolgungsjagden auf dem Rad und endlose Follow-The-Leader-Spiele. Mit 47 Kindern in unmittelbarer Nähe gab es immer genügend enthusiastische Teilnehmer. Da auch die Straßen von Sunnyvale für eine Vorstadt sehr breit und durch große, grüne Straßenlampen gut beleuchtet waren, spielten wir am Abend oft Verstecken und Dosenfußball, bis uns die Mütter von Kingsvale von den Veranden ins Haus riefen.
Man hat Sunnyvale immer vorgeworfen, dass es zu organisiert und geradlinig wäre, wo immer man hinsieht, gibt es einen Gehsteig und alle sechs Meter einen von den Stadtgärtnern gesetzten Baum. Das verleiht den Straßen ein gewisses monotones, militärisches Gesicht, das völlig anders ist als das des lieblichen Los Altos auf der anderen Seite von Highway 85. Für Neuankömmlinge im Valley ist es oft überraschend, wie nahtlos der El Camino Boulevard die Städte Mountain View, Sunnyvale, Santa Clara und San Jose verbindet, ohne dass man merkt, wo die eine Stadt aufhört und die nächste beginnt. Oft suchen Autofahrer stundenlang eine Elektronikfirma in Nord Sunnyvale und fahren nach Santa Clara hinein und hinaus, da alle Straßen und Firmengelände die gleiche frustrierende Eintönigkeit aufweisen. Das Fehlen markanter Orientierungspunkte verstärkte dieses Gefühl noch. Was an Reiz und markanten Punkten fehlte, wurde jedoch mehr als wettgemacht durch die Lebensqualität, die Sunnyvale bot. Fast jeder Einwohner fand in unmittelbarer Reichweite tolle Parks, Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplätze und Schulen. Was Planung betrifft, hat die Stadt eindeutig mehr richtig als falsch gemacht. In den 1970ern waren die Schulen wohldotiert und voll mit den Kindern der Arbeiter in der Elektronik-, Raumfahrt- und Rüstungsindustrie. Die Serra-Grundschule hatte je zwei Klassen mit 20 Kindern pro Jahrgang der K-6 (5- bis 11-Jährige), also fast 300 Kinder. Als ich mit Matt und seinen Schwestern zu unserem ersten Kindergartentag ging, standen auf beiden Seiten der Straße Schlangen von Kindern. Schutzweglotsen waren da mit Stopptafeln, die die Verkehrspolizei ausgeteilt hatte, um die wenigen Autos, die sich der Schule näherten, anzuhalten. Die größeren Kinder flitzten auf ihren Rädern vorbei. Im Gegensatz zu heute gingen fast alle Kinder zu Fuß oder kamen mit den Rädern zur Schule. Niemand wurde mit dem Auto hingefahren, außer es regnete. Die wenigen Kinder, die mit dem Auto kamen, verschwanden schnell beschämt. Indem wir uns in die Kolonnen von Pkws einreihten, um unsere Kinder vor der Volksschule abzusetzen, verloren wir an Unabhängigkeit.
Meine ersten Jahre in der Grundschule in Serra waren eine glückliche Zeit für mich. Drei Schulwarte sorgten für Sauberkeit im Gebäude und außerhalb. Die Tische wurden jeden Tag mit Salmiak geschrubbt und die Linoleumböden so glänzend gewischt, dass sie das Abendlicht spiegelten. Kein Blatt konnte zu Boden fallen, ohne dass es sofort in den Müll wanderte. Die großen Fenster und Glasflächen waren sauber und standen dank des milden Klimas meist offen. Silicon Valley hat so ein mildes Klima, dass oft das Fehlen von Jahreszeiten beklagt wird. Auch die Kinder waren meist sauber und proper, da ja die meisten Mütter zu Hause waren und wir alle Kleidung aus den nahen Geschäften Sears Robuck und Mervyns trugen.
Meine Kindergartenlehrerin, Mrs. Whitley, wurde von vielen willigen Schülermüttern unterstützt. Diese helfenden Mütter bildeten eine wohletablierte Gruppe in den Volksschulen, und es war nicht unüblich, zwei oder drei Freiwillige als Helferinnen in der Klasse zu haben. Das vermittelte ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit, und meist half jeder mit. So passten auch die älteren Kinder auf die jüngeren auf.
Sosehr ich auch die Serra-Volksschule mochte, noch lieber hatte ich die öffentliche Stadtbibliothek von Sunnyvale. Es war auch einer der Lieblingsplätze meines Vaters, also hüpften wir einmal in der Woche, am Freitagabend oder Samstagvormittag, in den purpurnen Mercedes und fuhren nach Norden zur Bibliothek, gleich beim El Camino Boulevard neben dem Rathaus gelegen. Mein Vater schmökerte in den neuesten Büchern und Elektronik-Zeitschriften rechts vom Eingang, während meine Brüder und ich nach links zu der Kinderbibliothek abzogen. Wir alle hatten unsere eigenen Bibliotheksausweise mit „allen Rechten“, auf die wir sehr stolz waren. Doch noch besser war, dass man gleich neun Bücher für zwei Wochen ausborgen konnte. Gratis!
Diagnose
Silence makes no sound,
Yet much is there,
Easily found
With attention and care.
Eine meine frühesten Kindheitserinnerungen betrifft die große Pendeluhr im Haus meiner Tante: Als Kleinkind lief ich jedes Mal zu der Uhr, wenn sie vor den Stundenschlägen eine Melodie spielte. Sie spielte sehr, sehr laut. Eines Tages, nach einer längeren Zeit der Krankheit mit hohem Fieber – und daran kann ich mich deutlich erinnern –, starrte ich die Uhr an und wartete auf ihren Klang. Doch er kam nicht. Ich konnte die Bewegung der Zeiger sehen, wie sie die volle Stunde anzeigten, aber ich konnte absolut nichts hören. Ich erinnere mich, wie ich Tante Marilyn bat, die Uhr zu reparieren oder lauter zu stellen, aber es nützte nichts. Damals konnte ich natürlich überhaupt nicht verstehen, was das für mich bedeuten würde. Doch wenn ich zurückblicke, erinnere ich mich deutlich an diese Uhr, die einst so laut und wohltönend schlug, ja so laut, dass ich es auf der anderen Seite des Hauses hören konnte, und die nun völlig stumm geworden war.
Meine Mutter behauptet, von meiner Taubheit gewusst zu haben, lange bevor ich begriff, dass ich ein Hörproblem hatte. Ich erinnere mich an den ersten Hörtest, den ich nicht bestand. 1969 besuchte ein mobiler Testbus der Kalifornischen Gehörgesellschaft die Serra-Schule. Er stand auf dem Schulparkplatz. Während des Tages kamen die Kinder klassenweise hinunter, setzten sich einen der Kopfhörer auf, zeigten auf, wenn sie einen Ton hörten, und gingen nach ein paar Minuten wieder hinaus. Alle außer mir. Ich musste bleiben und wurde getestet und wieder getestet und nochmals getestet von immer finsterer blickenden Erwachsenen, die untereinander flüsterten (was eigentlich unnötig war, denn ich konnte sie ohnehin nicht hören). Heute weiß ich, dass ich einmal hören konnte und dann plötzlich als kleines Kind nicht mehr. Mein Hörverlust war nach wissenschaftlichen Definitionen schwerwiegend, und die Diagnose und ihre Auswirkungen auf mein Leben waren gewaltig.
Es war ein Schock, als alle anderen Kinder den Bus verlassen konnten und dann meine Mutter in die Schule gerufen wurde. Zuerst wusste ich nicht, was ich davon halten sollte, doch bald ahnte ich, dass mit mir etwas Gravierendes nicht stimmte. An diesem Tag beschlich mich ein Gefühl der Furcht, und diese Erinnerung hat mich seitdem nicht verlassen. Ich habe den Hörtest mit sechs Jahren wieder nicht bestanden, auch nicht mit sieben oder acht. Danach kannten mich die Leute von der Kalifornischen Gehörgesellschaft, die die Tests durchführten, bereits und dachten sich, dass es sinnlos sei, mich mit den anderen Kindern zu testen, da ich ohnehin dauernd untersucht wurde. Ich war etwas enttäuscht, da ich immer noch glaubte, mein Zustand würde sich eines Tages bessern; dann würde ich den Test bestehen und wieder zu den „normalen“ Kindern gehören. Aber das passierte nie.
Ich verlor mein Hörvermögen wahrscheinlich allmählich in meiner frühen Kindheit. Da ich häufig krank war, musste ich immer wieder zum Arzt und lag häufig im Bett, mit hohem Fieber, geschwollenen Drüsen, chronisch wiederkehrenden Ohrinfektionen. Was genau die Ursache meines Gehörverlusts war, werde ich nie wissen. Ich zeigte auch allergische Reaktionen auf Antibiotika. Heute sind sich die Ohrenspezialisten (Otologen) einig, dass mein Gehörverlust höchstwahrscheinlich durch hohes Fieber oder eine ototoxische Reaktion auf Antibiotika oder durch beides hervorgerufen wurde, wobei eine ototoxische Reaktion auf Gentomyocin am ehesten in Frage kommt. Allerdings ist es letztlich egal, wie ich mein Gehör verlor. Das Resultat bleibt das gleiche.
„Der Bub ist schwerhörig! Schwerhörig, Mrs. Ball! Er wird viel, viel Hilfe brauchen, Mrs. Ball! Ganz viel Hilfe“, schrie die Audiologin.
Mit elf hatte ich mich schon daran gewöhnt, dass immer wieder Hörverlust festgestellt wurde, aber diese Audiologin tat das mit geradezu überschwänglichem Eifer. Jedes Mal, wenn mein Vater einen anderen Job bekam oder die Krankenversicherung wechselte, wurde mein Gehörverlust unweigerlich wieder von einem neuen Audiologen „entdeckt“. Als ich daher von dieser seltsam begeisterten Audiologin getestet wurde, hatte ich schon genug Erfahrungen mit diesen Tests. Ich weinte nicht mehr wie am Anfang, als man mir mitteilte, dass ich ein gravierendes Problem hätte. Ich hatte nicht mehr diesen Kloß im Hals, ich dachte nicht mehr, mein normales Leben sei für immer vorbei und ich müsse in eine Spezialschule gehen, nein, diesmal wurde ich wütend.
„Das wissen wir, verstehen Sie. Wir wissen, dass ich nicht hören kann. Was ist mit Ihnen los? Es ist wirklich nicht cool, sich bei dieser Diagnose so aufzuführen!“, schrie ich sie zornig an. Ich war wirklich wütend. Ihr Benehmen war einfach lächerlich.
Die Audiologin, die noch jung war, erstarrte. Meine Mutter stand hinter ihr und runzelte die Stirn.
Ich dachte mir:Na toll, jetzt krieg ich eswieder ab.Doch als wir im purpurnen Mercedes nach Hause fuhren, erklärte mir Mom, dass nicht ich der Grund ihres Ärgers war, sondern die Enthusiastische.
„Geoff“, sagte Mom, „manchmal werden sich die Leute verrückt aufführen und dumm auf deine Schwerhörigkeit reagieren. Das ist aber nicht deine Schuld.“
„Mom“, antwortete ich, „ich will nicht wieder zu der gehen. Die versteht das nicht.“
„Okay, wir werden schauen, was wir tun können.“ Und damit brachte mich Mom zurück zur Schule.
Ich hasste meine „Taubheit“. Sie machte mir Angst. Soweit ich das mitbekam, versuchten die Ärzte, eine ernsthafte Erkrankung auszuschließen. Obwohl ich nicht wusste, was Worte wie „Akustikusneurinom“ und „Tumor“ bedeuteten, war mir doch klar, dass diese Worte nichts Gutes verhießen. Was, wenn sich mein Zustand verschlimmern und ich den letzten Rest meines Gehörs verlieren würde?
Die Diagnose Gehörverlust war schrecklich, und durch all die Untersuchungen fühlte ich mich noch schrecklicher. Selbst heute, in der Rückschau, wird mir flau im Magen, und ich werde nervös, wenn ich daran denke. Es ist das Gefühl, etwas Kostbares verloren zu haben, das man nie wieder zurückbekommt, sosehr man auch versucht hat, es zu behalten. Die Situation schien hoffnungslos, düster, bedrohlich. In den ersten Wochen nach der Diagnose verbrachte ich Stunden um Stunden mit Hör- und Sprechtests in schallgeschützten Räumen. Ich konnte mich bemühen, wie ich wollte, das Resultat war immer gleich: Verdammt! Schon wieder beim Test durchgefallen. Nach ein paar Monaten hörten die Tests auf und ich nahm mein normales Leben wieder auf, aber dieses flaue Gefühl blieb mir erhalten.
Vielleicht war einer der Gründe, weshalb ich meine Schwerhörigkeit so hasste, das damit verbundene Stigma. Üblicherweise werden Personen mit Gehörverlust mit dem althergebrachten Terminus „taubstumm“ bezeichnet. Ich weiß nicht, woher dieser Ausdruck kommt, vielleicht weil viele geistig oder sonst in ihrer Entwicklung Gestörte auch an Hörverlust leiden. Es könnte auch daher kommen, dass Personen mit Gehörverlust oft die richtige Antwort auf die falsche Frage geben. So machen wir manchmal einen beschränkten Eindruck, auch wenn wir sehr intelligent sind. Durch das verminderte Hörvermögen können wir auch die Lautstärke unserer Stimme nicht abschätzen und erscheinen oft laut und unerträglich. Wir geraten in viele peinliche und verwirrende Situationen, ohne dabei sozialen Regeln folgen zu können.
Warum sprechen Menschen automatisch leiser, wenn sie einem näher kommen? Das passiert jedes Mal und ist zum Wahnsinnigwerden. Auch beginnen Leute viel zu laut zu sprechen, ja sogar zu schreien, wenn sie sich mit einer schwerhörigen Person unterhalten. Dazu verwenden sie dann noch ein vereinfachtes Vokabular. Und meinen sie es besonders gut, beginnen sie noch wild zu gestikulieren.
„Geoffrey!!!Ich will, dass du, duhu! liest!DIESEN SATZ! VOR DER KLASSE! VOR DER KLAAAAASSE! VOR DEEER KLAAAASSE!“ Heftige Gesten, Finger, die aufgeregt auf einen Absatz zeigen, während einen alle anderen Schüler verwirrt anstarren.
Da will man im Boden versinken. Ich erstarrte dann oft in einem verlegenen Schockzustand, versuchte fieberhaft die richtigen Worte zu finden, das Richtige zu sagen und verstummte gleichzeitig völlig angesichts dieser Idiotie.
Solche Verhaltensweisen sind nicht nur auf Gespräche mit Hörgeschädigten beschränkt. Als sie von meinem Gehörverlust erfuhr, setzte mich eine meiner Lehrerinnen sofort in die erste Reihe und begann dann mit Riesenbuchstaben und in Rot auf die Tafel zu schreiben. Immer wenn ich in der Klasse war, holte sie die rote Kreide hervor und schrieb drei Mal so groß wie sonst. Klar, wer nichts hört, ist auch dumm und kann daher von großer Schrift in Rot nur profitieren. Ich saß nur stumm, erstarrt vor Peinlichkeit, und war niedergeschmettert.
Natürlich wollte ich oft schreien: „Was machen Sie da? Ich kann doch gut sehen! Ich will nicht in der ersten Bank sitzen. Ich brauche keine extragroßen Buchstaben! Die anderen Kinder werden mich für einen Idioten halten!“ Doch ich wand mich nur jeden Tag vor Erniedrigung, fühlte mich schutz- und wehrlos den besten Absichten ausgeliefert, hinter denen aber schlimme Vorurteile steckten.
Ich bin sicher, dass sich die anderen Kinder nicht annähernd das dachten, was ich mir in meiner jugendlichen Phantasie ausmalte. Aber damals hätte ich mich am liebsten verkrochen. Ich wollte nicht, dass irgendwer erfuhr, und insbesondere nicht meine Kameraden, dass ich anders war. Nachdem mein Gehörverlust diagnostiziert worden war, diente ich Forschern und Studenten, die sich mit dem Gehör befassten, als Fallstudie, und sie besuchten mich häufig. Sie saßen herum und beobachteten mich, manchmal musste ich etwas lesen oder irgendeine Übung machen. Sie zeigten mir neue Wörter, und ich sollte sie aussprechen. Mit Hilfe meiner Mutter, die meinem Bruder und mir jeden Abend vorlas, hatte ich mir schon vor der Schule das Lesen selbst beigebracht, und aus irgendeinem Grund war die Art, wie ich las und wie ich mir neue Wörter aneignete, faszinierend für die Forscher. Ich erinnere mich an viele Fragen, wie ich das Lesen eigentlich gelernt hatte, was ein einzelnes Wort im Zusammenhang mit anderen bedeutete usw.
Es ist faszinierend, dass ich nie gelernt hatte, Wörter vom ersten bis zum letzten Buchstaben zusammenzusetzen, wie es üblicherweise geschieht. Ich las, indem ich die Muster von Wörtern und Sätzen erkannte. Genau werde ich freilich nie wissen, was für die Forschung an meiner Art zu lesen, Worte auszusprechen und zu hören so interessant war.
Ich kann mich an eine Studentin erinnern, die viel Zeit mit mir verbrachte und mir Folgendes erklärte: „Du bist deshalb so interessant für uns, weil du das nicht so wie andere machst, und daher wollen wir verstehen, wie du es machst, damit wir dir und anderen besser helfen können.“
Das absolut Letzte, was ich damals wollte, war natürlich, anders als die anderen zu sein. Ich vermutete, dass sie irgendeinen Grund suchten, mich aus der Serra-Schule zu nehmen und in eine Schule für Taube zu stecken. Ich wollte kein „Fall“ für die Forscher sein. Vielleicht erinnere ich mich nicht so genau, was wirklich so interessant für sie war, aber ich erinnere mich, dass für mich das einzig wirklich interessante Konzept vieler Heilpädagogen und Sprachtherapeuten, die mit mir arbeiteten, eines war: Lippenlesen.
Ich bekam spezielle Betreuung, um Lippenlesen zu lernen. Ich war nicht das einzige Kind an der Serra-Schule, das besondere Beachtung und Betreuung erhielt. Unserer kleinen Gruppe wurde zwar immer wieder gesagt, dass wir besonders wären, doch dachten wir alle, dass wir irgendwie „nicht normal“ wären. Zu Beginn wurde mir sprachtherapeutisch mehr geholfen als allen anderen. Doch da sich meine Sprechfähigkeit für jemanden mit meiner hochgradigen Schwerhörigkeit erstaunlich gut entwickelt und gebessert hatte, verwendete man mehr Zeit darauf, mit mir Lippenlesen zu üben. Das war genau das Richtige für mich. Für alle Normalhörenden wirkt Lippenlesen oft wie eine Art Zauberei. Ich wurde lange Zeit von Sprachcoaches in dieser Fertigkeit trainiert. Stundenlang wurden mir Worte ohne Ton vorgesprochen, musste ich in lauter, verwirrender Umgebung üben, wurden mir Worte mit halb verdeckten Lippen vorgesprochen. Manchmal konnte ich nur die Wangen der Therapeuten sehen. All das stundenlang, immer wieder. Mir machte das wesentlich mehr Spaß, als immer wieder Vokale und Konsonanten auszusprechen.
‚‚O.“ „OOOOOh.“ „O.“ „Jetzt Geoffrey!“ „S.“ „Ssssss.“ „S.“ Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Aber Lippenlesen fand ich cool, und ich liebte es.
Wenn ich zu meinen Hörtests ging, waren die Audiologen ganz erstaunt, wie gut ich es beherrschte. Zunächst dachten sie, mein Gehör hätte sich verbessert. Dann dachten sie, dass ihre Testgeräte nicht in Ordnung wären. Sie erfassten bald, dass es nicht genügte, ihren Mund zu verstecken, wenn sie die Worte für den Sprechtest vorlasen, und drehten sich schließlich während des Tests um. Ich konnte so gut Lippenlesen, dass die meisten Leute kaum merkten, dass ich so schlecht hören konnte.
„Mrs. Ball, Ihr Geoffrey ist der beste Lippenleser, der mir je untergekommen ist“, sagte einmal einer meiner Tester zu ihr.
Zu jener Zeit hatte das kalifornische Schulsystem genügend Geld für sonderpädagogische Betreuung. In der Grundschule erhielt ich sehr viel zusätzliche Unterstützung, ob ich wollte oder nicht. Bald verbrachte ich drei Tage pro Woche mit einem Sprachtherapeuten, um meine Sprechmuster und meine Aussprache zu verbessern. Ich trainierte, bis ich ein Lippenlese-Weltmeister war. Ich beherrschte das echt gut. Wenn die anderen Kinder ihre Fremdsprachklassen hatten, erhielt ich zusätzlichen Sprach- und Englischunterricht. (Damals glaubte man, dass eine Fremdsprache der Entwicklung eines erstklassigen Englisch abträglich wäre, heute ist man von dieser Meinung abgerückt.) Mit all dieser Unterstützung machte ich solche Fortschritte, dass man gar nicht versuchte, mir die Zeichensprache beizubringen. Manchmal besuchte ich Spezialklassen für taube Kinder, doch meist war ich mit Kindern mit unterschiedlichen sonderpädagogischen Bedürfnissen zusammen. Manche dieser Bemühungen waren erfolgreich, andere nicht. Manche Sonderpädagogen waren tolle Lehrer, andere weniger. Einige konnten mich gut motivieren und mir wirklich helfen. Heute spreche ich ordentlich und klar. Perfekt ist es natürlich nicht, und manchmal behauptet meine Frau, ich mache die ganze Zeit Fehler, aber Hauptsache, sie versteht mich.
Bald nach der Diagnose Hörverlust wurde mir mein erstes Hörgerät angepasst. Es sah wie ein großer Klumpen mit einer hässlichen, unförmigen Ohrmuschel aus. Damals hielten Audiologen in den Vereinigten Staaten Hörgeräte für keine geeignete Behandlungsmethode und durften deshalb laut Anweisungen ihres Hauptverbandes (der Amerikanischen Akademie für Audiologie) keine akustischen Geräte verordnen. Daher wurde mein Hörgerät von einem Mann, der in seinem Privathaus in San Jose arbeitete, angepasst. Eingequetscht zwischen einem Geschäft für Staubsauger-Verkauf und -Service und einer Werkstatt für Stoßdämpfer, machte das Haus einen schäbigen Eindruck. Die Akustikdecke wurde von Lichtreflektoren angestrahlt, das Büro war dunkel und beengt und roch unangenehm nach den drei Pekinesen, die ständig dort herumrannten. Seine Frau half im Büro mit und hatte eine jener Bienenstockfrisuren, die so hoch aufgetürmt war, dass sie an den Türstöcken streifte. Mein Ohrenarzt war damals Mansfield Smith. Er hatte eine reguläre Ordination, die offensichtlich dafür eingerichtet war, Leute zu behandeln. Als ich daher von dieser sauberen Praxis zu diesem schmuddeligen Haus kam, war für mich klar:Das kann nichts Gutes verheißen.
Als mir das erste Mal ein Hörgerät eingesetzt wurde, kam ich mir wie ein Alien vor, der gerade auf irgendeinem fremden Planeten gelandet ist. Elektronisches Surren, Quietschen, Kreischen – ich hörte nichts. Man zeigte mir, wie ich das kleinere Teil in meinen Gehörgang und das größere hinter mein Ohr stecken musste und wie ich mit einem kleinen Rad die Lautstärke regeln konnte.
Ich mochte das nicht, also testete der Mann das Gerät noch einmal, studierte die Ausdrucke und erklärte dann: „Es ist in Ordnung. Du musst dich einfach daran gewöhnen.“
„Aber es tut weh und klingt schrecklich!“, protestierte ich.
„Das braucht einfach einige Zeit“, wiederholte er.
Ich setzte das Gerät ein, ging hinaus und wurde vom Verkehrslärm auf der First Street fast umgeworfen. Es war unglaublich laut. Alles war viel zu laut. Ich kam mir wie ein Marsmensch vor. Meine Mutter holte die Autoschlüssel heraus, und das Klimpern war wie Hämmern auf meinen Kopf.
„Ich hasse das“, sagte ich ihr.
„Du wirst dich mit der Zeit daran gewöhnen, haben sie doch gesagt, du musst es halt versuchen.“
Es war mir von Anfang an klar, dass das keine Lösung für mich war.
„Können die Ärzte meine Ohren nicht operieren?“, fragte ich Mom.
„Nein, dein Ohrenleiden kann durch eine Operation nicht verbessert werden. Zumindest haben das die Ärzte gesagt.“
„Gar nicht?“
„Nein“, antwortete sie.
Der einzige Vorteil des Hörgeräts war, dass ich Montagvormittag die Schule schwänzen konnte, um zur Anpassung zu gehen. Das Schlimmste aber war, dass die Lehrerin der ganzen Klasse erzählt hatte, wo ich war und was passierte. Auf diese Weise erfuhr die gesamte Schule von meinem Hörverlust und dem Hörgerät, mit dem ich am Nachmittag auftauchen würde. Das war absolut keine tolle Idee.
Als ich daher am Nachmittag zurückkam und mich nur möglichst unauffällig auf meinen Platz setzen wollte, kam jedes einzelne Kind der Klasse zu mir:
„Lass mich das anschauen! Ich will es sehen!“
Ich empörte mich gegenüber der Lehrerin: „Sie haben es ihnen gesagt! Sie haben es jedem gesagt!“, und als sie mich anschaute, wusste ich, dass dem so war. Die ganze Klasse schwirrte um mich herum. Ein Kind versuchte das Gerät herunterzunehmen, andere drehten an dem Lautstärkeregler, den ich mindestens eine Woche überhaupt nicht anrühren sollte, bis ich mich daran gewöhnt hätte.
Ich war am Boden zerstört. Zum ersten Mal hörte ich den Spottgesang: „Tauber Geoff! Geoff ist taub! Geoff kann nichts hören, weil er taub ist.“ Es war ein schrecklicher Tag, wirklich schrecklich. Ich wollte auswandern.
Die Minuten zogen sich wie Stunden, und als die Schule endlich vorbei war, rannte ich, der jüngste Mutant der Serra-Schule in Sunnyvale, den ganzen Weg nach Hause, jagte in mein Zimmer, sperrte die Tür zu, um mich in meinen Kissen zu vergraben, in der festen Absicht, nie wieder herauszukommen. Aber als ich den Kopf niederlegte, begann mein Hörgerät wie ein Banshee zu kreischen und ich konnte es weder abdrehen noch herunternehmen. So saß ich auf meinem Bett, überzeugt, dass mein Leben zu Ende war, dass mein Hörgerät niemals funktionieren würde und dass ich auf eine Schule für Taube geschickt würde.
Schwerhörigkeit
Silence comes and silence is
The quiet place
True thinking lives
Das war also mein Leben in Sunnyvale: gute Freunde, ein rosa Haus, ein purpurner Mercedes, mit dem ich einmal pro Woche zu einer guten Bibliothek fuhr, Kleider aus dem Mervyn-Store. Ich konnte zwar nicht wirklich etwas hören, aber ich konnte perfekt Lippenlesen und hatte unbegrenztes Lesematerial. Nach etlichen Versuchen trug ich mein Hörgerät nur noch selten, weil es mir ohne besser ging. Im Grunde verursachte es nur Kopfschmerzen, sonst nichts. Solange ich gut in der Schule war und hart arbeitete, war die Gefahr der „Schule für Taube“ gebannt. Ich erhielt so viel sonderpädagogische Betreuung in der Schule wie überhaupt möglich. Gottlob war ich in Sunnyvale.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!