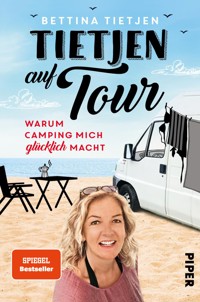9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In diesem sehr persönlichen Buch erzählt Bettina Tietjen von der Demenzerkrankung ihres Vaters, vom ersten "Tüdeln" bis zur totalen Orientierungslosigkeit. Offen und liebevoll beschreibt sie die Achterbahn ihrer Gefühle, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber auch ganz neu kennenzulernen, und die vielen komischen Momente, in denen sie trotz allem herzhaft zusammen lachen konnten. Bettina Tietjen musste lernen, dass Demenz ein Zustand ist, der ganz allmählich von einem vertrauten Menschen Besitz ergreift. Zuerst merkt man es nicht, dann will man es nicht wahrhaben. Schließlich muss man lernen, es zu akzeptieren. Denn trotz aller Herausforderungen ist Bettina Tietjen überzeugt: Demenz ist nicht nur zum Heulen, sondern kann auch Denkanstoß und Kraftquell sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Es war mein Anliegen, die Erlebnisse so authentisch wie möglich zu erzählen. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte habe ich Namen, Begebenheiten und Personen leicht verfremdet, was jedoch an dem Gesamteindruck, wie ich alles erlebt habe, nichts ändert.
ISBN 978-3-492-97031-0 Juni 2016 © Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2015 Die Zeichnungen hat Burchard Schniewind, Bettina Tietjens Vater, in seinen letzten Lebensjahren angefertigt. Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München Covermotiv: Bettina Tietjen privat Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Für meine Eltern.
Prolog
Als am Sonntagabend gegen 22Uhr mein Handy klingelt, weiß ich noch nicht, dass dieser Anruf mein Leben verändern wird. Ich bin müde, habe sieben Tage am Stück moderiert und freue mich auf mein Sofa.
Die Mailbox piept. Na und? Wer stört schon um diese Zeit. Eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, es herauszufinden, greife aber aus Gewohnheit trotzdem nach meinem Handy und höre mir die Nachricht an.
»Guten Abend, Frau Tietjen, hier spricht die Polizei Wuppertal. Wir befinden uns im Haus Ihres Vaters. Es gab einen … Zwischenfall. Wir bitten dringend um Rückruf.«
Ich starre fassungslos mein Handy an. Mein Vater ist zu diesem Zeitpunkt 86Jahre alt. Er hat Demenz im fortgeschrittenen Stadium, lebt aber noch in seinem Reihenhaus in Wuppertal und wird rund um die Uhr von zwei lettischen Frauen betreut, die sich abwechseln. Zwei Häuser weiter wohnt meine jüngere Schwester Dagmar, die aber momentan in Afrika im Urlaub ist und dort meistens kein Netz hat. Vor einer Woche war ich noch bei ihm, um nach dem Rechten zu sehen. Da war alles noch so weit in Ordnung.
Und jetzt das. Ich rufe zurück. Mein Herz klopft. Ich befürchte das Schlimmste.
»Frau Tietjen? Die Nachbarn Ihres Vaters haben uns benachrichtigt. Wir haben seine Betreuerin hier bewusstlos vorgefunden, sie war volltrunken und hat sich mehrfach im Wohnzimmer übergeben. Sie wurde ins Krankenhaus abtransportiert. Ihr Vater wird gerade von der Nachbarin ins Bett gebracht. Können Sie bitte sofort kommen?«
Gott sei Dank! Er lebt noch.
»Äh, ich wohne in Hamburg, das kann dauern …«, höre ich mich stammeln.
»Das ist schlecht. Die Nachbarn sind alle hier, möchten Sie jemanden sprechen?«
Ich verlange nach dem einzigen Nachbarn, den ich näher kenne. Er erklärt mir, so knapp es geht, was passiert ist: Mein Vater hat gegen 21Uhr völlig verwirrt bei der Nachbarin zur Linken geklingelt und gesagt, er wolle ins Bett. Als sie ihn zurückbringen wollte, war die Haustür ins Schloss gefallen, und niemand öffnete, obwohl innen alles hell erleuchtet war.
Eine kleine Delegation von eilig zusammengerufenen Nachbarn schlich sich daraufhin durch den Garten an und entdeckte beim Blick durchs Wohnzimmerfenster Fürchterliches. Auf dem Teppich lag ein regloser Frauenkörper. Zu sehen waren nur die Beine – der Rest war vom Sofa verdeckt. Es half kein Klopfen, kein Rufen und kein Hämmern – da regte sich nichts. Nach kurzem Beratschlagen (meine Schwester war ja nicht zu erreichen) wählten sie die 110. Und die Polizei tat, was in so einem Fall getan werden muss.
Eine Viertelstunde später sah die kleine Siedlung aus wie ein Tatort: Polizei, Blaulicht, Feuerwehr, Notarzt. Alle Nachbarn auf den Beinen. Im Handumdrehen wurde die Tür aufgebrochen – und da lag sie. Zum Glück nicht tot, aber so betrunken, dass sie nicht mehr ansprechbar war.
Mein armer Vater war in seiner Verwirrung natürlich als Zeuge völlig ungeeignet. Also wurde getratscht und spekuliert und währenddessen hektisch nach meiner Telefonnummer gesucht.
Ich bitte den netten Nachbarn, so lange bei meinem Vater zu bleiben, bis wir da sind, lasse mir von der strengen Polizistin noch nahelegen, »dieses Arbeitsverhältnis so schnell wie möglich zu beenden …«, und springe mit meinem Mann ins Auto.
Als wir gegen zwei Uhr nachts in Wuppertal ankommen, öffnet uns überraschenderweise die Missetäterin höchstpersönlich die Tür. Anna ist völlig zerknautscht und zerknirscht. Sie hat schon alle Spuren beseitigt. Offenbar hat sie sich aus dem Krankenhaus still und heimlich weggeschlichen. Der Nachbar guckt ratlos, mein Vater schläft.
»Ich nix wissen, was passiert. Haben getrunken Brandy mit Freundin. Ich sonst nie trinken. Ehrlich!« Sie schluchzt. »Nach Trinken ich noch mit Opa spazieren. Danach ich nix mehr wissen.« Ein klarer Fall von Filmriss. Todmüde nehme ich sie in den Arm, dann gehen wir alle schlafen.
Am nächsten Morgen berate ich mich mit meinem Mann. Mein Vater steht seit fast einem Jahr auf der Warteliste eines Hamburger Seniorenheims ganz bei mir in der Nähe. Meine Schwester drängt schon länger darauf, dass ich ihn zu mir hole. Seit dem Tod unserer Mutter vor mehr als 20Jahren kümmert sie sich um ihn. Die fortschreitende Demenz, das ständige Kontrollieren der sprachlich und fachlich oft überforderten Pflegerinnen, das Gefühl, dass die ganze Verantwortung auf ihren Schultern lastet – all das macht ihr zu schaffen und zehrt an ihren Kräften. Dass sich etwas ändern muss, war schon länger klar. Über den Zeitpunkt hat jetzt der Zufall entschieden.
Ich rufe im Altenheim an und schildere den Fall. Eine Stunde später der Rückruf: »Sie können Ihren Vater mitbringen, wir haben einen Platz zur Kurzzeitpflege für ihn.«
Anna ist fassungslos und kaum zu trösten. Ich erkläre ihr, dass die Situation nach diesem Zwischenfall nicht zu halten und das Vertrauensverhältnis massiv gestört sei. Sie versteht das nicht und will nicht zurück nach Lettland. »Wir uns immer kümmern um Opa. Opa nix Heim. Lieber hier mit Anna bleiben.«
Es bricht mir fast das Herz, aber ich sehe keine andere Lösung. Sympathie hin oder her, ich kann meinen alten orientierungslosen Vater nicht länger mit einer Frau alleine lassen, die mal eben so an einem Sonntagnachmittag eine Flasche Brandy kippt und danach komplett die Kontrolle über sich und ihren Schützling verliert. Ich gebe ihr das Geld für den Bus nach Hause, packe meinem Vater den Koffer und ihn ins Auto.
Bei herrlichem Wetter drehen wir noch mal eine Runde durch das wunderschöne Bergische Land, meine Heimat und auch die meines Vaters. Sein ganzes Leben hat er hier verbracht. Was wir, mein Mann und ich, in diesem Moment wissen, ahnt mein Vater nicht: All das hier sieht er wahrscheinlich zum letzten Mal. Schluss, aus, vorbei. Zu Lebzeiten wird er hierher wohl nicht zurückkehren. Das hier ist ein Aufbruch ins Unbekannte.
Es treibt mir die Tränen in die Augen. Mein Vater dagegen sitzt ganz entspannt auf dem Beifahrersitz neben meinem Mann und betrachtet die grünen Hügel mit den Fachwerkhäusern.
»Schön hier«, sagt er. »Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier schon mal war.«
Was ich in diesem Moment noch nicht ahne: Sein Umzug nach Hamburg wird mein Leben nicht nur sehr verändern, sondern auch bereichern. Wir werden eng zusammenrücken, mein Vater und ich, enger als jemals zuvor. Wir werden viel Spaß miteinander haben. Aber mir steht auch eine große Herausforderung bevor. Meine Nerven werden starken Belastungsproben standhalten müssen, mein gewohnter Lebensrhythmus wird aus dem Takt geraten. Und auch für meine Familie wird es keine leichte Zeit werden.
Ein neuer Abschnitt beginnt. Für zwei Jahre und sieben Monate.
Kommt denn hier keiner?
Das Foyer des Seniorenheims ist hell und einladend, durch eine breite Fensterfront sieht man den bunt bepflanzten Garten. »Willkommen bei uns!«, steht auf dem Plakat am Eingang neben dem Zeitungsständer mit der Heimzeitschrift. Tüdelig – na und? heißt das Monatsblättchen. Na, die nehmen es hier offenbar mit Humor.
Wir werden gebeten, in einer Sitzecke Platz zu nehmen. Während wir warten, studiere ich die gerahmten Bilder an der Wand gegenüber. Alle leitenden Angestellten sind dort mit Foto abgebildet, daneben hängen jede Menge Zertifikate, die vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung regelmäßig an alle Pflegeeinrichtungen vergeben werden. Ich sehe nur »sehr gut« in allen Bereichen, was mich in diesem Moment beruhigt. Wie diese Noten zustande kommen und dass sie ihren Zweck, Transparenz zu schaffen, nur bedingt erfüllen, werde ich erst später lernen.
All das hatte ich mir schon einmal aufmerksam angesehen, vor einem Jahr, als ich nach einer Unterkunft für meinen Vater in meiner Nähe suchte. Auf den Internetseiten der Hamburger Gesundheitsbehörde wurden unter der Rubrik »spezielle Demenzbetreuung« in meiner unmittelbaren Umgebung nur zwei Heime aufgeführt, eins davon war dieses hier. Bei der Besichtigung fiel mir neben der angenehmen Atmosphäre vor allem eins auf: Es roch nirgendwo nach Urin. Und das ist in einem Altersheim leider ganz und gar nicht selbstverständlich.
»Kommt denn hier keiner?«, fragt mein Vater leicht ungehalten. Er weiß zwar nicht, wo er ist, erwartet aber, dass sich jemand um ihn kümmert. In seiner Jugend hatte man Personal: Köchin, Kindermädchen, Gärtner, Putzfrau. Die wohlhabenden Eltern machten sich selbst nicht die Finger schmutzig. Den leicht arroganten Befehlston hat er sich wohl schon als Kind angewöhnt. Der Dünkel kam immer mal durch, im Restaurant zum Beispiel rief er gern, noch bevor er sich gesetzt hatte: »Hallo? Bekommt man hier mal was zu essen?« Die Demenz hat ihn zwar sehr viel weicher und nachgiebiger werden lassen, aber ein bisschen Herrenreiter blitzt gelegentlich noch auf.
»Herzlich willkommen in unserem Haus, Herr Schniewind!«
Eine kleine, durchtrainierte Frau um die 40 hat sich neben meinen Vater gehockt. Ihre schwarz gefärbten Haare sind raspelkurz geschnitten, die Schläfen sind rasiert. Sie hat auffällig blaue Augen und einen offenen, klaren Blick. Leise, aber deutlich und freundlich spricht sie meinen Vater an und fragt, wie es ihm gehe. Er sei sicher noch müde von der langen Fahrt und brauche erst mal ein bisschen Ruhe. Sie stellt sich vor als Frau Platt, Heimleitung, und legt ihre Hand auf seinen Arm. Mein Vater lächelt. Er scheint sie sympathisch zu finden. Und das, obwohl ihre Fingernägel schwarz lackiert sind und sie einen dicken silbernen Totenkopfring am Mittelfinger trägt. Eine solche Erscheinung hätte ihn früher gleich skeptisch gemacht.
Frau Platt erklärt kurz, was jetzt auf uns zukommt: Mein Vater bekommt erst einmal ein Doppelzimmer zugewiesen, das er alleine nutzen kann. Für vier Wochen – die sogenannte Kurzzeitpflege.
»Verstehen Sie, Herr Schniewind? Damit Sie erst mal sehen können, ob es Ihnen hier überhaupt gefällt!«
Mein Vater schaut etwas irritiert und nickt. Die Chefin lächelt und stellt uns dann eine attraktive junge Frau vor, die sich gerade zu uns gesellt hat: »Das ist Frau Fedder, unsere Pflegedienstleiterin. Sie ist meine wichtigste Kraft hier und wird Sie jetzt zum Wohnbereich bringen.«
Frau Fedder ist groß und kräftig, hat einen wilden blonden Lockenkopf und fröhliche braune Augen. In der einen Hand hält sie eine Tüte mit Weingummis und ein Handy, mit der anderen schüttelt sie meine Rechte. Ich muss einen Schmerzensschrei unterdrücken, so einen Händedruck haben sonst nur Bodyguards.
»Herzlich willkommen!« Als sie den Blick meines Vaters sieht, der sich an die Weingummis geheftet hat, hält sie ihm die Tüte hin. »Die hab ich immer dabei«, sagt sie grinsend, »kommt super an bei Menschen jeden Alters!«
Wir fahren mit dem Aufzug in die zweite Etage: Wohnbereich 2.
»Das ist der sogenannte beschützte Bereich«, erklärt die Pflegedienstleiterin. »Hier leben 34 demenziell veränderte Menschen in Doppel- oder Einzelzimmern in einer Art Wohngemeinschaft. Der Jüngste ist erst 47Jahre alt, die Älteste 101.«
Auch hier ist alles modern und geschmackvoll eingerichtet, es gibt zwei große Aufenthaltsräume mit Küchenbereich, Esstisch und Sitzgruppe. Alles ist liebevoll dekoriert im Retrostil: hier ein altes Transistorradio, da ein Herd aus Omas Zeiten, ich sehe auch ein Grammofon, ein Klavier und Blumen auf den Tischen.
Mein erster Blick fällt auf einen alten Mann im Rollstuhl. Er ist an eine Art Tropf angeschlossen, guckt apathisch, sein Mund steht offen. Er sieht aus wie ein Gespenst.
Oh mein Gott, denke ich, hoffentlich bleibt das meinem Vater erspart.
Frau Fedder sieht meinen Blick, streichelt dem Mann liebevoll über die Wange und beugt sich zu ihm hinunter: »Na, Herr Subowski, Sie sehen ja wieder fit aus! Immer schön aufpassen, dass hier kein Unbefugter den Flur betritt.«
Der Mann hebt kurz die Hand und verzieht den Mund zu etwas, das man mit viel Phantasie als Lächeln interpretieren könnte. »Herr Subowski ist schon 92«, sagt sie, während sie mit großen, energischen Schritten den Flur entlanggeht, »er hat vor Kurzem eine PEG, also eine Magensonde, gelegt bekommen. Seit er künstlich ernährt wird, ist er wieder richtig aufgeblüht.« Ich drehe mich vorsichtig noch mal um. Also, wenn so »aufgeblüht« aussieht, befindet sich mein Vater ja offensichtlich noch in Höchstform.
Auf dem Weg zum Zimmer rollt uns ein anderer Mitbewohner entgegen und strahlt mich an.
»Hallooooo!«, ruft er. »Kannst du mir helfen?«
»Was möchten Sie denn?«, frage ich leicht verunsichert.
»Zigaretten!«, ruft er fröhlich und krallt sich an meinem Arm fest.
»Nun lass mal los, Arthur!«, sagt Frau Fedder lachend und schiebt uns weiter den Flur entlang. »Das ist unser Schwerenöter Arthur. Er quatscht jede Frau an, entweder will er rauchen oder heiraten.«
Das Zimmer ist groß und fast leer. Bett, Nachttisch, Kleiderschrank, Stuhl. Na ja, es ist ja nur vorübergehend. Nachdem wir von den Pflegern begrüßt und eingewiesen wurden, kehrt erst einmal Ruhe ein. Ich beobachte meinen Vater. Wie nimmt er das hier auf? Versteht er, was gerade passiert? Ist er traurig, böse, durcheinander? Ist er so weit, den Umzug ins Altersheim zu akzeptieren?
Er sitzt auf dem einzigen Stuhl und guckt aus dem Fenster in den Garten. Dann dreht er sich zu mir um.
»Scheiße!«, sagt er.
Ich bin nie ganz sicher, was er meint, wenn er flucht. Das ist eine Angewohnheit, die mit fortschreitender Demenz immer schlimmer geworden ist. Niemals hätte er solche Ausdrücke in seinem früheren Leben benutzt, nur nachts, in seinen Albträumen, brach es manchmal aus ihm heraus. Tagsüber aber war alles, was sich »nicht gehörte«, tabu.
»Ach was, Vati, alles wird gut. Guck mal, wie schön die Sonne scheint! Ich packe jetzt erst mal deinen Koffer aus.«
Ich täusche gute Laune vor, trotzdem bin ich irgendwie deprimiert. Das hier ist jetzt also sein Zuhause. 47Jahre hat er in seinem Reihenhaus gewohnt, seit dem Tod meiner Mutter vor über 20Jahren allein, mal abgesehen von dem Jahr mit Iveta und Anna, den beiden Lettinnen. 47Jahre umgeben von den vertrauten Möbeln, den Bildern an den Wänden, dieselbe Straße, derselbe Garten, derselbe Blick aus dem Fenster. Und jetzt diese Entwurzelung. Habe ich das richtig gemacht? Hätten wir uns nicht doch nach neuen Betreuerinnen umsehen müssen? Hätten wir möglicherweise mehrere Fachkräfte fest anstellen müssen, die 24Stunden für ihn da gewesen wären? Das wäre allerdings finanziell kaum zu stemmen gewesen. Oder doch ein Heim im vertrauten Wuppertal?
Diese Zweifel werden mir von jetzt an immer wieder kommen. Aber immer sind auch schnell die Gegenargumente bei der Hand: Er merkt nicht mehr wirklich, wo er ist. Für ihn sind (fast) alle Menschen immer wieder neu und fremd. Die Gruppe und das umfangreiche Unterhaltungsprogramm werden ihn aufmuntern. Er ist hier umgeben von Fachkräften, die etwas von Demenz verstehen, dazu gehören Ergotherapeuten, Musiktherapeuten, Logopäden und Krankengymnasten. Es gibt Vorträge, Filmvorführungen, Spiele, Ausflüge und Feste. Es ist das Konzept dieses Seniorenheims, die alten Menschen nicht zu isolieren, sondern sie am sozialen Leben teilhaben zu lassen, wann immer es geht. Direkt neben dem Haus fließt ein kleiner Bach, über den eine Holzbrücke führt, am Ufer steht eine einladende Bank. Gegenüber ist ein großer Park, da kann ich mit ihm spazieren gehen.
Und das Wichtigste: Er ist jetzt hier bei mir. Ich kann mich kümmern und muss nicht ständig mit schlechtem Gewissen bei meiner Schwester anrufen und meinen übervollen Terminkalender nach Tagen durchforsten, an denen ich mich nach Wuppertal absetzen kann.
»So, Vati. Morgen mache ich dir erst mal einen schönen Osterstrauch. Und in zwei Wochen holen wir deine Möbel, damit du es hier richtig gemütlich hast!« Er guckt teilnahmslos. Eine hübsche Pflegerin steckt den Kopf durch die Tür:
»Herr Schniewind? Möchten Sie etwas essen? Es gibt Schnitzel mit Bratkartoffeln.«
Sofort hellt sich sein Blick auf.
»Essen gut! Ich Hunger«, sagt er und folgt der Pflegerin in den Aufenthaltsraum, ohne sich nach mir umzudrehen.
Schon wenige Tage nachdem Lettland bei meinem Vater eingezogen war, hatte er das gebrochene Deutsch der beiden Frauen übernommen, als handelte es sich um eine neue Fremdsprache. Er redet seitdem fast nur noch so, was zwar irgendwie komisch, aber angesichts seiner humanistischen Bildung und seines recht differenzierten Wortschatzes auch schade ist.
Nachmittags setzen wir uns in den Garten in die Sonne und füllen gemeinsam den umfangreichen »Biografie-Bogen« aus, den hier jeder neue Bewohner beim Einzug bekommt. »Um eine individuelle Pflege für Ihren Angehörigen gewährleisten zu können, sind sowohl medizinische Daten als auch Angaben zu Lebenseinstellung, Lebensgeschichte, Erlebnissen und Erfahrungen sowie Wünschen und besonderen Gewohnheiten hilfreich.« Also vermerke ich unter anderem, dass mein Vater gern klassische Musik hört, Zeitung liest, Schlips trägt, regelmäßig den Gottesdienst besucht, jeden Morgen duscht, gerne Schokolade isst und mit Leib und Seele Architekt war.
Was ich zuerst für eine etwas lästige Formsache gehalten habe, hat sich im Lauf seines Aufenthalts vielfach bewährt. Bis zuletzt wurde mein Vater zum Beispiel mit Zeichenblock und Stiften ausgestattet und zum Skizzieren animiert, ein Angebot, das er immer gern annahm. Sein Nachbar, Herr Schultze, ein ehemaliger Busfahrer, saß dagegen oft stundenlang mit einem Autoschlüssel in der Hand im Sessel und fuhr im Geiste glücklich die A7 rauf und runter.
»Vati, hier wird nach deinem Kindheitshobby gefragt. Was hast du als kleiner Junge am liebsten gemacht?«
Das Beantworten der Fragen dauert. Mein Vater schweift immer wieder ab, betrachtet das Haus und den Garten und vergisst nach zwei Sekunden schon wieder, was ich gerade gefragt habe.
»Radfahren!«, sagt er auf einmal. »Und mit Bauklötzen spielen.«
Dann fängt er an, laut zu rezitieren:
Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte,
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Eduard Mörike. Diese Zeilen gehören zu dem Repertoire an deutscher Poesie, das sich bei ihm in irgendeiner Hirnwindung eingebrannt hat, die immun ist gegen den Verfall. (Und zum Glück auch gegen das gebrochene Deutsch der lettischen Pflegerinnen.) Bis zuletzt hat er diese Gedichte in jeder Lebenslage aufsagen können. Es stimmt mich ein bisschen wehmütig, aber auch froh, dass der Umzug dieser Angewohnheit offensichtlich nichts anhaben konnte.
Ich bleibe an diesem ersten Tag bei meinem Vater, bis er ins Bett geht. Das Gefühl, eine vertraute Person bei sich zu haben, tut ihm sicher gut. Seine Mitbewohner interessieren mich an diesem Einzugstag noch nicht wirklich, ich nehme sie kaum wahr. In diesem Moment sehe ich im Tunnelblick nur ihn, für den ich mich jetzt verantwortlich fühle.
Als ich gehe, habe ich ein Déjà-vu. Genau so habe ich mich gefühlt, als ich meinen Ältesten zum ersten Mal allein im Kindergarten zurückgelassen habe.
»Machen Sie sich nicht verrückt«, hat die Erzieherin damals zu mir gesagt, als mein Kind weinend am Fenster stand und mir »Mama, Mama!« hinterherrief. »Sobald Sie außer Sichtweite sind, lacht er wieder.« Sie hat recht behalten.
Reißbrett? Scheißbrett!
Ich schlafe schlecht in dieser ersten Nacht. Schweißgebadet werde ich immer wieder wach, geplagt vom schlechten Gewissen. War es die richtige Entscheidung? Wird die Entwurzelung die Demenz nicht beschleunigen? Vielleicht geistert mein Vater jetzt durch die Flure des Wohnbereichs auf der Suche nach irgendeiner vertrauten Stimme oder einem bekannten Gesicht.
Vielleicht hat er wieder einen seiner Albträume, die mich meine Kindheit und Jugend über begleitet haben wie dunkle Schatten. Gruselig war das, wenn meine Schwester und ich mitten in der Nacht wach wurden durch die Schreie aus dem Elternschlafzimmer nebenan. Laut, kaum verständlich und mit angstverzerrter Stimme rief mein Vater Wortfetzen in die Dunkelheit, Flüche, Hilferufe, Beschimpfungen.
»Du Drecksau! Satan! Luzifer! Lass mich in Ruhe!«
Dazwischen leise die beschwichtigende Stimme meiner Mutter, die versuchte, ihn zu wecken, ihn zu retten aus seiner unterbewussten Not. Manchmal kuschelten wir Kinder uns aneinander, hielten uns die Ohren zu und warteten, bis der Spuk vorbei war. Am nächsten Morgen erschien der nächtliche Schrecken immer harmlos, er wurde sogar beim Frühstück fröhlich thematisiert.
»Vati hat mal wieder geträumt«, spöttelte meine Mutter, »weißt du eigentlich, dass du wieder um dich geschlagen hast? Ich hatte Mühe, dich zu bändigen.« Er lachte dann verlegen und sagte: »Tja, ich weiß auch nicht, was mich da wieder geritten hat. Immer diese Kriegsbilder. Ich hatte wohl wieder Angst.«
Kein Wunder, dass der Krieg meinen Vater immer wieder heimgesucht hat. Wie viele Männer seiner Generation hätte er eigentlich eine Therapie gebraucht, um die schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten. Als er eingezogen wurde, war er gerade mal 18Jahre alt. Er ging zur Marine und wurde schnell zum Offizier befördert. Die Anfangszeit verlief friedlich, sein Schiff war in der Bretagne auf Beobachtungsposten. An Bord ging es offenbar, so erzählte er später manchmal verschämt, recht derbe und hochprozentig zu. Es wurde viel geraucht und getrunken, und die Witze, die nach Mitternacht die Runde machten, schockierten den Sohn aus gutem christlichen Hause.
Natürlich konnte er das damals nicht zugeben, als piepjunger Offizier musste er ja mithalten.
»Zum ersten Mal richtig betrunken war ich Weihnachten 1942«, hat er meinem Sohn mal von Mann zu Mann gebeichtet.
Aber viel schlimmer als der Alkohol war das, was danach kam: die Flüchtlingsschiffe. Als der Krieg und Hitler schon in den letzten Zügen lagen, wurden bekanntlich die Menschen zu Tausenden aus den Ostgebieten übers Meer vor den Russen gerettet – für viele eine Flucht in den Tod. Mein Vater war nicht auf der »Wilhelm Gustloff«, aber auf einem der anderen Schiffe, die versenkt wurden. Er hat immer nur bruchstückhaft darüber gesprochen, aber so viel ist bei mir hängen geblieben: das brennende Schiff, um ihr Leben schreiende Menschen, Chaos und Todesangst. Um welches Schiff es sich damals handelte, wie genau er es geschafft hat zu überleben – ich weiß es nicht. Aber die Erinnerung an das Grauen, das er als sehr junger Mann damals nicht verkraften konnte, ist bei ihm offenbar nur sehr langsam verblasst. Nachts war sie immer am stärksten.
»Hat mein Vater laut geträumt, haben Sie Geräusche aus seinem Zimmer gehört?«, frage ich die erste Pflegekraft, die mir über den Weg läuft, als ich am nächsten Morgen den Wohnbereich betrete. »Nein, davon ist mir nichts bekannt, soweit ich das in den Notizen sehe, hat er eine ruhige Nacht verbracht.«
Die junge Frau stellt sich vor: »Ich bin Nadine, die Wohnbereichsleiterin. Wann immer Sie Probleme oder Fragen haben – ich bin jederzeit für Sie da.«
Ich muss erst mal schlucken. Nadine sieht aus wie 21, macht aber einen entschlossenen und selbstbewussten Eindruck und schaut mich an wie jemanden, der sich unbefugt Zutritt zu dieser Etage verschafft hat.
»Wo finde ich denn meinen Vater?«, frage ich freundlich und verdränge sofort den Gedanken, dass sie eventuell zu jung für diesen verantwortungsvollen Job sein könnte.
»Ihr Vater ist in seinem Zimmer, er war ein bisschen müde, in einer halben Stunde gibt es dann Mittagessen.«
Ich sehe auf die Uhr: fünf vor elf. An diesen neuen Rhythmus wird er sich wohl erst gewöhnen müssen.
Als ich vorsichtig die Tür zu seinem Zimmer öffne, scheint mir die Sonne ins Gesicht. Südseite, eigentlich schön – da schimmert sogar das schlichte Einheitsmobiliar in schmeichelhaftem Licht. Mein Vater liegt auf dem Bett und guckt mich mürrisch an.
»Na, wie hast du geschlafen?«, will ich wissen.
»Gut.«
»Und sonst?« – Keine Antwort. Er dreht den Kopf und sieht aus dem Fenster.
»Weißt du, wo du bist?«, frage ich vorsichtig.
»Ich nicht weiß.«
»Wie ist denn das Personal hier so?« (Ich weiß ja, dass er alle, die ihn umgeben, automatisch für Untergebene hält.)
»Geht so.«
Kurz angebunden heute, aber das ist ja auch kein Wunder nach dem ganzen Wirbel.
Ich packe meine Osterdekoration aus und mache mich gerade daran, das kahle Zimmer durch einen gigantischen Kirschzweigstrauch zu verschönern, da unterbricht er mich ganz unromantisch: »Ich muss mal.«
Zielstrebig steuert er die Tür an, auf der ein großes Schild mit einer unverkennbaren Toilette prangt.
»Scheißhaus!«, sagt er grinsend und drückt die Klinke herunter. Verblüfft gucken wir uns an – abgeschlossen! Nanu?
»Hallo«, rufe ich zögernd, »ist da jemand?«
Nach einer langen Pause eine zitternde Frauenstimme: »Jaaa. Ich bin hier.«
Verwirrt blicke ich zu meinem Vater. Er guckt teilnahmslos.
»Würden Sie bitte mal die Tür öffnen?«, frage ich.
»Das geht nicht«, kommt es sehr verhalten zurück. Ich habe so eine diffuse Ahnung, dass hinter dieser Tür keine schöne Überraschung wartet.
»Bitte! Machen Sie doch auf, ich helfe Ihnen!«, flöte ich.
Ganz langsam dreht sich der Schlüssel. Die Tür öffnet sich einen Spalt – im Badezimmer steht eine zierliche weißhaarige Dame. Mit weit aufgerissenen Augen sieht sie mich an. In der einen Hand hält sie einen verschlissenen Teddy, den sie fest an sich presst. Mit der anderen versucht sie, ihre Hose festzuhalten, die herunterzurutschen droht.
»Was wollen Sie hier?«, fragt sie schüchtern. »Das ist mein Zimmer.«
Ich versuche, die kotverschmierte Toilette zu ignorieren, und kämpfe gegen die Übelkeit, die der Geruch in mir auslöst. »Kommen Sie mit mir, Sie haben sich wohl im Zimmer geirrt«, sage ich beruhigend und versuche, die kleine Dame behutsam am Arm aus dem Zimmer zu führen.
»Nein!«, ruft sie entschlossen. »Ich wohne hier! Das ist mein Zimmer. Und könnten Sie vielleicht jemanden holen, ich kann so nirgendwo hingehen, ich …« Sie sieht an sich herab, und ich bemerke erst jetzt, dass sie völlig beschmutzt ist.
»Ich gehe nirgendwohin, ich wohne hier!«, sagt sie noch mal trotzig und drückt ihren Teddy gegen die Brust. Seufzend mache ich mich auf die Suche nach Hilfe.
»Oh, Frau Becker! Sie hat sich im Zimmer geirrt, das kommt hier häufig vor«, sagt der junge Pfleger mit einem Lächeln. Ein netter Kerl, groß, schlank, muskulös und offensichtlich gut gelaunt. Der Mann liebt seinen Beruf, das merkt man sofort. »Ich hole schnell Gummihandschuhe, dann bringe ich das wieder in Ordnung.«
Während Frau Becker und das Badezimmer wieder in ihren Originalzustand versetzt werden, bringe ich meinen Vater in den Speiseraum. Ein geschmackvoll eingerichtetes Zimmer mit großem ovalem Esstisch, einem altmodischen Ofen, Klavier, Sitzgruppe, Plattenspieler und Bildern an der Wand. Auf dem Tisch dampft schon die Gulaschsuppe – so habe ich mir das vorbildliche Seniorenwohnheim vorgestellt.
Mein Vater bekommt einen Platz zugewiesen, aber als ich mich zu ihm setzen will, sieht mich Nadine streng an: »Frau Tietjen, es ist bei uns nicht üblich, dass Angehörige während der Mahlzeiten anwesend sind. Das ist zum einen unfair gegenüber den Bewohnern, die keinen Besuch haben, zum anderen irritiert es das Personal, wenn Töchter, Söhne oder Ehepartner sich ständig einmischen. Das sind Erfahrungswerte, glauben Sie mir!«
Ihr entschiedener Ton duldet keinen Widerspruch. Mit ihrem strengen Zopf und dem roten Arbeitskittel hätte sie auch bei Hinter Gittern mitspielen können.
»Bekommt er ein Lätzchen?«, frage ich zögernd mit Blick auf seinen Kaschmirpullunder. »Er kleckert oft beim Essen.«
»Selbstverständlich. Allerdings nennen wir das hier Kleidungsschutz, im Interesse der Würde des Bewohners.«
Na, hier ist wohl erst mal Unterordnen angesagt. Ich küsse meinen Vater auf die Stirn und warte in seinem Zimmer auf ihn. Ich betrachte die Fotos, die ich beim hastigen Auszug eingepackt und jetzt überall im Zimmer verteilt habe, um einen Hauch von Heimat zu verbreiten. Viele kleine Silber- und Goldrahmen, die ganze Familie lächelt mich an, Eltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, Onkel, Tanten – meine Mutter liebte es, alles mit Fotos und Bildern zu dekorieren. Auch für meinen Vater waren Fotos immer wichtig, seine riesige Diasammlung füllte Schränke.
In den 60er-Jahren war es in unserem fernsehlosen Haus für uns Kinder immer ein Event, wenn der Projektor und die Leinwand ausgepackt wurden und die gut gelaunten Eltern Urlaubsschnappschüsse kommentierten. Am meisten liebe ich bis heute die Fotos, die mit Selbstauslöser gemacht wurden. Die ganze Familie quetscht sich feixend aufs Sofa – und ganz unten links am Rand sieht man noch Kopf und Oberkörper meines Vaters, der in letzter Sekunde ins Bild gehechtet ist.
Zum Glück hat er in seinen noch geistesklaren Rentnerjahren seine gesamte Diasammlung auf Papier abziehen lassen und ordentlich sortierte und beschriftete Alben angelegt. Als hätte er geahnt, dass diese Bilder am Ende seines Lebens mal eine wichtige Rolle spielen würden – als Erinnerungs-Eckpfeiler, um sein Leben zu rekonstruieren.
Ein ganz wesentliches Teil in diesem Puzzle ist seine Frau Marianne, meine Mutter. Von ihr, dem Menschen, der ihm am nächsten stand, gibt es hier die meisten Fotos. Aber merkwürdigerweise ist sie auch die Einzige, die er auf diesen Bildern immer seltener erkennt. Für mich ist es immer wieder ein kleiner Schock, wenn er bei unserem kleinen Ritual »Wer ist wer?« sämtliche Verwandten von seiner Mutter über Cousins, Cousinen, Onkel und Tanten identifizieren kann und nur bei Bildern meiner Mutter ins Zögern kommt.
»Wer ist das, Vati?«
»Ich nicht weiß!«
»Guck doch mal genau hin, das ist doch deine …?«
»Schwester?«, fragt er unsicher.
»Nein, das ist meine …?«
»Tante?«
Manchmal fasse ich es nicht. Die Frau, mit der er über 30Jahre lang verheiratet war, die er geliebt hat, mit der er drei Kinder gezeugt hat – ausgerechnet die erkennt er nicht mehr? Er guckt mich dann manchmal zerknirscht an, als hätte er ein schlechtes Gewissen. An meinem enttäuschten Gesicht sieht er wohl, dass da was nicht in Ordnung ist.
»Meine Frau?«, fragt er vorsichtig.
»Ja! Das ist Mami!«, freue ich mich dann. Gerade noch mal die Kurve gekriegt.
Ach ja, meine Mutter! Da sitze ich zwischen Tisch und Bett und Osterstrauch, starre auf die alten Fotos und werde sentimental.
Seit mehr als 20Jahren ist sie nun schon tot – und sie fehlt mir immer noch. Fröhlich war sie, temperamentvoll und stark. Sie hat das Leben und die Menschen geliebt, trotz aller Schicksalsschläge, die sie einstecken musste. Erst ist ihr der Mann nach kurzer Ehe weggestorben. Er war ihre erste große Liebe. Ein Blinddarmdurchbruch. Da war sie erst 26.
Jahre später, die neue Ehe mit meinem Vater, neues Glück, drei Töchter und dann die nächste Prüfung: Meine jüngste Schwester stirbt mit zwei Jahren. Sie hatte einen bösartigen Tumor an der Niere, der viel zu spät erkannt wurde. Eine Katastrophe, die unsere ganze Familie in den Grundfesten erschüttert hat und im Unterbewussten bis heute nachwirkt, sicher auch bei meinem Vater. Und schließlich hat meine Mutter selbst gegen den Krebs kämpfen müssen – und trotz aller Zuversicht und Hoffnung am Ende verloren.
Wäre alles anders gekommen, wenn sie nicht so früh gegangen wäre? Können Trauer und Einsamkeit die Demenz beschleunigen, vielleicht sogar zum Ausbruch bringen?
»So, Herr Schniewind, hier ist Ihr Zimmer, da ist auch Ihre Tochter! Am besten ruhen Sie sich jetzt erst mal ein bisschen aus.«
Ich schrecke aus meinen Gedanken hoch. Nadine schiebt meinen Vater sanft in Richtung Bett. Er sieht satt und zufrieden aus.
»Ich müde, ich heia!«, sagt er.
»Machen Sie ruhig ein paar Besorgungen, Frau Tietjen, heute Nachmittag lernen Sie dann unseren Ergotherapeuten kennen!«
Meinem Vater scheint das sehr recht zu sein, er hat im Moment nur Augen für Nadine. Die energische Art liegt ihm, da lässt dann wohl doch meine Mutter aus weiter Ferne grüßen.
Auf dem Weg nach draußen begegnet mir ein hochbetagtes Ehepaar, das ich kurz schon am Esstisch gesehen hatte. Anscheinend sind beide dement und, wie ich später erfahre, seit zwei Jahren hier im Doppelzimmer untergebracht. Sie wirken sehr gebrechlich, sind unzertrennlich, reden aber kein Wort miteinander. Mir fällt auf, dass die Frau ein blutunterlaufenes Auge hat. Misstrauisch schauen die beiden mich an.
»Na, Herr Kunze?«, ruft Nadine, während sie im Stechschritt vorbeimarschiert. »Alles o. k. bei Ihnen? Immer schön friedlich, nicht wahr? Das möchte ich nicht noch mal sehen, dass Sie Ihre liebe Frau schlagen!«
Oh mein Gott! Was ist denn hier los? In diesem Moment nimmt Frau Kunze meine beiden Hände in ihre und strahlt mich an: »Wie schön! Ich mag das! Sie sind so … so … so … ich …« Sie stammelt irgendetwas vor sich hin und sieht mich dabei unverwandt an. Offensichtlich will sie mir etwas ganz Wichtiges mitteilen, ich verstehe nur leider kein Wort.
Besorgt laufe ich zu Nadine, die jetzt in ihrem gläsernen Büro vorne am Anfang des Flurs sitzt, von wo sie alles im Blick hat.
»Ach, das ist nichts. Keine Sorge, Frau Kunze ist sehr mitteilsam, kann sich aber nicht mehr so artikulieren, einfach zuhören, nicken, das reicht schon, dann ist sie zufrieden!«
»Sind hier viele Ehepaare?«, frage ich Nadine. (Keine Ahnung, warum ich dabei plötzlich meinen Mann und mich Hand in Hand im Doppel-Elektro-Rollstuhl vor Augen habe.)
»Einige. Allerdings ist es meistens so, dass nur ein Ehepartner demenziell verändert ist und der andere dann auch hierherzieht, um in der Nähe zu sein. Die Kunzes sind da eine Ausnahme, aber es gibt auch oft Streit. Man muss immer aufpassen, dass die nicht aufeinander losgehen, da geht es manchmal richtig zur Sache.«
»Hat sie deswegen ein blaues Auge?«
»Nee, das war ich«, sagt Nadine lachend. »Spaß beiseite, das ist gestern Abend passiert, als die beiden alleine in ihrem Zimmer waren. Wir müssen wirklich immer wachsam sein. Demente Menschen können von einer Sekunde auf die andere von extremer Freundlichkeit auf totale Aggression umschalten.«
Ich beschließe, diese Informationen erst mal zu Hause bei einem Cappuccino sacken zu lassen. Was für ein Glück, dass ich in dieser Woche nicht arbeiten muss! Dass ich von Montag bis Freitag keinen einzigen Termin auf dem Zettel habe, kommt wirklich selten vor. Wer hätte sich sonst gekümmert? Meine Schwester ist im Urlaub, die Kinder sind in der Schule. Und mein Mann hatte nie ein besonders herzliches Verhältnis zu seinem Schwiegervater und ist deswegen als einfühlsamer Demenzbegleiter in dieser Lebensphase denkbar ungeeignet.
Als ich im Auto sitze, piept mein Handy. Eine SMS aus Afrika: »Wie geht’s euch? Hab gerade mal Netz. Mit Vati alles o. k.?«
Ach du meine Güte! Mir wird vor Schreck ganz heiß. Wie verhalte ich mich jetzt? Wie wird meine Schwester reagieren, wenn ich sie mal eben auf die Schnelle zwischen Elefanten und Löwen mit der Neuigkeit überrasche, dass ihr Vater nicht mehr in Wuppertal wohnt? Sie hat zwar schon lange darauf gedrängt, dass ich aktiv werde, aber so abrupt hat sie sich den Wechsel ganz bestimmt nicht vorgestellt. Warum sie jetzt beunruhigen? Ändern lässt sich sowieso erst mal nichts. Ich packe mein Handy wieder in die Tasche und beschließe, die SMS zu ignorieren. Wenn sie bald keinen Empfang mehr hat, erledigt sich die Sache hoffentlich von selbst.
Als ich nachmittags wieder im Heim aufkreuze, sitzt mein Vater im Garten im Strandkorb. Vor ihm steht eine Tasse Kaffee, und er ist dabei, ein riesiges Stück Käsetorte zu verspeisen. Neben ihm sitzt ein dunkelhaariger junger Mann und spricht mit ihm. Als die beiden mich sehen, lächeln sie mich an. Na, da macht aber offenbar jemand etwas richtig. Es ist das erste Mal, dass mein Vater in seinem neuen Zuhause nicht mürrisch guckt.
»Ich bin Andreas«, stellt der junge Mann sich vor, »ich gehöre zum Ergotherapeuten-Team. Sie erkennen uns an den hellblauen T-Shirts, das Pflegepersonal trägt ja immer rot.«
Der Mann ist mir auf Anhieb sympathisch. Er hat ein offenes, freundliches Gesicht und eine angenehme Stimme.
»Herr Schniewind und ich haben uns schon ausgetauscht, er war ja bei der Marine, und ich interessiere mich auch für große Schiffe.«
Dann wendet er sich wieder meinem Vater zu: »Ihre Tochter sieht aber Ihrer Frau Marianne sehr ähnlich.«
Oha! Dieser Andreas hat seine Hausaufgaben gemacht. Mein Vater ist erst einen Tag hier, und er hat offenbar schon genau seinen Lebenslauf studiert und sich aufmerksam die Fotos im Zimmer angesehen.
An der Reaktion meines Vaters sehe ich, dass die Bemerkung gerade etwas in ihm ausgelöst hat. Er lässt kurz die Kuchengabel sinken, nickt und lächelt unsicher. Dann verzieht er das Gesicht, als ob er gleich weinen würde, seine Augen füllen sich mit Tränen.
»Ähnlich, ja. Sehr ähnlich«, sagt er und guckt mich durchdringend an.
Diese Gratwanderung zwischen Lachen und Weinen, zwischen Freude und Betrübtheit beobachte ich immer häufiger an ihm. Ich nehme ihn in den Arm und freue mich, dass er sich im Moment offensichtlich wohlfühlt.
»Wie ist Ihr Eindruck?«, erkundige ich mich bei Andreas, »wie lange wird es wohl dauern, bis er sich eingelebt hat?«
»Das ist ganz unterschiedlich. Meistens bringt aber der Einzug ins Pflegeheim erst mal einen sogenannten Demenzschub mit sich, weil ja zur allgemeinen Orientierungslosigkeit noch die fremde Umgebung hinzukommt. Das ist ganz normal, deshalb kümmern wir uns am Anfang um die neuen Mitbewohner etwas intensiver. Aber Ihr Vater macht auf mich einen ganz aufgeräumten Eindruck. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich demnächst seine Hilfe als Architekt brauche.« Ich sehe ihn verständnislos an.
»Das haben wir ja schon abgemacht, Herr Schniewind, dass Sie für uns ein schickes Vogelhaus entwerfen. Wir besorgen für Sie ein Reißbrett und Stifte.«
Gespannt blicke ich meinen Vater an. Ob er das verstanden hat?
»Reißbrett? Scheißbrett!«, ruft er laut und kriegt sich vor lauter Freude über diesen gelungenen Witz kaum wieder ein. Andreas grinst und entschuldigt sich, weil eine alte Dame energisch an seinem Ärmel zupft.
»Bringst du mich jetzt endlich nach Hause?«, fragt sie. »Ich warte hier schon seit Stunden, und ich hab doch noch so viel zu erledigen.« Sie trägt Perlenohrringe, ist perfekt frisiert und elegant gekleidet.
»Wissen Sie, ich war nur vorübergehend hier, weil ich im Krankenhaus war«, flüstert sie mir verschwörerisch zu, »das dürfen die anderen hier aber nicht wissen.« Irritiert blicke ich zu Andreas. Der lächelt nur und schüttelt kaum merklich mit dem Kopf.
»Erst muss Ihr Bein mal richtig ausheilen, Frau Gottlob«, sagt er und nimmt ihren Arm, »wir zwei gehen jetzt mal nach oben und spielen eine Runde Karten.«
Was für ein angenehmer Mensch! Man spürt sofort, wie sehr er in seinem Beruf aufgeht, wie liebevoll er sich diesen verwirrten alten Menschen nähert, wie ernst er sie nimmt und ihnen ihre Würde lässt. Selbst bei meinem Vater, der eigentlich sehr lange braucht, bis er mit jemandem warm wird, hat er sofort den richtigen Ton angeschlagen. An Vatis Kinn klebt noch ein Klecks Käsekuchen, als er dem ungleichen Paar wohlwollend hinterherblickt und mich dann fragt: »Was jetzt?«
»Jetzt gehen wir ein bisschen spazieren, damit du die neue Umgebung kennenlernst!«, sage ich schwungvoll, wische ihm mit einem Stofftaschentuch (davon hatte er zeitlebens immer eins in der Hosentasche und mindestens 50 im Schrank) den Mund ab und mache mich mit ihm auf in den benachbarten Park. Zur großzügigen Grünanlage mit vielen Bänken sind es nur zehn Gehminuten.
»Weißt du, wo wir sind?«, frage ich meinen Vater.
»Elberfeld?«, überlegt er zögernd.
»Nein, wir sind in Hamburg«, verbessere ich ihn, »du wohnst jetzt gleich bei mir um die Ecke, ich habe dich hergeholt, damit wir uns öfter sehen können.«
»Mach keinen Quatsch!«, erwidert er und guckt mich schief an. Ich muss lächeln. Diesen Satz sagt er nur, wenn er gute Laune hat, das war schon früher so.
»Nee, kein Quatsch, Vati. Ich wohne doch da vorne, erinnerst du dich?«
Wie aus der Pistole geschossen, kommt meine genaue Anschrift mit korrekter Hausnummer und Stockwerk zurück. Die Adresse hat er also noch parat.
»Wie heißt du, und wie alt bist du?«, teste ich weiter. Mit diesen Standardfragen versuche ich genau wie mit den Fotos regelmäßig, sein Gedächtnis auf Trab zu halten.
»Burchard Schniewind, geboren am 27.April 1924.«
Sehr richtig. Auf dem Weg zum Park studiert er aufmerksam die Nummernschilder der vorbeifahrenden Autos.
»HH, HH, HH! Hahahahaha!«, ruft er erfreut. »Hier ist ja jede Menge los!«
Eine Joggerin mittleren Alters überholt uns.
»Dicker Arsch!«, ruft mein Vater laut und zeigt mit dem Finger auf die Frau.
»Vati«, ermahne ich ihn empört, »das sagt man doch nicht!«
»Warum denn nicht? Stimmt doch!«, murmelt er verständnislos.
Diese Hemmungslosigkeit! Es ist eine Begleiterscheinung der Demenz, an die ich mich nur schwer gewöhnen kann. Es kommen Instinkte durch, die mein Vater jahrzehntelang so gut vor allen verborgen hat, dass wir manchmal glaubten, so etwas wie Lust und Begehren sei bei ihm genetisch nicht angelegt. Hinzu kam der selbst auferlegte religiöse Verzicht auf »Fleischeslust«, wie es in der Bibel heißt.
Bevor hier Missverständnisse aufkommen: Mein Vater war kein verkappter Mönch, er hat nur eines Tages den Weg zu einer religiösen Gemeinschaft gefunden, die ihm geholfen hat, seine persönlichen und durch den Krieg bedingten Traumata halbwegs in den Griff zu bekommen. Eine kleine freikirchliche Gemeinde in Wuppertal, die – übrigens bis heute – ihr Leben streng danach ausrichtet, was wörtlich in der Bibel geschrieben steht.
Ich habe als Kind viele Stunden im Kreis dieser gläubigen Menschen verbracht, erst passiv und gehorsam, dann zunehmend kritisch und aufbegehrend, am Ende ratlos angesichts dieser Kombination aus religiöser Einfalt und fröhlicher Selbstgewissheit. Dazu muss man wissen: Wenn man ihre Regeln ernst nimmt, ist in dieser Welt eigentlich alles verboten, was Spaß macht. Kein Fernseher, kein Radio, kein Kino. Bücher nur dann, wenn sie sich mit dem Herrgott beschäftigen. Für die Frauen gilt: kein Schmuck, keine Schminke, keine Hosen, keine Kurzhaarfrisur. Flirten, Küssen, Sex vor der Ehe: tabu!
Im Gottesdienst sitzen Männer und Frauen getrennt voneinander. Frauen haben während des Gebets den Kopf mit einem Tuch zu bedecken und zu schweigen, außer beim Singen – da wird fünfstimmig geschmettert, was das Zeug hält! »Ich bete an die Macht der Liebe« – ich weiß nicht, wie viele Hundert Male ich diesen und andere Choräle inbrünstig mitgesungen habe. Als Teenager war der Gesang der einzige Lichtblick in dieser für mich beklemmenden Umgebung. Die Predigten hatten alle denselben Tenor: Wir Christen sind hier auf der Erde nur auf Durchgangsstation. Wenn wir uns an Gottes Gesetze halten, haben wir es im Himmel eines Tages besser.
Mein Vater hat sich in dieser Gemeinde aufgehoben gefühlt. Die selbst auferlegte Askese kann man deuten, wie man will, ihm hat sie offenbar durchs Leben geholfen. Vieles von dem, was er sich in seinem früheren Leben versagt hat, hat er aber in den Jahren der Demenz nachgeholt. Das gilt nicht nur fürs Fluchen, sondern auch für das Verhältnis zum anderen Geschlecht. Übrigens ist er da keine Ausnahme, wie ich im Wohnbereich 2 noch häufig beobachten werde. Da wird nicht nur ungeniert geguckt, sondern auch mal angefasst und gestreichelt.
»Was jetzt?« Mein Vater zupft mich am Ärmel.
Wir sind an einem Aussichtspunkt angelangt, zu dem uns unsere Spaziergänge noch sehr oft führen werden. Eine verwitterte Tafel erinnert an Kaiser Wilhelm II. Früher muss man von hier einen tollen Ausblick auf die Stadt gehabt haben, heute versperren hohe Bäume und Industrieschornsteine die Sicht.
»Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wiederhaben!«, singt mein Vater plötzlich und lacht. Eingehakt wandern wir zurück zum Heim. Als wir vor der Tür stehen, buchstabiert er laut, was dort in großen Buchstaben steht: »S-e-n-i-o-r-e-n-h-e-i-m«, und guckt mich verständnislos an. »Hier wohnst du jetzt, Vati«, sage ich, »das habe ich dir doch erzählt. Dein Zimmer ist in der zweiten Etage.« Er schüttelt den Kopf und lässt sich nur widerwillig von mir durch die Eingangshalle ziehen. Er hat bereits wieder alles vergessen, was er hier heute erlebt hat. Die Menschen, die er kennenlernte, das Zimmer, das Essen – alles weggewischt, ausgelöscht. Ich kenne das ja nun seit Jahren – und doch überrascht es mich immer wieder aufs Neue.
Im Vorübergehen höre ich Wortfetzen einer Unterhaltung.
»Weißt du, was am Freitag los ist?«, fragt eine noch jugendlich aussehende Frau ihren Mann, der im Rollstuhl sitzt und starr vor sich hinblickt. »Mein Geburtstag! Hast du das etwa auch schon vergessen?«, fragt sie gereizt.
»Alles auf Anfang«, murmele ich und schiebe meinen Vater sanft in den Aufzug.