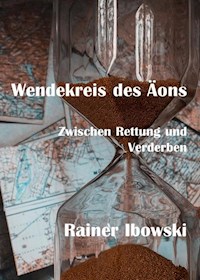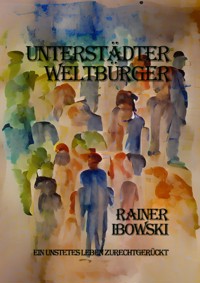
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist ein Kunterbunt an Erlebnissen, Reisen und Anekdoten aus meinem Leben, das sicherlich nicht vollständig alle Stationen erzählt, aber dafür hoffentlich einen kleinen Einblick gewährt, warum und wie ich denke und handele. Diesen Vorhang zur Seele etwas zu öffnen, ist mir bedeutsam, zumal im Alter hinzukommt, dass rückblickend Einzelschritte in einem logischen Zusammenhang erscheinen. In jungen Jahren sieht man dies nicht. Dies wäre auch schlimm, wenn nichts mehr einem gewissen Maß an Zufall überlassen wird. Winston Churchill formulierte, dass Planung alles und Pläne nichts sind. Als Physiker denke ich ebenfalls an eine Unschärferelation des Lebens. Oder, wie es meine Großmutter gerne ausdrückte, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Ibowski
Unterstädter Weltbürger
Ein unstetes Leben zurechtgerückt
Erste Auflage 2022
Text, Fotos und Umschlaggestaltung
© Dr. Rainer Ibowski
Verlag
Dr. Rainer Ibowski
Schwalbenweg 5
51674 Wiehl
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Ein Leben, das nicht kritisch
untersucht wird, ist es nicht wert, gelebt zu werden.
Sokrates (470 - 399 vor der Zeitenwende)
Inhalt
Unvermeidliche Eingangsgedanken
Zuhause fühlen
Bonn erfahren
Familie gründen
Junge Menschen fördern
Gesellschaftspolitisch wirken
Energiewirtschaft überdenken
Schienen legen
Lautstark schweigen
Kanada für Anfänger kennenlernen
Kanada für Fortgeschrittene erleben
Deutschland wiedersehen
Menschen verstehen
Ebenso unvermeidliche Schlussgedanken
Weitere Veröffentlichungen des Autors
Unvermeidliche Eingangsgedanken
Ich grübele seit mehreren Jahren darüber nach, ob und wie ich die Fortsetzung meiner Autobiografie der Jugendjahre „Unterstadt – Versuch einer Erinnerung“ anpacke. Ich bin fest entschlossen, dies zu schreiben. Aber wie gliedere ich eine solche Lebensgeschichte? Es fällt mir sofort ein, es als eine Art Zeitreihe anzulegen, chronologisch und penibel Jahr für Jahr aneinander zu reihen. Während das für Kindheit und Schulzeit gut geht, ist ein unstetes Erwachsenenleben wie meines dafür weniger geeignet, müsste ich doch immer wieder in den Erzählungen hin und her springen. Der rote Faden der Geschichte ginge schnell verloren. Irgendwann komme ich zu dem Schluss, dass so etwas nichts anderes ist als ein aufgeblasener Lebenslauf, vermutlich stinklangweilig und für eine Bewerbung zu lang.
Also was tun? Nach langen Zweifeln reift in mir der Plan, mein Leben von verschiedenen Seiten zu beleuchten, also die Kapitel meines Lebens thematisch zu gliedern. Auch dies hat seine Tücken. Zwangsläufig kommt es so zu Wiederholungen, die ich versuche dadurch interessant zu machen, dass ich mich auf den jeweiligen Aspekt konzentriere, also zum Beispiel Reisen sowohl unter den Gesichtspunkten Heimat als auch Erfahrungen diskutiere. Dies mag ebenfalls nicht die perfekte Lösung sein, spiegelt aber besser mein Inneres wider als eine bloße Chronologie. So entsteht ein Kunterbunt an Ereignissen und Phasen aus meinem Leben, das sicherlich nicht vollständig alle Stationen erzählt, aber dafür hoffentlich einen kleinen Einblick gewährt, warum und wie ich denke und handele. Diesen Vorhang zur Seele etwas zu öffnen, ist mir heute sehr bedeutsam, zumal im Alter hinzukommt, dass im Rückblick Einzelschritte in einem scheinbar logischen Zusammenhang erscheinen.
In jungen Jahren sieht man dies nicht. Dies wäre meines Erachtens auch schlimm, wenn nichts mehr einem gewissen Maß an Zufall überlassen wird. Planung ist bedingt möglich, wenn man akzeptiert, wie es Winston Churchill formulierte, dass Planung alles und Pläne nichts sind. Als Physiker denke ich ebenfalls an eine Unschärferelation des Lebens, die eine exakte Vorhersage des Ergebnisses eines gefassten Planes unmöglich macht. Versuchst du eine Konsequenz deiner Entscheidung so exakt wie möglich im Voraus zu bestimmen, werden andere Konsequenzen vager. Oder, wie es meine Großmutter gerne ausdrückte, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt.
An dieser Stelle muss ich mich bei meiner Frau entschuldigen, denn beim Schreiben merke ich, dass so mancher Gedanke in meinem Leben unausgesprochen geblieben ist. Ich habe einiges als bekannt unterstellt. Ich will meine Entschuldigung auch auf Verwandte, Freunde und Bekannte ausdehnen. Ich folge einer Gliederung des Buches, die an einzelnen kleinen und großen Ereignissen und Erlebnissen Dinge festmacht. Ich muss mich auf Anekdoten und Beispiele beschränken, denn ein vollständiger und ausführlicher Bericht über mein Leben ergäbe einen „Schinken“ von tausend Seiten und mehr. Es gibt mithin Auslassungen, was eventuell den einen oder anderen fragen lässt, ob mir die Begegnung mit ihr oder ihm unwichtig ist. Ich darf versichern, dass alle Begegnungen und alles Geschehen bedeutsam für meine persönliche und berufliche Entwicklung sind – ohne Ausnahme. Lediglich die Lesbarkeit erfordert Einschränkungen, die zufällig und nicht mutwillig sind.
Ich beginne mit Gedanken zur Heimat, ein gerade heute in den Zeiten von weltweiter Migration wichtiges Thema. Für mich, der viel auf dieser Welt sehen durfte, ist die Frage nach dem Zuhause auch eine bedeutsame Antwort auf oft gestellte Fragen im Bekanntenkreis. Wo fühle ich mich zuhause?
Im zweiten Kapitel mit Bonner Erfahrungen versuche ich aufzuzeigen, was mich für mein folgendes Berufsleben geprägt hat, welche Erfahrungen ich insbesondere während des Studiums sammeln konnte, um die unterschiedlichen Anforderungen meines beruflichen Werdeganges zu meistern. Da geht es um Physik und einen interessanten Studentenjob.
Bonn ist ebenfalls der Ort, wo meine Frau und ich eine Familie gründen, zwei Kinder bekommen und mit Freunden und Bekannten einiges unternehmen. Meine Frau ist berufstätig und eröffnet ihre eigenen Geschäfte. Auf diese Phase gehe ich im Kapitel „Familie gründen“ ein. Es endet mit unserem Umzug nach Oberfranken, über den ich ebenfalls hier kurz berichte.
Junge Menschen lehren und fördern sind mir stets ein besonderes Anliegen. Ich unterrichte an einem Gymnasium fast ein Jahrzehnt lang Mathematik und Physik. An der Universität bin ich in Physikpraktika für junge Studierende eingebunden. An der Universität in Calgary halte ich Seminare für junge Ingenieure ab, um ihnen Basiswissen über Verkehrsplanung in Städten zu vermitteln. Kontakt mit jungen Menschen ist nicht nur innerlich zufriedenstellend. Lehre ist Lernen für den Lehrenden. Ideenvermittlung ist keine Einbahnstraße.
Im Folgekapitel denke ich über mein politisches Engagement nach, über soziale Einstellungen, die nicht immer in Übereinstimmung mit meinem eher konservativ-kapitalistischen Umfeld sind. Ein bürgerliches Häusle-bauen mit samstäglichem Autowaschen ist mir bis heute zuwider. Ich lerne aber auch, dass sich gänzlich unterschiedliche politische Ansichten zwischen Chef und Mitarbeiter sachlich lösen lassen, wenn beide Seiten offen aufeinander zugehen. In diesem Kapitel erwähne ich insbesondere meine zehn Jahre in einem kommunalen Parlament.
Eine starke Prägung meines Berufslebens erfahre ich in den ersten zehn Jahren. Nach einer Beschreibung meiner Bewerbungen gehe ich ausführlich auf die Zeit bei der Interatom GmbH ein, die ich in den damaligen politischen Kontext stelle. Was bleibt – und ist deshalb Überschrift zu diesem Kapitel – ein Überdenken der Energiewirtschaft. Wie muss ein Energiemix aussehen, der nachhaltig und zukunftssicher ist?
Energie und Mobilität haben etwas gemeinsam. Es sind Grundbedürfnisse der Menschen. Von Interatom wechsele ich zur Siemens Verkehrstechnik nach Erlangen. Es geht nicht mehr um Kraftwerke, sondern um Schienenverkehr. Ich lege zwar nicht wörtlich Schienen, wie ich dieses Kapitel nenne, aber auf neuen Gleisen geht es rund um die Welt – Hektik und Stress einerseits, unvergessliche Eindrücke und Erlebnisse andererseits.
Mit lautstark schweigen beschreibe ich gerne meine vielfältigen Erfahrungen als Pressesprecher in der Industrie. Ich erzähle einige typische Ereignisse, die mich dem Journalismus nahegebracht haben, seinen positiven und seinen negativen Seiten. Journalismus und Autorenschaft sind aus meinem Leben seitdem nicht mehr wegzudenken.
Die deutlichste Veränderung erfahren meine Familie und ich durch meine Versetzung nach Kanada. Vom rheinischen Frohsinn über die Beschaulichkeit Frankens in die Weiten Nordamerikas ist ein Weg, den wir nicht mehr missen möchten. Rund ein Vierteljahrhundert in Kanada machen uns fast zu Einheimischen mit einer Vielzahl von Freunden und Bekannten. Meine Unterscheidung in ein Kapitel für Anfänger und eines für Fortgeschrittene ist ein wenig willkürlich. Dahinter stecken zunächst die praktischen Erfahrungen in der Neuen Welt, die uns durch meine Zugehörigkeit zu einem Weltkonzern erleichtert werden. Später dann als Selbständiger gibt es kein Netz mehr, das einen auffängt. Du bist gezwungen, in Kanada wie ein Kanadier zu leben. Wir empfinden es nicht als Belastung, sondern als Bereicherung.
Familiäre Ereignisse und Erkrankungen beenden vorübergehend unser Leben in Nordamerika. Wir sehen Deutschland nach einem Vierteljahrhundert wieder, das sich oberflächlich wenig und im Inneren stark verändert hat. Mehr als einmal stellen wir uns die Frage, ob wir noch in eine solche Umgebung passen.
Im vorletzten Kapitel ziehe ich ein Fazit aus meinen vielen Reisen. Länder sehen, Menschen verstehen und Kulturen entdecken und würdigen, machen einen erst zu einem Weltbürger, der sich von Egozentrismus befreit und Toleranz übt. Wir sind eben nicht der Nabel der Welt. Die Erde dreht sich nicht um uns, sondern wir drehen uns mit der Erde, eine Erkenntnis die uns klein und bescheiden machen sollte.
Was wären Gedanken und ein Rückblick auf ein unstetes Leben ohne philosophische Betrachtungen über das Leben schlechthin? Es sind die Gedanken, die einem im Kopf umherschwirren, wenn wir in der Abendsonne am Meer sitzen oder unter dem Sternenhimmel auf der Terrasse ein Glas Rotwein trinken. Wenn ihr es schafft, bis zu diesem Kapitel zu lesen, erfahrt ihr einige grundsätzliche Gedanken, die mein Leben bestimmen. Aus dem kleinen Jungen, der in Hildens Unterstadt mit dem Tretroller um den Häuserblock düst, ist ein Weltbürger geworden.
Wiehl, im September 2022
Zuhause fühlen
„Wo hat es Dir am besten gefallen?“ „Was ist deine Heimat?“ „Wo möchtest du alt werden?“
Mal abgesehen davon, dass die Frage nach dem Altwerden etwas irritierend wirkt, wenn man sie einem 76jährigen stellt, habe ich keine einfachen Antworten. Ich verstehe den Grund dieser Fragen, erzähle ich doch gerne von meinen Erlebnissen und Eindrücken auf meinen vielen Reisen. Ich habe vielleicht achtzig Länder besucht – manche nur kurz auf einer Geschäftsreise, also Flughafen, Büro, Hotel, Flughafen. In anderen habe ich das Glück, mich ein paar Tage aufzuhalten und etwas Landesspezifisches aufzusaugen. In einigen wenigen habe ich sogar mehrfach wochenlang verbracht oder für einige Zeit gelebt.
Habe ich einen bevorzugten Ort auf dieser Welt? Ich weiß es nicht. Ich weiß jedoch, dass ich diese Fragen jeweils anders beantworte, wenn unterschiedliche Kriterien angelegt werden. Mir fällt dann immer eine Anekdote ein. Ich war als junger Mann alles andere als erpicht auf weite Reisen oder Ortswechsel. Im Rahmen meines Physikstudiums hätte sich wohlmöglich ein einjähriger Austausch mit der Universität von Rochester im US-Bundesstaat New York ergeben können. Ich war gar nicht begeistert und habe mich geduckt. Es ist wohl Ironie des Schicksals, oder nenne es Karma, dass wir Jahrzehnte später in ein Haus gegenüber auf der Nordseite des Ontariosees in Oakville, Ontario, Kanada eingezogen sind.
Zurück zur Frage nach Heimat! Manche Menschen mögen es nicht, damit konfrontiert zu werden. Sie bauen einen Schutzwall auf und antworten flapsig, dass ihre Heimat dort ist, wo es drahtloses Internet gibt. Bloß keine Gefühle preisgeben!
Jeder Mensch hat seine Heimat dort, wo er geboren ist und aufwächst. Bei vielen und gerade bei den unsteten Erdbewohnern verlagert sich dieses Heimatgefühl häufig ins Unbewusste. Aber es ist ständig vorhanden und wird gelegentlich abgerufen. Ich bin ein Kind der Hildener Unterstadt, einem Viertel rund um die Benrather Straße und den Bahnhof, ein Viertel, das lange Zeit als nicht sehr nobel gilt. Erst in den letzten zwei, drei Jahrzehnten wurde es aufgehübscht – und hat so sein altes Flair verloren.
Ich gestehe, dass ich bei meinen jetzt seltenen Besuchen in Hilden gerne einmal, und sei es auch nur kurz, die alten Wege in der Unterstadt abfahre. Hier werden Erinnerungen wach: frühe Kindheit, Opas Schrebergarten, wilde Spiele mit Nachbarkindern, Schulzeit, erste Liebe und Knutschen. Warum soll ich solche Gedanken verdrängen? Klar auch, ich habe in unserer digitalen Welt Informationen aus Hilden am Computer abonniert, die ich intensiv studiere. Ich habe sogar auf der NINA-Warnapp Hilden als einen der Orte angegeben, über den ich informiert sein will.
Ich sehe im Ort der Geburt und der Kindheit so eine Art Urheimat, die sich aus dem Unbewussten von Zeit zu Zeit meldet. Sicherlich gibt es auch Schlechtes zu erinnern, aber das Tolle ist, dass sich der Blick mit zunehmendem Alter verklärt und das Schöne überwiegt.
Meine Frau, ebenfalls Hildenerin (pardon, sie legt Wert darauf, dass sie in Haan geboren ist), und ich sind dann nach Bonn verzogen. Bonn wurde uns eine zweite Heimat, eine Wahlheimat, die im Bewussten lebt, denn wir können erklären, warum wir gerne an fast fünfundzwanzig Jahre dort zurückdenken. Wir lieben diese Bonner Mischung aus kleinstädtischem Milieu und großer weiter Welt. Natur und Kultur sind sozusagen in Gehwegentfernung. In Bonn fühlen wir uns zuhause. Eine richtige Familie entsteht. Unsere beiden Kinder werden hier geboren. Meine Frau eröffnet ihre ersten Geschäfte. Ich studiere an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Physik und promoviere. Ich mache die ersten Schritte ins Berufsleben. Der damalige Lehrermangel in Nordrhein-Westfalen eröffnet mir die Chance, als Lehrer im Angestelltenverhältnis Physik und Mathematik am Mädchengymnasium Troisdorf-Sieglar (heute Heinrich-Böll-Gymnasium) zu unterrichten.
In Bonn sammele ich die ersten politischen Erfahrungen in einem kommunalen Parlament. Zehn Jahre bin ich Mitglied der Bezirksvertretung Bonn und beschäftige mich in der Opposition insbesondere mit Fragen von Stadt- und Verkehrsplanung, Umweltschutz und ebenfalls, im Rheinland wichtig, mit Brauchtum und Städtepartnerschaft.
Am wichtigsten ist natürlich nach der Universität meine erste Anstellung in der Wirtschaft bei Interatom GmbH, ein deutsch-amerikanisches Joint Venture, das bei meinem Einstieg zu Beginn des Jahres 1979 im Besitz der Kraftwerkunion ist. Ich bin zuständig für technisch-wirtschaftliche Grundsatzfragen, eine Stabsstelle, die man heute wohl mit dem Anglizismus Technology Assessment bezeichnen könnte. Zur Autofahrt ins Büro benötige ich gut dreißig Minuten. Uns kommt es aber nicht in den Sinn, in die Nähe des Unternehmens ins schöne Bergische Land umzuziehen. Wir haben uns zu sehr an unsere Wahlheimat Bonn gewöhnt, haben viele Freunde und Bekannte mit gemeinsamen Festen und Unternehmungen.
Mit den ersten Familienurlauben und Geschäftsreisen beginnen dann auch die Träumereien, ob es nicht auch andere verlockende Orte auf dieser Welt gäbe. Wir haben eine klassische Anforderung für den Familienurlaub: Sonne, Sand und Meer. Urlaub in den Bergen ist nicht unser Ding, wohl weil wir als Kinder zu hastigen Wanderungen in den Alpen gezwungen waren. Morgens früh schnell auf einen Gipfel, um mittags zum Essen zurück in der Pension zu sein. Denn „all inclusive“ ist noch nicht erfunden. Man bucht die Unterkunft mit Halb- oder Vollpension. Eine Esseneinkehr unterwegs ist verschleudertes Geld, da das Mittag- und Abendessen bereits bezahlt ist und pünktlich auf dem Tisch steht.
Wir folgen den Spuren meiner Eltern. Es bedeutet Camping zunächst an der Adria in Italien. Dann wird die Mittelmeerküste im Süden Spaniens entdeckt, hauptsächlich in der Gegend von Tarragona. Es ist interessant, aber ein Gefühl kommt nicht auf, ob dies einmal ein neues Domizil werden könne. Dies ändert sich ein wenig, als wir schließlich öfters auf der Insel Hvar in Kroatien (damals Jugoslawien) Ferien machen, nicht mehr mit Zelt sondern in Ferienwohnungen. Du fühlst dich gleich heimischer, denn du bist nicht mehr einer von Hunderten von deutschen Touristen auf dem Campingplatz. Du lernst einheimische Nachbarn kennen, musst dich in dem Städtchen wie zu Hause selbst organisieren. Enge Gässchen, Olivenhaine, Lavendelfelder und natürlich Strand und Meer sind die weiteren Zutaten für Träume eines dauerhaften Aufenthalts. Allerdings wird uns sofort bewusst, dass ein wichtiges Kriterium für eine Wahlheimat nicht erfüllt ist -- wirtschaftliche und politische Stabilität. Auf Schnitzel mit Pommes Frites kann ich verzichten, nicht aber in einer Diktatur leben.
Meine erste Geschäftsreise ins Ausland geht nach Griechenland. Ich arbeite in einem Team, das gemeinsam mit griechischen Partnern im Auftrag des deutschen Bundesforschungsministeriums einen mit Solarenergie versorgten Stadtteil von Athen plant und baut. Es folgen viele weitere Projektbesprechungen in Athen. Später kommen Fotovoltaik-Projekte auf griechischen Inseln hinzu. Griechenland zeigt sich mir, dem unerfahrenen Deutschen, auf eine fast schon orientalische Weise: Trubel in Athen, aber keine Hektik, kleine Straßenmärkte in der Altstadt, Abendessen nach einigen Ouzos um 23 Uhr, Absacker in einem Straßencafé auf einem kleinen Platz in der Nachbarschaft. Inselbesuche faszinieren mich besonders. Vor einer Bar im Hafen sitzen und einen türkischen (Entschuldigung, griechischen) Kaffee zu schlürfen, vielleicht kombiniert mit einem Gläschen Metaxa, nur dem gemütlichen Treiben oder den Fischerbooten zuschauen, da fehlt nur noch Mikis Theodorakis und Sirtaki.
Wenn ich wieder zuhause bin, erzähle ich meiner Frau, dass ich mir vorstellen kann, auf einer kleinen griechischen Insel alt zu werden. Sie nimmt mir diesen Traum nicht sofort, sie bringt mich aber auf eine andere Überlegung. Entspannung in einem Hafencafé ist eines. Was ist aber im Winter, wenn es auf einem Eiland mit fünfhundert Einwohnern und wenigen Besuchern einsam wird und sich Leben auf die eigenen vier Wände beschränkt? Will ich das? Meine rationale Antwort ist Nein. Mediterranes Inselleben für wenige Monate im Jahr und dann Einsamkeit? Meine Vernunft sagt mir, dass zu einer Heimat ebenfalls die Möglichkeit zu Unternehmungen und Veranstaltungen gehört. Ich brauche nicht jeden Tag Remmidemmi. Aber das grundsätzliche Fehlen schreckt ab. Die griechische Insel bleibt ein unvollkommener Traum, obwohl irgendwo in ein paar Gehirnwindungen immer noch diese Fantasie steckt.
Es folgen viele weitere Auslandsreisen und Begegnungen mit anderen Kulturen. Nirgendwo entsteht mehr ein ähnliches Gefühl wie in Griechenland. Es heißt zwar, dass jemand, der den Nil gesehen hat, so gebannt ist, dass er immer wieder wie unter Zwang zurückkehren will. Ja, es stimmt. Kairo ist wahnsinnig attraktiv. Genau so sehe ich andere Millionenstädte wie New York, Singapur, Hongkong, Kuala Lumpur, Seoul, Saigon, Paris, London, Berlin. Ich bin gerne für ein paar Tage dort und genieße die jeweiligen Vorzüge. Aber ein Leben auf Dauer? Neue Heimat?
Die Frage nach einer Wahlheimat kommt unvermittelt wieder mit einem beruflichen längeren Auslandseinsatz hoch. Ich erhalte die Wahl zwischen Australien und Kanada. Wir entscheiden uns aus praktischen Gründen für Kanada, denn es ist für Verwandte und Bekannte aus Europa leichter zu erreichen. Wir landen in Oakville, Ontario. Und es passiert Sonderbares. Wir fühlen uns sofort wohl. Wir sprechen wie selbstverständlich von Zuhause und meinen unser Haus in Oakville. Die weltoffene Lebensart, multi-kulti wie wir heute sagen, ist um uns herum. Kontakte mit Nachbarn sind einfach, wenn nicht gerade im Winter hoher Schnee liegt. Schnell sind Bekanntschaften geschlossen. Für mich steht fest, dass sich die enorme Weite des zweitgrößten Landes der Erde auch irgendwie in den Köpfen manifestiert. Auf Engstirnigkeit trifft man nur selten. Und schließlich nicht zu vergessen: wer ist schon wirklich Kanadier? Wir sind doch alle Einwanderer auf einem Kontinent, der die Heimat der First Nations ist, wie es in Kanada heißt.
Schnell wird uns klar. Hier wollen wir dauerhaft leben. Beruflich geht es dann gen Westen, erst Alberta, dann Britisch Kolumbien. Unsere heimatlichen Gefühle werden eher bestärkt. Alberta mit seinen Weiten und seinem offenem Himmel und Menschen, die sich gegenseitig helfen und sich der Gemeinschaft verpflichtet fühlen, wie kaum sonst wo auf der Welt, wohl Reminiszenz an die Goldgräberzeit, in der trotz bitterer Konkurrenz ein Überleben nur bei gegenseitiger Hilfe gesichert war. Britisch Kolumbien, insbesondere Vancouver, ist ein wahrer Schmelztiegel ethnischer Gruppen, der seinesgleichen sucht. Für mich ist es das „bessere“ San Francisco (wo ich mich allerdings für kurze Zeit auch gerne aufhalte).
Gegen Ende meiner angestellten Berufstätigkeit beschließen wir, uns am Okanagan-See im Inland von Britisch Kolumbien niederzulassen. Statt Meer ein großer Binnensee, kein Strand, aber Blick auf den See von jedem Winkel des Hauses, viele Weinberge, tolle Sommer und kurze Winter – Volltreffer, das ist es, wo wir hingehören.
Aus familiären und gesundheitlichen Gründen sind wir im Augenblick wieder in Deutschland, im Bergischen Land nicht allzu weit von Bonn und Hilden entfernt. „Vorübergehend“ sagen wir ständig. Für meine Frau, die im Jahr 2000 Kanadierin wurde, und für mich ist absolut sicher: Wie es in einem osteuropäischen Sprichwort lautet, ist Heimat nicht dort, wo du jeden Baum kennst. Heimat ist da, wo dich die Bäume kennen. Und dies ist definitiv Kanada.
Hilden, Eisengasse, Historisches Foto um 1960
Toronto, Ontario, Kanada
Bonn erfahren
Ich habe das Abitur in der Tasche. Was nun? Mich reizt ein Studium der Physik. Aber wo? Ich will in der Nähe von Hilden bleiben und täglich in die Uni fahren. Mir kommt Bonn in den Sinn. „Warum denn gerade Bonn“, fragen mich Freunde, „da ist doch nix los, ein Bundesdorf für Rentner. Geh‘ doch nach Köln, Weltstadt mit Kneipen, Kultur und Atmosphäre.“ Diese Fragen bestärken mich in der Wahl von Bonn. Vielleicht spielt es in meinem Unterbewussten eine Rolle, wie ich es heute glaube zu verstehen, dass ich Bonn lediglich als ein viel größeres Hilden betrachte.
Mein Entschluss bleibt bestehen: Bonn ist es! Ich habe es bis heute nicht bereut. Ich mache wichtige Erfahrungen, die ich in meinem späteren beruflichen Werdegang zu meinem Vorteil nutzen kann – eine Tatsache, die mir erst später im Leben wirklich klar wird.
Während des ersten Semesters im Jahr 1967 fahren mein Freund „Bommi“ Kattein und ich jeden Vorlesungstag nach Bonn. Er nennt einen VW Käfer sein eigen. Ich fahre einen himmelblau lackierten gebrauchten Mercedes 180 Diesel, den meine Eltern mühsam finanziert haben. An meist fünf Tagen pro Woche geht es auf die Autobahn. Es gibt noch nicht das heutige immense Verkehrsaufkommen, jedenfalls nicht, wenn man um Köln herumfährt. Köln und Bonn verbindet die alte Reichsautobahn ohne Mittelstreifen. Die Fahrt dauert um die fünfundvierzig Minuten. Wir stellen bald fest, dass der Studienort Bonn verkehrstechnisch eine gute Wahl ist – zwar weiter von Hilden entfernt, aber schneller erreichbar als die Kölner Universität, zu der man sich durch die verstopfte Innenstadt quälen muss.
Ich habe das große Glück, gerade so gegen Ende einer Universitätsära zu studieren, die noch ein bisschen alte Studententraditionen erahnen lässt. Es gibt natürlich Pflichtvorlesungen, die du nachweisen musst, und sogenannte Scheine, die bestätigen, dass du an Übungen und Seminaren teilgenommen hast. Ein paar Semester später wird es jedoch für die frischen Studenten immer mehr ein reglementierter Unterrichtsbetrieb. Ich habe während meiner Studienzeit nie eine Klausur schreiben müssen.
Das ist auch gut so! Das erste Semester ist sehr „freizeitintensiv“. Wir sind sechs Hildener Abiturienten des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, die es nach Bonn verschlagen hat, Studenten und Studentinnen der Physik, der Mathematik, der Medizin und der Geisteswissenschaften. Der Sommer des Jahres 1967 ist trocken und sonnenreich. Da tauscht man gerne den muffigen Seminarraum mit dem Grünen, meist auf dem Kreuzberg nicht weit von den naturwissenschaftlichen Instituten entfernt mit Superblick über Bonn-Poppelsdorf. Es kreisen zwei Lieblingsgesöffe unter den „Hildener“ Studenten. Das eine ist ein perliger roter Lambrusco, den es in Zweiliterflaschen für wenig Geld gibt. Das andere ist Bowle, ein bisschen Obst aus der Dose mit Weißwein angerührt, in Ermangelung eines Bowlengefäßes in einem Plastikeimer angesetzt. Was soll’s? Es gibt immer was zu feiern. Studentenunruhen sind bei den Naturwissenschaftlern in Poppelsdorf noch kein Thema.
Nach einem Semester erkennen „Bommi“ und ich, dass das tägliche Pendeln zwischen Hilden und Bonn keine Dauerlösung ist. Wir beschließen, uns eine Studentenunterkunft zu suchen. Wir schauen kurz bei Burschenschaften vorbei. Schlagende Verbindungen kommen auf keinen Fall infrage. Und andere sind auch nicht viel besser. Die Hierarchie in einem solchen Burschenschaftshaus ist hanebüchen. Also suchen wir nach möblierten Zimmern, vorzugweise zwei zusammenhängende, damit wir uns die Miete teilen können. Wir werden anfangs am Kaiser-Karl-Ring in Bonn fündig, zwei große Zimmer in Parterre, aber ein ständig lauthals betender asiatischer Nachbar und vor allem eine quietschende Straßenbahn, die ab fünf Uhr morgens vor dem Haus hält, sind nichts für das morgentliche Schlafbedürfnis von Studenten. Es folgen weitere Unterkünfte. Eine Wohnung in der Argelanderstraße in Bonn mit einem kleinen Balkon, auf den nur ein Kasten Bier zur Kühlung passt, ist die letzte Zimmergemeinschaft mit „Bommi“. Wir sind oft in einer Nachbarschaftskneipe und spielen bis morgens früh Skat. Der Wirt ist dann längst im Bett. Dessen Freundin passt auf, dass wir nach der Sperrstunde keinen Lärm machen und halbwegs gesittet nach Hause gehen. Grund für unsere Trennung sind unsere Freundinnen, die immer mehr in unser Leben eindringen. Wer will da schon durch einen Zimmernachbarn ständig gestört werden?
Die Grundvorlesungen in Physik werden von Professor Karl-Heinz Althoff gehalten, einem Experimentalphysiker, der vorher zwei Jahre am California Institute of Technology (CALTECH) war und dort auf den berühmten Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman traf. Althoff brachte dessen Lehr-Philosophie mit nach Deutschland. Feynman ging es immer um einen originellen Zugang zu physikalischen Prinzipien, wenn möglich mit allseits bekannten Alltagsphänomenen. Seine „Lectures on Physics“ waren jahrelang auch an deutschen Hochschulen Standardwerke für Grundvorlesungen in Physik. Ich besitze noch die Erstausgabe in Englisch, eine vom Stil her gedruckte und gebundene Vorlesungsmitschrift mit rotem Buchdeckel. Althoff fasst seinen Lehransatz so zusammen: „Wenn dich deine Freundin gerne in den Hörsaal begleitet, dann haben wir alles richtig gemacht.“
Diese Denkweise hat mich stark geprägt. Ich muss Dinge vereinfacht erklären, ohne Fehler einzubauen. Nicht auswendig gelerntes Wissen ist wichtig, sondern die Vermittlung von Ideen, in der Physik also von Modellen. Und, schließlich, es kommt stark auf die möglichst interessante Methode der Weiterverbreitung, der Lehre eines solchen Wissens an.
Mathematik, Pflicht für Physiker, ist dagegen nicht so meine Sache. Es rächt sich, dass ich nach dem Realschulabschluss in drei statt der üblichen vier Jahre mein Abitur gemacht habe. In höherer Mathematik wie Lineare Algebra und Differentialgleichungen hapert es gewaltig. Nach mehreren Anläufen rette ich mich in die Mathematik für Ingenieure, die an der landwirtschaftlichen Fakultät gelehrt wird. Dies ist für mich wesentlich anschaulicher und ich kann damit unmittelbar etwas in den Physikübungen anfangen.
Meine Englisch-Kenntnisse sind nach insgesamt sieben Jahren Englischunterricht durchaus brauchbar, haben aber einen Nachteil. Ich kann Shakespeare lesen und interpretieren, scheitere jedoch beim Brötchenkaufen. Damaligen Schülern werden Fremdsprachen eben nicht praxisnah beigebracht. Immerhin kann ich meine Lectures on Physics lesen. Dies hat allerdings einen lustigen Nebeneffekt. Noch Jahre später ist mein englischer Wortschatz stark mit physikalischen Ausdrücken durchmischt – er ist zwar verständlich, aber erzeugt Stirnrunzeln beim Gegenüber ob der hochgestochenen Sprache.
Auf mein großes Latinum bin ich ein bisschen stolz. Drei Schuljahre reichen gerade mal für einfache Literatur bis Cicero. In meiner mündlichen Abiturprüfung bekomme ich einen Cicero-Text über Planetenbahnen. Da hat wohl jemand an mein zukünftiges Physik-Studium gedacht. Die Übersetzung gelingt halbwegs. Die Deutung des Textes als politische Beschreibung eines Staates geht dagegen voll daneben. Es ermuntert mich, in Zukunft solche politischen und gesellschaftlichen Überlegungen in die Welt meiner Gedanken einzubeziehen.
Längst ist Latein kein Muss mehr für die Zulassung zur Hochschule. Dies ist einerseits vernünftig, weil es endlich ein Studium für jeden einfacher ermöglicht. Es ist aber andererseits bedauerlich, dies überwiegt bei mir, weil Latein viel mehr als eine tote Sprache ist. Es bringt dir zwangsläufig strenges logisches Denken bei – gerade in den Naturwissenschaften unbedingt erforderlich --, hilft ungemein fremde Sprachen zu erlernen und fördert eine saubere grammatikalisch richtige Schreibkultur. Wer heute Beiträge in den sozialen Medien liest, stellt sofort fest, dass Sprachkultur vollkommen verloren ist. Sind Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik noch gegenwärtig? Haben Lehrer versagt?
Eine Anekdote am Rande ist, dass mein Latein-Oberstudienrat zur alten Schule gehörte und selbstverständlich bemüht war, uns besonders im Fach Philosophie Altgriechisch beizubringen. Ich kann heute noch Überschriften in Zeitungen und Straßenschilder in Griechenland entziffern, wenn auch nicht alles verstehen. Und ich gehöre in den Anfangssemestern zu den Wenigen, die griechische Buchstaben lesen und schreiben können. Physikalische Formeln sind kein Problem!
Eines wird mir allerdings in den ersten Semestern deutlich. Ich habe in meiner Schulzeit nie gelernt zu lernen. Wenn dir gute Zeugnisnoten ohne große Mühen zufallen, entstehen enorme Schwierigkeiten, sich zu einem ausdauernden Büffeln hinzusetzen. Fruchtlose Versuche führen leicht zur Frustration, jedenfalls in meinen Anfängen an der Bonner Universität.
Spätestens nach dem Vordiplom wird es Zeit, sich zu spezialisieren. Seminare und Praktika sollen so weit wie möglich auf das spätere Diplom vorbereiten. Oft geht damit ein Wechsel der Universität einher, was in meinem Fall nicht zur Debatte steht. Zum eigentlichen Diplom musst du dich endgültig festlegen. Als bei mir diese Zeit naht, denke ich über Astronomie nach. Gerade ist das damals größte bewegliche Radioteleskop der Welt in Effelsberg in der Eifel in Betrieb gegangen. Als ich auf der Poppelsdorfer Allee auf dem Weg zum Astronomischen Institut schlendere, begegnet mir ein Bekannter. Er erzählt mir, dass er von einem interessanten Gespräch am Institut für Strahlen- und Kernphysik (heute HISKP, Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik) an der Nussallee komme. Dort sei ein neuer junger Institutsleiter mit begeisternden Forschungsideen. Da in der Astronomie momentan keine Gesprächspartner zu finden sind, denke ich mir, dass es ja nicht schadet, sich einmal ein anderes Fachgebiet anzuschauen.
Ich komme mit einigen Diplomanden und Doktoranden und sogar dem Institutsleiter ins Gespräch. Ich weiß nicht warum, aus meinem Interesse für das ganz Große, den Blick in den Kosmos, wird Neugierde für das ganz Kleine. Die innere Struktur von Atomkernen und ein „Zoo“ von Elementarteilchen sind ein Schwerpunkt der Forschung. Ohne großes Zögern schwenke ich um. Meine universitäre Heimat wird das HISKP.
Der Institutsleiter Professor Theo Mayer-Kuckuk kommt vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg und hat ebenfalls für einige Zeit am CALTECH in Pasadena verbracht. Mayer-Kuckuk stellt mir eine wegentscheidende Frage: „Was willst du nach der Universität machen, wissenschaftlich arbeiten oder in die Industrie gehen.“ Ich bin mir nicht sicher, antworte aber dann „Industrie“, weil ich mir denke, dass da ja auch wissenschaftliche Möglichkeiten bestehen. Mayer-Kuckuks Antwort: „Dann solltest du bei Professor Jürgen Ernst arbeiten. Er macht Experimentalphysik und du kannst ein Großexperiment managen.“
Na ja, ein frischer Diplomand managt natürlich nicht. Dies kommt erst später während des Doktorats. Für Diplom und Dissertation geht es um Experimente am BANDIT, dem Bonn Apparatus for Neutron Deficient Isotopes on Tape. Dieses Experiment steht jedoch nicht in Bonn. Es ist eine Bonner Einrichtung am Synchrotron des Institutes für Kernphysik der Kernforschungsanlage in Jülich, damals kurz KFA. Von nun an heißt es „Strahlzeit“ in Jülich. Alle sechs bis acht Wochen steht uns der große international genutzte Teilchenbeschleuniger an meist fünf oder sechs Tagen für das gesamte Team von Jürgen Ernst zur Verfügung. Sechs Tage rund um die Uhr kannst du nur im Schichtbetrieb leisten. Wir einigen uns im Team auf Zwölf-Stunden-Schichten jeweils von acht bis acht. Alle helfen allen ohne zu murren. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ein sehr frühes Aufstehen und gegen sieben Uhr mit dem Auto Richtung Jülich aufbrechen oder die lange Nacht, die so ab drei Uhr morgens schier endlos erscheint, zumal dann auch noch eine einstündige Rückfahrt nach Bonn ansteht. Das Ergebnis der Messreihen wird auf großen Magnetbändern gespeichert. Die kennt wohl kaum noch jemand. Die vor sich hin ruckelnden Riesenbänder sind damals in der Spielfilmwelt das Synonym für Computer, was heute meist mit vielen flackernden Lämpchen dargestellt wird.
Die gesammelten Daten werden in Bonn ausgewertet. Denkt jedoch nicht an heutige PCs. Es gibt den Großrechner der Universität, eine IBM Mainframe-Maschine, Weltstandard der 1960er und 1970er Jahre. Die Dateneingabe erfolgt in der Regel über Lochkarten. Es sind allerdings schon die ersten Eingaben mit einer überdimensionierten Schreibmaschine möglich. Ich bevorzuge die beiden dem Institut gehörenden „Kleincomputer“, eine PDP 9 und eine PDP11, beides Programmed Data Prozessoren von DEC (Digital Equipment Corporation), von denen Ende der 1960er Jahre gerade einmal ein paar hundert Exemplare weltweit in Betrieb sind. Klein ist ein Witz, wenn man bedenkt, dass ein klimatisierter Raum von Wohnzimmergröße für diese Maschinen erforderlich ist. Ich liebe sie deshalb, weil sie einen unmittelbaren Kontakt vermitteln. Du sitzt davor und sie haben bereits Bildschirm und Tastatur. Ich sehe sie ein bisschen als Urahn meines PCs an. Ich hege ungeheuren Respekt vor all den Fachleuten, die es mit einer verglichen mit jetziger Technologie solch primitiven Datenverarbeitung schaffen, im Jahr 1969 punktgenau auf dem Mond zu landen. Ein Handy ist heutzutage viel leistungsfähiger. Einige Ausdrücke aus diesen Anfangszeiten finden sich weiterhin in der Computer-Sprachwelt. Das bekannteste dürfte „booten“ sein, denn, ja, wir mussten die Computer selbst mit einem Lochstreifen, dem „Bootstrap“, starten.
Auf die mir oft gestellte Frage, was ich in Jülich mache, antworte ich wahrheitsgemäß und kurz: „Ich bombardiere mit kleinen Teilchen andere kleine Teilchen und schaue, was hinten herauskommt.“ Demjenigen, der es genauer wissen will, erzähle ich ohne detaillierte Physik-Vorlesung, dass wir Helium-Atomkerne auf eine hohe Geschwindigkeit beschleunigen und diese dann mit Atomkernen schwererer Elemente, beispielsweise Cadmium oder Thorium, kollidieren lassen, etwa so im Großen vorstellbar, als ob ein Asteroid auf einem Planeten einschlägt. Es verdampfen Teile des Zieles und es entstehen neue Atomkerne, also neue chemische Elemente. Die Daten dieses Prozesses werden analysiert und speisen die Modelle der theoretischen Physiker. So, genug der Physik! Genügend Literatur ist auf dem Markt.
Meine Arbeiten zum Diplom dauern fast drei überdurchschnittlich lange Jahre. Meine Dissertation geht viel schneller, denn ich kann auf viele unveröffentlichte Dinge meines Diploms zurückgreifen. Gut fünf Jahre für Diplom und Doktorarbeit zusammen ist eine fast schon bemerkenswert kurze Zeit in der Physik.
Was nehme ich an Erfahrung aus langen Jahren des Physik-Studiums mit? Was wird mir im weiteren Leben Vorteile bringen? Abgesehen vom bloßen Fachwissen sind für mich Dinge wichtig, die ich gerne abstrakt so zusammenfasse: analysieren, modellieren und simulieren. Dies sind Eigenschaften, die nicht nur in den Naturwissenschaften gefragt sind, sondern in vielen Bereichen Anwendung finden. Mir kommen sie bei Stadt- und Verkehrsplanung zugute, sehr viel später zum Beispiel auch bei Geschäftsfeldplanung und beim Projektmanagement in der Wirtschaft.
Ich sage oft arrogant und maßlos übertrieben, dass wir Physiker universell einsetzbar sind. Wir können alles.
Ich will ein paar weitere Erfahrungen aus dieser Zeit nicht auslassen, die mich ebenfalls beeinflusst haben. Mayer-Kuckuk verlangt von uns Experimentalphysikern, ein mehrtägiges Praktikum in der zum Institut gehörenden Feinmechanik-Werkstatt zu absolvieren. Er will unser Verständnis wecken, dass Experimente viel handwerkliches Wissen und Können beinhalten. Der Familienname des Werkstattleiters Klapperstück ist alles andere als Programm. Er hilft uns meisterhaft bei der Entwicklung von notwendigen und speziellen Bauteilen. Er ist trotz offiziellem Knurren für uns da, wenn mal wieder etwas für eine Versuchsreihe von jetzt auf gleich gebaut werden muss. Obwohl ich bereits in Ferienjobs Werkstätten von innen kennen gelernt habe, verstärkt dieser Kontakt meine Auffassung von der Bedeutung handwerklicher Berufe.
Als Experimentierer kommst du kaum an ölverschmierten Händen und Brandblasen durch Lötkolben vorbei. Es ist wie das McMurphy-Gesetz, dass Marmeladenbrote immer auf die Marmeladenseite fallen -- wie ein Naturgesetz. Wenn etwas an deinem Experiment kaputt geht, dann in einer Samstagnacht nach Mitternacht, wenn du ganz auf dich alleine gestellt auf die Auswerteelektronik starrst. Du willst dich nicht blamieren, da du vielleicht nur einen dummen kleinen Fehler gemacht hast, und verzichtest darauf, den Werkstatt-Notdienst aus dem Bett zu holen. Stattdessen baust du zentnerschwere Paraffinblöcke und Bleiziegel alleine ab, die der Abschirmung von Radioaktivität dienen. Dann geht es in die Werkstatt, um ein Ersatzteil halbwegs passend zu bearbeiten, ein paar Kabel umzulöten und dann wieder Einbau und die Wiedererrichtung der schweren Abschirmung. Eile tut not, denn der Betrieb des Synchrotrons ist teuer. Immerhin hat es den Energiebedarf einer Kleinstadt. Die Erfahrungen aus diesen schweißtreibenden Arbeiten sind jedoch preislos. Du begreifst, dass du dich nicht als Akademiker von der breiten Bevölkerung abheben darfst und sollst. Wir sind alle „normale“ Menschen. Ich erkläre immer wieder, dass ein Doktortitel keine menschliche Errungenschaft, sondern ein akademischer Ausbildungsgrad ist. Oder einfach: du bist ein Idiot oder Genie, egal ob du studiert hast oder nicht.
Meine Kontakte mit der Medizin sind kurz und nicht tiefschürfend. Es geht um triviales Persönliches und um allgemeine Diagnose und Therapie. Zunächst einmal das Belustigende. Als Kind und Heranwachsender habe ich panische Angst vor Spritzen und Blutabnahme. Mehr als einmal wird mir schwarz vor Augen und ich muss auf der Liege beim Arzt erst wieder zu mir kommen. Der Umgang mit radioaktiven Substanzen ändert dies. Wieso? Der Gesetzgeber schreibt für Menschen in radioaktiven Kontrollbereichen eine permanente Überwachung vor. Die am Körper getragenen Messgeräte werden jeden Monat exakt ausgewertet und eventuelle kritische Werte durch die Aufsicht genau hinterfragt. Hinzu kommen vierteljährliche Blutkontrollen. Ein Uni-Institut nutzt die kostengünstigste Möglichkeit, nämlich die eigene Poliklinik. Da geht es für alle zum Teil widerstrebend hin, denn dort werden Schwestern ausgebildet. Die ganz jungen dürfen Blutabnehmen an uns üben. Das ist häufig ein wildes Rumstochern in den Armvenen. Der kräftige Bluterguss hält sich viele Tage. Aber sei es drum, mit diesen drakonischen Erfahrungen überstehe ich von da an Spritzen ohne Panikanfälle.
Im Forschungszentrum Jülich wird 1964 ein Institut für Nuklearmedizin gegründet. Es werden vor allem Methoden entwickelt, wie mit bildgebenden Mitteln Vorgänge in lebenden Organismen sichtbar gemacht werden können. Dies geschieht zum Beispiel durch die Injektion radioaktiver Substanzen, die mit geeigneten Detektoren im menschlichen Körper erfasst werden. Dies kennen sicher einige Patienten als Szintigrafie. Eine Zeit lang müssen wir an unserem BANDIT die Ausgangssubstanzen für diese so genannten Radio-tracer herstellen. Meist montags von zwei bis fünf Uhr früh wird ein kleiner Stapel von Blechstreifen intensiv mit dem Synchrotron bestrahlt. Das Ergebnis ist hochradioaktives Material, das nun rasch zur Weiterverarbeitung in der Medizin gebracht werden muss. Das schnellste Transportmittel ist das Fahrrad mit einem Bleibehälter auf dem Gepäckständer.
Wir arbeiten häufig wegen der Radioaktivität in einem Kontrollbereich – Zutritt nur unter Sicherheitsauflagen. Wir sind je nach Ort und Arbeit verschiedenen Strahlungsarten ausgesetzt. Beim Alpha-Zerfall entstehen Helium-Atomkerne, die aufgrund ihrer relativen Größe einfach abzuschirmen sind. Bei kleiner Energie reicht schon ein Blatt Papier. Beim Beta-Zerfall sendet das Material Elektronen aus (oder auch das Antiteilchen), also ein sehr kleines Teilchen, das zur Abschirmung mehr benötigt: Blei oder Bleiglas. Gamma-Strahlen entstehen fast immer als Beiprodukt bei diesen Zerfällen. Wir kennen Gamma-Strahlen vom Röntgen. Ihre Wirkung kann ebenfalls nur mit viel Blei abgeschwächt werden. Schlimmer sind Neutronen, die bei manchen Prozessen freigesetzt werden. Wie der Name andeutet, reagieren sie kaum mit anderen Materialien. Schutz bieten erhebliche Mengen an Wasserstoffatomen. Wasser ist gut geeignet. Besser handhabbar sind chemische Verbindungen mit hohem Wasserstoffanteil, so zum Beispiel Paraffin.
Diesen erneuten Ausflug in die Physik mache ich, um eines klarzustellen. Wir alle wissen um die Wirkung und deshalb auch die Gefahren radioaktiver Strahlung. Mayer-Kuckuk formuliert dies so: „Jedes noch so kleine Teilchen kann dich an der falschen Stelle treffen.“ Da die Wahrscheinlichkeit mit der Stärke des Bombardements zunimmt, ist geeigneter Schutz und Wachsamkeit geboten. Panik ist allerdings ein schlechter Ratgeber. Aufklärung hilft, der Radioaktivität den Schrecken zu nehmen. Routine kann jedoch ebenfalls gefährlich werden, wenn wir reagieren, ohne bewusst einzelne Maßnahmen wahrzunehmen. Wir kennen dies vom Autofahren, denn wohl jedem ist passiert, dass er sich nach einiger Zeit an einer anderen Stelle befindet, ohne zu wissen, wie man dorthin gekommen ist. Diese Grundhaltung – ohne Panik mit wachem Bewusstsein handeln -- prägt mein gesamtes Leben bei allen Fragen zur Radioaktivität.
Als Student musst du leider auch Geld verdienen, es sei denn, du hast reiche Eltern. Ich habe mit Taxifahren am Wochenende in Hilden viel Geld verdient. Da ich nicht mehr jedes Wochenende von Bonn nach Hilden fahren möchte, schwenke ich auf Chauffeurfahrten um. Ich checke bei einer Bonner Autovermietung ein, die Leihwagen mit Fahrer vermietet. Hauptkunde ist die Fahrbereitschaft der Bundesregierung. Bei Staatsbesuchen und bei ähnlichen Anlässen – Bonn ist Bundeshauptstadt – müssen wir ran. Das bedeutet Fahrten nach Schloss Gymnich, eine Wasserburg in der Gemeinde Erftstadt in Nordrhein-Westfalen, das von 1971 bis 1990 von der Bundesregierung als Gästehaus gemietet ist. Das heißt auch, so manche Stunde gemeinsam mit den „Weißen Mäusen“, der Polizeieskorte auf Motorrad, in der Küche des Kanzlerbungalows auf Einsätze warten -- übrigens bei ausgezeichneter Bewirtung, Bier eingeschlossen. Wer stoppt schon eine Polizeieskorte zur Alkoholkontrolle? Spannend ist das Fahren in Kolonnen. Der Wagen des Staatspräsidenten verlässt mit langsamer Geschwindigkeit das Palais Schaumburg. Du als Fahrer eines weit hinteren Fahrzeuges musst dann bereits mit nahezu achtzig Kilometern pro Stunde aus dem Tor fahren, um dran zu bleiben. Das ist weder für Fahrer noch Fahrgast amüsant. Die Bonner Bevölkerung ist an diese Wagenkolonnen gewöhnt. Da kannst du mit Polizeibegleitung mit einhundert Sachen über eine rote Ampel brettern. Extrem gefährlich wird es in anderen Städten, weil ein deutscher Autofahrer auf seinem Recht pocht und bei Grün die Kreuzung passieren will. Da hilft mehr als einmal nur eine Notbremsung gleichfalls zur „Freude“ deines Insassen.
Mit wachsender Bedrohung durch den RAF-Terrorismus ändert sich einiges. Das Hotel auf dem Petersberg des rheinischen Siebengebirges wird immer öfter Gästehaus. Die Zuwegung ist besser zu kontrollieren. Die Fahrer müssen viele Wochen im Voraus namentlich gemeldet sein und eine Sicherheitsprüfung durchlaufen. Diese Vorgabe kann ich kaum erfüllen. „Mein“ letzter Staatsbesuch ist der des japanischen Kaisers Hirohito, von 1926 bis 1989 Tennō, mit seiner Frau Nagako und zweien seiner Töchter. Die letzte Fahrt führt nach Frankfurt am Main. Wir übernachten im Schloss Bad Homburg. Damals haben die meisten Nobelhotels noch einfache Fahrerzimmer. Abends möchten die Töchter das Nachtleben von Frankfurt erleben. Wir fahren unauffällig mit zwei Fahrzeugen los. Ich habe zwei Beamte des Bundeskriminalamtes als Personenschutz im Auto, ein Kollege fährt beide Töchter mit eigenen japanischen Bodyguards. Bei einem Diskothekenbesuch bleiben die BKA-Beamten und ich an der Bar sitzen, denn zwei japanische Personenschützer sind bereits auffällig genug. Nach geraumer Zeit machen wir uns Sorgen um den Verbleib der beiden Damen. Suchen macht erschreckend klar: verschwunden! Draußen am Scheibenwischer des Autos hängt ein kleiner Zettel mit holprigem deutschem Text: „Wir sind alleine weiter.“ Hektische Suche gemeinsam mit der Frankfurter Polizei geht los. Das Karriereende der BKA-Leute droht. Erst nach einer Stunde wilder Fahrt finden wir die Geflohenen in einem anderen Club wieder.
Diese Kontakte bei Staatsbesuchen geben einem das Gefühl, in die große Politik eingebunden zu sein. Das ist selbstverständlich Quatsch. Es vermittelt mir aber aufschlussreiche Einblicke in andere Kulturen der Besucher.
Ich will eine weitere damals für mich aufregende Begegnung erwähnen. Der adlige Botschafter des Zwergstaates Monaco ist für die deutschsprachigen Länder und Luxemburg zuständig. Er fragt mich, ob ich Lust hätte, ihn in seinem Privatwagen zu fahren, damit er nicht ständig einen Wagen mit Chauffeur bei seinen Besuchen in Bonn mieten muss. Ich sage nicht zuletzt wegen des guten finanziellen Angebotes zu. Bei seinem nächsten Besuch staune ich nicht schlecht. Sein privates Auto ist ein ausgewachsener Rolls Royce Silvercloud – mehr geht nicht. Ich fühle mich stolz wie Bolle, wenn ich chauffiere. Menschen staunen ehrfürchtig, als ich mit monegassischer Standarte am vorderen Kotflügel zu einer Filmpremiere in einem Kino auf dem Bonner Marktplatz vorfahre. Lernen muss ich schmerzhaft, dass man einen Rolls Royce nicht einfach in eine Waschstraße fahren kann. Die Kühlerfigur ist alarmgesichert. Beim Umknicken durch die Waschbürsten geht ein Höllenlärm los und du musst fünf Minuten verzweifelt suchen, wo du ihn abstellen kannst. Leider ist diese Schicki-Micki-Phase schnell vorbei. Der Botschafter wird abgelöst und ich fahre wieder einen „billigen“ Mercedes.
Meine allerletzte Chauffeurfahrt ist eine Tour mit einer amerikanischen Familie, ein Ehepaar mit drei Kindern, in einer Mercedes-Stretchversion, einer verlängerten Limousine, die locker fünf Fahrgästen Sitzplätze bietet. Es geht von Bonn am Rhein entlang nach Süddeutschland und weiter bis nach Wien. Jeden Abend lerne ich im Hotel Teile eines Reiseführers auswendig, denn ich soll auch als Reisebegleiter etwas über Route und Besuchsorte sagen. Am siebten Tag der Reise kurz vor Wien fragt mich der Familienvater, wieviel Trinkgeld denn so üblich sei. Ich wundere mich, warum diese Frage erst jetzt kommt, denke mir aber nichts weiteres dabei. Ich erkläre, dass ein Kellner bei gutem Service etwa zehn Prozent des Rechnungsbetrages erwarten darf. Beim Abschied ist meine Überraschung groß. Ich bekomme einen Umschlag in die Hand gedrückt, der eine Menge Geldscheine enthält, ziemlich genau zehn Prozent der Rechnung für diese Reise.
Diese Episode meines Stundentenjobs hat ein „politisches“ Nachspiel. Ich beschließe, von Wien aus direkt nach Hause nach Bonn zu fahren, auch wenn es in die Nacht hineingeht. Also weg mit der Krawatte und Jacke aus. An der deutsch-österreichischen Grenze in Passau schöpft ein Grenzbeamter wegen meines jungen Alters und mein nicht zu einer Luxuslimousine passenden Outfits Verdacht. Meine ausführliche Erklärung verhallt im Leeren. Er bittet mit unmissverständlicher Stimme, ihm in die Wachstube zu folgen. Er will überprüfen, ob ich tatsächlich berechtigt bin, den Mercedes zu fahren. Ich bitte ihn, sich zu beeilen, denn das Büro der Autovermietung schließe um 21 Uhr. Er erwidert, dass dies länger dauere, da es über Polizeikommunikationswege mit mehreren Stationen laufe. Er könne allerdings telefonieren. Dann müsse ich jedoch die Fernsprechgebühren zahlen. Nach kurzer sinnloser Debatte zücke ich mein Portemonnaie und zahle 1,80 DM. Ich schäume innerlich vor Wut. Während der erlaubten Weiterfahrt denke ich intensiv darüber nach, was ich gegen ein solches Fehlverhalten eines Beamten tun kann.
Gleich am Tag nach meiner Rückkehr setze ich mich hin und schreibe einen Beschwerdebrief an Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher. Der sollte doch wohl in der Exekutive für die Einhaltung der Grundrechte sorgen. Nach etlichen Wochen erhalte ich eine Antwort. „Wir haben ihr Schreiben an das zuständige Innenministerium des Freistaates Bayern weitergeleitet.“ Hätte ich mir denken können, denn erstens ist Polizei und Grenzschutz Ländersache und zweitens ist Bayern nahezu ein Königreich im Bundesländerverbund. Es vergehen erneut zig Wochen ohne Reaktion. Meine Frau und Bekannten lachen bereits über meine nichts bringende Sturheit. Und doch, dann liegt ein Brief der bayrischen Regierung im Briefkasten mit der Mitteilung, man habe mein Schreiben zuständigkeitshalber an die Grenzpolizeibehörde in Passau gesandt. Nun geht es „schnell“. Nach weiteren zwei Monaten kommt ein Brief von eben dieser Behörde. Darin steht sinngemäß, dass man sich entschuldige, der Beamte habe im Sinne der Sparsamkeit des Staates gehandelt. „Anbei erhalten sie 1,80 DM in Briefmarken erstattet.“
Wow, Hartnäckigkeit selbst in kleinen Dingen zahlt sich aus. Wehret den Anfängen und verteidigt. Menschenrechte, selbst wenn es um Lappalien wie 1,80 DM zur Unschuldsüberprüfung geht.
Rhein, Abgeordnetenhochhaus, Drachenfels
Radioteleskop Effelsberg, Eifel
Über den Dächern von Bonn
Familie gründen
In Bonn gehe ich kurz nach Studienbeginn bei einer Familie ein und aus, eine – neudeutsch – Patchworkfamilie mit vielen Kindern, einige von „ihm“, einige von „ihr“ und eines gemeinsam. Ich komme drei Schwestern nahe. In Kurzform liest sich das so. Die Erste interessiert sich für mich, aber ich bin zurückhaltend und unschlüssig. Die Zweite ist meine erste Wahl, aber sie denkt nicht daran, sich in meine Fänge zu begeben. Ich ende – und ich meine dies überhaupt nicht negativ – mit der Dritten, der Jüngsten. Ihren Vornamen will ich verraten: Katja. Sie geht gerade in die Oberprima und das Abitur steht bevor. Wir verbringen fast täglich miteinander. Sie besucht mich nach der Schule. Ich verbringe viel Zeit bei ihr und ihren Eltern und übernachte dort öfters. Der Vater erscheint unnahbar und verlangt Respekt – ein Generalmajor alter Schule bei der Bundeswehr. Diese für einen Außenstehenden als nüchtern empfundene Atmosphäre wird durch die Mutter kompensiert. Sie ist für alle da, sei es die Kinder oder die Freunde der Kinder. Abendessen finden im großen Kreis statt. Wenn ein weiterer Besucher an der Haustüre läutet, wird selbstverständlich ein Stuhl dazugestellt und das Schnitzel geteilt.
Wir sind, soweit man dies in jungen Jahren sagen kann, glücklich, bis eine gewaltige Veränderung ansteht. Katjas Vater wird an die deutsche Botschaft in Washington D.C. versetzt. Bis auf Katja sind alle Kinder aus dem Haus. Sie soll und sie will mit in die USA umsiedeln. Und ich? Ich versuche erst gar nicht einen Weg zu finden, um beispielsweise in den USA zu studieren. Ein so gravierender Ortswechsel kommt für mich nicht infrage. Vielleicht habe ich Angst vor dem Ungewissen. Wir werden getrennt, schreiben uns ab und zu Briefe, aber dann schläft die Beziehung ein. Wir streiten uns nicht. Es entsteht simpel Funkstille.
Ich treffe Katja erst nach rund zwanzig Jahren auf der Hochzeit einer ihrer Nichten wieder. Inzwischen sind wir beide verheiratet und haben beide schon ein bewegtes Leben hinter uns. Wir tauschen alte und neue Geschichten aus. Richtig vertraut gehen wir nicht miteinander um, so als ob wir vermeiden wollen, dass Erinnerungen schmerzlich sein könnten.
Ich lerne eine junge Frau beim Taxifahren in Hilden kennen. Wir treffen uns gelegentlich mal hier und da, bis wir dann ab Spätsommer 1968 „miteinander gehen“, wie es damals so kurios heißt. Karin, eine geborene Block aus Hildens Südstadt, ist bei ihrem Onkel im letzten Ausbildungsjahr zur Friseurin. Ihre Eltern betreiben eine Wäscherei in der Hildener Innenstadt. Zu der Zeit baut ihr Vater ständig am Wohnhaus im Eichendorffhof in Hilden. Als Karin mich zum ersten Mal vorstellt, muss ihr Vater die Schubkarre voller Sand abstellen, um mir die Hand zu reichen. Ihre Eltern sind sehr streng. Ein Freund ist unerwünscht. Die Achtzehnjährige wird mitunter wie ein kleines Kind als Eigentum behandelt. Sie muss spätestens um 22 Uhr zu Hause sein. Wenn sie sich verspätet, drohen Schläge. Leider entspricht das damaliger Rechtsprechung. Erst im Alter von 21 Jahren ist man volljährig. Eine körperliche Züchtigung von Kindern ist Eltern gesetzlich erlaubt. Eine solche Haltung kenne ich von meinen Eltern nicht, die immer meinen Freundinnen und Freunden gegenüber sehr aufgeschlossen sind. Ich habe vielleicht ein- oder zweimal als junger Schüler eine Ohrfeige von meiner Mutter bekommen.
Als Karin in mein Leben tritt, geht eine Veränderung mit meiner Mutter vor. Sie ist freundlich. Karin darf mich besuchen. Aber irgendwie wirkt meine Mutter kühler als üblich, so als ob sie meine Freundin nicht mag. Jahrelang sorgt dieses ungute Gefühl für ein Hin und Her im Verhältnis zu meinen Eltern. Rückblickend glaube ich zu verstehen, dass Mütter ihren Erstgeborenen ungerne loslassen. Die Freundin oder Ehefrau treten an die Stelle der Mutter. Eifersucht macht sich breit. Meine Mutter fühlt wohl instinktiv, dass Karin mehr als nur eine kurze Begegnung ist.
Nach mehreren Kurzbesuchen zieht Karin im Frühsommer 1969 zu mir nach Bonn. Wir wohnen in meiner Studentenbude, die rasch für uns zwei zu beengt und unvollkommen ist, keine Küche und ein Badezimmer, das mit anderen studentischen Bewohnern geteilt wird. Karin findet schnell eine Stelle in einem Friseursalon, denn jemand muss regelmäßig Geld verdienen. Wir haben kein Auto. Wir haben das Glück, dass die Endhaltestelle der Straßenbahn nur ein paar Gehminuten entfernt ist.
Im Juli 1969 gehen wir auf Urlaubsreise. Wir besuchen eine der mir gut bekannten Schwestern aus Bonn, die mittlerweile verheiratet in Germersheim lebt und gerade ihr erstes Kind bekommen hat. Ihren Mann Adolfo kenne ich aus Bonn, ein gebürtiger Chilene und guter Freund. Er will Dolmetscher werden und studiert in Germersheim Deutsch, Spanisch und Englisch. Mit seinem Talent, deutsche Dialekte nachzumachen, kann er es ohne Schwierigkeiten mit jedem Einheimischen aufnehmen.
Für Karin und mich bleibt der Sommer 1969 unvergesslich. Für mich als Physikstudent ist der erste Schritt eines Menschen auf dem Mond eine Zäsur im Denken. Wir beobachten Landung und Ausstieg am 21. Juli spät nachts gebannt auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher in einem Kellerraum der Universität. Der andere wichtige Einschnitt in unserem Leben ist biologischer Natur, insbesondere für Karin. In Deutschland sind die ersten Antibabypillen auf dem Markt. Karin erhält sie rezeptpflichtig von ihrem Frauenarzt, denn es ist uns klar, dass uns unsere Wohn- und Finanzsituation nicht erlaubt, Eltern zu werden. Diese Pillen der frühen Jahre sind wahre Hormonbomben, nach heutigem Verständnis lebensbedrohlich. Es kommt, wie es kommen muss. Karin nimmt etliche Kilogramm zu. Ihre Eltern wundern sich bei unserer Rückkehr, dass bestimmt das Essen in der Pfalz gut geschmeckt habe.
Durch die Erlebnisse in Germersheim bestärkt wächst in uns der Wunsch nach einer eigenen Wohnung, stoßen aber immer wieder auf Bedenken der Vermieter. Im damaligen Zeitgeist und gerade in einer konservativen Stadt wie Bonn ist es beinahe unmöglich, als unverheiratetes Paar eine Wohnung zu mieten. In vielen Bonner Köpfen der Immobilienbesitzer steckt noch immer das alte überholte und längst nicht mehr vorhandene Gesetz gegen Unzucht im Kopf, dass die Ermöglichung einer „wilden Ehe“ unter Strafe stellt. Wir hören mehr als einmal, dass wir erst heiraten sollten. Nach vielem Frust mit der Wohnungssuche heiraten wir am 17. November 1970 standesamtlich in Hilden. Zwangsheirat sozusagen! Es gibt nur eine kleine Feier im Familienkreis.
Wenige Wochen später halten wir einen Mietvertrag in unseren Händen. Es sind vier durchgehende Zimmer in der ersten Etage eines Altbaus in der Wolfstraße in der Bonner Altstadt. Die Toilette ist eine halbe Treppe tiefer und in einem der Zimmer ist nachträglich Dusche und Waschbecken eingebaut, von Architekten schönfärberisch „Frankfurter Bad“ genannt. Geheizt wird anfangs mit Kohleöfen, einer im Wohnzimmer, der andere im so genannten Bad, dessen leere Zimmerhälfte mein Heimbüro wird. Kohle und Brikett werden im Keller gelagert. Den mit Kohle befeuerten Ofen im Wohnzimmer tauschen wir bald gegen einen Ölofen aus. Luxus, aber jetzt muss kannenweise aus dem Keller Öl nach oben geschleppt werden. Wenn man etwas verschüttet, stinkt es erbärmlich in der ganzen Wohnung. Eine Nachbarin rennt dann immer mit Essigessenz durch den Hausflur, um den Gestank zu übertünchen. Das Schlafzimmer beschaffen Karins Eltern mit dem Geld ihrer Aussteuerversicherung. Wir ärgern uns, denn es geht nach der „Methode Block“. Sie bestimmen und kaufen ohne unsere Mitsprache. Von Karins Onkel und Tante erhalten wir anderes gebrauchtes Mobiliar. Karin schleift die Esstischstühle ab, beizt sie neu und frischt die Polsterung auf. Einen alten Elektroherd mit Backofen steuern meine Eltern bei. In Ermangelung eines Wohnzimmerschrankes beschließe ich forsch, dass man einen solchen selbst bauen kann. Es vergehen Wochen, bis aus einer Unzahl von Spanplatten etwas Schrankähnliches entsteht. Über die Kleinigkeit, dass einige Türen nicht richtig schließen, sehen wir großzügig hinweg. Erst bei einem Umzug in späteren Jahren, bemerken wir, was für ein „Trumm“ entstanden ist. Der Schrank, im Wohnzimmer gebaut, passt durch keine Türe. Wir müssen ihn zersägen. Die Teile benutzen wir noch viel Jahre als Regale, zuletzt in Vorratsräumen. Aber wie kompliziert das Leben auch ist, es ist neu und aufregend für uns. Wir lieben uns. Bonn wird auf lange Jahre Heimat. Wir fühlen uns in Bonn nun vollständig integriert.
Mit Karins Lohn und meinen Studentenjobs kommen wir finanziell leidlich über die Runden. Wir können uns sogar Anfang 1971 einen Luxus leisten. Wir schaffen uns einen gebrauchten dunkelroten Renault R4 mit Dreigang-Stockschaltung an, einen kompakten Kleinwagen mit Frontantrieb und senkrechter Heckladeklappe. Seine 25 PS sind ausreichend, denn wir wollen keine Rennen fahren. Es ist schon damals schwierig, einen Straßenparkplatz in der Altstadt zu finden. Wir sind froh, dass uns erlaubt wird, unser Auto im Hof des Altbaus abzustellen.
Mit diesem Auto geht es auf die erste richtige gemeinsame Urlaubsreise. In der Nähe von Tarragona treffen wir meine Eltern auf dem Campingplatz. Wir übernehmen ihr Zelt und sie fahren nach Hause. Wir machen Ausflüge ins Landesinnere und ich zeige Karin Orte meiner früheren Spanien-Besuche, vor allem Barcelona und Lloret de Mar mit der Strandbar, in der ich mit Adolfo und dem kettenrauchenden Barbesitzer Pepe viele Nächte verbracht habe. Adolfo hat hier vor seinem Studium gekellnert. Auf der Heimfahrt nach Bonn ist unser kleiner R4 bis unters Dach voll. Ein großes Hauszelt und Urlaubseinkäufe müssen verstaut werden, darunter fünfundzwanzig Liter alkoholhaltiger Getränke. Vor Karins Füßen steht eine Fünf-Liter-Korbflasche mit Wein, der in einer Bodega abgefüllt wurde. Den deutschen Zoll – Schengener Abkommen unbekannt – verwickele ich ein Gespräch, wo ich nachts in der Nähe tanken kann. Eine Kontrolle findet so glücklicherweise nicht statt. Das wäre teuer geworden. Wir urlauben in den Folgejahren noch ein paar Mal in Spanien, immer südlich von Tarragona, immer mit eigenem Zelt, dass uns Karins Eltern leihen.
Spanisches Mittelmeergefühl prägt sich in mein Denken ein und bleibt dauerhaft erhalten.
Nach wenigen Jahren müssen wir uns von unserem betagten Dreigang-R4 trennen. Wir sind jetzt finanziell in der Lage, einen Neuwagen zu leasen, natürlich wieder einen R4, nun in grasgrün mit einer Viergang-Stockschaltung und ein paar PS mehr. Die erste längere Fahrt zur Weihnachtsfeier bei den Eltern endet nach einigen hundert Metern mit zerbeultem Blech. Ich lege während der Fahrt den Sicherheitsgurt an, verreiße das Steuer und krache in einen parkenden PKW. Die Versicherung übernimmt die Schadensregulierung und ich nehme für den Rest meines Lebens mit, einen Sicherheitsgurt vor Abfahrt anzulegen.
Eines unserer beliebten Ausflugsziele ist das Vorgebirge, eine langgestreckte und bis zu gut 165 Metern hohe Hügelkette der Voreifel nordwestlich von Bonn. Sie begrenzt die Kölner Bucht zwischen Köln und Bonn. Berühmt berüchtigt ist der Heimatblick in Bornheim. Von dort hat man bei klarem Wetter einen Weitblick bis zum Kölner Dom im Norden und dem Siebengebirge im Süden. Mehr noch als die Aussicht zieht die Besucher ein Ausflugsrestaurant an (leider heute nicht mehr bewirtschaftet). In der Umgebung wachsen Unmengen Brombeeren. Das meist getrunkene Gesöff ist deshalb Brombeerwein. Ich finde ihn zu süß, muss aber bei sommerlichen Temperaturen auf der Terrasse mithalten. Falls du mit dem Auto anreist, solltest du tunlichst vorab einen Fahrer bestimmen, denn die Wirkung des Weins an einem heißen Sommertag ist wie ein Hammer.
Mit einem befreundeten Ehepaar in Bonn spielen wir lange Abende Karten – Doppelkopf. Wir setzen kleine Geldbeträge ein, um den Anreiz zu erhöhen. Das erspielte Geld kommt in eine Gemeinschaftskasse, mit der wir von Zeit zu Zeit zum Essen ausgehen.
Die Freunde kaufen einen Altbau in der Weberstraße in Bonn. Gemeinsam schmieden wir den Plan, im Ladenlokal einen Friseursalon einzurichten (Karin hat inzwischen den Meistertitel erworben) und in die Wohnung des ersten Obergeschosses einzuziehen. Geschäft und Wohnung müssen von Grund auf renoviert werden. Ein Nachbar von der Wolfstraße hilft uns. Wir arbeiten nächtelang und ich verlege hunderte von Metern Kabel, denn der Salon benötigt viele Steckdosen.
Kurz nach dem Einzug und der Geschäftseröffnung kommt unsere Tochter Natascha am 18. November 1975 per Kaiserschnitt zur Welt. Ich erwähne das Datum selbst heute gerne in der Form, „wir haben am 17. November geheiratet und Natascha wird am 18. November geboren.“ Für die hocherstaunten Zuhörer ergänze ich dann nach einer Pause „…allerdings fünf Jahre später.“ Wir richten auf halber Etage ein Kinderzimmer ein.
Leider hat das fröhliche Leben bald ein Ende. Nach dem Kaiserschnitt bekommt Karin medizinische Probleme. Arbeiten in ihrem Salon fallen ihr schwer. Das Geschäft wirft anfangs so wenig ab, dass an eine zusätzliche Mitarbeiterin nicht zu denken ist. Es reift der Gedanke des Aufgebens. Beschleunigt wird der Gedanke dadurch, dass unsere Freundschaft mit den Hausbesitzern abkühlt. Es ist halt etwas anderes, Karten zu spielen und dann und wann Ausflüge zu unternehmen oder mit jemandem 7/24 unter einem Dach zu leben. Wir streiten uns nicht wirklich, aber wir fühlen uns unwohl und suchen Neues.
Mein Mandat in der Kommunalpolitik erschließt mir eine gute Beziehung zur Stadtverwaltung Bonn. Mit unserem Wohnberechtigungsschein erhalten wir rasch eine Sozialwohnung im neuen Stadtteil Tannenbusch, den ich gut kenne, weil Katja im alten Tannenbusch gewohnt hat. Es sind typische Häuser des sozialen Wohnungsbaus, manche bis zu sechs Stockwerke hoch. Nur der DDR-Plattenbau hat schäbigere Architektur hervorgebracht. Die Wohnung selbst ist groß und hell und sehr vorteilhaft geschnitten. Es finden sich sogar ein für deutsches Verständnis großzügiges Kinderzimmer sowie zwei Badezimmer nebst einem großen Balkon. Ich kann ebenfalls ein Büro mein Eigen nennen. Unser Auto hat einen festen Platz in der Tiefgarage. Hier leben zu der Zeit Migranten, Aussiedler und Einheimische ohne Probleme zusammen. Unser direkter Wohnungsnachbar ist Hausmeister, was ein großer Vorteil ist, denn er sorgt besonders in unserem Hausbereich für Ordnung und Sauberkeit. Mit dem Wegzug dieser Familie beginnt schleichend der Niedergang. Es bildet sich durch Umzüge ein Schwerpunkt für Migranten, damals besonders aus der Türkei. An sich kein Problem, aber wenn gleichzeitig Vandalismus von Jugendlichen um sich greift, weil es kein Freizeitangebot gibt, wird die Gemengelage schwierig. Die Integration ethnischer Gruppen funktioniert nur dann, wenn sie von der Gesellschaft aktiv mitgetragen wird. Ich sage seitdem, dass die Stadt Bonn das Beste im Tannenbusch wollte, aber kläglich mit einem falschen Konzept versagt hat. In den Wohnbauten Raum für eine Durchmischung von Ethnie und Alter zu schaffen, ist der allererste Schritt. Aber dann muss Begleitung und Hilfe folgen. Was wäre passiert, wenn es in jedem Wohnblock eine Sozialarbeiterin gegeben hätte? So ist der Tannenbusch bis heute verkorkst.
Wie dem auch sei, wir geben nach ein paar Jahren auf, weil die Situation unerträglich wird und weil das nächste Kind unterwegs ist. Wir benötigen mehr Platz. Da ich mittlerweile einen relativ gut bezahlten Job in der Industrie habe, entscheiden wir uns für ein Reihenendhaus in der Friedlandstraße von Bonn-Buschdorf. Dies ist ebenfalls eine Mischung aus alt und neu. Da es jedoch einen alten Kern von „Ureinwohnern“ gibt, verläuft die Integration von Zugezogenen weniger problematisch. Wie einige bäuerliche Großgrundbesitzer im Bonner Umland hat unser Vermieter sein Land an einen Bauträger verkauft, der ihm nicht nur etliche Millionen bezahlt, sondern ihm obendrauf eine schicke Villa baut und ein, zwei der Neubauobjekte zur freien Verfügung überlässt. So gehören unserem Vermieter zwei Reihenendhäuser in zwei Reihen von Häusern. Wir ziehen voll Begeisterung ein. Zwei Etagen und Kellerräume, genügend Platz für uns und die Kinder, sowie ein kleiner Garten mit Terrasse. Unser Sohn Gregor wird am 16. Oktober 1980 geboren, wie Natascha per Kaiserschnitt im Krankenhaus auf dem Bonner Hardtberg.
Nach den beiden R4 fahren wir nun einen Renault R14, den ich liebe. Leider baut Renault dieses Modell nicht mehr, als wir einen neuen PKW benötigen. Mit der nun vierköpfigen Familie halten wir einen Kombi für angebracht. Es wird ein Datsun Bluebird (heute Nissan), ein japanischer Fünftürer mit einem Zwei-Liter-Dieselmotor. Er ist unverwüstlich und ich benutze ihn Hunderttausende von Kilometern bis 1992.
Karin muss sich nach dem erneuten Kaiserschnitt wieder einigen Operationen unterziehen und hat bis heute darauf zurückzuführende medizinische Einschränkungen. Dennoch wagt sie auf ein Neues, einen Friseursalon im alten Tannenbusch zu übernehmen. Zu diesem gehört eine kleine Behelfswohnung, sehr praktisch für die Betreuung kleiner Kinder und bei Arbeitspausen. Die Besitzerin geht ins Seniorenheim. Sie schenkt Karin ihren PKW, einen DAF Variomatic, einen betagten Kleinwagen aus niederländischer Produktion, der aufgrund seiner einfachen mechanischen Automatik vorwärts und rückwärts gleich schnell fahren kann. Dieses Wägelchen gibt recht bald seinen Geist auf. Wir beschaffen für Karin einen gebrauchten roten VW Käfer, denn ich bin mit unserer Familienkutsche jeden Werktag unterwegs ins Büro.