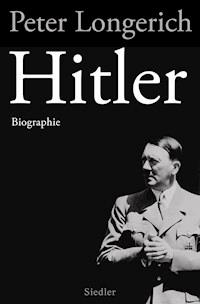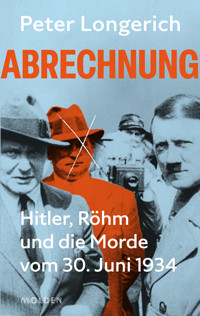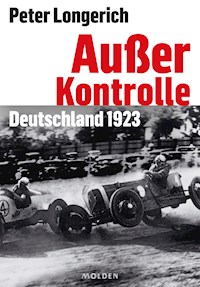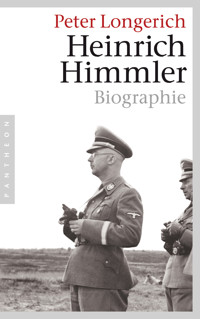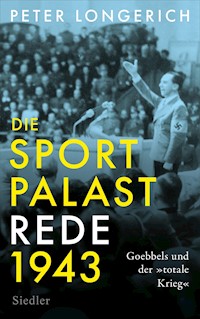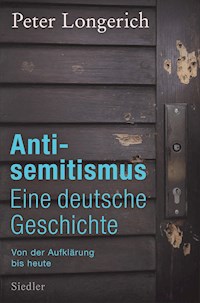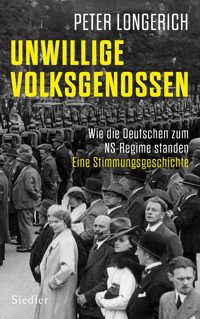
26,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 26,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kein Volk von Ja-Sagern: Ein überraschender Blick auf die Stimmung im Nationalsozialismus
Waren die Deutschen nach 1933 ein Volk von Jublern und Ja-Sagern? Die Mehrheit der Deutschen sei nach 1933 von einer rauschhaften nationalen Aufbruchstimmung ergriffen worden und habe sich überraschend schnell den neuen Machthabern angeschlossen, so lautet das gängige Urteil über die Zeit der Nazi-Diktatur. Es hält sich hartnäckig und prägt bis heute unsere Vorstellung von der »Machtergreifung« und ihren Folgen.
Dieses Bild einer »Zustimmungsdiktatur« stellt Peter Longerich, einer der renommiertesten Historiker des Nationalsozialismus und Autor zahlreicher Bestseller, in seinem neuen Buch infrage. Auf der Basis von vielen tausend zeitgenössischen Berichten von verschiedenen Dienststellen der NS-Diktatur und jenen des sozialistischen Exils, die bisher in ihrer Gesamtheit noch nicht ausgewertet wurden, legt Longerich die erste Gesamtdarstellung der Volksstimmung im Dritten Reich vor. Sie zeigt, dass die Unzufriedenheit mit dem Regime in der Bevölkerung viel größer war als bisher angenommen. In sämtlichen Bevölkerungsgruppen, von den Bauern über die Arbeiterschaft bis zur bürgerlichen Mitte, war sie weit verbreitet – die »Volksgemeinschaft« erweist sich somit vor allem als ein Mythos der NS-Propaganda. Ein augenöffnendes Buch, das unseren Blick auf die Grundlagen und den Machtcharakter des NS-Regimes verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1027
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Waren die Deutschen nach 1933 ein Volk von Jublern und Ja-Sagern? Die Mehrheit der Deutschen sei von einer Aufbruchstimmung ergriffen worden und habe sich überraschend schnell den neuen Machthabern angeschlossen, so lautet das gängige Urteil. Dieses Bild einer »Zustimmungsdiktatur« stellt der renommierte Historiker Peter Longerich infrage. Auf der Basis von vielen tausend zeitgenössischen Berichten von verschiedenen Dienststellen der NS-Diktatur und jenen des sozialistischen Exils, die bisher in ihrer Gesamtheit noch nicht ausgewertet wurden, legt er die erste Gesamtdarstellung der Volksstimmung im Dritten Reich vor. Sie zeigt, dass die Unzufriedenheit mit dem Regime in der Bevölkerung viel größer war als bisher angenommen – die »Volksgemeinschaft« erweist sich somit vor allem als ein Mythos der NS-Propaganda. Ein augenöffnendes Buch, das unseren Blick auf die Grundlagen und den Machtcharakter des NS-Regimes verändern wird.
Autor
PETERLONGERICH, geboren 1955, lehrte als Professor für moderne Geschichte am Royal Holloway College der Universität London und war Gründer des dortigen Holocaust Research Centre. Von 2013 bis 2018 war er an der Universität der Bundeswehr in München tätig. Er war einer der beiden Sprecher des ersten unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus des Deutschen Bundestags und Mitautor der Konzeption des Münchner NS-Dokumentationszentrums. Seine Bücher über die Politik der Vernichtung (1998) und ihre Resonanz in der deutschen Bevölkerung, Davon haben wir nichts gewusst! (2006), sind Standardwerke. Seine Biographien über Heinrich Himmler (2008), Joseph Goebbels (2010) und Hitler (2015) fanden weltweit Beachtung. Zuletzt erschienen Wannseekonferenz (2016), Antisemitismus. Eine deutsche Geschichte (2021) sowie Die Sportpalast-Rede 1943. Goebbels und der totale Krieg (2021).
PETER LONGERICH
UNWILLIGE VOLKSGENOSSEN
Wie die Deutschen zum NS-Regime standen
Eine Stimmungsgeschichte
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Siedler Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
[email protected](Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Ludger Ikas, Berlin
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31366-1V001
www.siedler-verlag.de
INHALT
Einleitung
KAPITEL 1 »Machtergreifung«: Die Gleichschaltung der »Öffentlichkeit« durch die Nationalsozialisten
KAPITEL 2 Anatomie einer Krise
KAPITEL 3 Der 30. Juni und die Folgen
KAPITEL 4 Allgemeine Stimmung und Reaktionen auf wichtige innen- und außenpolitische Ereignisse 1935–1937
KAPITEL 5 Die Stimmungsentwicklung innerhalb der verschiedenen Bevölkerungsgruppen sowie gegenüber der Partei
KAPITEL 6 Reaktionen auf die Kirchenpolitik des Regimes 1935–1937
KAPITEL 7 Die Volksstimmung in der Zeit von Expansion und Kriegsvorbereitung 1938/39
KAPITEL 8 Kriegsbeginn und »Sitzkrieg«
KAPITEL 9 Die Zeit der Blitzkriege
KAPITEL 10 Überfall auf die Sowjetunion
KAPITEL 11 Winterkrise und Sommeroffensive
KAPITEL 12 Kriegswende
KAPITEL 13 Untergang
Schluss
Quellen und Literatur
Verzeichnis der Fundorte der Stimmungs- und Lageberichte
Abkürzungen
Anmerkungen
Personenregister
EINLEITUNG
In Deutschland lässt sich seit den 1990er-Jahren in der Geschichtswissenschaft, aber auch in der öffentlichen Debatte eine starke Tendenz beobachten, das Maß an Zustimmung, welches die deutsche Bevölkerung einst dem NS-Regime entgegenbrachte, als sehr hoch einzuschätzen. Namhafte Historiker stimmen in diesem Punkt überein: Formulierungen wie »Backing Hitler« (so der englische Titel eines Buches von Robert Gellately[1]) oder »Zustimmungsdiktatur« (Frank Bajohr und Götz Aly[2]) sind typische Schlagworte für diese Tendenz, während Hans-Ulrich Wehler in seiner großen Gesellschaftsgeschichte Deutschlands konstatiert, das Regime habe eine »stürmisch wachsende, schließlich enthusiastische Zustimmung aus der deutschen Gesellschaft« erfahren, und spekuliert, bei freien Wahlen hätte es auf dem Höhepunkt seiner Erfolge (also 1940) »95 Prozent, wenn nicht gar die Gesamtheit der Stimmen für sich gewonnen«.[3] In seiner Studie zur »Fatalen Attraktion des Nationalsozialismus« setzt Thomas Rohkrämer wie selbstverständlich voraus, »dass eine Mehrheit eine mörderische und im Letzten auch selbstmörderische Politik getragen« habe,[4] und auch Norbert Frei gibt sich davon überzeugt, »dass sich seinerzeit fast die gesamte deutsche Nation mit Hitler und seinen Zielen identifizierte, in hohem Maße sogar mit seiner Politik gegenüber den Juden«.[5]
In neueren Überblicksdarstellungen, die vor allem für Studierende bestimmt sind, erscheint diese Vorstellung mittlerweile als scheinbar unumstößlich gesicherter Forschungsstand. So heißt es etwa bei Jörg Echternkamp: »Die meisten ›Volksgenossen‹ […] waren grundsätzlich einverstanden mit der Politik des Regimes. Ihre Zustimmung wurde nicht durch Kontrolle erzwungen, auch nicht durch eine manipulierte Propaganda, deren Erfolge begrenzt blieben.«[6] Auch Michael Wildt ist sich ganz sicher, dass es den Nationalsozialisten gelang, »eine auf Volk, Rasse und Führer gegründete Diktatur zu errichten, die sich der Zustimmung einer großen Mehrheit der Deutschen sicher sein konnte«.[7] Die beschriebene Tendenz wird durch eine große Zahl von Beiträgen zum nationalsozialistischen Konzept der »Volksgemeinschaft« gestützt, das – so der Tenor – zumindest als »Verheißung« außerordentlich attraktiv und wirkungsmächtig gewesen sei.[8]
Doch die in der Forschung so stark in den Vordergrund gerückte Vorstellung, die Deutschen hätten, angezogen von der volksgemeinschaftlichen Utopie, in großer Mehrheit der Politik des Regimes zugestimmt, hat eine entscheidende Schwäche: Sie ist nicht hinreichend dokumentarisch belegt.
Dabei ist unstrittig, dass eine große Mehrheit in ihrem alltäglichen Handeln die Politik des Regimes im Wesentlichen mittrug oder sie zumindest hinnahm, abgesehen von einigen Fällen, in denen Kritik und Proteste das Regime veranlassten, bestimmte Maßnahmen wieder zurückzunehmen oder abzuändern (so etwa bei der Modifizierung des »Euthanasie«-Verfahrens im Sommer 1941 oder bei der Revision verschiedener kirchenfeindlicher Entscheidungen). Worauf es hier aber im Kern ankommt, ist die Frage, inwieweit die Bereitschaft zum Mitmachen bzw. die Gefügigkeit der Menschen von wirklicher Zustimmung einer deutlichen Mehrheit getragen wurden oder ob sich die Menschen in ihrem Verhalten primär unter mehr oder weniger starkem Druck, aus Furcht vor Repression oder auch aus Opportunismus an die Vorgaben des Regimes anpassten.
Einige Autoren meinen, in den hohen Zustimmungsraten bei den »Abstimmungen« bzw. »Wahlen«, die das Regime 1933, 1934, 1935, 1936 und 1938 veranstaltete, immerhin einen Indikator für dessen tatsächlich übergroße Popularität sehen zu können.[9] Dabei ignorieren oder unterschätzen sie jedoch das Ausmaß, in dem die Wählerinnen und Wähler eingeschüchtert und bedrängt sowie die Ergebnisse manipuliert wurden, wie im Einzelnen zu zeigen sein wird.
Zitate aus zeitgenössischen Briefen und Tagebüchern, die voller Enthusiasmus Loyalität gegenüber dem Regime bekunden, oder aus später niedergeschriebenen Memoiren, die solche Einstellungen zu erklären versuchen, haben allenfalls illustrativen Wert. Auch eine umfangreichere Auswertung solcher Zeugnisse, wie sie etwa Janosch Steuwer anhand von 140 Tagebüchern vorgelegt hat,[10] kann zwar bestimmte Muster aufzeigen, nach denen Individuen versuchten, sich in das »Dritte Reich« einzubringen, lässt aber keine belastbaren Schlussfolgerungen über das Ausmaß der Zustimmung zu.
Es steht jedoch eine Quellengattung zur Verfügung, die in umfassender Weise Aussagen über die Einstellung der Menschen zum Regime enthält. Gemeint sind die »Lage- und Stimmungsberichte«, die von einer Anzahl von Institutionen in der Zeit des »Dritten Reiches« auf der Grundlage umfangreicher Erhebungen und meist im Monatsrhythmus angefertigt wurden. Eine gewisse Kontrollmöglichkeit der hier enthaltenen Aussagen bieten die vom sozialistischen Exil ebenfalls periodisch aufgrund von aus dem Reich herausgeschmuggelten Informationen erstellten Berichte.
Natürlich hat sich die Forschung bereits intensiv mit diesen Berichten beschäftigt. In erster Linie zu nennen sind hier die Arbeiten von Marlis Steinert über »Hitlers Krieg und die Deutschen« sowie von Ian Kershaw, der die bayerischen Berichte bis hinunter zur Ortsebene sehr eingehend untersucht hat. Beide Arbeiten machen deutlich, dass in diesen amtlichen Zeugnissen zwar ein erhebliches Maß an Unzufriedenheit mit der Politik des Regimes zum Ausdruck kommt, sich diese Missstimmungen aber nicht zu einer breiten Oppositionsbewegung verfestigten.[11] Bei Steinert und in einem weiteren Buch von Kershaw über den »Hitler-Mythos«[12] wird außerdem betont, dass in den amtlichen Berichten die breit gestreute Unzufriedenheit durch ein hohes Vertrauen in den charismatischen »Führer« Adolf Hitler überstrahlt wurde, das bis weit in den Krieg hinein fortbestand. Dabei vertrauen Steinert und Kershaw in der Regel Aussagen der amtlichen Berichte, obwohl beide auch immer wieder Zweifel äußern, ob einzelne Passagen nicht einfach auf stereotype Weise nationalsozialistische Propagandafloskeln wiedergeben. Darüber hinaus sind seit den 1970er-Jahren eine Reihe von regional[13] oder zeitlich[14] begrenzten sowie thematisch orientierten[15] Studien zur »Volksstimmung« erschienen, insbesondere zur Reaktion der Deutschen auf die Judenverfolgung.[16]
Bisher hat allerdings niemand den Versuch unternommen, auf der Grundlage dieses Materials eine umfassende »Stimmungsgeschichte« für den Zeitraum von 1933 bis 1945 zu verfassen. Hierfür dürften nicht zuletzt die außerordentliche Fülle des Materials sowie seine Verteilung auf zahlreiche Archive verantwortlich gewesen sein. Heute stellt sich die Situation allerdings anders dar: Mittlerweile sind mehr als ein Dutzend Editionen zu einzelnen Regionen erschienen,[17] und große Bestände wie die fortlaufend erhaltenen Berichte der bayerischen Regierungspräsidenten sowie das Material im Bestand »Reichssicherheitshauptamt« des Bundesarchivs können online abgerufen werden; ebenso sind die Berichte über die Reaktion auf die Judenverfolgung durch den von Otto Dov Kulka und Eberhard Jäckel herausgegebenen Band Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten umfassend erschlossen. So ließen sich, ergänzt um einige Archivrecherchen, etwa 5000 Berichte für dieses Buch auswerten. Damit konnte die große Masse der überlieferten Dokumente auf der Ebene der Regierungsbezirke (oder vergleichbarer bzw. größerer Gebietseinheiten) im Gebietsstand von 1937 (»Altreichsgebiet«) erfasst werden.[18] Dabei stellen zwar die bayerischen Regierungspräsidentenberichte die einzige den gesamten Zeitraum 1933 bis 1945 abdeckende Berichtsserie dar, doch ergänzen sich die unterschiedlichen Zeiträume der verschiedenen Berichtsserien gegenseitig so, dass insgesamt doch ein einigermaßen ausgewogenes Bild entsteht, wenn auch für die Jahre 1936 bis 1939 eine gewisse »Bayernlastigkeit« in Kauf genommen werden muss.
In den Kapiteln des vorliegenden Buches habe ich mich bemüht, die Stimmungsberichte, soweit dies zum Verständnis der Inhalte notwendig erschien, zu kontextualisieren: zum einen mit der jeweiligen Propagandalinie, die sich ja in einer ständigen Auseinandersetzung mit der seinerzeit durch die Berichterstattung ermittelten Volksstimmung befand, und zum anderen mit den wichtigsten Faktoren, die auf die Stimmung einwirkten, also insbesondere den Kontroll- und Repressionsmaßnahmen des Regimes, Faktoren wie Einkommensentwicklung und Lebenshaltung sowie der »realen« Politik des Regimes gegenüber den großen sozialen Bevölkerungsgruppen und den Konfessionen.
Die auf diese Weise in einen Kontext gestellte Auswertung der Berichte und vor allem der Abgleich des parallel von verschiedenen Institutionen in unterschiedlichen Landesteilen erstellten Materials ergibt ein Gesamtbild, das sehr viel differenzierter ist als die Vorstellung einer »Zustimmungsdiktatur«. Es stellt diesen Befund sogar infrage. Denn aus den Berichten ergibt sich, dass die Bevölkerungsmehrheit mit den zentralen ideologisch-politischen Grundsätzen des Regimes nicht übereinstimmte. In wichtigen Bereichen gab es sogar weitgehenden Unwillen und Unzufriedenheit mit seiner Politik. Wenn aber die große Mehrheit trotzdem mehr oder weniger gefügig den Vorgaben des Regimes folgte und somit sicherstellte, dass es seine hochgradig ideologischen Zielsetzungen in die Tat umsetzen konnte, dann muss dies zu einer Neubewertung der »deutschen Katastrophe« führen.
Denn zum einen ergibt sich aus den Befunden, dass eine totalitäre Diktatur auch ohne Zustimmung und Akzeptanz der Mehrheit funktionieren und ihre Ziele somit weitgehend autonom durchsetzen kann, eine Erkenntnis, die auch für die Einschätzung anderer moderner Diktaturen wesentlich erscheint. Das ändert zum zweiten jedoch nichts an der Gesamtverantwortung »der Deutschen« für die verheerenden Folgen nationalsozialistischer Politik, die allerdings neu zu begründen ist. Denn diese Verantwortung ergibt sich nicht in erster Line aus Begeisterung für und Übereinstimmung mit dem nationalsozialistischen Projekt, sondern primär aus einer passiven Grundeinstellung, aus mangelndem politischen Interesse, Engagement und Zivilcourage, aus dem Unwillen, sich einer eigentlich skeptisch bis ablehnend eingeschätzten Politik entgegenzustellen.
Im Folgenden sollen aber zunächst einmal die einzelnen Berichtsserien[19] kurz vorgestellt und einige grundlegende quellenkritische Überlegungen zu ihrem Studium angestellt werden.
DIE BERICHTSSERIEN
Politische Polizei
Im Zuge des Aufbaus der preußischen Geheimen Staatspolizei (Gestapo) seit dem Frühjahr 1933 wurde ein umfangreiches Berichtswesen eingerichtet, das dann ab Dezember 1933 zur Erstattung monatlicher »Stimmungs- und Lageberichte« durch die jeweils für einen Regierungsbezirk zuständigen Gestapostellen führte.[20]
Nach der Übernahme des Geheimen Staatspolizeiamts (Gestapa) durch den Reichsführer SS Heinrich Himmler im April 1934 wies dessen Stellvertreter Reinhard Heydrich die Gestapostellen an, jeweils am Ersten jedes Monats den von nun an zu erstellenden »Tagesberichten« allgemeine Übersichten über die Stimmung der Bevölkerung, die politische Lage und den Stand der öffentlichen Sicherheit anzufügen.[21]
Diese Monatsübersichten basierten vor allem auf der Berichterstattung der Landräte und Bürgermeister in ihrer Eigenschaft als Kreis- bzw. Ortspolizeibehörden sowie auf Informationen aus der NSDAP, aus Wirtschaftsverbänden usw. Darüber hinaus beschaffte sich die Gestapo eigenständig Informationen, vor allem mithilfe von »Gewährsleuten«,[22] aber auch durch die Auswertung der bei ihr eingehenden Anzeigen.[23] Verschiedentlich hielten Gestapostellen auch regionale »Nachrichtenkonferenzen« ab, um sich mit ihren Informationslieferanten enger abzustimmen.[24]
Auch die in den übrigen Ländern eingerichteten politischen Polizeibehörden (bzw. die ihnen vorgesetzten Innenministerien) gingen alsbald dazu über, regelmäßige Lageberichte zu erstellen. Nachdem Himmler bis zum Juni 1934 nach und nach in allen deutschen Ländern zum Kommandeur der jeweiligen politischen Polizei ernannt worden war, wurden diese Lageberichte zum Teil an das preußische Schema angepasst, zum Teil behielten sie aber weiterhin ein eigenständiges Format.[25]
Die Berichterstattung der Gestapo in Preußen wurde schließlich auf Anweisung Heydrichs vom 8. April 1936 aufgrund einer durch den Ministerpräsidenten Hermann Göring gefassten Entscheidung eingestellt. Nach Görings Ansicht fielen die Berichte schlicht zu negativ aus.[26] Außerhalb Preußens sind Monatsberichte der Bayerischen Politischen Polizei (die 1936 in die nun reichsweite Gestapo eingegliedert wurde) für den Zeitraum Januar 1936 bis November 1937 überliefert, und von ihren Außenstellen bei den Polizeidirektionen Augsburg und München (ab 1936 Staatspolizeistellen) liegen entsprechende Berichte für den Zeitraum von September 1934 bis September 1943 bzw. von Juli 1934 bis Ende 1937 vor.[27]
Innere Verwaltung
Neben den Gestapoberichten existierte zwischen 1934 und 1936 ein mit diesen verbundenes Berichtswesen der inneren Verwaltung. Es stützte sich vor allem auf die Berichte der Landräte und der lokalen Polizeibehörden, also auf das gleiche Material, das auch die Gestapo verwendete. Grundlegend geordnet wurde dieses Berichtswesen im Juli 1934, unmittelbar nach den blutigen Ereignissen vom 30. Juni: Zum einen bestimmte Göring im Juli 1934, die Gestapoberichte nun in Kopie auch an die Ober- und Regierungspräsidenten zu senden, die sie dann wiederum vielfach in ihre Berichte übernahmen bzw. dort kommentierten.[28] Zum anderen führte das Reichsinnenministerium die direkte Berichterstattung der preußischen Ober- und Regierungspräsidenten sowie der Innenressorts der übrigen Länder an das Ministerium ein.[29] Die gesamte Berichterstattung der mittleren Verwaltungsbehörden in Preußen wurde jedoch ebenso wie die der Gestapo im April 1936 aufgrund der oben erwähnten Entscheidung Görings eingestellt.
Nicht betroffen von dieser Regelung war jedoch Bayern, wo traditionell eine eigenständige periodische Berichterstattung der Innenverwaltung existierte. Die Berichte der Präsidenten der sechs bayerischen mittelinstanzlichen Landesbehörden (die damals noch »Kreise« hießen, hier aber, um Missverständnisse zu vermeiden, durchgehend als »Regierungsbezirke« bezeichnet werden) wurden bis Juli 1934 halbmonatlich, dann monatlich erstellt und liegen für den gesamten Zeitraum 1933 bis 1945 nahezu vollständig vor.[30] Für die Zeit von der Einstellung der preußischen Berichte bis zum Einsetzen der reichsweiten Berichterstattung des Sicherheitsdiensts des Reichsführers SS (SD) kurz nach Kriegsbeginn bilden sie deshalb die Hauptquelle für die vorliegende Darstellung. Dabei gilt es stets im Auge zu behalten, dass sie sich aus Gründen, die noch zu erörtern sein werden, durch eine gewisse Vorsicht auszeichnen.
Justiz
Aufgrund einer mündlichen Anordnung des Reichsjustizministers Franz Gürtner vom 23. September 1935 und seiner schriftlichen Verfügung vom 9. Dezember 1935 erstellten die Generalstaatsanwälte und die Präsidenten der Oberlandesgerichte (OLG) alle zwei Monate jeweils im Wechsel Berichte, die der politischen Orientierung des Justizministers dienten. In diesen Berichten ging es neben einer allgemeinen Schilderung der Lage der Justiz insbesondere um Eingriffe in deren Arbeit seitens der SS und der Partei sowie um die Entwicklung der Kriminalität und nicht zuletzt – als Hintergrundinformation und in sehr unterschiedlicher Intensität – um die Entwicklung der Stimmung in der Bevölkerung. Im Vertrauen darauf, dass die Berichte nicht für einen größeren Leserkreis bestimmt waren, äußerten sich einige der Autoren zum Teil relativ offen nicht nur zu den Eingriffen in die Justiz, sondern sie kritisierten auch andere Dinge, so beispielsweise den Kurs, den Joseph Goebbels in der Propaganda fuhr.
Von 1942 an berichteten OLG-Präsidenten und Generalstaatsanwälte nur noch in einem zweimonatigen Rhythmus, das heißt jeweils über Zeiträume von vier Monaten. Aus dem sogenannten Altreichsgebiet (Deutschland in den Grenzen von 1937) liegen für vier Oberlandesgerichtsbezirke Berichte aus der Vorkriegszeit vor, während für die Jahre 1940 bis 1944 der Großteil der Berichte aus insgesamt 25 Bezirken erhalten ist.[31]
Wehrmacht
Die seit 1935 erstellten monatlichen Berichte der dreizehn Wehrwirtschaftsinspektionen im Reichsgebiet enthalten ebenfalls Informationen über die Volksstimmung. In erster Linie ging es den Berichterstattern, meist reaktivierten Weltkriegsoffizieren mit einschlägigen zivilen Berufserfahrungen, um die Situation in den für die Rüstung relevanten Betrieben sowie um gesamtwirtschaftliche Kriegsvorbereitungen. In diesem Kontext enthalten die Berichte nicht nur Aussagen über die Stimmung »der Wirtschaft«, sondern insbesondere auch über die Situation und die Befindlichkeit der Belegschaften. Darüber hinaus liefern sie aber auch Informationen etwa über den Stand der Landwirtschaft und den Grad der Zufriedenheit der dort tätigen Menschen oder über die allgemeine Ernährungs- und Versorgungslage.[32]
Ebenfalls durch Wehrmachtsoffiziere erstellt wurden in den letzten Kriegsmonaten Berichte, die die Wirkung einer durch die Propagandatruppe durchgeführten »Mundpropaganda-Aktion« unter der deutschen Zivilbevölkerung dokumentieren und damit auch Einblicke in die Stimmungslage geben sollten. Für die vorliegende Darstellung wurden edierte Berichte insbesondere über die Situation in Berlin herangezogen.[33]
Wirtschaftsbehörden
Außerdem wurden Berichte der dem Arbeitsministerium unterstehenden Reichstreuhänder der Arbeit ausgewertet, die 1933 installiert wurden, um insbesondere anstelle der von den bisherigen Tarifparteien ausgehandelten Verträge »Tarifordnungen« auf regionaler Ebene festzulegen.[34] Ebenso gingen einige Berichte der Oberbergämter in Dortmund und Breslau (also der staatlichen Aufsichtsämter über den Bergbau) in die Darstellung ein.
Sicherheitsdienst des Reichsführers SS
Im Jahr 1937 begann der SD mit einer systematischen Berichterstattung über die allgemeine Lage und Stimmung: Zu diesem Zweck erstellten die SD-Abschnitte und -Oberabschnitte sowie die zugehörigen Außenstellen ab Februar 1937 periodisch Berichte, von denen allerdings nur wenige überliefert sind;[35] erhalten sind jedoch die in der Zentrale selbst entstandenen Zusammenfassungen für das Jahr 1938 sowie für das erste Quartal 1939. Ab Oktober 1939 verfasste man dort dann auf Basis der täglich bei ihr einlaufenden Meldungen der SD-Abschnitte und -Oberabschnitte regelmäßig – bis Mai 1940 dreimal in der Woche, danach in der Regel zweimal wöchentlich – Berichte zur innenpolitischen Lage, die im Dezember 1939 in »Meldungen aus dem Reich« umbenannt wurden.[36]
Die SD-Berichte bilden für die Kriegszeit die Hauptquelle für die in diesem Buch unternommene Analyse. Gegenüber den Monatsberichten der anderen Institutionen zeichnen sich die SD-Berichte durch drei Besonderheiten aus: zum einen durch die wesentlich höhere Frequenz der Berichterstattung, mit der kurzfristige Ausschläge der allgemeinen »Volksstimmung« gemessen wurden, während die Autoren anderer Institutionen häufig vom Monatsende her eine Gesamtbilanz zogen und damit ihrer Ansicht nach nur zeitweilige Ausschläge »begradigten«. Zweitens unterhielt der SD während des Krieges mit seinen insgesamt 50 Leitabschnitten und Abschnitten sowie 51 Hauptaußenstellen und 519 Außenstellen im Reichsgebiet[37] ein ausgefeiltes Netzwerk[38] von etwa 30 000 nebenamtlichen Informanten,[39] die in dieser Tätigkeit unterschiedliche Funktionen hatten und damit auch einen unterschiedlichen Status innerhalb des SD besaßen. Sie waren nicht nur auf die Beobachtung der »Volksstimmung« angesetzt, sondern lieferten auch fachliche Mitteilungen aus ihren jeweiligen Berufsfeldern, arbeiteten sehr viel stärker als die »Gewährsleute« der anderen Institutionen nach einheitlichen Richtlinien und tauschten sich vor Ort in thematisch orientierten »Arbeitsgemeinschaften«[40] umfassend aus. Drittens wurden die Berichte aus der Provinz in der Zentrale abgeglichen und daraus so etwas wie ein reichsweiter Mainstream in der »Volksstimmung« ermittelt. Allerdings verfolgten sie nicht, wie die Berichte der Verwaltungsbehörden und der Gestapo, systematisch die Stimmung in den sozialen Großgruppen, also bei Arbeitern, Landwirten sowie beim Mittelstand und im Bürgertum, so dass hier für die Kriegszeit ein gewisses Defizit vorliegt.
Die »Meldungen aus dem Reich« mussten Ende Mai 1943 eingestellt werden, da sie nach Auffassung des Propagandaministers Goebbels zu viele negative Befunde enthielten, namentlich auch über seine eigene Arbeit.[41] Sie wurden abgelöst durch die »SD-Berichte zu Inlandsfragen«, die sich bestimmten Themen widmeten und wohl jeweils einen kleineren Verteiler hatten als die umfassend angelegten »Meldungen« zuvor. Im Juli 1944 wurde die regelmäßige Berichterstattung des SD auf Intervention Himmlers dann aber endgültig eingestellt; abermals war der Grund, dass sie zu negativ ausfiel.[42]
NSDAP
Das umfangreichste periodisch erstellte Berichtswesen unterhielt die NSDAP. Es reichte, angelehnt an ein ausgefeiltes Berichtsschema,[43] über die Gau- und Kreisleitungen bis hinunter in die Ortsgruppen; gleichzeitig erstellten die verschiedenen Fachämter bzw. die NS-Verbände und -Gliederungen auf Reichs-, Gau- und Kreisebene ihre eigenen Berichte. So lässt sich etwa ein umfangreiches Berichtswesen des Hauptamtes für Kommunalpolitik ebenso nachweisen wie die Existenz von Berichtssystemen der Hauptämter für Schulung, für Rassenpolitik und für Volksgesundheit bis hinunter zur Kreisebene.[44] Die Reichspropagandaämter erstellten ebenfalls vierzehntägig Berichte, deren Inhalte heute allerdings nur noch durch Übersichten des Propagandaministeriums für die Jahre 1943 bis 1945 zu erschließen sind. Die Parteikanzlei wiederum erstellte aus dem umfangreichen Berichtsmaterial der NS-Bewegung »Auszüge aus den Berichten der Gauleitungen u. a. Dienststellen«, die für das Jahr 1943 im Wochenrhythmus nachweisbar sind.[45]
Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses bis auf die Ortsebene reichenden und im Monatsrhythmus arbeitenden weit gefächerten Berichtswesens der NSDAP erstellten Berichte dürfte für den Zeitraum von 1933 bis 1945 im Millionenbereich gelegen haben. Davon sind freilich nur kleine Reste erhalten; so sind insbesondere eine Reihe von Berichten aus dem Gau Westfalen-Nord überliefert, die einen Eindruck davon vermitteln, wie diese Maschinerie funktionierte.
Sozialistisches Exil
Die zwischen April 1934 und April 1940 monatlich erscheinenden Deutschland-Berichte der SOPADE (Sozialdemokratische Partei Deutschlands im Exil) enthielten neben umfangreichen Analysen über die Situation in NS-Deutschland Berichte von Informanten über Lage und Stimmung der Bevölkerung im Reichsgebiet. Dank einer Reprint-Ausgabe[46] sind diese Berichte seit 1980 gut zugänglich und werden relativ häufig als Zeugnisse »aus erster Hand« zitiert, die einen angeblich unzensierten Einblick in die Einstellung der Bevölkerung in Nazideutschland bieten.
Tatsächlich gilt es bei der Auswertung der SOPADE-Berichte jedoch eine Reihe von quellenkritischen Punkten zu beachten: Erstens stammten die Informanten in der Regel aus dem sozialdemokratischen Milieu und waren somit nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Zweitens entstanden die Berichte in der Regel jenseits der deutschen Grenzen: Die »Grenzsekretäre« der SOPADE befragten die aus dem Reich kommenden Genossen nach einem vorgegebenen Schema und verfassten dann die Berichte, die anschließend von den Herausgebern einer redaktionellen Überarbeitung unterzogen wurden. Dabei kam es den Bearbeitern durchaus darauf an, die große politische Perspektive (so wie sie vom Vorstand der SOPADE vertreten wurde) in die Berichte einzubringen, da ihrer Ansicht nach die Genossen aus dem Reich aufgrund ihrer isolierten Lebenssituation nur über begrenzte Einsichten verfügten. Drittens ging es den Herausgebern nicht nur um eine wirklichkeitsnahe Berichterstattung aus dem Reich, sondern sie wollten mit ihrer Publikation vor allem auch ein Gegengewicht zu der in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre auf den internationalen Nachrichtenmärkten immer mehr an Einfluss gewinnenden NS-Propaganda schaffen. Man muss die SOPADE-Berichte daher auch als faktenbasierte Gegenpropaganda lesen. Hinzu kommt viertens, dass die Herausgeber bestrebt waren, zur Sicherung der Finanzierung des Projekts die Anzahl der Abonnenten zu steigern und zu diesem Zweck auch inhaltlich auf deren mögliche Interessen einzugehen. So ist die Zunahme der Berichte über die Judenverfolgung in Deutschland wohl auch darauf zurückzuführen, dass man jüdische Organisationen als Abonnenten gewinnen wollte.[47]
Waren die SOPADE-Berichte in den Anfangsjahren der Diktatur hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Arbeiterschaft noch recht optimistisch gestimmt, so brachten sie später deutlich eine gewisse Enttäuschung über das sich eher an die Verhältnisse anpassende Verhalten der deutschen Arbeiter zum Ausdruck; beides, der anfängliche Optimismus und die anschließende Frustration, trug wohl zu einer gewissen Überakzentuierung oder gar Einseitigkeit bei der Auswahl und der Redaktion des Berichtsmaterials bei. Außerdem macht die Lektüre deutlich, dass es den Herausgebern von etwa 1936 an offenbar immer schwerer fiel, generelle Aussagen über die politische Einstellung der deutschen Arbeiter zu treffen, was auf eine gewisse Entfremdung zwischen den im Reich verbliebenen Sozialdemokraten und ihren Genossen im Exil schließen lässt.
Was die Einschätzung des Widerstandspotenzials der Arbeiterschaft angeht, waren die »Berichte über die Lage in Deutschland« der ins Ausland geflüchteten Mitglieder der sich zur Sozialdemokratie rechnenden Oppositionsgruppe »Neu Beginnen« im Vergleich nüchterner gehalten.[48] Allerdings ist die Berichterstattung dieser Gruppe weit weniger umfangreich: Sie umfasst achtzehn Monatsberichte aus dem Zeitraum von Dezember 1933 bis September 1936 und gibt häufig kurze, nicht kommentierte Meldungen wieder, die Schlaglichter auf die jeweilige Situation in Deutschland werfen.
Quellenkritik
Alle Forscherinnen und Forscher, die sich bisher mit den amtlichen Stimmungsberichten auseinandergesetzt haben, sind sich darüber einig, dass man diese nicht ohne Weiteres als authentisches Abbild der seinerzeitigen »Volksmeinung« lesen kann. Dabei wird von einigen die Auffassung vertreten, dass es den Berichterstattern in erster Linie darum gegangen sei, der Führung ein objektives Bild der »Volksstimmung« zu vermitteln; bei den Berichten habe es sich also um eine, wenn auch nur rudimentäre und methodisch mit vielen Fehlerquellen behaftete Frühform der Demoskopie gehandelt, weshalb sie im Kern »zuverlässig« seien.[49] Immer wieder wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Berichterstatter durch ihre Auftraggeber zur wahrheitsgemäßen und objektiven Berichterstattung ermahnt worden seien.[50]
Andere, skeptischere Stimmen messen solchen Vorgaben wenig Bedeutung bei und betonen umso mehr, dass sich den Berichterstattern das eigentlich unlösbare Problem gestellt habe, durch »teilnehmende Beobachtung« ein Meinungsbild einer Gesellschaft zu erstellen, in der die Menschen unter den repressiven Bedingungen der Diktatur immer mehr davor zurückgeschreckt seien, sich in der Öffentlichkeit zu kritischen Themen zu äußern. Vor allem aber habe die gesamte Berichterstattung systembedingt einer ganzen Reihe anderer Ziele gedient als bloß der Erstellung eines objektiven Stimmungsbildes: Sie sei in erster Linie darauf ausgerichtet gewesen, kurzfristig negative Reaktionen auf bestimmte Maßnahmen und Ereignisse zu ermitteln, habe unter dem Primat der Bekämpfung tatsächlicher oder potenzieller Gegner gestanden, sie habe andererseits zur Schönfärberei tendiert, sei auf politisch-ideologische Vorgaben fixiert gewesen und habe darüber hinaus unterschiedlichen Sonderinteressen der Berichterstatter gedient.[51] Die Berichte, so Ian Kershaw, würden letztlich interpretatorische Probleme aufwerfen, die sich in einem methodisch strengen Sinne nicht lösen ließen.[52]
Aufgrund dieser Kritik und meiner eigenen Arbeit mit einer großen Zahl von Berichten unterschiedlicher Provenienz seien im Folgenden eine Reihe von Verzerrungen und Defizite der Berichterstattung ausdrücklich benannt:
Die Berichte betonen in der Tat immer wieder, wie schwierig es sei, die »wahre« Stimmung zu erfassen, da die Menschen sich öffentlich nur sehr zurückhaltend äußerten und der politische Meinungsaustausch sich in die private Sphäre zurückziehe. Damit sah sich die Berichterstattung mit einem unlösbaren Problem konfrontiert. Verschiedentlich wird in den Berichten darauf hingewiesen, dass es ein in der Größenordnung unbekanntes kritisches Potenzial in der Bevölkerung gebe, das sich einer präzisen Beobachtung und Vermessung entziehe.Demgegenüber hatte die Stimmungsberichterstattung jedoch die primäre Aufgabe, ein möglichst konstant positives Gesamtbild der »Volksstimmung« zu zeichnen. Sie war Teil der Maschinerie, mit deren Hilfe die Nationalsozialisten das öffentliche Erscheinungsbild des »Dritten Reiches« kontrollierten: Die Menschen wurden angehalten, durch ihr Verhalten in der Öffentlichkeit ihre Zustimmung zur Politik des Regimes zum Ausdruck zu bringen, etwa indem sie ihre Wohnungen und Häuser beflaggten, den Hitlergruß zeigten, NS-Abzeichen und -Uniformen trugen, bei den zahlreichen Haus- und Straßensammlungen spendeten, an Aufmärschen und Großveranstaltungen teilnahmen und sich – wie im letzten Absatz erwähnt – mit kritischen Äußerungen über das Regime und seine Politik in der Öffentlichkeit zurückhielten.Das Bild dieser ganz im nationalsozialistischen Sinne ausgerichteten Öffentlichkeit wurde sodann vom Propagandaapparat medial verbreitet und unterstrich die angebliche Übereinstimmung von Volk und Führung. Die Stimmungsberichterstattung sollte vor allem die Erfolgsbilanz dieser Inszenierung dokumentieren: Sie gab die Tatsache, dass die Menschen sich wie vom Regime erwartet verhielten, als innere Zustimmung zur nationalsozialistischen Politik aus. Exemplarisch dafür steht, was die Stapo Hildesheim im Herbst 1935 über die Wirkung des wohlvorbereiteten Massenspektakels aus Anlass des Erntedanks auf dem Bückeberg schrieb: »Der Massenandrang aus allen Teilen der Bevölkerung zu dem Führerbesuch anlässlich des Erntedanktages am 6. Oktober 1935 ist der beste Beweis dafür, daß die große Masse der Bevölkerung geschlossen hinter dem Führer und den von ihm getroffenen Maßnahmen steht.«[53] Aus solchen Statements Rückschlüsse auf die »wahre Volksstimmung« zu ziehen, wäre jedoch grob fahrlässig. Der Stimmungsberichterstattung ging es nicht so sehr um die Ermittlung von Einstellungen, sondern um die Registrierung von Verhaltensweisen in der Bevölkerung, die das Regime mit mehr oder weniger großem Druck durchsetzte.
Ein wichtiger Topos der Berichterstattung ist das unbedingte Vertrauen der Bevölkerung in den »Führer« bis weit in die Kriegszeit hinein. Wie zu zeigen sein wird, ist jedoch auffällig, dass dieses Vertrauen meist im Zusammenhang mit Kritik an untergeordneten Organen thematisiert wird. Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Berichterstatter hier nur den Modus widerspiegeln, in dem im »Dritten Reich« öffentlich oder halböffentlich Kritik geäußert wurde (»Wenn das der Führer wüsste …«).Die Berichterstatter stellten zentrale politisch-ideologische Elemente des Nationalsozialismus nicht infrage, sondern teilten sie. Sie gingen also zum Beispiel ganz selbstverständlich davon aus, dass es Rassen mit unterschiedlicher Wertigkeit gebe, dass eine »Judenfrage« existiere, dass Deutschlands Kriegsvorbereitungen und Kriegsführung der Verteidigung dienten usw. Durch diese ideologische Brille nahmen sie die Wirklichkeit wahr und analysierten sie entsprechend – und nicht aufgrund nüchterner »Fakten«.Negative Berichte waren grundsätzlich unerwünscht: Auffällig ist bereits in der Anfangsphase ein immer wieder entschuldigender Tonfall der Berichterstatter, wenn doch etwas Negatives zu melden war. Es gab aber auch unmissverständliche Äußerungen führender NS-Politiker, die sich negative Stimmungsberichte verbaten, am deutlichsten Hitler selbst in seiner Rede vom 1. September 1939 an die im Reichstag versammelten Parteifunktionäre: »Keiner meldet mir, dass in seinem Gau oder in seinem Kreis oder in seiner Gruppe oder in seiner Zelle die Stimmung einmal schlecht sein könnte. Träger, verantwortlicher Träger der Stimmung sind Sie!«[54] Ähnliche Verbote sind von Martin Bormann in einem Rundschreiben an die Gauleiter aus dem Dezember 1942 sowie von Joseph Goebbels in einem Schreiben an die Reichspropagandaämter vom Februar 1943 überliefert.[55] Unmissverständlich waren aber vor allem die Begründungen, mit denen die wichtigsten Berichtsserien eingestellt wurden (Gestapo und Regierungspräsidenten 1936, SD-Meldungen aus dem Reich 1943): Die Berichterstattung habe sich zu einem Vehikel einseitig überspitzter Kritik entwickelt und übe durch ihren relativ großen Leserkreis ihrerseits negativen Einfluss auf die »Stimmung« aus.Wichtige Ereignisse in der Geschichte des »Dritten Reiches« kommen, wie im Einzelnen zu zeigen sein wird, in Teilen der Berichterstattung nicht vor. Hierfür gab es unterschiedliche Gründe: Zum Teil wussten die Berichterstatter wohl nicht, wie sie sich zu ihnen offenkundig unangenehmen Vorkommnissen verhalten sollten, so etwa die Regierungspräsidenten in Bayern angesichts des von der Partei organisierten antijüdischen Boykotts 1933 oder speziell der Münchner Regierungspräsident angesichts der Proteste gegen die vorübergehende Absetzung des protestantischen Landesbischofs Meiser im Herbst 1934. Oder sie sahen sich, wie etwa der SD in seinen »Meldungen aus dem Reich«, daran gehindert, über die Wirkungen bestimmter in der Bevölkerung zwar bekanntgewordener, amtlich aber verschwiegener Maßnahmen, wie zum Beispiel die »Euthanasie« oder die Deportation der Juden aus Deutschland, zu berichten: Was nach offizieller Lesart nicht stattfand, konnte schließlich auch nicht stimmungsbildend sein. Für die SD-Berichterstatter galten zudem generell bestimmte Bereiche als tabu, beispielsweise Vorgänge innerhalb der Wehrmacht, parteiinterne Angelegenheiten oder Behördeninterna.[56]Die aufgeführten Defizite, Auslassungen und Verzerrungen können durch die große Zahl der hier ausgewerteten Berichte jedoch weitgehend ausbalanciert werden. Wie sich nämlich herausstellt, weisen die durch diverse Behörden und Organisationen in den verschiedenen Regionen des Reiches unabhängig voneinander erstellten Berichte nicht nur in der Beurteilung der allgemeinen Stimmungsentwicklung der Bevölkerung, sondern auch in der Schilderung konkreter Beschwernisse und Missstimmungen ein hohes Maß an Übereinstimmung auf.
Das hängt wesentlich damit zusammen, dass die Berichte entgegen der ursprünglichen Intention der Auftraggeber schon bald zu Beschwerdekatalogen über Fehlentwicklungen, skandalöse Zustände und sonstige Ärgernisse wurden, zumal wenn diese außerhalb der unmittelbaren Verantwortung der Berichterstatter lagen. In den Berichten stellten sie sozusagen das »Kleingedruckte« dar, das häufig in auffallendem Gegensatz zur meist einleitend betonten grundsätzlichen Übereinstimmung der Menschen mit der Politik des Regimes stand. Inhaltlich lassen sich diese Beschwerdekataloge in sieben Hauptpunkten zusammenfassen:
schlechte Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterschaft;geringe Erträge in der Landwirtschaft, Arbeitskräftemangel und Drangsalierung durch den Reichsnährstand;unzureichende wirtschaftliche Lage des Mittelstandes, Angst im Bürgertum vor Verlust von Privilegien;»Kirchenkampf« und Spaltung der protestantischen Kirche;fortwährende Einengung der Aktivitäten der katholischen Kirche jenseits der reinen Religionsausübung;Unzulänglichkeit der lokalen Parteiorganisation;Angst vor einem Krieg bzw. dann im Krieg die immer wieder enttäuschte Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende.Auf diese in der Berichterstattung zum Ausdruck gebrachten Kritikpunkte konzentriert sich die folgende Darstellung. Wie sich zeigen wird, spiegeln sie in der Summe ein erhebliches Ausmaß an Unzufriedenheit und innerer Oppositionshaltung in der damaligen Bevölkerung wider. Diese Tatsache steht wiederum in offenem Widerspruch zu der in den Berichten immer wieder betonten grundsätzlichen Zustimmung zur Politik des Regimes und lässt diese wie ein Mantra behauptete Übereinstimmung zwischen Volk und Führung vor allem als propagandistische Selbstdarstellung erscheinen. Dies wird umso deutlicher, wenn man sich die im Vergleich dazu geringe positive Resonanz vor Augen hält, die das »große« Kernziel nationalsozialistischer Politik in der Bevölkerung laut Berichterstattung fand, nämlich die Schaffung einer rassisch homogenen und von der offenen Austragung von Interessengegensätzen befreiten »Volksgemeinschaft«, die bereit war, unter großen Opfern und Risiken einen Krieg zur Eroberung von Lebensraum vorzubereiten und zu führen.
Wenn diese weit verbreitete und vielfältige negative Einstellung zur Politik des Regimes in diesem Buch zusammenfassend auf die Formel vom »Unwillen« der Bevölkerung gebracht wird, so ist das in einem doppelten Sinne zu verstehen: Zum einen ist damit die geringe oder zögerliche Bereitschaft gemeint, sich mit der Politik des Regimes zu identifizieren, zum anderen aber eben auch der Mangel an Wille und Entschlossenheit, gegen die skeptisch gesehene Politik des Regimes offen aufzubegehren.
KAPITEL 1 »MACHTERGREIFUNG«: DIE GLEICHSCHALTUNG DER »ÖFFENTLICHKEIT« DURCH DIE NATIONALSOZIALISTEN
»Es ist erreicht. Das deutsche Volk ist einig. Nun können wir der Welt gegenübertreten. Das deutsche Wunder. Man schweigt in Demut still.« Mit dieser Tagebucheintragung vom 13. November 1933 feierte Propagandaminister Joseph Goebbels den triumphalen Sieg der Nationalsozialisten bei der Volksabstimmung über den bereits erfolgten Austritt aus dem Völkerbund, die drei Tage zuvor stattgefunden hatte und der Regierung 95,1 Prozent Zustimmung bei einer sehr hohen Wahlbeteiligung eingebracht hatte; bei der gleichzeitig stattfindenden Reichstagswahl hatte die von der NSDAP zusammengestellte Einheitsliste, der einzige zugelassene Wahlvorschlag, immerhin 92,1 Prozent eingefahren.
Obwohl diese beiden Ergebnisse unter erheblichem Druck und mithilfe von Manipulationen zustande gekommen waren, scheint sich in ihnen doch nach heute noch weit verbreiteter Auffassung tatsächlich ein Stimmungsumschwung zugunsten der neuen Regierung widerzuspiegeln. Viele zeitgenössische Berichte und Erinnerungen aus dem Jahr 1933 vermitteln das Bild eines fundamentalen politischen Umschwungs – viele Menschen seien von einer rauschhaften nationalen Aufbruchstimmung ergriffen worden und hätten sich überraschend schnell den neuen Machthabern angeschlossen.[1] Dieses eindrucksvolle Bild einer nationalen Wiedergeburt hat sich als außerordentlich wirkungsmächtig erwiesen; es ist in zahlreiche historische Darstellungen eingegangen und prägt bis heute unsere Vorstellung von der damaligen »Machtergreifung«. Nach dieser Auffassung war es den neuen Machthabern weniger als zehn Monate nach der Regierungsübernahme durch Hitler gelungen, die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung hinter sich zu versammeln und die euphorische Atmosphäre eines fundamentalen politischen Neuanfangs zu erzeugen.[2]
Ebendiese Auffassung soll im vorliegenden Buch einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass es den Nationalsozialisten im Zuge der »Machtergreifung« und der Gleichschaltung sehr schnell gelang, die deutsche »Öffentlichkeit« unter ihre Kontrolle zu bringen: nicht nur, indem sie oppositionelle Stimmen zum Schweigen brachten und die Medien als Träger der öffentlichen Meinung vereinnahmten, sondern auch, indem sie den öffentlichen Raum in massiver Weise mit Beschlag belegten – durch Plakate, Beflaggung, Aufmärsche, Feiern, Lautsprecherübertragungen usw. – und den öffentlich vor sich gehenden Meinungsaustausch der Menschen in erheblichem Umfang kontrollierten und in ihrem Sinne prägten. Sie waren in der Lage, kollektive Stimmungen zu erzeugen, und besaßen (zumindestens innerhalb Deutschlands) das Monopol, diese Stimmungen nach ihrem Gutdünken zu dokumentieren und propagandistisch aufzubereiten. Mit dieser vielgestaltigen Beherrschung der Öffentlichkeit prägen sie sogar noch unser heutiges Bild der Wirklichkeit des »Dritten Reiches«.
Der Prozess der Vereinnahmung der Öffentlichkeit im Zuge der »Machtergreifung« soll in diesem ersten Kapitel insbesondere anhand der damaligen internen Berichterstattung des Regimes über die Stimmung im Volk kritisch betrachtet werden. Zwar ist die Stimmung im »Dritten Reich« ausgerechnet für das Jahr 1933 am schlechtesten dokumentiert: Eine regelmäßige Berichterstattung durch die Regierungspräsidenten existierte nur in Bayern, daneben finden sich verstreut einige amtliche Berichte aus anderen Regionen; und die Sozialisten nahmen ihre Berichterstattung aus dem Exil erst Ende des Jahres auf. Dennoch reicht das vorhandene Material aus, um zumindest erhebliche Zweifel an der angeblichen großen politischen Trendwende zugunsten des Nationalsozialismus zu begründen, erst recht, wenn man die Berichterstattung mit der realhistorischen Entwicklung abgleicht und auf dieser Basis die Plausibilität eines fundamentalen Stimmungsumschwungs hinterfragt. Den Endpunkt dieses Kapitels soll die Volksabstimmung vom 10. November 1933 bilden, und es wird die Frage zu stellen sein, ob es die Nationalsozialisten tatsächlich zustande brachten, innerhalb eines Jahres (die letzten freien Wahlen fanden im November 1932 statt) ihren Anhang im Volk annähernd zu verdreifachen.
FEBRUAR 1933: EINE ZUNEHMEND KONTROLLIERTE ÖFFENTLICHKEIT
Den Nationalsozialisten gelang es nach dem 30. Januar in nur sechs Monaten, eine Diktatur zu errichten und das gesamte Land weitgehend unter ihre Kontrolle zu bringen.[3] Innerhalb des stufenförmigen Prozesses dieser »Machtergreifung« waren die schrittweise Übernahme der Kontrolle über die öffentliche Meinung und die Ausrichtung der gesamten öffentlichen Sphäre auf nationalsozialistische Maximen von zentraler Bedeutung.
Der erste entscheidende Schritt zur Ausdehnung seiner Machtstellung gelang Hitler bereits gleich zu Beginn seiner Kanzlerschaft: Er konnte sich mit der Forderung nach Neuwahlen durchsetzen. Bei einem Wahlsieg seiner Partei, so sein Kalkül, würde er nicht länger von den Notverordnungen des Reichspräsidenten Hindenburg abhängig sein, und die parlamentslose Zeit bis zu den Neuwahlen am 5. März 1933,[4] während der das Vetorecht des Reichstags gegen Notverordnungen außer Kraft gesetzt war, konnte dafür genutzt werden, die Machtposition der Regierung auszubauen und so bereits den Wahlkampf zu dominieren.[5]
Diesen ersten Ausbau ihrer Machtstellung vollzog die neue Regierung im Wesentlichen durch eine Kombination von drei Maßnahmebündeln:
Zum einen nutzte sie das Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten extensiv aus: Mit der Notverordnung zum Schutze des deutschen Volkes vom 4. Februar wurden insbesondere Versammlungs- und Pressefreiheit erheblich eingeschränkt und die Polizeihaft für Personen eingeführt, die im bloßen Verdacht hoch- oder landesverräterischer Taten standen.[6] Zwei Tage später folgte eine weitere Notverordnung, die der durch Reichskanzler Franz von Papen im Juli 1932 weitgehend entmachteten verfassungsmäßigen preußischen Regierung willkürlich ihre letzten Rechte entzog und die Handhabe schuf, auch den preußischen Landtag noch am gleichen Tag aufzulösen.[7]Damit war, zweitens, die – wenn auch fragliche – rechtliche Basis geschaffen, auf der nun vor allem der neue kommissarische preußische Innenminister Hermann Göring rücksichtslos gegen die Gegner der Nationalsozialisten vorgehen konnte; die übrigen bereits nationalsozialistisch regierten Länder[8] schlossen sich dieser Linie an. Von Anfang an betrachtete Göring insbesondere die preußische Polizei als ein Instrument, das ohne jede rechtsstaatliche Beschränkung gegen die Gegner der neuen Regierung eingesetzt werden sollte. Schon nach wenigen Tagen begann er damit, systematisch hohe Polizeibeamte, vorwiegend solche, die der SPD und der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) nahegestanden hatten, aus ihren Ämtern zu entfernen.[9] Am 17. Februar ordnete er in einem Erlass zudem an, gegen »kommunistische Terrorakte und Überfälle« hätten seine Polizeibeamten, »wenn nötig, rücksichtslos von der Waffe Gebrauch zu machen«,[10] und am 22. Februar berief Göring für das Land Preußen eine bewaffnete Hilfspolizei in Stärke von 50 000 Mann ein, die sich aus Angehörigen von SA, SS und Stahlhelm zusammensetzte.Mit solchen Maßnahmen verstärkte er schließlich einen dritten Faktor, auf den die Nationalsozialisten beim Ausbau ihrer Machtstellung setzten: die gewaltsame Beherrschung des öffentlichen Raumes durch über 400 000 Angehörige der SA und weitere Hunderttausende von Parteiaktivisten.Alles in allem konnten die Nationalsozialisten so bereits im Februar 1933 die Gewichte erheblich zu ihren Gunsten verschieben und den Wahlkampf nahezu vollkommen dominieren. Intern gab Hitler als Leitparole den »Angriff gegen den Marxismus«[11] aus, nach außen hin stellte er sich jedoch in der ganz auf seine Person abgestellten Kampagne als christlich und national gesinnter, um die Erhaltung des eigenen Volkes kämpfender Staatsmann dar.[12] Die Wahlkampagne bildete so die erste Etappe auf dem Weg zur Eroberung und völligen Beherrschung der deutschen Öffentlichkeit.[13]
Ein zentrales Element war dabei die zügige Indienstnahme des Rundfunks durch die Nationalsozialisten. Schon am Abend des 30. Januar erhielten Göring und Goebbels Gelegenheit, im Rahmen einer Radioreportage über den abendlichen Fackelzug aus Anlass der »Machtergreifung« ihre Kommentare abzugeben,[14] und am 1. Februar strahlte man einen Aufruf der Reichsregierung aus, den Hitler persönlich verlas.[15] Am 5. Februar übertrug der Rundfunk aus dem Berliner Dom und vom Invalidenfriedhof die zu einem Staatsbegräbnis ausgestalteten Trauerfeierlichkeiten für den Polizei-Wachtmeister Zauritz und den SA-Sturmführer Maikowski, die beide als angebliche Opfer kommunistischen Terrors am 30. Januar im Anschluss an den abendlichen Fackelzug erschossen worden waren; die Übertragung über alle deutschen Sender schloss Grabreden von Goebbels und Göring ein.[16]
Parteipolitische Wahlkundgebungen im Radio hatte die Weimarer Republik nicht gekannt, und rein formal hielt man sich auch weiterhin an diesen Grundsatz, als man im Kabinett übereinkam, führende Politiker der neuen Regierung könnten »Ministerreden« im Rundfunk halten.[17] So wurde Hitlers Rede am 10. Februar im Berliner Sportpalast, der eigentliche Auftakt seines Wahlkampfes, ebenso wie weitere 44 Veranstaltungen der Regierungsparteien in den folgenden Wochen vom Rundfunk übertragen, einschließlich einer längeren Anmoderation von Goebbels, der zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keinen Kabinettsposten bekleidete. Nicht nur erfolgte die Ausstrahlung über alle deutschen Sender, sondern auch auf zehn Plätze in Berlin, die mit Lautsprecheranlagen ausgestattet waren, sowie in zahlreiche deutsche Städte, in denen man ebenfalls öffentliche Übertragungen vorbereitet hatte.[18] Auf diese Weise trug man nicht nur dem Umstand Rechnung, dass nur etwa ein Drittel der deutschen Haushalte Rundfunkempfänger besaß, sondern man wollte zugleich den eigenen Anhängern ein kollektives Erlebnis ganz neuer Art bieten: Der »Gemeinschaftsempfang« sollte in den kommenden Jahren immer weiter ausgebaut werden.
Auch die folgenden Großkundgebungen Hitlers wurden – meist nach einer einführenden »Reportage« von Goebbels – im Radio ausgestrahlt, etwa am 15. Februar aus Stuttgart, am 19. aus Köln oder am 24. aus München. Am 2. März sprach er erneut im Berliner Sportpalast[19], wobei man diesmal Übertragungen an sechs öffentlichen Berliner Plätzen sowie in die Ausstellungshallen am Kaiserdamm schaltete.[20]
Während sich so die nationalsozialistische Propaganda – großzügig unterstützt durch eine Spendenaktion führender Industrieller[21] – in diesen Wochen frei entfalten konnte, wurden der politische Gegner und kritische Stimmen konsequent aus dem öffentlichen Raum verdrängt und nach Möglichkeit mundtot gemacht.
Zunächst hatte Göring bereits am 1. Februar ein Versammlungsverbot für die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) in Preußen erlassen, dem sich auch die übrigen bereits in nationalsozialistischer Hand befindlichen Länder anschlossen. Durch ständige Verbotsverfügungen legte man die kommunistische Presse lahm, während die Berliner Parteizentrale – ebenso wie zahlreiche Büros im ganzen Land – mehrfach von Durchsuchungen betroffen war und schließlich am 24. Februar geschlossen wurde.[22] Auch der Wahlkampf der SPD wurde vor allem in der zweiten Februarhälfte durch Versammlungs- und Publikationsverbote sowie durch massive Störungen ihrer Wahlveranstaltungen erheblich beeinträchtigt.[23]
Aber nicht nur die Zeitungen der Linken, sondern die gesamte deutsche Presse wurde durch Erklärungen Hitlers bereits in den ersten Wochen seiner Kanzlerschaft unter zunehmenden Druck gesetzt: Bei einem Presseempfang am 8. Februar erklärte der Kanzler, dass mit der Notverordnung vom 4. Februar selbstverständlich »die Freiheit der Kritik grundsätzlich nicht geschmälert werden« solle, er »wünsche« jedoch, dass die deutsche Presse angesichts »der geschichtlichen Umwälzung, die sich jetzt vollziehe […], nicht später gezwungen sei, zuzugeben, daß sie die politischen Vorgänge falsch gesehen und beurteilt« habe.[24] Vor Vertretern der NS-Presse wurde er eine knappe Woche später deutlicher, indem er die »Erziehung der ganzen deutschen Presse zum Gedanken des Dienstes am Volke« zum »obersten Grundsatz« erklärte, aus dem sie »als öffentliche Einrichtung ihre Daseinsberechtigung überhaupt ableite«. Ihr Ziel müsse es sein, »zu einem wirklichen Ausdruck und zu einem getreuen Spiegelbild deutschen Lebens und Geistes zu werden.«[25] Am nächsten Tag legte der Völkische Beobachter mit einer »Warnung an die Hetzpresse« nach: Teile der »sogenannten ›bürgerlichen‹ Presse« warteten in ihren Leitartikeln ständig »in einer widerlich lehrhaften, ölig schleimigen Art mit ihrer ›Auffassung‹ zur jeweiligen Lage« auf. Es gelte nun aber der Grundsatz: »Die Presse hat sich der Ethik des neuen Staates einzufügen oder sie hat zu verschwinden.«[26]
Ab Mitte Februar griffen die neuen Machthaber auch massiv in den Wahlkampf der Deutschen Zentrumspartei ein, und zwar in Form verstärkter Presse- und Versammlungsverbote sowie durch gewalttätige Ausschreitungen auf Wahlkampfveranstaltungen. Nach Beschwerden der Partei wurden zwar Zeitungsverbote wieder aufgehoben und die Gewalttäter durch einen Aufruf Hitlers zurückgepfiffen, doch in der Schlussphase des Wahlkampfes sah sich das Zentrum erneut solchen Behinderungen ausgesetzt.[27] Auch Versammlungen der zur Bedeutungslosigkeit zusammengeschrumpften Deutschen Staatspartei, wie sich die DDP nun nannte, wurden durch Nationalsozialisten gewaltsam beendet.[28]
Eine Umfrage des Regierungspräsidenten in Potsdam unter den Landräten bzw. den Polizeibehörden in den kreisfreien Städten seines Bezirks ergab in der dritten Februarwoche ein allgemein »als ruhig« eingestuftes politisches Lagebild; drei der insgesamt neunzehn Berichte zeigen jedoch deutlich, dass sich die Linksparteien zu dem Zeitpunkt bereits in der Defensive befanden und sich offenkundig eingeschüchtert in der Öffentlichkeit zurückhielten.[29]
Behinderungen und Verbote betrafen aber keineswegs nur die Parteien. Eine wichtige Initiative kritisch eingestellter Intellektueller, nämlich der für den 19. Februar durch mehr als sechzig Organisationen in die Berliner Kroll-Oper einberufene Kongress »Freies Wort im freien Land«, konzipiert als »Willenskundgebung aller geistig Schaffenden« und besucht von zahlreichen Prominenten wie Thomas und Heinrich Mann, Ricarda Huch oder Martin Buber, wurde bezeichnenderweise schon nach drei Stunden durch Einschreiten der Polizei aufgelöst. Man nahm, wie die Vossische Zeitung schrieb, offenbar Anstoß an einer Äußerung des früheren preußischen Ministers Wolfgang Heine, der sich an einer »Gegenüberstellung von Christentum und Hakenkreuz« versucht hatte.[30] »Viele hatten sicher ebenso wie ich das Gefühl«, notierte Harry Graf Kessler, einer der Organisatoren des Kongresses, in seinem Tagebuch, »dass dieses für lange Zeit das letzte Mal sei, wo Intellektuelle in Berlin öffentlich für die Freiheit eintreten können.«[31]
Währenddessen weitete Göring die »Säuberung« der preußischen Verwaltung seit Mitte März auch auf Zentrums-Beamte aus, um so den demokratischen Elementen in Polizei und Verwaltung vollends den Rückhalt zu nehmen.[32]
Mithilfe dieses massiven Drucks gelang es den Nationalsozialisten bis Ende Februar, die deutsche Öffentlichkeit weitgehend zu beherrschen. Zwar war das demokratische System der Weimarer Republik zu dem Zeitpunkt bereits erheblich ausgehöhlt, aber noch nicht ausgeschaltet. Ja, in der Wahrnehmung der Zeitgenossen schienen die Notverordnungen, Verbote und Polizeiaktionen nicht wesentlich über die Ausnahmemaßnahmen hinauszugehen, wie sie schon frühere Regierungen der Republik – zuletzt die von Papens im Zusammenhang mit der Reichsexekution gegen Preußen im Vorjahr – erlassen hatten. Auch der Straßenterror der Nationalsozialisten war kein neues Phänomen, hatte er doch bereits in den vorangegangenen Jahren erhebliche Ausmaße erreicht. Dass die neuen Machthaber tatsächlich damit begonnen hatten, einen Systemsturz einzuleiten, sollte sich dann aber in den wenigen Wochen zwischen Ende Februar und der Selbstentmachtung des Parlaments am 23. März zeigen.
MÄRZ 1933: DIE GRUNDLAGEN DER DIKTATUR WERDEN GELEGT
Nicht mehr nur eingeschränkt, sondern förmlich außer Kraft gesetzt wurden die wesentlichen Grundrechte der deutschen Bürger am 28. Februar 1933, als die Machthaber den Brand des Reichstages in der Nacht zuvor als Signal für einen kommunistischen Aufstand hinstellten und dazu nutzten, um mit der präsidialen Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat das Recht auf persönliche Freiheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Brief- und Postgeheimnis, die Publikations-, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit sowie die Unversehrtheit des Eigentums aufzuheben.
Bedeutsam an dieser sogenannten Reichstagsbrandverordnung war ferner das der Reichsregierung eingeräumte Recht, die exekutive Gewalt in den Ländern selbst zu übernehmen, wenn dies, wie es hier ganz allgemein hieß, zur »Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung« notwendig erschien; damit war dieses in der Verfassung eigentlich dem Reichspräsidenten obliegende Recht faktisch in die Hände der Regierung gelegt worden.[33] Hinzu kamen exorbitante Strafvorschriften, insbesondere eine Ausdehnung der Todesstrafe auf eine ganze Reihe von Delikten.[34]
Für Preußen stellte Göring wenige Tage später – gegen den Einspruch liberaler Stimmen[35] – in einem Runderlass klar, dass der in der Präambel der Reichstagsbrandverordnung genannte Zweck der Ausnahmebestimmungen, also die »Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte«, sich ohne Weiteres auch auf die Verfolgung von Sozialdemokraten und Anarchisten ausdehnen ließ.[36] In der Praxis gingen Polizei und Justiz alsbald sehr viel weiter: Das neue Ausnahmerecht erlaubte unter dem Vorwand der »Schutzhaft« das »Festhalten der verdächtigen oder mißliebigen Person auf unbestimmte Zeit und ohne Anklage, ohne Beweise, ohne Verhör, ohne Rechtsbeistand«, es handelte sich also dem Historiker Karl Dietrich Bracher zufolge um nicht weniger als die »Ablösung des Rechtsstaats durch den Polizeistaat«.[37]
Der Wahlkampf artete nun zu einem Vernichtungsfeldzug gegen die Linke aus. Noch in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar und in den folgenden Tagen rollte eine Verhaftungswelle über das Land, die mehrere Tausend vor allem kommunistische Funktionäre erfasste, darunter auch zahlreiche Mandatsträger. Soweit nicht bereits geschlossen, wurden nun auch die restlichen Büros der KPD und ihre Zeitungsverlage besetzt.[38] Göring hatte außerdem bereits in der Nacht nach dem Reichstagsbrand die gesamte SPD-Presse für vierzehn Tage verbieten lassen und erneuerte dieses Verbot in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder. Nur außerhalb Preußens konnten noch einige sozialdemokratische Blätter sporadisch erscheinen.[39]
Begleitet von diesem ständig anwachsenden Terror, erreichte der nationalsozialistische Wahlkampf am 4. März seinen Höhepunkt: Am Vorabend des »Tages der erwachenden Nation« strahlte der Rundfunk die Wahlkampf-Abschlussrede Hitlers aus Königsberg aus; die Glocken des dortigen Domes und das gemeinsam gesungene Niederländische Dankgebet beschlossen das Programm, das in den meisten deutschen Städten auch über Lautsprecher übertragen wurde. In Berlin war man nun bereits in der Lage, 24 Plätze zu beschallen; ein im Völkischen Beobachter veröffentlichter Befehl regelte eigens den mit Fackeln illuminierten Anmarsch der Parteiformationen und Anhänger der »Bewegung«.[40] Überall im Reich, »von den Bergen bis zum Meer«, wurden zur gleichen Zeit Höhenfeuer angezündet, »als Feuer der Wende des deutschen Schicksals«.[41]
Für die Parteigenossen veröffentlichte der Völkische Beobachter in seiner Ausgabe vom 3. März auch »Zwölf Gebote für den Tag der erwachenden Nation«, die einen Eindruck davon vermitteln, welchen Druck die Parteimitglieder bereits fünf Wochen nach der Machtübernahme auf den Rest der Bevölkerung ausübten, waren sie doch gehalten, »alle Möglichkeiten der Propaganda mit ungestümem und rücksichtslosem Bekennermut auszuschöpfen«. »Aus allen Fenstern müssen unsere Hakenkreuzfahnen wehen«, lautete folglich eines der Gebote, und selbstverständlich hatten alle Parteigenossen Hakenkreuzbinde und Parteiabzeichen anzulegen bzw. sich in Uniform sehen zu lassen. »Wer einen Lautsprecher besitzt, öffne weit seine Fenster und stelle den Lautsprecher an die Fenster und lasse den Appell Adolf Hitlers an die Nation auf die Straße schallen, damit auch die letzten Schläfer erwachen. Dazu lade jeder so viele Bekannte wie möglich ein, damit sie die Rede des Führers hören können.« Und: »Jeder versuche an seiner Stelle durchzusetzen, daß unsere Plakate in allen Gastwirtschaften und Lokalen ausgehängt werden.« Schließlich: »Propaganda von Mund zu Mund […] bringt die unter dem Trommelfeuer eurer überzeugenden Worte wankend gemachten Gegner in unsere Versammlungen und Kundgebungen.«
Tatsächlich sollte es den Nationalsozialisten und ihren deutschnationalen Verbündeten am 5. März gelingen, das Straßenbild in den deutschen Städten, in denen mit Karabinern bewaffnete Polizei sowie SA als Hilfspolizei patrouillierten, weitgehend zu beherrschen.[42] Die Eroberung des öffentlichen Raumes durch die Nationalsozialisten, ihre Symbole und Parolen sowie ihren Sound war von Anfang bereits weit fortgeschritten und eng mit Gewalt oder zumindest Gewaltandrohung verbunden.
Die an diesem Tag stattfindenden Wahlen zeigten jedoch, dass die Nation nur sehr unvollständig »erwacht« war. Bei einer überaus hohen Wahlbeteiligung von 88,7 Prozent erhielt die NSDAP 43,9 Prozent der Stimmen, was gegenüber den vorherigen Reichstagswahlen einen Zuwachs von 10,8 Punkten bedeutete; im Vergleich zu ihrem besten Wahlergebnis vom Juli 1932 konnte sie jedoch nur um 6,4 Prozent zulegen. Fast 17,3 Millionen Deutsche wählten am 5. März 1933 die NSDAP, im Vorjahr waren es im November über 11,7 Millionen und im Juli über 13,7 Millionen gewesen. Hitlers rechtskonservative Unterstützer Deutschnationale Volkspartei (DNVP), Stahlhelm und Reichslandbund, die unter der Listenbezeichnung »Kampffront Schwarz-Weiß-Rot« angetreten waren, erhielten 8,0 Prozent und damit 0,5 Prozent weniger als die DNVP im November 1932. Insgesamt erreichte die Regierung mit annähernd 52 Prozent eine Stimmenmehrheit. Berücksichtigt man die Nichtwähler, so entschieden sich 39 Prozent der deutschen erwachsenen Bevölkerung für die NSDAP bzw. 46 Prozent für die Regierung Hitler. Von denjenigen, die gültige Stimmen abgaben, wählten im Übrigen 18,3 Prozent SPD (Verluste 2,1 Prozent), 12,3 KPD (minus 4,6 Prozent), 14 Prozent Zentrum und dessen Schwester Bayerische Volkspartei, die BVP (zusammen minus 1,0 Prozent). Die liberalen Parteien waren mit einem Stimmenanteil von 1,1 Prozent (Deutsche Volkspartei, DVP) bzw. 0,9 Prozent (Deutsche Staatspartei) nach weiteren Verlusten in der Bedeutungslosigkeit angekommen.
Die historische Wahlforschung erklärt den Stimmenzuwachs der NSDAP am 5. März 1933 mit hoher Plausibilität wie folgt: Demnach hatten 63 von 100 NSDAP-Wählern auch schon im November 1932 für die Partei votiert, 22 kamen aus dem Lager der bisherigen Nichtwähler, sechs von den liberalen Parteien (vor allem von der DVP), drei aus dem kommunistischen und zwei aus dem sozialdemokratischen Lager sowie einer aus dem von Zentrum/BVP. Eine massive Wählerwanderung von links nach ganz rechts oder aus dem Kreis der aktiven Katholiken zur NSDAP hatte folglich nicht stattgefunden.[43]
Das Wahlergebnis war jedoch nicht das Ergebnis einer freien Entscheidungsbildung, sondern spiegelte bereits die politische Willensbildung unter den geschilderten Beschränkungen wider. Nicht nur hatte die KPD überhaupt keinen Wahlkampf mehr führen können, während der Auftritt der SPD massiv und der des Zentrums in einem gewissen Umfang behindert worden waren. Vor allem musste die Attraktivität der gegen die Regierung Hitler auftretenden Parteien für die Wählerschaft in dem Maße sinken, in dem sich deren Anhänger ausrechnen konnten, dass eine effektive Oppositionsarbeit gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich sein würde. Stimmen für diese Parteien wären also mehr oder weniger »verschenkt« oder allenfalls noch eine Geste des Protestes. Das traf vor allem auf die KPD und die SPD zu und erklärt zum Teil die Verluste dieser Parteien. Kurzum: Bei wirklich freien Wahlen hätte die NSDAP mit Sicherheit weniger Wähler mobilisieren können und wäre kaum über 40 Prozent der Stimmen gekommen.
Terror und weitere Gleichschaltung
Die SA, die Anfang 1933 über 400 000 Mann umfasste, ging unmittelbar nach den Wahlen daran, die von ihren Leuten selbst so genannte »nationalsozialistische Revolution« gewaltsam durchzusetzen. Dabei wurde sie in keiner Weise durch die Staatsmacht eingeschränkt, sondern im Gegenteil von dieser nach Kräften unterstützt.
Zum einen begann die SA nun willkürlich und auf eigene Faust, ihre politischen und sonstigen Gegner, meist Angehörige der Linken, zu verschleppen.[44] Überall im Reichsgebiet entstanden provisorische Haftstätten: neben den vielen spontan in gerade zur Verfügung stehenden Gebäuden eingerichteten Prügelkellern und Folterhöhlen auch etwa siebzig größere staatliche Konzentrationslager, die durch SA und SS bewacht wurden. Hier herrschten vollkommene Rechtlosigkeit und äußerste Brutalität.[45] Im März und April waren in allen Haftstätten insgesamt etwa 45 000 bis 50 000 Menschen – in der Regel für einen kürzeren Zeitraum – inhaftiert, im gesamten Jahr 1933 waren es wohl über 80 000,[46] möglicherweise auch wesentlich mehr.[47] Aufgrund der Abschirmung der Lager und der Verschleierung der in ihnen begangenen Verbrechen ist es nicht möglich, für 1933 eine auch nur annähernd präzise Zahl von Todesopfern zu nennen: Es dürfte sich jedoch um einige Hundert Menschen gehandelt haben.[48]
Zum anderen gelang es der Regierung in den Tagen unmittelbar nach der Wahl, mithilfe der Reichstagsbrandverordnung die noch nicht nationalsozialistisch regierten Länder ihrer Kontrolle zu unterwerfen. Die einschüchternden Demonstrationen ihrer Anhänger vor Ort lieferten jeweils den Vorwand für die Einsetzung von Reichskommissaren, die dafür sorgten, dass die amtierenden Landesregierungen durch gefügige Gefolgsleute ersetzt wurden.[49] Bis Mitte März kontrollierten in allen Ländern Nationalsozialisten die Regierung, womit die politische – aber noch lange nicht die staatsrechtliche – Gleichschaltung der Länder abgeschlossen war.
Im Zusammenhang mit der Machtübernahme in den Ländern rissen die Nationalsozialisten häufig auch die Führung in den Kommunen an sich, indem sie ihren »Sieg« symbolisch mit dem Hissen der Hakenkreuzfahne auf dem Rathaus zum Ausdruck brachten.[50] Ebenfalls unmittelbar nach den Wahlen gingen sie überall im Reich massiv gegen die jüdische Minderheit vor: Sie belagerten von Juden geführte Geschäfte, Rechtsanwalts- und Arztpraxen und vertrieben jüdische Juristen gewaltsam aus Gerichten.[51] In Berlin marschierte die SA am 9. März vor der Börse auf und verlangte einen Rücktritt des Börsenvorstands wegen angeblicher »jüdischer Hetze« im Hause. Ebenso behinderten sie die Verkaufstätigkeit von Warenhäusern, sogenannten Einheitspreisgeschäften und Konsumgenossenschaften, also von Betrieben, die seit Jahren als angeblich unlautere Konkurrenz des »deutschen« Einzelhandels im Fokus ihrer Agitation gestanden hatten.[52] Solche sich immer weiter ausbreitenden »Eingriffe in das Wirtschaftsleben« riefen allerdings die konservativen Regierungspartner auf den Plan, so dass Hitler schon nach wenigen Tagen ein Ende dieser »Einzelaktionen« anordnete,[53] ohne sie jedoch völlig verhindern zu können.[54]
Vor dieser gewalttätigen Drohkulisse drückten die Nationalsozialisten auch dem äußeren Erscheinungsbild des Landes immer weiter ihren Stempel auf. Ihre Plakate, Uniformen und Parolen beherrschten bereits die Straßen vieler deutscher Städte. Am 12. März, dem Volkstrauertag, wurde zudem aufgrund einer Partei-Anordnung Hitlers nicht mehr in den auf der gesamten Rechten verachteten Farben der Republik – Schwarz-Rot-Gold – geflaggt, sondern man hisste überall die schwarz-weiß-roten Fahnen des alten Kaiserreichs.[55] In seiner Rundfunkansprache an diesem Tag gab Hitler außerdem einen »Flaggenerlass« des Reichspräsidenten bekannt, wonach bis zur endgültigen Regelung der Reichsfarben auf öffentlichen Gebäuden sowohl schwarz-weiß-rote Fahnen als auch die Hakenkreuzflagge nebeneinander gehisst werden sollten.[56]
Als ganz wesentlich für die weitere Kontrolle der deutschen Öffentlichkeit erwies sich die Ernennung von Joseph Goebbels zum Propagandaminister am 13. März. Die im Wahlkampf unter Goebbels’ Leitung hochgefahrene Propagandamaschinerie der NSDAP konnte so fast nahtlos zu einem staatlichen Instrumentarium umfassender Meinungsbeeinflussung mit wesentlich erweiterten Vollmachten ausgebaut werden. Es dauerte zwar bis zum Juli, bis die Grundstruktur des Propagandaministeriums stand, doch bereits im März griff der neue Minister deutlich in die Regie des öffentlichen Lebens ein.
So konnte Goebbels schon nach wenigen Tagen seinen Einfluss auf den Rundfunk ausbauen, indem er die Programmüberwachung vom Reichsinnenministerium übernahm.[57] Als er sich am 15. März der Reichspressekonferenz vorstellte, ließ er wenig Zweifel über den neuen Kurs: Es müsse eine »weitgehende Gleichschaltung zwischen Regierung und Volk erfolgen, und das sei die spezielle Aufgabe des von ihm geleiteten Ministeriums«. Die Presse habe nicht nur das Volk zu informieren, sondern auch »zu instruieren«. Im Klartext: »Wir wollen die Menschen so lange bearbeiten, bis sie uns verfallen sind.« Die Presse müsse »so organisiert sein, daß gleichsam die Regierung auf ihr wie auf einem Instrument spielen könne«. Gegen eine regierungsfeindliche Kritik werde er »mit allem Nachdruck einschreiten«, und i m Übrigen hoffe er »auf vertrauensvolle Zusammenarbeit«.[58]
Die unüberhörbaren Drohungen zeigten sogleich Wirkung: Liberale Blätter wie die Vossische Zeitung oder die Frankfurter Zeitung, die im Februar und in der ersten Märzhälfte täglich über gewalttätige Auseinandersetzungen offenkundig politischen Charakters mit Toten und Verletzten berichtet hatten, und zwar auf eine Art und Weise, dass man diese Taten durchaus den Nationalsozialisten zuordnen konnte, stoppten diese Art der Berichterstattung abrupt Mitte des Monats. Die Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ) unterstützte wiederum von Anfang an die Politik der neuen Regierung, trat dabei allerdings prononciert für eine Stärkung ihrer eigenen Klientel der Rechtskonservativen, der »unentbehrlichen Kameraden des Nationalsozialismus«, ein und versuchte in diesem Sinne, eine eigene Linie zu vertreten. Aber auch die übrige Presse passte sich rasch an den neuen Kurs an. Dies zeigte sich insbesondere in der Berichterstattung über das nächste durch die neuen Machthaber inszenierte »Großereignis«: Auf den »Tag der erwachenden Nation« folgte am 21. März der »Tag von Potsdam«.[59]
Der »Tag von Potsdam«
An diesem Tag sollte der neu gewählte Reichstag – dessen Gebäude ja wegen des Brandes unbenutzbar war – nach einer Vereinbarung zwischen Regierung und Reichspräsident in der Garnisonskirche in Potsdam eröffnet werden, mithin an einem höchst symbolträchtigen Ort: Hier befand sich die Gruft mit den Särgen der beiden Preußenkönige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., und hier waren bis 1919 die Fahnentrophäen der siegreichen preußischen Armee ausgestellt worden. Der an diesem Tag so viel beschworene »Geist von Potsdam«, also die historische Dreieinigkeit von Thron, Altar und Militär Preußens, sollte das definitive Ende der Republik von Weimar zum Ausdruck bringen. Das Kalkül der Nationalsozialisten, auf diese Weise die von so vielen Deutschen hochgehaltenen preußischen Traditionen für sich zu vereinnahmen, ging allerdings nur zum Teil auf: Schon die Tatsache, dass Goebbels und Hitler, beide Katholiken, sich kurzfristig entschlossen, vor der eigentlichen Zeremonie nicht an dem morgendlichen Gottesdienst in Potsdam teilzunehmen, weil sie, so die Begründung, von ihrer Kirche andernfalls als »Abtrünnige« behandelt würden, zeigt, dass sie die Veranstaltung nicht wirklich unter ihrer Kontrolle hatten. In Potsdam selbst überwogen die schwarz-weiß-roten Fahnen, und die Reichstagseröffnung wurde zu einer machtvollen Demonstration des alten kaiserlichen Deutschlands. Zahlreiche seiner Persönlichkeiten waren dann neben den nationalsozialistischen und bürgerlichen Abgeordneten in der Garnisonskirche präsent, und im Mittelpunkt der eigentlichen Zeremonie stand der greise Präsident Hindenburg