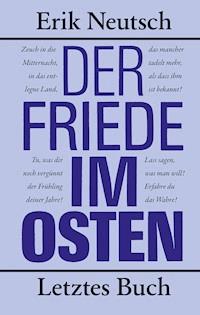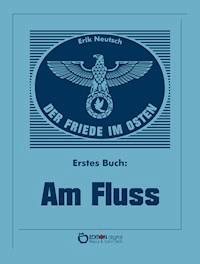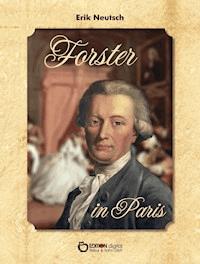7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In dieser essayistischen Erzählung geht es um Verluste, die Neutsch selbst durchlitten hat, und obwohl er im Text manches in der dritten Person verfremdet, so erkennt man ihn dennoch hinter jeder Zeile. Voller Betroffenheit und tiefer Trauer begleitet er seine Frau, mit der er fast fünfzig Jahre seines Lebens teilte, während der letzten fünf Tage bis zu ihrem Tod. Dabei werden Erinnerungen wach, an die Ungebrochenheit ihrer Liebe, aber auch an Verletzungen. Ihre Gemeinsamkeit war erfüllt von Visionen, die sie beide mit ihrem Land verbanden, in dem sie aufwuchsen. Um so stärker trifft es sie, als sie von ihrer Republik Abschied nehmen müssen. Schonungslos, nahezu philosophisch, versuchen sie, sowohl die Ursachen als auch die längst erkennbaren Folgen des Scheiterns ihrer Ideale zu ergründen. Und was wird davon nicht verdämmern? Der Autor bleibt zurück - allein mit seinen bohrenden Fragen ... LESEPROBE: Inzwischen jedoch hatten sich beide bei uns zu Hause einquartiert und warteten ungeduldig auf meine Antwort. Jedesmal sprach ich mit ihnen über ein Telefon außerhalb des Zimmers, weil ich mir unsicher war; ob Ulrike womöglich nicht doch, trotz ihres Zustands, einen Fetzen von unserer heimlichen Verabredung hätte mithören können. Dann aber war es endlich soweit. Sie nickte schwach, als ich ihr nun schon zum wiederholten Male den Wunsch unserer Töchter übermittelte, hauchte ein leises Ja. Sie kamen sofort. Schon meine Zusage am Telefon, die ja nichts anderes war als nur die Wiedergabe ihrer Zustimmung, mußte für sie die Befreiung aus einer bis dahin irrationalen Angst sein. Sie wollten sofort mit dem Auto losfahren, und so würde es höchstens zwanzig Minuten dauern, bis sie einträfen. Ich empfing sie auf dem Korridor, bat sie noch, beim Anblick ihrer Mutter nicht zu erschrecken, und täten sie es doch, sich nichts anmerken zu lassen, und blieb zurück, damit sie mit ihr allein im Zimmer sein konnten. Nicht einmal eine Viertelstunde mochte vergangen sein, da öffneten sie wieder die Tür und traten heraus. Ich sah ihnen an, sie waren zutiefst erschüttert. Offenbar hatten sie schon am Krankenbett ihre Tränen nicht unterdrückt, denn ihre Augen waren gerötet und verweint, sie schluchzten noch immer. Minutenlang standen wir im Schweigen. Sie sei zwar ansprechbar gewesen, sagten sie nach einer Pause, aber bei jedem Wort habe sie sich gequält. Schließlich sei sie in Apathie versunken, nachdem sie ihrem Geflüster nur noch hätten entnehmen können, daß sie sehr müde sei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Erik Neutsch
Verdämmerung
ISBN 978-3-86394-720-0 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 2003 im SCHEUNEN VERLAG, Kückenshagen.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Auf Wunsch des Autors wurde nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt.
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Sie wußte, daß sie stirbt. Es war am dritten Tag nach ihrer erneuten Einweisung ins Krankenhaus Sankt Ursula. Der 4. Oktober. Vom frühen Morgen an hatte sie die nun wohl endgültig letzte Untersuchung über sich ergehen lassen müssen. Und war sie bis dahin denn noch voller Hoffnung gewesen?
Mich traf es, als würde ich selber ins Abgrundtiefe gestoßen. Wie soll ich es anders nennen. Mir fehlen die Worte. Und trotzdem versuche ich, etwas Ähnliches zu finden, etwas, das sich anhört wie Sprache. Ich weiß nicht, ob mir an diesem Tag die Beine wie Blei wurden. Oder ob sie einknickten, ich Halt suchte. Ich fühlte in mir nur die abgrundtiefe Leere. Verzweiflung. Nie mehr helfen zu können.
Als ich kam, zur Besuchszeit, sagte mir die Ärztin: Fragen Sie Ihre Frau, sie wollte die Wahrheit wissen. Ich ging zu ihr, suchte ihr Gesicht, ihre Augen, ihre großen und schönen Augen. Mir schien, sie wären noch weiter als sonst, geweitet, indem sie mich ansah und hauchte: „Es ist Krebs..." Und wohl auch: Sie wisse, daß sie sterben müsse.
Ich wollte schreien. Sie umkrampfte, soweit es ihre Kraft noch zuließ, meine Hand. Nebenan in den Betten lagen noch drei andere Patientinnen. Ich preßte die Faust gegen meine Lippen, verstopfte mir den Mund, biß mir in die Knöchel.
Sie hatte mein Stöhnen vernommen. „Teddy, Teddy, du mußt jetzt sehr stark bleiben."
Zwei Wochen später sagte mir die Ärztin: Wenn Sie erst morgen kommen, kann es vielleicht schon zu spät sein. Wie klein, wie nichtig wurde dagegen alles, sinnlos das Alltägliche, es zerrann zu einem Nichts. Eine Werkstatt, das Auto, Behördenbriefe, die dringend einer Antwort harrten, jede Art Schreiben - ein Nichts vor der Übermacht des Unvermeidlichen in den nächsten Stunden. Der Tod stand so nah, und sie wußte es. Sie hatte die Ärzte bedrängt, ihr die Wahrheit zu sagen.
Ich eilte zurück in unser Haus, packte einen Koffer mit dem Nötigsten für mich, nahm ein Taxi, und nachdem ich die Anmeldung hinter mir hatte, ließ ich mich zu ihr ins Zimmer legen, besetzte ein zweites Bett, ihr gegenüber, das für mich schon vorbereitet war.
Sie erkannte mich noch. Obwohl sie gewiß wieder unter Morphium stand. Die Dämmerung des hereinbrechenden Abends erfüllte den Raum. Ich schaltete ein mattes Licht an, hockte mich auf einen Stuhl ihr zur Seite. Ich küßte ihre spröden Lippen, ihre mehr als sonst von durchscheinend blauen Äderchen gezeichnete Hand. Daraufhin war sie bemüht, sich aufzurichten, ihren Arm um mich zu legen. Doch kraftlos fiel sie zurück in die Kissen.
„Jetzt bin ich bei dir", sagte ich, „und alles wird gut. Mein Kreislauf macht mir wieder zu schaffen. Deshalb bin auch ich hier. Man hat's mir empfohlen. Doch bald werden wir beide wieder gesund und gehen gemeinsam nach Hause."
Mir schien, als nickte sie. Als spränge ein Funke auf in ihren wie von einem Schleier leicht verhüllten Augen. Waren es Tränen? Doch nein. Oder wieder, wie schon das ganze Jahr über, Hoffnung? Ich hatte gelogen. Und trotzdem war ich froh darüber. Ich glaubte, daß sie spürte: Ich war bei ihr. Sie fühlte sich nicht mehr allein.
Die Ärztin sagte mir später: Seitdem Sie bei ihr sind, ist Ihre Frau ruhiger geworden.
2. Kapitel
In der ersten Nacht schon, und ich konnte nicht ahnen, daß noch vier Tage und Nächte folgen würden, achtete ich auf jeden Atemzug von ihr. Ich wollte nicht schlafen, und selbst wenn ich gewollt hätte, es wäre mir nicht gelungen. Verwirrten sich dann doch irgendwann meine Sinne, war es, als fiele ich in ein Loch voller Dunkelheit, das mich sofort wieder ausspie. Alpträume. Das Wissen darum, sie könnte in jedem Augenblick sterben, ohne daß ich es bemerkt hätte, steigerte meine Furcht, hielt mich wach, versetzte mich in den Zustand einer von mir noch nie so empfundenen Abwehrmüdigkeit, in Aufbegehren und Ohnmacht zugleich, in einen Taumel zwischen Tätigseinwollen und fatalistischem Hilflossein. Nichts vermochte ich zu ändern, nichts abzuwenden. Ich konnte nur warten, warten, warten... Und meine nur um ihren Tod noch kreisenden Gedanken ließen mich fortwährend aufschrecken. Sie umflatterten mich im Nichtschlaf wie schwarze, nein, fand ich, nun wohl doch wie bunte, exotische Vögel, sobald sich mir die Erinnerungen auftaten...
Die allerersten Monate, Wochen, Tage. Frühsommer. Im gelbgewaschenen Sand zwischen den Buhnen an der Elbe. Vorüber treiben Raddampfer mit Lastkähnen im Schlepptau, zerwühlen den Fluß, so daß die Wellen ans Ufer schwappen und den Jungen dort und das Mädchen unter der glühenden Sonne erfrischend umspülen. Julius Hay und HABEN, Büchner und DANTONS TOD. Ja, er ist besessen von sozialer Gerechtigkeit und betet Revolutionen an. Er liest ihr die beiden Stücke vor, nachdem sie sich während der Ferien Tag für Tag hierher verkrochen haben, zu zweit in die Einsamkeit. Und zwischendurch ein Umarmen und Küssen. Und weder vom einen noch vom anderen kennt er ein Ende.
Nachdem sie sich kurz darauf, getrieben von ihrem Verlangen, in einer entfernteren Stadt ein Hotelzimmer genommen haben, nennt sie ihn in der Nacht, was nur bei maßlos ineinander Jungverliebten nicht peinlich klingt, Teddy. Sie sagt: Bisher lag neben mir im Bett immer ein Teddybär. Ab heute bist du es. Tausend und tausend Mal hat er sie seither, bis die letzte Hülle gefallen, entkleidet, und jedesmal war er trunken davon. Damals an der Elbe streift er ihr den weißen Bikini mit den rot aufgestickten Schmetterlingen ab. Nackt liegt sie vor ihm, und noch nie hat er dergleichen gesehen. Bernsteinblond, die Haut gebräunt, etwas blasser nur um Brüste und Schoß. Sie schließt die Augen, bevor sie sich ihm entgegenhebt. Ihr Beieinander, Ineinander, das Füreinander an die fünfzig Jahre...
Und wieder in mir das Erschrecken: Es sollte, es durfte nicht sein, daß sie jetzt von mir geht!
Ricke nennt er sie, mein blondes Reh, nachdem sie sich immerfort in den Pausen auf dem Schulhof und erst recht zu den Wochenenden auf den Tanzböden begegnet sind. Micha, nennt sie ihn, Micha, mein Bär, während sie sich bald nach dem Abitur als Lehrerin für Russisch ausbilden läßt und sie beide sich schwören, für immer und ewig zusammenzubleiben.
Sie allerdings kommt aus einer Familie, die über Generationen hinweg, bis ins frühe achtzehnte Jahrhundert, ihren Stammbaum verfolgen kann, darin mütterlicherseits, wenngleich anfangs noch Spänner, später dann zunehmend Großbauern, und väterlicherseits teils höchste Beamte aufgeführt sind. Ihr Vater hat es genau erforscht. Er ist Lehrer, deutschnationaler Anschauung, ohne Hitler zu mögen, eher Preußen verehrend, spartanisch im Wesen. Nur in einem steht er den Nazis nahe, in der Verachtung nichtarischer Rassen.
Micha hingegen, jedenfalls so, wie er es empfindet, entstammt der Klasse der Unterdrückten. Proletarier alle seine Verwandten, wohin er auch blickt, und aus Erzählungen kennt er sie höchstenfalls nur bis kurz vor der Jahrhundertwende. Sein Vater einst, am Ende des Ersten Weltkriegs, nachdem er sowohl die Materialschlacht bei Arras als auch die Verbrüderung mit den Russen an der Ostfront erlebt hatte, im Soldatenrat, beteiligt, den Offizieren die Epauletten abzureißen, seine Mutter, Fabrikmädchen in einer Patronenschmiede, im Arbeiterrat. Zeitlebens bestimmt es beider Gesinnung.
Der Vater erklärt ihm die Schlacht um Stalingrad und prophezeit, daß der Moloch Hitler an der Sowjetunion ersticken wird. Das geschieht, als ihn bereits seine Berufskrankheit, die Silikose der Former, dahinsiechen läßt. Zuvor, noch im Besitz seiner Kräfte, fährt er an jedem Lohntag Woche für Woche mit seinem Rad in die Geschäftsstraße der Stadt, kauft allerhand Süßigkeiten und ihm, zusätzlich, um seine Lesewut zu stillen, bei einem Boulevardhändler billigste Schmöker. Manchmal jedoch befindet sich auch ein Reclamheft darunter.
Jetzt, im Sand an der Elbe, zieht Micha ein schon halb zerfleddertes aus dem Badebeutel, DIE RÄUBER. Szene um Szene liest er ihr vor, und hellauf entflammt zitiert er Sätze wie solche: Pfui über das schlappe Kastraten-Jahrhundert... Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem nach Freiheit... Menschen haben Menschheit vor mir verborgen, da ich an Menschheit appellierte. Weg dann von mir Sympathie und menschliche Schonung...
„Sei nicht so laut", sagt sie. „Sonst könnte bald dein Echo vom Wald gegenüber gehört werden und uns verraten." Wie um es ihm zu beweisen, setzt sie sich auf, trichtert die Hände und ruft: „Herr Lehrer, Herr Lehrer! Was woll'n Sie aus uns erschaffen?" Vom anderen Ufer schallt es mehrmals zurück: „Affen, Affen..."
„Auch Karl Moor schreit es aus sich heraus", verteidigt er sich in seinem Feuer. „Damit es widerhallt in ganz Deutschland."
Ricke küßt ihm den Mund zu, und leise fügt sie hinzu: „'Die Waffen ruhn, des Krieges Stürme schweigen,/ Auf blut'ge Schlachten folgt Gesang und Tanz,/ Durch alle Straßen tönt der muntre Reigen,/ Altar und Kirche prangt in Festes Glanz...' - Auch das ist Schiller."
„Aber ein ganz gezähmter!", empört er sich und greift wieder zu HABEN mit dem Vorwort von Feuchtwanger: Das Stück zeigt, wie die kapitalistische Anschauung vom Besitzen den dörflichen Menschen bis in sein tiefstes Innen verkrüppelt hat. „Was weiß denn schon ein Polizeibüttel", macht er jetzt noch sein eigenes Nachwort darauf, „vom Elend der Ärmsten, auch daß im Dorf die Weiber in ihrer Verzweiflung nicht anders können als zu morden, um sich aus dem Gutsherrendreck zu befreien? Hör noch einmal die Vágó: ,Wir erklären doch alles, Herr Feldwebel, mit Geduld. Warum das Volk gerade so lebt, wie es lebt, - warum das Volk nicht mehr Boden hat...' Daraufhin beim Lesen dieses Flugblattes der Dummkopf: ,Als könnte man anders leben... Als gäbe es mehr Boden, der nicht irgend jemandem gehört, dem man ihn doch nicht wegnehmen kann...' - Doch, Ricke, man kann, man muß!"
„Was bist du nur haßsüchtig, ja, kommunistisch. Mein Onkel hat sich erhängt bei der Bodenreform."
Ein andermal dann Robespierre im Jakobinerklub und St. Just im Nationalkonvent: Die Unterdrücker der Menschheit bestrafen, ist Gnade; ihnen verzeihen, ist Barbarei... - Ich frage nun: soll die moralische Natur in ihren Revolutionen mehr Rücksicht nehmen als die physische? Soll eine Idee nicht ebenso gut wie ein Gesetz der Physik vernichten dürfen, was sich ihr widersetzt? Soll überhaupt ein Ereignis, das die ganze Gestaltung der moralischen Natur, das heißt der Menschheit, umändert, nicht durch Blut gehen dürfen?
Micha muß jeweils die Seiten durchblättern, um die rot angestrichenen Stellen zu finden, die er vorlesen will. Ricke hingegen kennt ihre Texte auswendig. Sie hat sie gelernt aus Vergnügen, rezitiert aus dem Gedächtnis, so daß es jedesmal schlagfertig wirkt. Wie den Monolog der JOHANNA so auch die Parabel des NATHAN: Vor grauen Jahren lebt' ein Mann im Osten,/ Der einen Ring von unschätzbarem Wert/ Aus lieber Hand besaß... Wohlan!/ Es eifre jeder seiner unbestochnen/ Von Vorurteilen freien Liebe nach!/ Es strebe von euch jeder um die Wette,/ Die Kraft des Steins in seinem Ring' an Tag/ Zu legen... „Verstehst du denn nicht? Auch ich will Menschlichkeit. Doch ohne Blut. Nur so, daß sie uns heilt."
Ich mußte aus dem Schlaf gefahren sein, horchte zu ihr hinüber, und plötzlich war mir, als vernähme ich wieder unseren Wettstreit mit den Dichterworten. Aber war es nicht mehr als nur das gewesen? Ein zwar konträres, jedoch ein gegenseitig Sichverstehenwollen? Die Sehnsucht der Liebe auch nach geistiger Annäherung, wenngleich vorerst auf neutralem Felde? Ich fragte mich, ob sie sich, wie in all den Jahren unserer Ehe zuvor; mit der ihr eigenen ironischen Heiterkeit ebenfalls noch daran würde erinnern können. Nein, nein, ich ahnte es selbst durch die Dunkelheit, sie dämmerte dahin. Ich wußte nicht, was geht in ihr vor; und schon gar nicht, wo jetzt ihre Gedanken sein mochten.
Sie hatte über Schmerzen in den Beinen geklagt. Bis zu den Knien schon reichte die Anschwellung. Noch im Zimmer mit den anderen Frauen hatte man ihr Bett mit einem Gitter abgesichert. Sie habe sich, hieß es, um sich Erleichterung zu verschaffen, aufgesetzt und ihre Füße baumeln lassen. Dabei sei sie vornüber auf den Boden gestürzt. Als ich sie danach besuchte, fragte sie mich wie mit der Stimme eines gescholtenen Kindes: Was hab ich denn Böses getan, daß man mich einsperrt? Sie fühlte sich, ja, so wirkte es auf mich, als sei sie wegen einer Ungezogenheit bestraft worden. Ich wandte mich ab, um vor ihr meine Tränen zu verbergen. Was auch hätte ich ihr denn Tröstliches antworten können? Meine stets so empfindsame, zarte, gewiß verletzliche, aber vor allem auch selbstbewußte Frau - wie erniedrigt mußte sie sich vorkommen. Was war aus ihr geworden!
Ich sprach mit der Ärztin. Danach wurde sie in ein Einzelzimmer verlegt, worin man für mich ein zweites Bett aufstellte.
Über dreißig Jahre später nach jenem Sommer, in dem sie sich fanden und entdeckten, kommen Ricke und Micha zurück auf DANTONS TOD. Längst haben sich beide die Weltliteratur erschlossen. Sie liebt ANNA KARENINA, er eher KRIEG UND FRIEDEN, und er will den noch verbliebenen Spuren Georg Försters während der Französischen Revolution nachgehen. Sie darf ihn begleiten, da sie neben Russisch auch ein einigermaßen gutes Schulfranzösisch spricht und somit dem Kulturministerium die Kosten für eine Dolmetscherin auf seiner Studienreise erspart. Paris! Irgendwie ist es die Stadt ihrer beider Träume. Nicht zuerst wegen ihrer Sehenswürdigkeiten, sondern wegen ihrer Geschichte und ihres Geistes. Place de la Concorde, wo einst die Guillotine stand, die Champs Elysées, Louvre und Tuilerien, Notre Dame und schließlich auch der Besuch in der Conciergerie. Schauplätze sämtlich bei Büchner.
Sie stehen vor der Zelle, in der die Autrichienne, Königin Marie-Antoinette, ihr Todesurteil empfing. Mit Blumen überhäuft, vom Licht flackernder Kerzen erhellt. Nur wenig weiter der Kerker von Robespierre und St. Just, ihr letzter Aufenthalt, bevor sie auf dem Karren zur Hinrichtung durch die Verräter an der Revolution und am Volke gefahren wurden. Kahl und düster, eine schauerliche, der Vergessenheit anverdammte Gruft. Die Museumsführerin, soweit Ricke ihren Worten folgen und sie übersetzen kann, gedenkt der bourbonischen Österreicherin in schwärmerischer Ehrfurcht, geradezu lächerlich wirkendem Royalismus, hingegen der Jakobiner, schnell vorübertrippelnd, nur mit Verachtung und Abscheu.
Sind sie beide denn in dieser Menschentraube, die hier, zusammengewürfelt aus aller Herren Länder, durchgeschleust wird, die einzigen, die die Geschichte anders zur Kenntnis nehmen, anders mit ihr umzugehen wissen?
Nachdem sie das finstere Gemäuer wieder verlassen haben und frische Luft schöpfen im Grünen, seufzt sie enttäuscht: Sie begreifen nichts. Selbst die Grande Nation, zu der ich immer bewundernd aufgeschaut habe, begreift absolut nichts. Mit zumindest staatlicher Billigung läßt man uns hier Maulaffen feilhalten und verkehrt die großen Traditionen in ihr Gegenteil, lobhudelt sogar noch heute diesem korrupten Regime unter Ludwig und der Marie-Antoinette. Mein Gott! Was ist bloß davon noch übriggeblieben: Liberté - Ègalité - Fraternité.
Er hüllt sie in seine Jacke, denn es scheint sie noch immer unter der Kühle des Verlieses zu frösteln. „Komm, wärme dich erst einmal, Ricke. Und sei nicht allzu hart in deinem Urteil."
Da aber haben sich Rickes Weitsicht, ihr geistiges wie politisches Credo längst gewandelt. Sehr frühzeitig, möglicherweise auf sein Drängen hin, was sie jedoch stets bestreiten wird, findet sie zum Atheismus. Er, beim plebejischen Rebellentum seines Vaters, das auf Dauer nur von der Mutter etwas gedämpft werden kann, ist nicht einmal getauft worden. Doch sie, kaum daß sie sich enger verbunden fühlen, wagt eine, jedenfalls damals, provokative Entscheidung. Sie trennt sich, nicht ohne das Mißfallen ihrer Eltern, aber besonders der anhängigen Verwandtschaft, von Kirche und Religion, weil sie, wie sie es begründet, Heuchelei und erst recht Bigotterie nicht mag. Manchmal jedoch, nachdem sich der moralische Rigorismus ihrer Jugend gelegt hat, sie beide nicht mehr nur ein Ja oder Nein, ein Entweder-Oder als Antwort gelten lassen, fragen sie sich, was wohl mit Gott gemeint sein könnte, ob es vielleicht ein Synonym sei für Schicksal. Obwohl es sie ängstigt, sprechen sie über eine Zukunft, so fern sie ihnen auch erscheint, in der einer den anderen zu verlassen gezwungen sein würde. Es wäre am Ende der Tod, und sie sagt: Sobald es denn mich trifft, vor dir, will ich Asche sein und, ohne Aufsehens, auf einem stillen Friedhof bestattet werden.
Es ist nach ihrer ersten Operation an der Bauchspeicheldrüse. Der Befund danach lautet, es hätten sich lediglich Zysten gebildet und die ließen sich medikamentös behandeln und mit der Zeit eintrocknen. Ricke müsse nur mit der erforderlichen Diät leben, mutig sein und Geduld aufbringen. Doch sie, fürchtet er, mißtraut den Aussagen der Ärzte.
Unablässig horcht sie in sich hinein, und eines Tages führt sie ihre Gedanken an jene noch unbestimmte, für ihn völlig unvorstellbare Zukunft fort: Und sollte es soweit sein, Micha, möchte ich Julia und Soja bei mir haben. Denn bei wem, wenn nicht bei unseren Töchtern, solltest du sonst ohne mich Halt finden?
Schweig, entgegnet er, fast unwirsch, schweig! Ich will nichts davon wissen... Ihn, der vor allem erschrickt, was unabwendbar erscheint, schaudert jetzt erst recht bei der Vorstellung, es könnte gar ein Ende für sie beide geben. Was nur, was entmutigt dich so, daß du solch schwarzen Visionen anhängst? Du wirst gesund, hörst du, und nie, nie wieder darfst du vom Sterben sprechen. Gemeinsam werden wir alt wie Philemon und Baucis... Sie lächelt, doch wirkt es gequält. Und nach einer Weile kommt sie erneut darauf zurück: Ich weiß, Micha, mein Bär, daß du mich niemals vergessen wirst. Wir waren zu gut miteinander solange. Ich kann es doch selbst noch nicht fassen. Auch an ein Weiterleben kann ich nicht glauben... Sie sagt: Oder doch. Vielleicht in dir, wenn du dann an mich denkst.
Sie drückt sich an ihn. Er will ihr jedes weitere Wort verbieten, aber nun ist es an ihm zu schweigen, sie zu streicheln und zu schweigen.
Ich hatte ein Foto von ihr mitgenommen, das nicht viel älter als zehn Jahre sein mochte, zu erkennen an der Bluse, in der ich sie stets besonders gern gesehen hatte, und auf dem sie noch ungemein jung wirkte. Ich wollte in den zu erwartenden schweren Stunden von diesem Bild begleitet sein, hatte es auf den kleinen Speisetisch gestellt, doch so, daß sie es von ihrem Bett aus, selbst wenn sie bei vollem Bewußtsein wäre, kaum würde bemerken können. Als eine Krankenschwester es betrachtete, sagte sie: „Was für ein offenes, schönes Gesicht."
Tags darauf betrat eine Ordensschwester unser Zimmer; offenbar eine Ursulinerin, bis zu den Füßen schwarz gewandet, mit weißer Haube und einem an einer längeren Halskette hängenden Kruzifix. Gewiß war ihr mitgeteilt worden, daß nun keine Rettung mehr bestünde, und so kam sie, bald schon die Hände faltend, um mit ihr ein Gebet zu sprechen, vielleicht ein letztes.
Da jedoch, als sie die Schwester vor ihrem Bett stehen sah, weiteten sich, trotz der Betäubung, in die sie die Morphiumgaben versetzt hatten, schreckhaft ihre Augen. Sie muß diese wie ins Schwarz der Finsternis gekleidete Person nicht anders als einen Todesengel empfunden haben, angesichts seiner deshalb auch tiefste innerliche Furcht. Trotz all der ihr eingeflößten Sedativa, der künstlich erzeugten Beruhigung, muß ihr wieder zu Sinnen gekommen sein, was nun unabwendbar war.
Selber hatte sie die volle Wahrheit über sich wissen wollen, und so war es geschehen.
Aber jetzt? Ich kannte von ihr jeden Atemzug, jede leiseste Regung in ihrem Gesicht. Sie klammerte sich ans Leben und suchte, um Hilfe flehend, meine Blicke.
Ich verstand. Ich mußte sie aus ihrer Not befreien. Auch bei mir hatte der plötzliche, mit keinem Wort zuvor angekündigte Besuch der Ursulinerin Erschrecken ausgelöst. Also forderte ich sie auf, mit mir das Zimmer zu verlassen und auf den Korridor zu gehen.
Dort, indem ich vorerst noch um Fassung rang, fragte sie: „Es ist Ihre Mutter, nicht wahr?"
Ich zuckte zusammen. Denn erst jetzt, bei dieser Frage wurde mir klar, wie körperlich verfallen sie inzwischen auf andere wirkte. Ich selbst hatte es bisher nicht einmal zur Kenntnis genommen. Für mich glich ihr Gesicht noch immer dem auf dem Bilde mit der rotweißblau gestreiften Bluse.