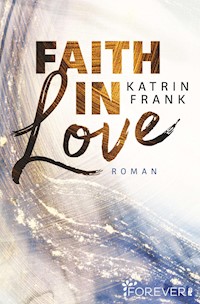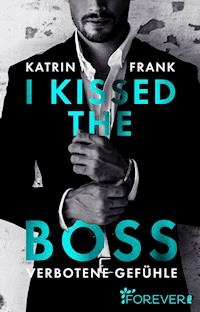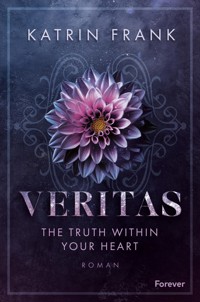
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Veritas
- Sprache: Deutsch
Eine LGBTQI-Dark-Academia-Romance im Ivy-League-Setting Harvard Kolton ist der Student, der jeder sein will: Beliebt, gutaussehend und der beste Quarterback in der gesamten Ivy League. Doch keiner ahnt den Schmerz, die Leere und Einsamkeit, mit denen er kämpfen muss. Als ein neuer Mitbewohner in seine WG zieht, ist Kolton zutiefst genervt: Vance stört seinen Schlaf, ernährt sich vegan, und löst in ihm Gefühle aus, die er nicht wahrhaben will. Zwischen täglichen Zankereien kommen die beiden sich näher – und stellen bald fest, dass sie zwar ganz unterschiedliche Vergangenheiten haben, aber beide auf der Suche nach sich selbst sind. Inmitten von Lügen müssen die beiden lernen, füreinander einzustehen, um ihre gemeinsame Wahrheit zu finden. Doch während Kolton sich immer tiefer in seinen Leistungszwang hineinsteigert, um vor der Realität zu fliehen, wird Vance mit dem Rätsel seiner Familiengeschichte konfrontiert...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Veritas
KATRIN FRANK, geboren 1983, ist eine leidenschaftliche Autorin aus Klagenfurt am Wörthersee. Ihr Herz schlägt für gefühlvolle und prickelnde Romane, Reisen und Kaffee. Sie liebt es, neue Orte zu entdecken und Menschen zu beobachten, und nutzt die Kraft ihrer Geschichten, um Akzeptanz und Verständnis zu vermitteln.
Kolton ist der Student, der jeder sein will: beliebt, gutaussehend und der beste Quarterback in der gesamten Ivy League. Doch keiner ahnt den Schmerz, die Leere und Einsamkeit, mit denen er kämpft. Als sein neuer Mitbewohner Vance in die WG zieht, ist Kolton zutiefst genervt. Zwischen täglichen Zankereien kommen die beiden sich näher. Inmitten von Lügen müssen sie lernen, füreinander einzustehen. Doch während Kolton sich immer tiefer in seinen Leistungszwang hineinsteigert, um vor der Realität zu fliehen, wird Vance mit dem Rätsel seiner Familiengeschichte konfrontiert...
Katrin Frank
Veritas
The truth within your heart
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Liste sensibler Inhalte:- Beleidigendes Verhalten gegenüber queeren Menschen- Leistungsdruck- Trauer und Verlust- Alkoholkonsum- Adoption, familiäre Probleme- Angstzustände und Panikattacken
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH Berlin
1. Auflage März 2024© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: emilybaehr.deTitelabbildungen: © volody10, vilmosvarga/Freepik und ifong, BoxerX, tomertu, 99Art/ShutterstockAutorinnenfoto: © Katrin FrankE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-95818-803-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Epilog
Persönliche Worte – Danksagung
Leseprobe: Stars In Your Eyes
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
1
Kolton
Eine falsche Bewegung reichte aus, um das Gleichgewicht zu verlieren, wie wild mit den Händen zu rudern, ohne Halt zu finden. Dabei spielte es kaum eine Rolle, wie sehr man sich abmühte. Wenn es nichts gab, woran man sich festhalten konnte, sorgte die Schwerkraft dafür, dass man zu Boden fiel. Den Aufprall musste man hinnehmen. Genauso den Schmerz, der sich wie ein Gift durch den Körper zog, sich unbarmherzig und rasant ausbreitete.
Keine Gnade.
Keine Zurückhaltung.
So spielte das verdammte Leben nun mal und verzichtete dabei auf eine Strategie, auf den perfekt geplanten Spielzug. Das Leben war kein Teamplayer, sondern zog sein bescheuertes Vorhaben ohne Rücksicht durch.
Ein qualvoller Stich bohrte sich in meinen Rücken und erschwerte mir das Atmen, sodass ich hustend nach Sauerstoff rang. Es dauerte einen Moment, bis ich mich seitlich abrollte, mich aufsetzte und meine Lungen wieder mit Luft befüllte. Aus der Ferne hörte ich Coach Tucker rufen, aber was genau er von sich gab, konnte ich nicht verstehen. Mir schwirrte der Kopf, und in meinen Ohren breitete sich ein aufdringliches, surrendes Geräusch aus. Die Zähne fest aufeinandergebissen, schloss ich die Augen und konzentrierte mich auf die Atmung. Allmählich ließ das Surren nach, und mein Kopf wurde wieder klar. Als ich die Augen öffnete, streckte mir mein Kumpel Wyatt schon seine Hand entgegen. Ich starrte auf die verletzte Stelle an seinem Unterarm. Zwischen den stark hervortretenden Adern drangen vereinzelt Blutstropfen an die Oberfläche und vermischten sich dort mit dem grünen Abrieb, der von einem Sturz rührte. Eine kleine Verletzung, kaum der Rede wert. Wenn es eine Sache gab, die beim Football eine Rolle spielte, dann war es Mut.
Keine Furcht vor einem Tackle.
Keine Furcht vor Misserfolgen.
Keine Furcht vor Verletzungen.
Das einzige Ziel bestand darin, den gottverdammten Football über die zehn Yards zu bekommen. Dafür hatte ich vier Versuche, sonst erlangte die gegnerische Mannschaft den Ballbesitz. Das Leben selbst hielt sich jedoch nicht an diese Regel, es war erbarmungslos. Ich hatte eine falsche Entscheidung getroffen und noch nicht mal einen verfluchten zweiten Versuch erhalten. Nichts. Keine weitere Chance. Da hatte kein Schiedsrichter am Seitenrand gestanden und gebrüllt: »Hey, der Junge hat noch drei Versuche!« Niemand vermochte das Leben in seine Schranken zu weisen.
Also war die Furcht zu meinem stillen Begleiter geworden, und ich hatte keinen blassen Schimmer, wie ich das dritte Jahr an der Uni, geschweige denn die neue Footballsaison überstehen sollte.
»Alles klar, Mann?« Wyatt blickte durch die Facemask auf mich herab. Seine dunklen Augen musterten mich besorgt, und ich konnte darin noch eine weitere, unausgesprochene Frage erkennen. Wyatt verlor selten die Fassung. Er war darauf programmiert, seine Gefühle zu verbergen. Manchmal war ich mir nicht sicher, ob er überhaupt irgendetwas fühlte. Mein bester Freund war eine Maschine. Diszipliniert, verlässlich und kalt. Ab und zu fragte ich mich, wie wir überhaupt Freunde hatten werden können. Aber da stand er jetzt und hielt mir weiterhin seine Hand hin. Er war für mich da. Immer. Wir konnten uns stundenlang anschweigen oder unangebrachte Witze erzählen, selbst wenn in jedem von uns ein Tornado tobte und es so vieles gab, worüber es sich zu sprechen lohnte. Wir lenkten uns gegenseitig ab, weil wir gleichermaßen kaputt waren.
»Komm schon, hoch mit dir!«, forderte er mich auf und nickte in Richtung der Menschentraube, die sich um uns gebildet hatte. »Wir wollen doch kein Aufsehen erregen.«
»Mach schon, Kolton! Du ziehst ja das gleiche Drama ab wie Hardin«, rief Toby mit einem selbstgefälligen Grinsen.
Sofort stand ich wieder auf den Beinen, stieß Wyatt zur Seite und packte Toby, der mich vorhin zu Boden gestoßen hatte, am Shirt, sodass meine Fingerknöchel weiß hervortraten. Seinen Namen aus dem Mund eines Teamkollegen zu hören war, als landete eine eiserne Faust mitten in meinem Gesicht. Sie traf mich so brutal und schonungslos, dass ich nicht mehr klar denken konnte. Adrenalin schoss durch meine Blutbahnen und entfesselte eine überwältigende Kraft, die mich diesen weit über hundert Kilo wiegenden Kerl ein paar Zentimeter vom Boden hochheben ließ. Wut und Hass dominierten mich in diesem Augenblick. Wie konnte er es wagen, Hardins Namen auszusprechen?
Ich stand kurz davor, ihn auf den Boden zu werfen und meine Fäuste auf ihn einprallen zu lassen, als ich von hinten gepackt wurde und mich mehrere Hände zurückhielten. Sie zwangen mich, Toby loszulassen.
»Kolton!«, mahnte Wyatt.
»Sofort vom Platz, Evans. Sperre für die nächsten zwei Trainingsstunden«, brüllte Tucker, dabei war seine Enttäuschung unüberhörbar. »Ich dulde keine Gewalt auf dem Feld.« Sein unerbittlicher Blick traf mich schwer. »Jetzt, sofort! Ich will dich hier heute nicht mehr sehen!«
»Fuck you!«, presste ich unüberlegt hervor und spürte, wie Tränen vor Wut in meinen Augen brannten. Der Scheißkerl wusste schließlich, dass ich keinen Tag ohne Training überstehen würde. »Fuck you!«, wiederholte ich. Hitze stieg mir vor Zorn ins Gesicht, es war schier unmöglich, auch nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen.
Jemand zog mich weg. Es war das Gewicht von Wyatt, der mich fortbrachte, um noch Schlimmeres zu verhindern. Doch ich hatte ohnehin nicht vor, auf den Coach zu hören und das Training auszusetzen. Niemand konnte mir das verbieten. Tucker konnte nicht einfach so über mein Leben bestimmen. Außerdem stand in zwei Wochen das erste Spiel der Saison an. Ich musste trainieren, um in Form zu bleiben. Die Mannschaft konnte schlecht auf ihren besten Quarterback verzichten.
Schritt für Schritt stolperte ich rückwärts. Wyatt hatte Mühe, mich vom Feld zu zerren. Abwechselnd stierte ich dabei von Toby zu Tucker. Sie konnten mir das Leben vielleicht zur Hölle machen, aber ich brannte ohnehin schon lichterloh. Anhaben konnten sie mir nichts.
»Jetzt beruhige dich endlich.«
Ich riss mich von Wyatt los, der verständnislos den Kopf schüttelte. »Was ist bloß in dich gefahren?«
»Was ist denn dein Problem?«, entgegnete ich aufgewühlt.
»Meins? Du drehst völlig durch. Toby hat einen dummen Kommentar von sich gegeben. Du weißt doch, wie es auf dem Spielfeld zugeht. Lass das nicht an dich ran.«
Ich schätzte Wyatt in vielerlei Hinsicht, aber in Augenblicken wie diesen fragte ich mich ernsthaft, warum ich überhaupt noch mit ihm befreundet war. »Er hat …« In meinem Hals bildete sich ein Kloß, mächtig und unüberwindbar. Ich schluckte einige Male, konnte ihn aber nicht beseitigen.
»Kolton, das liegt doch schon Wochen zurück.«
Seine Worte trafen mich hart. »Ich soll einfach darüber hinwegkommen? Ernsthaft?«, brachte ich mühevoll über die Lippen. Schließlich war ich mir nicht sicher, ob ich jemals mit der Schuld leben konnte. Weil ich es verhindern hätte können. Außer der Polizei kannte niemand die ganze Wahrheit über die Nacht des vierten Juli. Und jedes Jahr würde mich der Independence Day mit einem bombastischen Feuerwerk daran erinnern, welche folgenschwere Entscheidung ich an jenem Abend getroffen hatte.
Mir fehlten immer noch die Worte. Trauer hatte nun mal kein gottverdammtes Ablaufdatum. Und der Vorfall lag erst wenige Wochen zurück. Meine Leistungen als Student und Sportler waren nach wie vor herausragend. Ich büffelte in jeder freien Minute und trainierte härter als all meine Teamkollegen. Es gab keinen Grund, mir etwas vorzuwerfen, ich machte gute Miene zum bösen Spiel. Wyatt hatte also kein Recht, mir vorzuschreiben, wie ich trauern sollte. Das war allein meine Angelegenheit. Hardin und ich waren mehr als nur Brüder gewesen. Wir gehörten zusammen. Wir waren eins. Niemand konnte diesen Schmerz in mir nachempfinden.
Ich riskierte einen letzten Blick. Dann kehrte ich der brutalen Miene meines Freunds den Rücken zu, joggte über den Platz und schlug den schmalen Weg nach links ein. Wyatt rief mir hinterher, doch ich ignorierte ihn. Meine Beine trugen mich immer weiter und schneller. Die ersten Blätter raschelten unter meinen Füßen, vereinzelt flogen sie zu Boden. Der sanfte Wind ließ sie an den Ästen schaukeln. Auf eine Weise beruhigte mich das. Ich mochte den Spätsommer. Hardin hatte den Spätsommer auch gemocht. Unvermittelt versetzte mir die Erinnerung an ihn einen Stich in die Brust. Wir waren täglich gemeinsam joggen gewesen.
Ich lief weiter und steigerte das Tempo. Je härter ich trainierte, desto mehr hatte ich das Gefühl, meinen Körper zu beherrschen. Wieder zurückzufinden. Ihn zu spüren. Mich im Griff zu haben. Meine Gedanken für eine Weile kontrollieren zu können. Das Training half mir, den unsagbaren Schmerz in mir zumindest für ein paar Stunden auszuschalten.
Ohne eine Pause einzulegen, rannte ich über den Campus, durchquerte den Cambridge Common, lief an der Buchhandlung The Coop, an Cafés und Restaurants vorbei. Hin und wieder schnappte ich Wortfetzen auf oder erntete verdutzte Blicke. Es kam wohl nicht allzu häufig vor, dass ein Footballspieler mitsamt seiner Ausrüstung über das Universitätsgelände lief und dabei einen Marathon hinlegte. Meine Trikotnummer war auf dem Campus bekannt, vermutlich würden die Leute reden. Aber das spielte keine Rolle. Das Einzige, was zählte, war, den Schmerz beiseitezuschieben. Schritt für Schritt.
2
Vance
Der Campus war imposant, weitläufig und glich einer altertümlichen Stadt, was mich zugegebenermaßen überforderte. Zwar hatte ich vor meiner Ankunft in der Campus-App ein Fähnchen an die Stelle gesetzt, wo sich das Apartment befand, dennoch war ich erleichtert, als sich die brünette Frau hinter dem ausladenden Tresen einen Stift schnappte und den Weg dorthin auf einer Karte nachzeichnete. Auf ihrer Nase thronte eine Lesebrille, die an der Fassung mit einer Goldkette verbunden war. »Willkommen in Harvard«, sagte sie lächelnd.
Harvard.
»Stimmt etwas nicht?« Sie hob die Augenbrauen und musterte mich.
Um ihrem prüfenden Blick auszuweichen, sah ich mich um. Das Büro war spartanisch eingerichtet. Ein Schreibtisch aus Eiche, gepflegt und ordentlich. Ein Regal, das bis an die Decke reichte, Bücher und Ordner präzise aneinandergereiht. Es war schwer zu beschreiben, welche Wirkung der Raum auf mich ausübte. Er war farblos, aber nicht kühl.
Das war also der Ort, an dem ich studieren würde. Hinter den Mauern der ältesten Universität unseres Landes würde sich die Wahrheit verbergen. Mein Blick fiel auf das große Universitätswappen an der Wand. Veritas. So schlicht und doch so ausdrucksvoll. Die Buchstaben brannten sich in mein Gedächtnis ein. Auch ich würde mich an diesem Ort meiner Wahrheit stellen müssen.
»Doch, doch, war nur ein langer Flug«, entgegnete ich. Einen Moment beäugte sie mich noch skeptisch, dann nickte sie zufrieden. Ich verabschiedete mich, schnappte mir meinen Koffer und machte mich auf den Weg. Anders als die meisten aus meinem Jahrgang hatte ich den Campus zuvor noch nicht besichtigt. Als die Veranstaltung für zukünftige Studierende stattgefunden hatte, war ich krank gewesen. Umso aufgeregter war ich jetzt, was mich erwarten würde. Bisher kannte ich den Campus lediglich von Bildern.
Ich schritt durch den Flur, sah an den holzgetäfelten Wänden hoch und betrachtete die Gemälde im Vorbeigehen. An einem anderen Tag würde ich sie mir in Ruhe anschauen. Die Rollen meines Koffers verursachten ein Geräusch, hallten leise durch den lang gezogenen Gang, bis ich an einigen Studierenden vorbei ins Freie trat. Die Sonne war bereits untergegangen. Mein Flug hatte Verspätung gehabt, weshalb ich von Glück hatte sprechen können, den Schlüssel für das Apartment noch am späten Abend zu erhalten.
Ich zog die Campusübersicht aus der Hosentasche und warf einen kurzen Blick darauf, um mir Orientierung zu verschaffen. Der Weg führte durch den Harvard Yard direkt an einem College vorbei und war von Bäumen und Sträuchern gesäumt. Von den eindrucksvollen Backsteingebäuden war in der Dunkelheit nur wenig zu sehen. Einige Gebäude waren jedoch beleuchtet, und so gewann ich einen ersten Eindruck davon, was mich bei Tageslicht erwarten würde. Unvermittelt packte mich das Bedürfnis, die geschichtsträchtige und imposante Atmosphäre mit meiner Kamera einzufangen. Was ich auch tun würde. Aber erst einmal musste ich mich zurechtfinden, einleben und rechtzeitig in den Kursen auftauchen.
Noch wirkte der Campus mächtig, geradezu erdrückend. Vielleicht überforderte es mich aber auch, dass ich niemanden kannte und in ein fremdes Apartment zog, mit Leuten, die ich nie zuvor gesehen hatte. Das Ungewisse erzeugte eine innere Spannung in mir. In ein Studentenwohnheim direkt auf dem Campus zu ziehen war keine Option gewesen. Denn dort gab es weit mehr Menschen, denen ich lieber aus dem Weg ging. Ich war nicht introvertiert, bevorzugte aber Ruhe und einen kleinen ausgewählten Kreis von Personen um mich. Das freie Zimmer in einer WG am Rande des Campus war daher ein absoluter Glücksgriff gewesen.
In meinem Bauch kribbelte es, als ich dem roten Fähnchen auf der App näher kam und schließlich einen letzten prüfenden Blick auf die Hausnummer warf, um sicherzugehen, dass ich hier richtig war. Das Wohnhaus hob sich von den anderen ab. Es war modern, versprühte nicht diesen altmodischen Charme, wie die Gebäude, an denen ich eben vorbeigegangen war oder die man von Bildern kannte. Ich spürte das Hämmern meines Herzens, hörte, wie es wild gegen den Brustkorb schlug, während ich den Koffer über die Stufen zum Eingang schleppte, meine Schlüsselkarte zückte und vor das Lesegerät hielt. Ein Surren ertönte, und ich stemmte mein Gewicht gegen die Tür, die sofort aufsprang. Kurz atmete ich auf. Wenigstens konnte ich eine Karte lesen und der Beschreibung folgen. Für eine Sekunde verwarf ich die andauernde Frage in meinem Kopf, ob ich vielleicht doch auf Mom hätte hören sollen, die mir immer und immer wieder davon abgeraten hatte, Harvard zu wählen. Ihrer Meinung nach war Harvard eine übertrieben elitäre Einrichtung, die von alten, weißen Männern dominiert wurde. Nur allzu deutlich hörte ich ihre Stimme im Ohr und sah sie mit in die Hüften gestemmten Händen vor mir ihren Kopf schütteln, weil sie nicht nachvollziehen konnte, weshalb ich ausgerechnet hier studieren wollte. Es war ein langer und mühseliger Kampf gewesen, mich gegen ihre Ansicht durchzusetzen.
Wiederholt hatte Mom versucht, mir Harvard schlechtzureden und mich von meiner Entscheidung abzubringen. Manchmal hatte mich das Gefühl beschlichen, dass sie mich gezielt vom Lernen hatte abhalten wollen. Und das, obwohl sie gewusst hatte, wie schwer es für mich werden würde, angenommen zu werden. Ich hatte hart schuften müssen, um das geforderte Niveau zu erreichen. Es war ein ermattender Kampf gewesen, aber ich hatte ihn auf mich genommen. Denn auch wenn die Chancen zu Beginn miserabel ausgesehen hatten: Der Wille in mir war stark. Und ich wollte es so unbedingt. Aus tiefstem Herzen war ich davon überzeugt, dass ich fast alles erreichen konnte, wenn ich nur hart genug dafür arbeitete.
Sicher würden mir Steine in den Weg gelegt werden, unüberwindbare Felsbrocken, und es würde dauern, sie alle fortzuschaffen. Bestimmt würde ich dabei auf die Hilfe anderer angewiesen sein, aber ich würde nicht aufgeben, bevor ich mein Ziel erreicht hatte.
Also hatte ich gekämpft. Ungeheuerlich. Und war eine von zweitausend Personen, die es geschafft hatten und in Harvard zugelassen worden waren. Zudem hatte ich das Glück, dass Mom die Studiengebühren stemmen konnte, denn für eines der wenigen Stipendien, die Harvard vergab, waren meine Leistungen dann doch zu schlecht.
Mein neues Zuhause befand sich im vierten Stock. Als ich mit zitternder Hand den Knopf drückte, um den Aufzug zu rufen, schlug mir das Herz bis zum Hals. In wenigen Sekunden würde ich meinen Mitbewohnern gegenüberstehen. Was, wenn sie mich nicht ausstehen konnten oder ich sie nicht mochte? Was, wenn es eine bescheuerte Idee gewesen war, nicht in das Studentenwohnheim zu ziehen? Mom hatte mir die Wahl überlassen. Sie war Hauptdarstellerin in einer angesagten Sitcom, die im kommenden Frühjahr in die vierte Staffel ging, und so besaß ich das Privileg, selbst zu entscheiden, wo ich wohnen wollte. Geld spielte bei uns eine untergeordnete Rolle, auch wenn Mom es nie zum Fenster rauswarf und weiterhin auf eine Reinigungskraft verzichtete. Der Luxus einer gefeierten Schauspielerin beschränkte sich in unserem Fall auf Personenschutz und ein Sicherheitssystem. Und egal wie viel Geld sie verdiente, vermutlich würde sie sich niemals von der alten Ledercouch trennen, die Grandma ihr zum Studienabschluss geschenkt hatte. Mom war genügsam.
»Warte!«, rief plötzlich jemand, und ich steckte gerade noch rechtzeitig meinen Fuß zwischen die Tür. »Hey, danke.« Lächelnd schlüpfte eine junge Frau mit mandelförmigen Augen in den Aufzug. Mit einer unfassbar einnehmenden Aura strahlte sie mich an. Fast so wie Taylor Swift, wenn sie eine Bühne betrat. »Ich bin leider nie pünktlich, und weil du auf mich gewartet hast, spare ich jetzt zumindest eine Minute Verspätung ein.« Ihre brünetten Haare reichten weit über ihre Schultern. Sie trug ein dezentes Make-up, ihr Outfit erinnerte allerdings ein bisschen an das eines It-Girls. »Lass mich raten, Freshman?«
Sie sprach ohne Punkt und Komma. Ihre Stimme klang weich und doch charismatisch. Sie erinnerte mich an die Sprecherin eines Hörbuchs, das ich im Sommer gehört hatte.
»So offensichtlich?«, warf ich ein, ehe sie die nächste Frage stellen konnte, die bestimmt schon auf ihrer Zunge brannte.
»Ein bisschen. Ich kann deine Angst förmlich riechen.« Sie zog die Nase kraus, beugte sich ein Stück weit in meine Richtung und roch an mir. »Harvard ist anspruchsvoll, aber nicht so schwierig, wie man denkt.«
»Das beruhigt mich … kein bisschen.« Ich schüttelte den Kopf, spürte aber deutlich, wie meine Mundwinkel zuckten. Die Unbekannte schenkte mir ein mitfühlendes Lächeln, bevor wir gemeinsam den Aufzug verließen.
Ein langer Flur erstreckte sich vor uns, und vermutlich verriet mein ahnungsloser Gesichtsausdruck, dass ich keinen Schimmer hatte, ob ich nach links oder rechts musste.
»Welche Apartmentnummer suchst du?«, erkundigte sie sich.
»Fragst du fremde Männer immer, wo sie wohnen?«
Sie verengte die Augen. »Nur die, die besonders gut aussehen und ein bisschen verloren wirken.« Dann zwinkerte sie und stieß ihren Oberarm gegen meinen. »Lass mal sehen.«
»Na gut, danke.« Ich gab mich geschlagen und hielt ihr den Mietvertrag mit der Apartmentnummer hin. Sie warf einen kurzen Blick darauf und starrte mich dann einen langen Moment an. Sie blinzelte. Einmal. Zweimal.
Das Licht im Flur erlosch, und so standen wir uns im Dunkeln gegenüber. Ich hatte keinen Schimmer, was gerade vor sich ging oder ob ich etwas falsch gemacht hatte. Aus einem Apartment in unserer Nähe drangen dumpfe Bässe, ansonsten war es totenstill. »Stimmt etwas nicht?«
Im schwachen Licht der Notausgangsschilder konnte ich erkennen, wie sie mich mit großen verwunderten Augen ansah. Dann kehrte das Lächeln auf ihre Lippen zurück. »Wow, nein. Ich bin nur … überrascht. Du bist also Vance?«, fragte sie ungläubig.
»Bist du meine Mitbewohnerin?« Ich war irritiert, meines Wissens teilte ich mir eine Wohnung mit drei Typen: Aiden, Kolton und Wyatt. Wir hatten schriftlich kommuniziert, und mit Aiden hatte ich sogar ein Skypegespräch geführt.
Das Licht ging genau in dem Moment an, als sie mir die Hand reichte. »Ich bin Haisley und wohne im Apartment gegenüber. Freut mich, wir werden uns blendend verstehen und bestimmt viel Zeit miteinander verbringen. Du passt hervorragend zu den Jungs, ihr könntet die neuen Elevator Boys werden«, plapperte sie, als wäre der Moment eben keineswegs eigenartig gewesen. »Ich hatte mir unser Kennenlernen einfach nur anders vorgestellt. Was für ein Zufall, dass wir uns bereits im Aufzug begegnet sind und ich dich vor den anderen kennenlernen konnte.« Ihr Blick fiel auf meinen Koffer, ehe sie wieder aufsah und quiekte. »Wie aufregend.«
Mit ihrer überschwänglichen Art überforderte sie mich etwas. »Freut mich auch. Und wie du jetzt ja schon weißt, bin ich Vance«, erwiderte ich und rang mir ein Lächeln ab, das meine Nervosität hoffentlich kaschierte. Ich hatte nämlich keine Ahnung, wer oder was diese Elevator Boys sein sollten.
»Komm, ich zeig dir, wo du wohnst. Allerdings steigt dort gerade eine Party, mach dich also auf einen turbulenten ersten Abend gefasst«, bemerkte sie und schritt lächelnd voran.
Eine Party bei meiner Ankunft. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es war nicht so, dass ich Partys grundsätzlich verabscheute. Aber an meinem ersten Abend hätte ich Ruhe bevorzugt. Immerhin hatte ich mich genau deshalb gegen ein Wohnheim entschieden. Außerdem hatte ich gehofft, meine Mitbewohner erst richtig kennenzulernen, bevor wir gemeinsam auf dem Boden hockten und Trinkspiele spielten. Okay, das hier war Harvard. Vermutlich spielte hier niemand Trinkspiele.
In mir breitete sich zunehmend Nervosität aus, während ich Haisley folgte und wir der Musik näher kamen. Wenige Schritte später hielten wir vor einer Tür, und ich war erstaunt, dass Haisley wie selbstverständlich einen Code eintippte, um die Tür zu öffnen.
»Keine Sorge. Ich habe nicht vor, nachts an deinem Bett zu sitzen und dir beim Schlafen zuzusehen.« Sie zwinkerte frech.
»Padam Padam« von Kylie Minogue war jetzt in voller Lautstärke zu hören. Plötzlich brachen all die Zweifel und Ängste über mich herein, die ich bisher erfolgreich unterdrückt hatte. Es war, als leerte jemand einen Kübel glühender Kohle über mich. Meine Wangen brannten, und auf meiner Stirn bildeten sich erste Schweißtropfen – jedenfalls fühlte es sich so an. Die Hitze machte es mir unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich hatte Kalifornien verlassen, meine vertraute Umgebung, die mich so akzeptierte, wie ich war. Was, wenn die Leute hier anders tickten? Plötzlich hatte ich furchtbare Angst, mich für etwas rechtfertigen zu müssen, wofür ich nicht verantwortlich war. Schließlich konnte man sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebte. Es war ein Gefühl. Nein, es war mehr als das. Es war meine Identität. Nichts, was ich beeinflussen oder abstellen konnte. Und es gab keinen Ausweg: Alle Studentenheime und auch alle Wohngemeinschaften, die ich angeschrieben hatte, waren nach Geschlechtern aufgeteilt.
Doch dann konzentrierte ich mich auf die Musik, und allmählich fiel die Anspannung von mir ab. Vielleicht war es naiv, aber wenn sie diesen Song hörten, konnten meine neuen Mitbewohner doch keine homophoben Idioten sein. Im Gegenteil, die Chancen standen sogar gut, dass sie cool waren. Immerhin bewiesen sie Musikgeschmack.
»Jetzt macht endlich diese schwule Musik aus!«, lallte eine tiefe und sehr betrunkene Stimme. Die Worte trafen mich hart und ließen mich innerlich erstarren. Ich spürte förmlich, wie sich jeder Muskel meines Körpers anspannte und das lähmende Empfinden von eben zurückkehrte. Sogar mein Magen zog sich auf eine beklemmende, fast schon schmerzhafte Weise zusammen. Ich bemühte mich, mein Entsetzen vor Haisley zu verbergen. Solche Aussagen schmerzten. Immer. Aber das würde ich nicht preisgeben. Denn wenn ich das tat, bot ich umso mehr Angriffsfläche. Ich musste stark sein. Für mich.
»Das war dein Mitbewohner Wyatt«, bemerkte sie seufzend und sichtlich genervt. »Eigentlich ist er cool.«
»Und uneigentlich?«, hakte ich nach, als ich mich einigermaßen gefangen hatte.
Sie schürzte die Lippen. »Kann er sich echt danebenbenehmen.«
Na super, dann blickte ich ja einer wunderbaren Zeit mit Wyatt entgegen. Ich hatte nicht vor, meine Homosexualität zu verbergen. Aber es war auch nicht das Erste, was ich über mich erzählte. Warum auch. Niemand, der heterosexuell war, lief den ganzen Tag herum und verkündete das laut. Und auch wenn mich solche Aussagen verletzten, wusste ich, dass nichts, rein gar nichts an mir verkehrt war. Trotzdem setzte es mir jedes Mal zu, wenn ich solchen Kommentaren ausgesetzt war. Ich fühlte mich dann seltsam nackt und angreifbar. Was absurd war, weil ich es eigentlich besser wusste. Aber … so sah es nun mal in mir aus.
Im Flur standen einige Leute rum, die Haisley begrüßten. Ich kam mir völlig fehl am Platz vor. »Und das ist Vance. Er …« Sie schluckte schwer, und ihre strahlende Miene verhärtete sich. »Er wohnt jetzt hier«, sagte sie nach einer kurzen Pause und in einem seltsamen Tonfall. Ihr Blick wirkte erschöpft. Vielleicht sogar traurig. Haisley verhielt sich merkwürdig, von der einen auf die andere Minute änderte sich ihre Stimmung. So ganz schien sie die neue Wohnsituation hier wohl noch nicht fassen zu können.
Ich hob die Hand, rang mir ein Lächeln ab und gab das beste »Hey« von mir, das mein Kehlkopf in diesem Moment hervorbringen konnte. Woher auch immer diese Unsicherheit plötzlich kam. Eigentlich war ich nicht schüchtern oder zurückhaltend. Dennoch gefiel mir die Situation gerade kein bisschen. Inmitten des Flures, umzingelt von feiernden Studierenden, stand ich mit meinem Gepäck und wusste noch nicht mal, wo sich mein Zimmer befand. Abgesehen davon, dass ich keine Ahnung hatte, wer meine restlichen Mitbewohner waren.
Wyatts unverkennbar betrunkene Stimme übertönte erneut die Musik. Abermals protestierte er, als Lady Gagas Born This Way aus den Boxen drang.
»Wyatt! Es ist nur Musik. Du wirst davon nicht gleich über den nächsten Kerl herfallen«, brüllte Haisley, und ich zuckte zusammen, weil ihre Wut in jeder Silbe hörbar war. »Idiot«, schimpfte sie. »Komm.« Sie fasste nach meinem Unterarm. Wir schlängelten uns an einigen Partygästen vorbei, und ich hatte Mühe, meinen Koffer hinterherzuziehen, ohne jemandem damit über die Füße zu fahren. »Das hier ist dein Zimmer.« Sie deutete auf die Tür zu unserer Rechten.
Ich war erleichtert, dass sie mich nicht dem Schicksal überlassen hatte. »Danke.«
»Kommst du gleich wieder raus? Es wird lustig. Versprochen.« Sie setzte ein sonniges Lächeln auf, zeigte ihre weißen geraden Zähne und wirkte dabei wie ein Kind, das seine Eltern um einen Gefallen bat.
»Mal sehen.« Ich erwiderte ihr Lächeln und öffnete die Tür. Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, dass sie eine schmollende Schnute zog, was mich noch breiter grinsen ließ. Ich kannte Haisley erst seit ein paar Minuten, aber ich hatte so ein Gefühl, dass wir uns wirklich blendend verstehen würden. Sie war ein bisschen durchgedreht, aber im Grunde schien sie sehr sympathisch zu sein.
Erleichtert atmete ich durch und lehnte mich mit dem Rücken an die geschlossene Tür. Endlich ein Moment für mich. Das Zimmer war möbliert. Aber mich irritierte die Unordnung auf dem Boden. T-Shirts und Boxershorts lagen verstreut herum. Schulterschützer und ein Helm. Dann fiel mein Blick auf das Bett. Plötzlich war mir klar, dass es sich um ein Missverständnis handeln musste. War Haisley doch nicht so nett, wie sie vorgab? Hatte sie mich vorsätzlich in ein falsches Zimmer gelotst, um sich einen Spaß zu erlauben? Dann setzte mein Herz einige Schläge aus und kam ganz zum Stillstand.
Stechend grüne Augen. Schwarzes Haar, das ihm in feuchten Strähnen in die Stirn fiel. Eine nahezu perfekte, gerade Nase. Ein Bartschatten, der sein markantes Kinn verbarg. Vor mir stand ein unglaublich gut aussehender Mann. Komplett nackt. Wie Gott ihn schuf. Und sein Blick war … roh und brutal. Wütend. Ohne es beeinflussen zu können, glitt mein Blick über die breiten Schultern weiter zu seiner gestählten Brust bis zu den Bauchmuskeln, die ausgeprägt hervortraten, und unausweichlich zu seinem …
»Was hast du hier zu suchen?«, wetterte er, schnappte sich rasch ein Handtuch und schlang es sich um die Hüften. Was ich zugegebenermaßen schade fand. Gott, sein Penis war der schönste, den ich je gesehen hatte. Ich starrte immer noch auf die Stelle, die er nun verdeckt hatte, studierte die Partie unter seinem Bauchnabel, die sich seitlich zu einem V formte. Bis mich ein hektisches Fingerschnippen vor meinem Sichtfeld aus diesem erbärmlichen Zustand befreite. »Na, gefällt dir, was du siehst? Sieht so aus, als würdest du gleich anfangen zu sabbern.«
Ich blinzelte und gewann langsam die Kontrolle über mein Verhalten wieder. »Mir wurde gesagt, dass das mein Zimmer ist«, gab ich nicht ganz so locker von mir, wie ich es mir gewünscht hätte.
»Das befindet sich nebenan«, blaffte er, und seine Augen verengten sich. Das Grün darin verschwand beinahe. Dennoch brannte sich sein Blick in mich. Roh. Brutal. Wütend.
Es dauerte einen Augenblick, bis ich mich einigermaßen gefangen hatte und meine Sprache wiederfand. »Entschuldige die Störung.« Ich hatte die Möglichkeit, sofort aus dem Zimmer zu verschwinden. Das Richtige zu tun. Ihm seine Privatsphäre einzuräumen. Doch etwas Unerklärliches hielt mich zurück. Und ich konnte es mir wenn, dann nur damit erklären, dass ich den Verstand verloren hatte. Immerhin war der Kerl einen Kopf größer als ich, hatte viel mehr Muskeln und somit Kraft, mir wehzutun. Offenbar hing ich seit ein paar Minuten nicht mehr an meinem Leben. Als hätte mich meine Ankunft in Harvard mutig gemacht. Zu einem Adrenalinjunkie. Denn statt mich zu rühren, starrte ich ihn einfach nur weiterhin an. Ich war offensichtlich völlig verrückt geworden und konnte nur hoffen, dass mir der Sabber nicht aus den Mundwinkeln tropfte.
»Das wäre jetzt der geeignete Moment, um mein Zimmer zu verlassen«, schlug er vor. Und dabei verschwand auf einmal die unbändige Wut aus seinem Blick. Ich glaubte sogar, ein amüsiertes Schmunzeln zu erkennen. »Das hier ist nämlich mein Zimmer.«
Dass ich in seinen einnehmenden Augen versank, war an sich nicht weiter schlimm. Allerdings schien es auch ihm aufzufallen, was bedeutete, dass es … vermutlich doch schlimm war.
Er hob eine Augenbraue, und das Schmunzeln zeichnete sich inzwischen deutlich auf seinen Lippen ab. Ich hatte mich also nicht geirrt. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, dass mir sein Blick weiche Knie bescherte. Was völlig absurd war, weil wir uns nicht einmal kannten. Er war ein Fremder. Ein gut aussehender Fremder. Nichts weiter. Na ja … und mein sehr attraktiver Mitbewohner, was womöglich nicht ganz so vorteilhaft für unser Zusammenleben war.
»Ich bin Vance und wohne dann wohl … nebenan.«
»Kolton«, erwiderte er schlicht und bedachte mich weiterhin mit diesem Gesichtsausdruck, der meine Gehirnaktivitäten einschränkte. Das war neu. Seit ich denken konnte, stand ich auf Jungs. Aber dass mich jemand beinahe sprachlos machte, das war bisher noch nie geschehen.
»Tut mir leid, dass ich in dein Zimmer gecrasht bin«, murmelte ich und schaffte es endlich, mich von ihm abzuwenden. Ich drehte den Knauf und warf noch einen schnellen Blick über die Schulter. »Und dass ich deine Privatsphäre nicht respektiert habe.« Auch wenn ich den Anblick genossen hatte, war mir bewusst, wie falsch es gewesen war, ihn anzustarren. Als wäre er ein saftiger Brownie. Gott, ich liebte Brownies.
»Wohl eher gestarrt und gesabbert wie ein Welpe, der nicht genügend zu fressen bekommt.«
Schuldig seufzte ich. Dem konnte ich nichts entgegnen. Mein Verhalten war alles andere als korrekt gewesen.
»Tja, ich muss zugeben, dass mir gefallen hat, was ich gesehen habe.« Und als ich begriff, wie verkehrt das schon wieder klang, ruderte ich auf eine bedauernswerte Weise zurück. »Ich werde zukünftig keine nackten Männer mehr einfach so anstarren. Also … schon. Also, nein! Das war jetzt auch wieder falsch. Ich werde nur die ansehen, die mir ausdrücklich die Erlaubnis dazu erteilen. Äh … nicht die Schwänze, die können ja nicht sprechen. Also … ich werde die Personen um ihr Einverständnis bitten.« So daneben, wie ich drauf war, wünschte ich mir dringend jemanden herbei, der mich aus dieser schrecklich peinlichen Situation befreite.
Wo war nur dieser verdammte Flaschengeist, wenn man ihn einmal brauchte? Ich hatte als Kind wohl zu oft Aladin geguckt. Das passierte also, wenn man in Hollywood aufwuchs. Aber das, was in diesen Sekunden geschah, war das reale Leben. Niemand würde verhindern können, dass mich Kolton, mein Mitbewohner, dessen Penis ich eben aufmerksam studiert hatte, das ganze Semester hassen und mit verächtlichen Blicken strafen würde. Es war ihm nach diesem Kennenlernen kaum zu verübeln, und am Ende hatte ich es vermutlich sogar verdient.
3
Kolton
Sanfte Celloklänge ließen mich aus dem Schlaf erwachen. Penetrant mischten sie sich unter die Klaviertöne, die durch die Wand drangen. Sie erinnerten mich an einen Moment in meinem Leben, an dem ich vollkommen machtlos gewesen war. Verloren. Die Beerdigung meines Bruders.
Die leise Musik katapultierte mich um Wochen zurück, schien sich an meinem Gehörgang festzusaugen. Wie eine Zecke, die zugebissen hatte und sich an mir labte. Ein Parasit.
Noch im Bett liegend, befand ich mich längst im freien Fall.
Ohne Halt. Ohne Boden.
Es war endlos.
Ich fühlte mich, als hätte ich eben erst in den Schlaf gefunden. Die Lider schwer, die Beine müde. Mit geschlossenen Augen tastete ich nach dem Handy und stieß mit dem Handgelenk gegen das Holz des Nachttischs. Der Schmerz schoss hoch bis in die Schulter. Verdammt. Was für ein beschissener Morgen. Endlich fand ich mein Smartphone. Das qualvolle Pochen, das sich über meinen Arm ausdehnte, ließ allmählich nach, und ich erhaschte einen Blick auf das Display. Es war kurz vor acht. Meine Vorlesung würde erst um elf beginnen, ich hatte gerade mal drei Stunden geschlafen und war völlig erledigt.
Genervt ließ ich das Handy auf die Decke fallen und drehte mich zur Seite. Mein Schädel brummte, was bestimmt den Gläsern Gin Tonic geschuldet war. Gestern hatte die erste Party des Semesters in unserem Apartment stattgefunden. Wyatt ließ es sich nicht nehmen, solche Partys zu organisieren. So fanden sich einmal im Monat mehrere Kommilitonen zu einem feuchtfröhlichen Beisammensein in unseren vier Wänden ein. Und ich hatte eindeutig zu viel getrunken. Während sich die klassische Musik gemischt mit obszön meditativen Klängen in mein Gehirn bohrte, dehnte sich das nervtötende Dröhnen in meinem Kopf weiter aus. Von der Stirn ausgehend bis zum Hinterkopf, wo meine Nervenbahnen hinterhältige kleine Pfeile abfeuerten und es von Sekunde zu Sekunde unerträglicher wurde.
Fuck! Jetzt erinnerte ich mich wieder an die Auseinandersetzung beim gestrigen Training. Daran, dass ich über den gesamten Campus gejoggt war. Kurzerhand beschlossen hatte, mein Zimmer zu tauschen, ohne es vorher mit meinen Mitbewohnern zu besprechen. An Vance, der mich angestarrt hatte, als wäre ich ein Geschenk, das jemand vor seinen Augen ausgepackt und auf den Präsentiertisch gelegt hatte. Dass ich daraufhin unzählige Gin Tonics gemixt hatte, um sie anschließend zu exen. An Haisley, die ich geküsst hatte und deren Lippen sich weich angefühlt hatten, nach Vanille rochen. Danach konnte ich mich an nichts mehr erinnern.
Irgendwann hatte ich mich zurückgezogen. Sehr betrunken und allein. Zumindest ging ich davon aus. Wäre es anders gekommen, läge ich jetzt nicht in meiner Jeans im Bett, die sich äußerst unangenehm auf meiner Haut anfühlte.
Ich brauchte dringend eine kalte Dusche.
Schon wieder dieses Cello. Und dann mischte sich auch noch Vogelgesang darunter. Die Musik trieb mich in den Wahnsinn. In meinen Beinen und Armen kribbelte es, als liefen Tausende Ameisen durch meine Venen. Ich ballte meine Hände zu Fäusten und bewegte meine Füße. Kurz stellte sich eine Besserung ein. Doch dann drangen die Klänge wieder aufdringlich in meine Ohren, und das marternde Kitzeln kehrte zurück. Für einen Augenblick überkam mich der unbändige Wunsch, mir die Haut vom Körper zu reißen. Ich konnte es nicht in Worte fassen, aber die Wut in mir fraß mich buchstäblich auf.
Es war nur Musik, und sie drang noch nicht mal allzu laut aus dem Nebenzimmer. Trotzdem störte sie mich. Wie eine Plage von Mücken, die einen schmalen Spalt gefunden hatten und nun allesamt auf mich losgingen.
Ein letztes Mal spannte ich meine Muskeln an, und das Kribbeln löste sich auf. Aber sobald ich locker ließ, war es zurück. Fuck!
Aus welchem Grund mein neuer Mitbewohner zu solchen Foltermethoden griff, war mir ein Rätsel. Ich konnte nicht nachvollziehen, weshalb er sich bereits am ersten Morgen dermaßen unbeliebt machen wollte. Wyatt und Aiden konnten diesen Klängen bestimmt genauso wenig abgewinnen wie ich.
Energisch warf ich die Decke zurück und holte kräftig Luft, aber als ich meine Füße auf den Boden stellte und schließlich auf die Beine kam, erfasste mich ein so starker Schwindel, dass ich schwankte. Ich massierte meine Schläfen und schleppte mich ins Badezimmer. Die Musik aus dem Nebenzimmer war immer noch zu hören.
Es war nervtötend.
Meine Hände zitterten leicht, als ich endlich meine Jeans öffnete und sie abstreifte. Als Nächstes schlüpfte ich aus meinen Boxershorts und stellte die Dusche an. Den Regler hatte ich wie immer auf kalt gestellt. Seit Wochen waren dies die wenigen Minuten am Tag, in denen ich den Schmerz selbst regulieren konnte.
Wie klitzekleine Nadelstiche prasselte das kalte Wasser auf meine Brust und floss weiter über den Bauch. Ich drehte mich um, stellte mich mit dem Rücken unter den Strahl. Während mein Herz wild pochte, genoss ich das einmalige Gefühl, meinen Gedanken zu entfliehen. Abgesehen von der Zeit auf dem Feld, wenn ich mich auf das Spiel oder Training fokussierte, war das der Augenblick, der mir eine Auszeit bot. Ein Time-out von meinen schmerzhaften Erinnerungen. Wenn ich den Ball unter den Arm klemmte und versuchte, einen Touchdown zu erzielen, vergaß ich alles andere. Diese Momente gehörten ausschließlich mir, und niemand konnte sie mir nehmen. Coach Tucker konnte mir das Training nicht verbieten. Immerhin war ich sein bester Mann auf dem Footballfeld.
Ich stand lange unter der Dusche, bevor ich sie abstellte und zurück in die Realität kehrte.
Die Musik war immer noch zu hören. Meine Kopfschmerzen hatten sich inzwischen gelegt, und auch das Schwindelgefühl war glücklicherweise verschwunden. Aber die Wut war geblieben. Weshalb ich mich rasch abtrocknete, in eine Jogginghose schlüpfte, mein Zimmer verließ, beinahe über meine Kleidungsstücke, die ich gestern achtlos zu Boden geworfen hatte, stolperte und energisch an Vance’ Tür klopfte.
Als nach einer halben Minute, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte, immer noch nichts geschah, wiederholte ich mein Hämmern. Dann verharrte ich. Es verging eine weitere Minute. Sollte ich seine Privatsphäre vielleicht doch respektieren? Mir war bewusst, dass ich gleich eine Grenze überschreiten würde. Aber eine höhere Macht in mir entschied sich dafür, die Tür unaufgefordert zu öffnen.
Eigentlich rechnete ich damit, dass Vance mir irgendetwas an den Kopf werfen würde. Doch stattdessen herrschte Stille im Zimmer, bis auf diese verdammten Klänge, die weiterhin aus den Boxen drangen. Der Geruch eines Räucherstäbchens, holzig und süß, gelangte in meine Nase. Mein Blick huschte zum Bett, das ordentlich aussah, als hätte er nie darin gelegen. Dann entdeckte ich ihn. Er lag auf einer Yogamatte, die er auf dem Boden ausgebreitet hatte. Gesenkte Lider. Ein friedvoller Gesichtsausdruck. Beinahe, als würde er schlafen. Seine Beine waren leicht gespreizt, die Handflächen nach oben gerichtet.
Tief in mir brodelte es. Zorn sammelte sich in meiner Brust und dehnte sich dort immer breiter aus. Ignorierte Vance mich etwa bewusst?
Nur wenige Schritte später war ich beim Lautsprecher angekommen und zog den Stecker. Sofort verstummte das Teil, und es war mucksmäuschenstill. Ich trat zurück von der Anrichte und steuerte direkt auf Vance zu, der nach wie vor auf dem Boden lag und unfassbar entspannt wirkte. Auf Höhe seines Kopfes hielt ich an, sah auf ihn hinab und überlegte, ob er mich gerade reinlegte. Es konnte doch unmöglich wahr sein, dass er einfach auf dem Boden lag und seelenruhig schlief.
»Deine Revanche wegen gestern?«, fragte er mit sanfter Stimme und öffnete die Augen. Ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals so graue Augen an einem Menschen gesehen zu haben. Die Farbe ließ mich nicht los, hielt mich gefangen.
Bei unserer ersten Begegnung gestern war mir das nicht aufgefallen. Vielleicht, weil jetzt Sonnenstrahlen durchs Fenster und teilweise auf sein Gesicht fielen. Es war merkwürdig, die Augenfarbe eines Mannes zu bewundern. Und doch musste ich mir eingestehen, dass sie mich faszinierte. »Und gerade starrst du mich an, wir sind sozusagen quitt.« Er grinste jungenhaft.
Ich blinzelte und trat einen Schritt zurück. »Weil ich überrascht bin, dass du lebst. Immerhin habe ich nicht nur ein Mal an die Tür geklopft.«
»Jetzt bist du ja hier. Womit kann ich dir helfen?« Er setzte sich auf und richtete seinen erwartungsvollen Blick auf mich.
Tatsächlich benötigte ich einen Augenblick, um mich daran zu erinnern, weshalb ich überhaupt in sein Zimmer gekommen war. Die Situation war seltsam. Ich kannte niemanden, der sich freiwillig auf den Boden legte, um dort zu verweilen und dabei scheußliche Musik zu hören. Wyatt und Aiden bestimmt nicht. Es wunderte mich, dass die beiden hier nicht eher aufgeschlagen waren. Aber ihre Zimmer lagen gegenüber, vermutlich wurden sie von dem Sound nicht so stark gestört wie ich.
»Diese Musik, das muss aufhören.«
Vance schmunzelte. »Die kannst du doch unmöglich hören.«
»Und weshalb stehe ich dann um diese Uhrzeit hellwach in deinem Zimmer?« Ich verschränkte die Arme vor der Brust und betrachtete ihn. Er trug eine schwarze Baumwollhose und ein Tanktop. Man konnte sehen, dass er auf seinen Körper achtete und regelmäßig Sport trieb.
»Bei allem Verständnis, selbst wenn du sie hören konntest, das ist Meditationsmusik, davon wirst du höchstens ruhiger oder schläfst länger«, hielt er dagegen, während er sich erhob.
»Das muss aufhören«, forderte ich erneut und riskierte dabei einen Blick in seine grauen Augen. Hauptsächlich, um klarzustellen, dass er sich gefälligst daran zu halten hatte.
»Kolton, nicht wahr?« Er grinste unverschämt breit. Beinahe herausfordernd. Er hatte etwas Spitzbübisches an sich, und obwohl er kleiner war als ich, wirkte er dennoch maskulin.
Dass er vorgab, meinen Namen nicht zu kennen, machte mich rasend. So zu tun, als wüsste er nicht, wer ich war, war lächerlich. Vor allem nach unserem unglücklichen Zusammentreffen gestern. Ich nahm ihm keineswegs ab, dass er seine neuen Mitbewohner vor dem Einzug nicht gegoogelt hatte. Das tat doch jeder, verdammt.
Es fiel mir schwer, ein Schnauben zu unterdrücken. »Du weißt ganz genau, wer ich bin.«
Vance hob eine Augenbraue und trat einen beachtlichen Schritt auf mich zu. Trotz seiner muskulösen Arme war er wesentlich schmaler als ich, aber das schien ihn nicht davon abzuhalten. Dass ich ihn körperlich überragte, schüchterte ihn offenbar nicht ein, zumindest ließ er es sich nicht anmerken.
»Ihr seht eben alle gleich aus.«
»Wir?« Ich spürte, wie sich mein Kiefer anspannte. Worauf legte er es an? Ich musste dringend mit Aiden sprechen, denn er hatte sich um die Bewerber für das freie Zimmer gekümmert. Ich war ohnehin dagegen gewesen, einen Mitbewohner zu suchen. Der Gebäudekomplex wurde jedoch von der Universität verwaltet, weshalb ich nichts dagegen unternehmen hatte können. Die Fakultät hatte darauf bestanden, dass das Zimmer vergeben werden musste. Es war eines der wenigen Häuser, in denen Studenten aus verschiedenen Fakultäten und Jahrgängen zusammenlebten. Dementsprechend teuer war es auch. Die Freiheit musste man sich sozusagen erkaufen.
Seinem breiten Grinsen nach zu urteilen, machte er sich über mich lustig. »Footballspieler.«
Und diese unverblümte und oberflächliche Feststellung brachte mich doch tatsächlich zum Lachen. »Solltest du mit solchen Aussagen nicht umsichtiger sein?«, forderte ich ihn heraus, nachdem ich mich gefasst hatte.
Er zuckte mit den Schultern und lenkte ein. »Der Punkt geht dann wohl an dich«, sagte er gönnerhaft.
»Dir ist bewusst, dass Wyatt ebenfalls spielt, oder?«
Sein Mundwinkel zuckte auf eine unverschämte Weise. »Ach was? Jetzt, wo du es sagst.« Sein Grinsen dehnte sich weiter aus.
Keine Ahnung, ob es an der Musik von vorhin lag, aber etwas an ihm nervte mich. Vielleicht war es die Art, wie er grinste. Seine mystischen grauen Augen. Womöglich lag es auch daran, dass er mich an Peter Parker erinnerte. Ich hatte Spider-Man noch nie leiden können. Ein Superheld, der von einer Spinne gebissen wurde. Was für ein Schwachsinn.
»Okay, Spider-Man. Die Sache mit der Musik haben wir geklärt. Also hör lieber auf damit!«, beharrte ich und bedachte ihn mit einem ernsten Blick.
»Spider-Man?« Er gluckste.
Sein Verhalten war nervtötend und das, obwohl er noch nicht mal einen Tag hier wohnte. Aber es machte in diesem Moment wenig Sinn, mich länger mit ihm zu unterhalten, weil er immer noch ungerührt vor sich hin grinste und mich nicht ernst zu nehmen schien. Seufzend löste ich die Arme vor der Brust und trat den Rückzug an.
»Für dich bin ich also ein Superheld?«
»Antiheld. Spider-Man ist ein Superheld für kleine Mädchen«, konterte ich und hielt in der Bewegung inne. Sein Blick brannte auf meinem Rücken. Sekunden wurden zu Minuten. Das Schweigen zwischen uns war unangenehm. Woher kam dieser Kommentar von mir bloß? Vielleicht von seinem Gesichtsausdruck, als er mich gestern nackt gesehen hatte. Ich ahnte, dass ich ihn mit der Aussage gekränkt hatte. Unser Start war nicht gerade gut verlaufen, aber ich hatte nicht vor, mir meinen Zimmernachbarn zum Feind zu machen. Außerdem wollte ich ihn nicht persönlich angreifen und beleidigen. Das war auf so vielen Ebenen falsch. Selbst wenn ich ihn nicht sonderlich leiden konnte.
Ich wandte mich ihm zu. »Vance, hör zu …«
Abwehrend hob er die Hand. »Schon gut.« Sein Lächeln war verschwunden, sein Blick wirkte abwesend, und das Grau in seinen Augen war verblasst, als hätte sich eine Nebelschicht darübergelegt. Sein Gesichtsausdruck war nicht wütend, eher zeichnete sich Enttäuschung darauf ab.
»Das war nicht so gemeint, wie es klang«, wagte ich einen Versuch.
»Das ist es doch nie, nicht wahr?«
Seine Worte trafen mich unvermittelt. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Ein Zitat aus dem Talmud, das mein Bruder häufig wiederholt hatte, kam mir in den Sinn. Ich hörte seine Stimme, als hätte er neben mir gestanden und sie mir in mein Ohr geflüstert. Ein kalter Schauder rieselte mir über den Rücken, und meine Härchen an den Armen stellten sich auf. Es war absurd, aber für den Bruchteil einer Sekunde war er gegenwärtig.
Ich verließ Vance’ Zimmer und stieß auf dem Flur mit Haisley zusammen. »Hey«, sagte sie verstohlen und steckte sich eine lose Haarsträhne hinters Ohr.
»Sorry.« Ich legte meine Hände seitlich an ihre Oberarme und musterte sie. »Alles in Ordnung?«
Sie kicherte. »Ja, alles gut.«
»Haisley, du bist ein Schatz!«, rief Wyatt aus dem Wohnzimmer. »Blitzeblank!«
»Was meint er? Ich bin eben erst zur Tür rein.«
Neugierig schritten wir ins Wohnzimmer und stellten anerkennend fest, dass es noch nicht mal bei unserem Einzug vor zwei Jahren so tadellos sauber ausgesehen hatte. »Ich war das nicht«, sagte sie und sah sich verwirrt um.
Gelassen nahm Wyatt einen Schluck von seinem Kaffee. »Keine falsche Bescheidenheit.« Er stellte die Tasse auf den Tresen, der die Küche vom Wohnzimmer trennte, und ließ sich auf den Barhocker sinken.
Haisley lachte auf. »Ich war das wirklich nicht.«
Wyatt warf mir einen fragenden Blick zu. »Mich musst du gar nicht erst anschauen.« Wer auch immer dafür verantwortlich war, musste noch früher wach geworden sein als wir. Und das war fast unmöglich, denn für die lange Partynacht, die hinter uns lag, waren wir alle ohnehin schon früh auf den Beinen.
In dem Moment stieß Vance zu uns, fischte eine Tasse aus dem oberen Schrank, goss Kaffee ein und lehnte sich gegen die Kücheninsel. Er vermittelte den Eindruck, als lebte er schon eine Weile hier. Ich war beeindruckt davon, wie selbstsicher er wirkte. Insbesondere nach unserem Gespräch eben.
Als er an der Tasse nippte, verzog er das Gesicht. »Keine Ahnung, warum ich das Zeug immer wieder probiere. Ich sollte einfach einsehen, dass ich zu den wenigen Menschen gehöre, denen Kaffee nicht schmeckt.«
»Unser neuer Roomie!« Aiden stieß gut gelaunt zu uns und klopfte Vance auf die Schulter, der gerade noch rechtzeitig die Tasse zur Seite stellte, bevor sie überschwappte. »Mich kennst du ja schon, das sind Wyatt und Kolton. Und das ist Haisley, die viel zu oft bei uns rumhängt«, erklärte er aufgekratzt. Kurz überkam mich das Bedürfnis, ihm an die Gurgel zu springen, weil er dafür gesorgt hatte, dass Vance bei uns wohnte.
»Und mich willst du nicht vorstellen?« Blaze stand plötzlich im Türrahmen. Vor über einem Jahr waren wir alle Freunde geworden und verbrachten beinahe jede freie Minute zusammen. Umso verrückter war es, dass Haisley und ich uns gestern geküsst hatten.
»Das ist Blaze. Er und Haisley wohnen im Apartment gegenüber, aber sie finden immer unseren aktuellsten Schlüsselcode heraus. Kommen und gehen, wann es ihnen beliebt.«
Haisley kicherte. »Ihr wählt nicht gerade ausgefallene Codes. 6969 oder 6666. Manchmal lassen sie sich so was wie 1313 einfallen.« Beim letzten Wort malte sie Gänsefüßchen in die Luft. »Nicht gerade anspruchsvoll.«
»Bisher wurden wir noch nicht ausgeraubt«, bemerkte Aiden unbeeindruckt. »Also, ich hab bis eben geschlafen, wer hat hier denn so sauber gemacht?«, fragte er in die Runde. Für gewöhnlich blieb die meiste Arbeit an ihm hängen.
Vance räusperte sich. »Mein Willkommensgeschenk an euch, nachdem ihr für mich zum Einzug extra eine Party geschmissen habt.«
Wyatt warf Aiden einen Blick zu, und dieser suchte meinen. Verzweiflung hing in der Luft.
»Schon gut, die Party war nicht für mich. Schon klar.« Vance lachte, goss den restlichen Kaffee in die Spüle und räumte die Tasse in den Geschirrspüler.
»Da wir ja jetzt nicht mehr putzen müssen, bleibt uns allen genug Zeit für ein Frühstück im Juliets. Wer kommt mit?« Haisley strahlte.
Wyatt, Aiden und Blaze waren von ihrem Vorschlag begeistert.
»Vance, du darfst dir unter keinen Umständen die besten Pancakes auf dem Campus entgehen lassen«, erklärte sie, was sich mehr nach einem Befehl als einem wohlwollenden Tipp anhörte.
»Nicht?«
»Du kommst mit«, bestimmte sie und wandte sich daraufhin an mich. »Wie sieht es bei dir aus?« Jetzt klang sie fast schüchtern. Nach unserem Kuss gestern überraschte mich das zwar nicht, aber es passte trotzdem nicht zu ihrer üblichen Art.
»Training.«
»Wyatt trainiert seltener als du«, gab sie zu bedenken.
»Tja, deshalb wird er auch nie zum Spieler der Woche gewählt«, konterte ich.
Wyatt schimpfte unverständlich vor sich hin. Daraufhin lachte Aiden auf und boxte ihm gegen den Oberarm. Im Grunde wusste Wyatt, dass ich besser war als er und dass es ihm nicht an Talent, sondern an Disziplin mangelte.
»Du schießt weit über das Ziel hinaus«, murmelte Wyatt.
»Weil ich trainiere?«
Er schnaubte und verengte die Augen, während alle anderen den Atem anzuhalten schienen.
»Du verrennst dich.«
Neugierig hob ich eine Augenbraue und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Im Leben geht es um mehr, als ständig Leistungen zu erbringen.« Für meinen Geschmack klang er gerade viel zu erwachsen und kein bisschen wie Wyatt, der es liebte, einen blöden Spruch nach dem anderen von sich zu geben. Und das fühlte sich … befremdlich an. Hatte er sich über den Sommer hinweg dermaßen verändert?
Ich ließ mir meine Gedanken nicht anmerken und zuckte unbeeindruckt mit den Schultern. »Wir sind in Harvard, hier geht es immer um Leistungen.«
»Das stimmt«, gab sich Wyatt geschlagen. »Trotzdem wäre es schön, wenn du wieder öfter mit uns abhängst.«
»Ich war gestern auf der Party.«
Aiden und Wyatt wechselten einen Blick, und ich konnte darin Aidens Bitte lesen, das Thema ruhen zu lassen. Eine verdammt gute Idee.