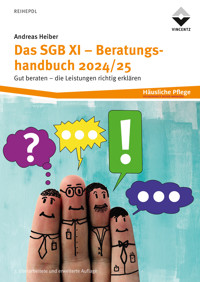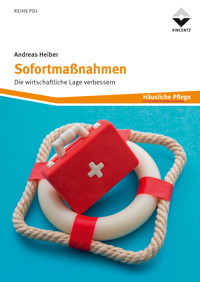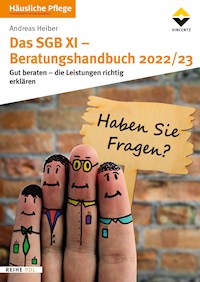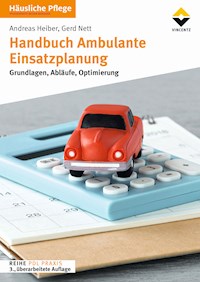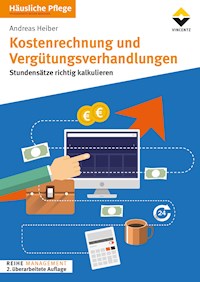45,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vincentz Network
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Reihe PDL
- Sprache: Deutsch
Professionelle Pflege hat ihren Wert, aber auch ihren Preis. Und immer häufiger sind Sie als Leistungsanbieter:in gefordert, Verträge nur mit Kunden abzuschließen, deren Bedarfe zu den Kapazitäten Ihres Pflegedienstes passen. Unternehmensberater Andreas Heiber stellt ein Konzept für Vertragsgespräche vor, dass hier Transparenz schafft. Es führt hin zu konkreten Entscheidungen der Pflegebedürftigen und Angehörigen. Denn die entscheiden, welche Leistungen sie wollen und streichen selbst die Leistungen, die ihnen zu teuer sind. Das Handbuch unterstützt Sie bei der Vorbereitung, dem Abschluss und der Umsetzung des Vertrages. Nutzen Sie die hilfreichen Berechnungstabellen und Formulare wie z.B. den Kostenvoranschlag. So erfassen Sie den Tagesablauf, erstellen Kostenvoranschläge und führen noch erfolgreicher Preisgespräche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Andreas Heiber
Vertragsgespräche richtig führen
Die Pflegebedürftigen entscheiden lassen
Inhalt
Cover & Impressum
1 Einleitung
2 Die aktuellen Grundlagen
2.1 Die Ausgangslage hat sich verändert!
2.2 Wer ist für Beratung zuständig?
Die Pflege kommt immer ‚plötzlich‘
2.3 Das Missverständnis mit der Pflegeversicherung
3 Welche Kunden könnten (noch) versorgt werden?
3.1 Falsche Kriterien: Was rechnet sich?
4 Die drei Schritte im Vertragsgespräch
5 Vorbereitung
5.1 Telefonischer Kontakt als Filter
5.2 Vorbereitung
5.3 Unterlagen und Material
5.4 Persönlicher Auftritt
5.5 Zeitmanagement
6 Begrüßung und Vorstellung
6.1 „Arbeitsplatz“ einrichten
6.2 Vorstellungsrunde
6.3 Zeitanker ‚werfen‘!
7 Der Tagesablauf als Basis für den Kostenvoranschlag
7.1 Das Formular Tätigkeitsübersicht
7.2 Tagesablauf besprechen und dokumentieren
7.3 Leistungen anderer Kostenträger ermitteln
8 Den Kostenvoranschlag erstellen
8.1 Der Papier-Kostenvoranschlag als Basis des Preisgesprächs
8.2 Kostenvoranschlag für die Sachleistungen
8.3 Kostenvoranschlag: Dienstleistungen
9 Preisgespräch erfolgreich führen
9.1 Klassische Einwände und die Reaktion
9.2 „Sagen Sie uns, was wir weglassen sollen“
9.3 Eigenanteil senken: Steuerliche Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen
9.4 Wer entscheidet? Pflegebedürftige:r oder Angehörige:r?
10 Vertragsabschluss
10.1 Verabschiedung
11 Organisatorische Fragen
11.1 Pflegevertrag erklären können
11.2 Was wird gemacht?
11.3 Umgang mit Serviceleistungen
11.4 Teampflege
11.5 Zeitpunkt und Pünktlichkeit
11.6 Erreichbarkeit und Rufbereitschaftseinsätze
11.7 Pflegedokumentation
12 Mit dem Pflegevertrag leben
13 Leistungsübersichten
14 Autor
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1Einleitung
Die meisten Vertragsgespräche in der ambulanten Versorgung kreisen nicht um die richtige Versorgung der Pflegebedürftigen, sondern um die Höhe bzw. Reduzierung der Kosten für die Versorgung. Wer hat noch nie den Satz gehört: „Sie sollen Vater in der Woche jeden Morgen komplett versorgen, aber es müssen noch 100 € für die Putzfrau übrigbleiben!“ Dass Pflege eine professionelle Dienstleistung ist, die selbstverständlich Geld kostet, scheint in der Bevölkerung nicht angekommen zu sein. Zu oft wird sie noch mit kostenfreier „Nächstenliebe“ verwechselt. Darunter leiden nicht nur die gemeinnützigen Pflegedienste, sondern alle Pflegekräfte und Pflegefachkräfte.
Das hat seine Ursachen u. a. darin, dass oftmals nicht bekannt ist, was für die Versorgung tatsächlich nötig ist und was der Pflegedienst alles macht – und damit ‚Arbeit‘ hat. Wenn den Angehörigen nicht klar ist, was bisher nebenbei mitgemacht wurde und was tatsächlich als Versorgung durch Dritte nötig ist, gehen auch Vertragsgespräche, die mit der Frage: „Was können wir für Sie tun?“ eingeleitet werden, in die falsche Richtung.
Deshalb wird hier ein anderer Ansatz vorgestellt: Bevor geklärt werden kann, was der Pflegedienst übernimmt, wird in einem Schritt davor zunächst dokumentiert, was notwendig ist und (schon) gemacht wird.
Auf der Basis des Tagesablaufes bzw. der gesamten Tätigkeitsübersicht lässt sich ein erster Kostenvoranschlag nicht nur einfacher erstellen, sondern auch besser verhandeln. Denn die Basis, was gemacht werden muss, steht vorher fest.
Nach dem Motto: „Beraten statt Verkaufen“ geht es nicht darum, möglichst viele Leistungen zu verkaufen, sondern das zu vereinbaren, was die Pflegekunden/Angehörigen tatsächlich benötigen und wünschen. Dazu gehört auch der Mut zur Lücke und die Fähigkeit, Versorgungslücken zwar aufzuzeigen, aber auch auszuhalten. Denn: „Jeder hat das Recht zu stinken!“
Die aktuelle Ausgabe der „Vertragsgespräche“ ist die Überarbeitung der zweiten Auflage aus dem August 2016. Dabei ist die Methode, die inzwischen viele Pflegedienste nutzen, gleichgeblieben, es kommen neue Aspekte wie die Kundenauswahl dazu.
Das Allgemein- und Beratungswissen der Pflegeversicherung wird im Buch vorausgesetzt und nur stichpunktartig aufgefrischt. Dieses Beratungswissen für alle Leistungsparagrafen der Pflegeversicherung ist ausführlich und praxisnah darstellt in dem Buch SGB – XI-Beratungshandbuch (Andreas Heiber), das inzwischen in der Ausgabe für die Jahre 2024-2025 im Frühjahr 2024 erscheint.
Die im Buch dargestellten Formulare finden sich alle zum (in der Regel kostenfreien) Download unter https://blog.syspra.de/shop/
Dank gilt weiterhin den vielen Pflegefachkräften auch aus den PDL-Kursen des ASB Bildungswerkes in Köln und vieler anderer Fortbildungen zum Führen von Vertragsgesprächen, die durch ihre vielfältigen Diskussionen und Rückmeldungen zu diesem Arbeitsbuch beigetragen haben. Wie immer hat mein Beraterkollege Gerd Nett von SysPra Wershofen die Erstellung des Buches mit begleitet und bei der Überarbeitung unterstützt.
Januar 2024
Andreas Heiber
2Die aktuellen Grundlagen
2.1Die Ausgangslage hat sich verändert!
Früher war alles anders: Auf die Entwicklung der Vertragsgespräche kann man diese Plattitüde super anwenden! Früher, also noch vor fünf bis zehn Jahren, standen die Pflegedienste im Wettbewerb miteinander, weil es ein ordentliches und ausreichendes Angebot an Pflegediensten im Verhältnis zu den potenziellen Pflegekunden gab. So kam es nicht nur gelegentlich vor, dass die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen sich nicht nur einen Pflegedienst zu einem Vertragsgespräch geholt haben, sondern mehrere nacheinander und sich dann das beste Angebot aussuchen konnten.
Die Zeiten sind im Jahr 2024 vorbei!
Über den Personalmangel in der Pflege ist inzwischen in jeder Tageszeitung zu lesen, genauso über Insolvenzen von Pflegeeinrichtungen. Wie kommt es dazu? Es gibt wie meistens nicht nur eine Ursache:
Die Coronazeit hat sicherlich ihren Tribut gefordert, die Arbeitsverdichtung und die lange währende Notlagenzeit haben auch dafür gesorgt, dass mehr Mitarbeitende den Pflegebereich verlassen haben.
Die Zahl der Pflegebedürftigen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Dabei ist ein Unterschied zu beobachten: Während die Gesamtzahl und die Zahl der ambulant versorgten Pflegebedürftigen kontinuierlich steigt, bleibt die Zahl der in Pflegeheimen versorgten Pflegebedürftigen erstaunlich konstant und das nicht erst bedingt durch Corona (siehe Abb. 1 auf Seite 10). Die Menschen wollen und können offensichtlich viel länger zu Hause leben, trotz Pflegebedürftigkeit. Von 2011 bis 2019 (also vor Corona) ist die Zahl der Pflegebedürftigen um ca. 1,5 Millionen gestiegen, im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der stationär versorgten Pflegebedürftigen jedoch nur um ca. 50.000.
Ob dies schon Indizien dafür sind, dass wir insgesamt anders (also gesünder) alt werden, sei dahingestellt. Klar ist aber, dass die ambulanten Zahlen massiv gestiegen sind und sich die ambulante Entwicklung von der vollstationären ‚abgekoppelt‘ hat.
Die Anzahl der Pflegedienste und die Anzahl der von Pflegediensten zu versorgenden Pflegebedürftigen (sei es mit Sachleistungen, kombinierten Sachleistungen oder reinen Pflegegeldbeziehern) ist ebenfalls gestiegen (siehe Abb. 2 auf Seite 11). Seit 2015 sind jedes Jahr im Saldo (also auch trotz Betriebsaufgaben) ca. 5 % neue Pflegedienste dazugekommen. Die Zahl der rechnerischen Kunden pro Dienst ist deutlich gestiegen: Kamen 2011 auf einen Pflegedienst rechnerisch 142 Pflegebedürftige, liegt der Wert inzwischen bei 271 Pflegebedürftigen (Sachleistungs- und Pflegegeldbezieher).
Eine weitere Entwicklung betrifft die Anzahl der Pflegekräfte, die verfügbar ist: Wir alle kennen das Schlagwort „Babyboomer“. Das ist die riesige Gruppe der Geburtsjahrgänge 1955 bis 1969, die nun schrittweise das Rentenalter erreichen (siehe Abb. 3). Jeder Betrieb in Deutschland (und damit natürlich auch die Pflegebranche) hat ein demografisches Problem: Es gehen schrittweise viele Mitarbeitende in den nächsten Jahren in den Ruhestand, aber es fehlen die entsprechenden nachrückenden Kräfte, weil die nachfolgenden Jahrgänge kleiner sind.
Abbildung 1
Abbildung 2
Abbildung 3
Was heißt das alles für die Vertragsgespräche?
Das ‚knappe Gut‘ sind nicht mehr die potenziellen Kunden und Kundinnen und Pflegebedürftigen, sondern die Pflegedienste mit ihren Personalkapazitäten.
Pflegedienste können und müssen sich genau die Kund:innen aussuchen, die zu ihnen und ihnen Kapazitäten passen!
Das heißt: Es geht bei den Vertragsgesprächen gar nicht mehr darum, Leistungen zu verkaufen, sondern die richtigen Kunden und Kundinnen zu finden, die mit ihren Wünschen und Bedarfen zu den Kapazitäten des Pflegedienstes passen. Das kann auch heißen, dass man beispielsweise bestimmte Einsätze, z. B. am Abend oder am Wochenende, ablehnen muss, weil man hierfür aktuell keine Kapazitäten hat.
„Beraten statt verkaufen!“ war schon immer der heimliche Untertitel dieses Buches. Durch die richtige Beratung zum sachgerechten Pflegevertrag. Das wird unter den aktuellen Voraussetzungen noch wichtiger: Die Zeit der reinen ‚Verkäufer‘, die man an Kennzahlen wie Umsatz pro Pflegekunde oder Umsatz pro Pflegegrad gemessen hat, sind endgültig vorbei.
Heute kommt es vielmehr darauf an durch die richtige Vorbereitung, die Kunden mit den richtigen Leistungen zu finden. Das kann auch dazu führen, dass nicht jeder Interessent genommen werden kann. Im Vertragsgespräch stellt man fest, dass die Pflegebedürftigen beispielsweise eine viel intensivere Versorgung wünschen, als der Pflegedienst aktuell leisten kann, oder dass die Interessenten einen Leistungsmix wählen wollen, der aus fachlicher Sicht nicht ausreichend ist. Dann ist es der richtige Zeitpunkt, das Vertragsgespräch zu beenden und diesen Interessenten nicht als Kunden aufzunehmen. Vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfragen kann und muss sich das jeder Pflegedienst leisten.
Unterschied zwischen Vertragsgespräch und pflegerischem Erstgespräch
Der Unterschied zwischen einem Vertragsgespräch und einem pflegerischen Erstgespräch ergibt sich aus den verschiedenen Aufgaben und Zielen:
Das
Vertragsgespräch
klärt den Inhalt und Umfang der zu vereinbarenden Leistungen und soll zum Abschluss des Pflegevertrages führen. Deshalb geht es hier ‚nur‘ um die Frage, was ist notwendig und was davon kann der Pflegedienst übernehmen.
Das
pflegerische Erstgespräch
ist der formale Beginn der Pflegeplanung. Dazu gehört eine ausführlichere Anamnese, einschließlich beratender und aufklärender Inhalte (nachvollziehbare Beratung einschließlich Nachweis), sowie die Erstellung einer ersten Pflegeplanung auf der Basis der vom Pflegedienst zu erbringenden Leistungen (wie es die „Gemeinsamen Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die Qualitätssicherung nach § 113 SGB XI“ mit aktuellem Stand festgelegt haben).
In vielen Leistungskatalogen ist die Leistung „Erstgespräch“ so beschrieben, dass auch der Vertragsabschluss dazu gehört. Das heißt aber nicht, dass man auch jedes Vertragsgespräch als ‚Erstgespräch‘ abrechnen sollte (siehe Seite 15).
Es stellt sich daher die in der Praxis oft schwierige Frage der Abgrenzung: Wann hört das Vertragsgespräch auf und wann beginnt der pflegerische Erstbesuch? Oder anders/genauer formuliert: Wie viel und wie wenig Beratung muss erfolgen, um den Vertrag abschließen zu können? Muss beispielsweise das Badezimmer ausführlich besichtigt werden, um zu diskutieren, welche Hilfsmittel hier noch zu installieren wären?
Es ist die gleiche Problematik, die die spezialisierten Fachgeschäfte haben, um ein Beispiel aus einem anderen Bereich zu nennen: Viele Kaufinteressierte lassen sich vom guten Fachhändler ausführlich beraten, um anschließend – gut beraten – billiger beim Discounter oder im Internet einzukaufen. Da ist es legitim, wenn der Fachhändler nicht gleich zu ausführlich berät, sondern zunächst versucht zu klären, ob der Interessent auch tatsächlich bei ihm Kunde werden und kaufen will. Das Gleiche gilt für die Pflege.
Im Einzelfall wird man nicht immer eine starre Grenze zwischen Vertragsgespräch und pflegerischem Erstgespräch ziehen können, aber die unterschiedlichen Inhalte ermöglichen eine klare Abgrenzung.
Ganz praktisch hat diese Differenzierung auch Auswirkungen auf die Informationsmenge, die man im Rahmen des vorgelagerten Vertragsgesprächs erheben muss. Daten, die man zur Abrechnung von Leistungen benötigt, wie die Versichertennummer, braucht man noch nicht im Vertragsgespräch. Es spart auch Zeit, wenn man sich anfangs auf die Fakten beschränkt, die man für das Vertragsgespräch benötigt.
2.2Wer ist für Beratung zuständig?
Oftmals rufen Interessenten oder deren Angehörige an, die noch keine Einstufung haben und durch ein Gespräch mit dem Pflegedienst eine Orientierung erwarten nach dem Motto: „Wir lassen uns mal informieren, dann wissen wir, wie wir einen Antrag stellen sollen und wie wir das machen“. Das ist eine vergleichbare Situation, die viele Handwerker auch kennen: Der Kunde ruft an, lässt sich vom Gärtner Vorschläge machen, wie er den Garten gestalten könnte, auch einen Kostenvoranschlag erstellen, um dann alles selbst zu machen.
Es stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen und Konditionen ein Pflegedienst ein solches Informationsgespräch führen sollte: Es ist ja nicht einmal klar, ob überhaupt ein Pflegegrad vorliegt und ob hier ein Vertrag zustande kommen kann. Andererseits ist das Einstufungssystem so komplex, dass man nicht mehr einfach erkennen kann, ob und welcher Pflegegrad wohl zu erreichen wäre. Dazu kommt, dass im Pflegegrad 1 keine Sachleistungen zur Verfügung stehen.
Grundsätzlich ist nicht der Pflegedienst der erste Ansprechpartner bei Beratungsfragen, sondern die eigene Pflegekasse. Nach § 7a SGB XI haben alle Pflegebedürftigen den Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch eine:n Pflegeberater:in der eigenen Pflegekasse! Den Anspruchsberechtigten (also die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen) soll durch die Pflegekassen vor der erstmaligen Beratung unverzüglich ein zuständiger Pflegeberater oder eine Pflegeberaterin benannt werden, was in der Regel im Rahmen des Bescheids über den Pflegegrad oder im Schriftwechsel des Antragsverfahrens erfolgt. Jeder Pflegedienst kann also die Interessenten jederzeit auf die eigenen Pflegekassen und ihren Rechtsanspruch verweisen. Trotz dieser seit 2009 gesetzlich definierten Beratungsmöglichkeit lassen sich viele Interessent:innen lieber von Pflegediensten beraten als von Mitarbeitenden der Pflegekassen.
Liegt ein Pflegegrad vor (z. B. bei bisherigen Pflegegeldbeziehenden), kann das Beratungsgespräch über die mögliche Veränderung der Versorgung auch im Rahmen der Beratungsbesuche nach § 37.3 SGB XI erfolgen. Hinzuweisen ist auf den Gesetzestext: die Beratungsbesuche sind jeweils pro Halb- oder Vierteljahr abzurufen; auch die freiwilligen Beratungsbesuche bei Sachleistungsbeziehenden oder bei Pflegegrad 1 sind einmal im Halbjahr nutzbar. Das heißt nicht, dass zwischen den Besuchen immer ein Halbjahr (oder Vierteljahr) liegen muss. Daher könnte auch bei Pflegegeldbeziehenden, die zuletzt im Juni den Beratungsbesuch abgerufen haben, die gewünschte Beratung im September auch als Beratungsbesuch abgerechnet werden.
Wenn noch keine Einstufung vorliegt und die Pflegebedürftigen/Angehörigen eine Beratung durch den Pflegedienst wünschen, sollte man diese kostenpflichtig anbieten. In diesem dann zeitlich definierten und finanzierten Rahmen kann man auch eine erste Probeeinstufung vornehmen etc. Bezüglich der Kosten kann auch vereinbart werden, dass bei einem späteren Vertragsabschluss die Kosten für die Beratung erstattet oder mit den Eigenanteilen verrechnet werden, so dass in diesem Fall die erste Beratung kostenfrei oder zumindest günstiger ist. Aber bei Interessenten, die nur beraten werden wollen und später beispielsweise allein das Pflegegeld nutzen, sollte die Beratung kostenpflichtig bleiben.
Die Pflege kommt immer ‚plötzlich‘
Die Pflege von Angehörigen ‚kommt‘ seltsamerweise immer plötzlich. Da kann der Pflegebedürftige noch so Schwierigkeiten beim Gehen haben (was beim Geburtstag jeder sieht), es führt oftmals nicht dazu, dass die Angehörigen/Pflegepersonen proaktiv tätig werden und beispielsweise Türschwellen beseitigen oder zusätzliche Geländer anbringen. Dabei könnte eine frühzeitige Beratung helfen, mögliche ‚Hindernisse‘ sofort zu beseitigen oder durch Hilfsmittel zu entschärfen.