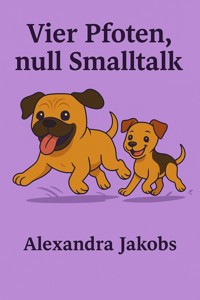Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist kein Ratgeber. Es ist meine Geschichte – und die eines Hundes, der mein Leben bereichert. Seit Cane, ein Cane Corso, bei uns lebt, ist nichts mehr wie vorher. Aus einem geregelten Alltag wird ein Leben voller Geschichten: von Vertrauen, Verantwortung, Liebe und Schmerz – und von all den Momenten, in denen ich einfach nur laut lachen muss. Mit liebevollem Blick, einer Portion Selbstironie und ganz viel Herz erzähle ich vom Zusammenleben mit einem Hund, der mich jeden Tag daran erinnert, was wirklich zählt. Es sind die kleinen Augenblicke zwischen Chaos und Nähe, in denen ich spüre: Man kann das Leben nicht planen – aber man kann es lieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexandra Jakobs
vier Pfoten – Mein Leben mit einem Cane Corso
Impressum
Copyright © 2025 Alexandra JakobsText und Bild: Alexandra JakobsAlle Rechte vorbehalten.
Die Inhalte dieses Buches – einschließlich Texten, Bildern und Grafiken – sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung der Urheberin in irgendeiner Form reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für den Inhalt dieses Werkes ist allein die Autorin verantwortlich. Kontakt: buch. alexandra. jakobs@gmail. com
Vorwort
Dieses Buch ist kein Ratgeber.Es ist auch kein Nachschlagewerk über Hundeerziehung, keine wissenschaftliche Abhandlung über die Rasse Cane Corso und ganz bestimmt keine Anleitung zum „perfekten Hund“.
Ratgeber findet man bei mir an anderer Stelle. Unter dem Titel „Vier Pfoten …“ habe ich bereits Bücher geschrieben, die sich mit Hundeerziehung, Hundeverständnis und dem Alltag im Sozialverband befassen. Doch dieses Buch widmet sich nur einem Thema: dem Zusammenleben mit meinen eigenen Hunden.
Es ist schlicht und einfach unsere Geschichte – eine Geschichte, die an einem warmen Spätsommerabend auf der Terrasse begann, als wir eigentlich noch fest davon überzeugt waren: Unser Hund wird ein Bullmastiff. Punkt.
Und dann kam alles anders, wie das Leben eben spielt, wenn man glaubt, man hätte schon alles entschieden. Statt eines sanften Riesen mit nachdenklicher Stirn stand plötzlich ein kleiner, beiger Welpe mit schwarzer Maske in meinem Leben und sah mich an, als wäre ich die Antwort auf alle seine Fragen.
Von da an begann ein Abenteuer, das ich mir so nie hätte ausmalen können: voller Sabber, Witz und Herzklopfen. Natürlich hätte ich hier auch nüchtern berichten können, wie man mit einem Cane Corso lebt – welche Futtermenge ein Kalb auf vier Pfoten täglich vertilgt, wie viel Platz er braucht, welche Regeln sinnvoll sind.
Aber mal ehrlich, das kann man überall nachlesen.
Was man nicht nachlesen kann, sind die kleinen Momente, die Blicke, die Eigenheiten, die Szenen, bei denen man lacht, obwohl man eigentlich schimpfen wollte. Und genau diese Momente möchte ich hier festhalten.
Wer also einen Ratgeber sucht, findet ihn in meinen anderen Büchern. Wer aber Lust hat, mit uns durch die Höhen und Tiefen des Cane-Corso-Alltags zu stolpern – zwischen Kuschelkissen, Buddellöchern, Sofa-Regeln und dem einen oder anderen Herzstillstand beim Tierarzt –, der ist hier genau richtig.
Dies ist eine Liebeserklärung.
An einen Hund, der nie geplant war.
An eine Freundschaft, die größer ist als jede Rassebeschreibung.Und an all die verrückten, wunderbaren Augenblicke, die das Leben mit Cane und Snoopy so einzigartig machen.
Manchmal beginnt eine Geschichte nicht mit einem großen Knall oder einer schicksalhaften Begegnung.
Manchmal fängt sie leise an, fast unscheinbar, so still, dass man es im ersten Moment gar nicht bemerkt.Sie beginnt an einem dieser Abende, an denen die Luft warm und weich auf der Haut liegt und die Welt so tut, als könne der Sommer ewig bleiben.
So begann auch unsere Geschichte.
Ein Spätsommerabend, an dem die Schatten länger werden, während der Himmel langsam orange glüht. Wir saßen barfuß auf der Terrasse, mit einem Glas in der Hand, und für einen Moment schien es, als hätte der Alltag beschlossen, sich in den Hintergrund zurückzuziehen.
Die Kinder waren im Bett – zumindest offiziell. Wahrscheinlicher war, dass sie noch tuschelnd unter der Decke lagen, kichernd jede Anweisung ignorierten und heimlich Gummibärchen teilten. Aber fürs Erste war Ruhe.
Der kleine Hund Snoopy döste zufrieden unter dem Tisch, eingerollt, nur sein rechter Hinterfuß zuckte hin und wieder, als träumte er von einem Wettlauf gegen einen besonders langsamen Dackel.
Fluffy, unsere Katze, hatte sich auf der warmen Fensterbank zusammengerollt und beobachtete das Ganze mit halb geschlossenen Augen, als wüsste sie längst, dass dieser Abend wichtiger war, als wir ahnten.
Um uns herum: nichts. Kein Telefon, das klingelte, kein Wäschekorb, der drängelte, kein „Mamaaa!“ oder „Papaaa!“. Nur diese seltene, beinahe kostbare Stille, in der man über Dinge spricht, die sonst im Lärm des Alltags untergehen.
Und so redeten wir über Urlaubspläne, über die Schule, über das Chaos im Haus – und schließlich immer wieder über ihn.
Den Hund. Oder besser gesagt: den Hund, der irgendwann zu uns kommen sollte.
Diesmal, so hatten wir uns geschworen, sollte es anders werden. Kein „übrig gebliebenes“ Tier, das man nur aus Mitleid mitnimmt und das dann zehn Jahre lang jedes Paar Socken zu seinem persönlichen Besitz erklärt. Kein Spontanwelpe, den man „nur mal kurz anschauen“ wollte und der dann plötzlich im eigenen Auto saß, als hätte er vergessen, wieder auszusteigen.
Nein, diesmal wollten wir bewusst entscheiden. Überlegt. Geplant. Ein Hund, der zu uns passt, zu unserem Leben, zu unserer Familie. Kurz: unser Lebenshund.
Und eigentlich war die Sache längst entschieden. Wir hatten uns auf einen Bullmastiff festgelegt – kein „vielleicht irgendwann“, sondern ein klarer Plan. Mein Mann war begeistert, ich ebenso. Groß. Gelassen. Ein Hund, der mit einem einzigen Blick sagt: „Keine Sorge, ich habe das im Griff.“
Einer, der denkt, bevor er bellt. Einer, der neben dir läuft, als wäre er schon seit Jahrzehnten an deiner Seite. Ich konnte ihn bereits sehen: wie er im Garten saß, still und würdevoll, wie ein alter Philosoph, der die Welt schon hundertmal hat untergehen sehen und trotzdem ruhig in die Ferne schaut.
So einer, der dich mit einem einzigen Blick entwaffnet, wenn du dich aufregst, und der unausgesprochen denkt: Kindchen, reg dich nicht auf, dafür lohnt es sich nicht.
Ich sah uns auf langen Spaziergängen:
Er – schwer und majestätisch, ein Fels an der Leine.Ich – sicher in der Gewissheit, dass dieser Hund nichts und niemanden fürchtet.
Ein sanfter Riese, ein Seelenhund, der mit seiner bloßen Anwesenheit das Wohnzimmer in einen Zen-Tempel verwandelt, auch wenn er dabei mehr Platz beansprucht als wir alle zusammen.
Wir hatten recherchiert, Züchterlisten durchstöbert, Blutlinien studiert. Mein Mann hätte vermutlich einen Bullmastiff-Fanclub gegründet, wenn es nicht schon längst einen gegeben hätte.
Für uns stand fest: Bullmastiff. Unser Hund.Dachte ich.
Bis zu diesem einen Abend, als mein Mann mir beiläufig sein Handy unter die Nase hielt.
„Was hältst du eigentlich von einem Cane Corso?“, fragte er, als ginge es um ein neues Paar Turnschuhe.
Ich runzelte die Stirn, nahm das Handy – und war im ersten Moment regelrecht überrumpelt.
Auf dem Display starrte mich ein Hund an: kantig, ernst, mit kupierten Ohren und dem Gesichtsausdruck eines Sicherheitschefs kurz vor dem Nervenzusammenbruch.
Mir entwich ein instinktives „Uff“, und ich zog das Handy ein Stück von mir weg.
„Was ich davon halte? Dass das hoffentlich verboten ist!“
„Vielleicht ist das ein altes Bild“, lenkte mein Mann ein. „Oder aus dem Ausland …“
Für mich war die Sache erledigt. Allein dieses eine Bild hatte meinen Bullmastiff-Traum mit einem Schlag verschmiert.
Und dann dieser Name: Cane Corso.
Ich sprach ihn laut aus und musste lachen.
„Klingt wie ein italienisches Kaffeegetränk. Oder wie eine Wohnwand. Einmal die Wohnwand Cane Corso in Anthrazit, bitte.“
Wie auch immer – mein Hund war das ganz sicher nicht.Und trotzdem klickte ich. Aus Neugier. Man ist offen.
Plötzlich war ich mittendrin in einem digitalen Strudel voller Fotos. Hunde, die angeblich alle zur selben Rasse gehörten, aber aussahen, als hätten sie selbst Zweifel daran. Schwarz. Beige. Grau. Gestromt. Blaugrau. Mit Maske, ohne Maske, mit Stirn, ohne Hals.
Ich scrollte und dachte nur: Was ist das bitte? Eine Rasse oder ein Versehen im Genlabor?
Dazu die typischen Online-Beschreibungen, die irgendwo zwischen Fachwissen, Halbwahrheit und Weltuntergang schwankten: wachsam, eigenständig, nicht für jedermann, Fremden gegenüber misstrauisch, hoher Schutztrieb, braucht klare Führung, nur mit Erfahrung zu halten, stellt Regeln gern infrage.
Und mein absoluter Favorit: Der Cane Corso kennt keine halben Sachen.
Na wunderbar.
Ich dagegen war Jedermann. Ich liebte meine Regeln. Ganz klar: raus.
Einige Tage vergingen. Dann kam mein Mann erneut – diesmal mit einem Foto von Welpen.
„Drei sind noch zu haben“, sagte er beiläufig. „Zwei
Hündinnen – und der hier.“
Ich nahm das Handy, und für einen Herzschlag lang blieb mir die Luft weg.
Ein beigefarbener Rüde, schwarze Maske, breiter Kopf. Seine Stirn, seine Augen – vertraut und doch fremd.Nicht mein Bullmastiff, aber verdammt nah dran. Weiche Falten, die so aussahen, als würden sie nur auf meine Finger warten. Für einen winzigen Moment machte mein Herz diesen leisen, verbotenen Sprung.
Ein Oh nein, das man innerlich sofort wieder wegschiebt.Doch da war er, dieser eine Sekundenblick, der alles ins Wanken brachte.
Natürlich gewann die Vernunft die Oberhand. Ich wollte keinen Cane Corso. Das war beschlossene Sache.Also gab ich das Handy zurück, so neutral wie möglich, und murmelte: „Der sieht ganz süß aus.“
In Wahrheit meinte ich: Ich bin stark. Ich schau nur. Ich nehme nichts.
Dann kam er – dieser eine Satz, der alles kippte:„Wollen wir ihn uns nicht einfach mal anschauen?“
Ich lachte, halb genervt, halb wissend. „Anschauen ist ja nicht gleich mitnehmen“, sagte ich.
Und noch während ich es aussprach, wusste ich: Doch. Ganz genau das ist es.
Aber während ich innerlich noch tapfer versuchte, bei meinem Ich will keinen Cane Corso zu bleiben, war mein Mann längst ein paar Schritte weiter – oder besser gesagt: mindestens zwanzig.
Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Er hatte sich schon längst auf leisen Sohlen an Plan B gemacht.Heimlich hatte er mit dem Züchter telefoniert, nicht nur einmal, sondern mehrmals.
Er hatte sich Bilder schicken lassen, Informationen gesammelt, Blutlinien verglichen, Details abgefragt, sich Notizen gemacht. Ganz in Ruhe. Ganz sachlich. Und vor allem: hinter meinem Rücken.
Nicht aus bösem Willen, nicht aus Berechnung, eher mit dieser stillen Zielstrebigkeit, die er manchmal an den Tag legt, wenn er etwas wirklich will, verbunden mit einem kleinen Flirt mit dem Schicksal, als wolle er ihm zuzwinkern:Na los, gib mir ein Zeichen – aber ich fahr trotzdem schon mal los.
In Wahrheit hatte er längst entschieden, dass wir „nur mal gucken“ fahren würden.
Ich hielt es noch für eine spontane Idee.
Er hingegen war innerlich schon bei Operation Cane Corso – Phase 2 läuft.
Und dann kam der Tag.
Ein Samstag, strahlend schön.
Die Sonne stand warm über den Feldern, und für einen Oktober war es erstaunlich mild – fast ein Geschenk, als wolle der Sommer sich mit einem letzten Aufbäumen verabschieden.Die Luft roch nach Heu und nach diesem flüchtigen Hauch von Wärme, der nur kurz bleibt, bevor der Herbst alles in grauen Nieselregen taucht.
Wir stiegen ins Auto: mein Mann am Steuer, die Kinder aufgeregt wie vor einem Zoobesuch, ich skeptisch – und Snoopy, unser kleiner Hund, mittendrin.
Snoopy war kein typischer Familienhund – eher ein Unikat auf vier Pfoten.
Optisch erinnerte er an eine Miniaturausgabe eines Schäferhundes: hochbeinig, drahtig, mit wachem Blick und zwei kleinen, weichen Schlappohren, die bei jeder Bewegung fröhlich mitwippten.
Er sah aus, als würde er jederzeit zum Einsatz bereitstehen – nur eben im Format „handlich und niedlich“.
Und heute war genau sein Tag.
Er durfte hinten auf der Rückbank Platz nehmen – zwischen den Kindern, angeschnallt mit speziellem Gurt, das Brustgeschirr saß perfekt.
Seine Ohren tanzten leicht im Fahrtwind – oder besser gesagt im gut gemeinten Durchzug – und sein ganzer Körper vibrierte vor gespannter Vorfreude.
Snoopy liebte Ausflüge. Er war stolz. Stolz wie Oskar.Der geborene Reisebegleiter – nur das Auto war danach nicht mehr ganz dasselbe.
Vorne schwebten die Bullmastiff-Pläne in einer Art Warteschleife, hinten legte sich eine zarte Schneedecke aus Hundehaaren über die Sitze.
Denn Snoopys Fell war von der Sorte: Ich teile mich gern.Am Ende sah die Rückbank aus, als hätte jemand eine wuselige Staubwolke ausgeklopft – aber Snoopy war glücklich.Und vielleicht spürte er sogar, dass dieser Tag etwas Besonderes war, dass da jemand Neues auf der Bildfläche erscheinen würde.
Die Fahrt zog sich. Rechts und links Felder in sattem Goldbraun, Hecken, an denen das Laub schon in allen Farben glühte.
Hin und wieder ein Traktor, der gemächlich seine Bahnen zog.
Die Kinder plapperten durcheinander, erfanden Namen für den möglichen Neuzugang, stritten über alberne Vorschläge und kicherten, als säßen sie in einem geheimen Club.Snoopy gähnte demonstrativ und lehnte den Kopf gegen die Rückenlehne, als wolle er sagen: Lasst mal gut sein. Den Namen entscheide ich.
Unser Ziel hieß Laucha – ein kleiner Ort, etwa hundertzwanzig Kilometer entfernt.
Keine Weltreise, aber weit genug, um unterwegs jede Menge Zeit zu haben, nachzudenken.
Zu zweifeln. Sich auszumalen, wie es wäre, diesen Hund wirklich zu sehen.
Für meinen Mann war es vermutlich ein entspannter Wochenendausflug.Für mich dagegen der längste Weg meines Lebens.
Denn tief in mir wusste ich: Wenn ich ihn sehe – wirklich sehe – wenn ich ihm gegenüberstehe, ihn rieche, ihn spüre … dann wird es schwer, bei meinem Nein zu bleiben.
Ich redete mir ein, dass ich noch ganz bei mir sei. Noch voller Widerstand. Noch klar im Kopf.
Aber irgendwo, ganz hinten links in meinem Herzen, war es schon – ganz leise, ganz vorsichtig, aber unaufhaltsam – dieses kleine, unscheinbare, aber hochgefährliche Vielleicht.
Wir fuhren auf einen riesigen Hof. Viel Grün, viel Weite.Vögel zwitscherten in der Ferne, und in der warmen Oktobersonne flirrte die Luft, als hätte der Sommer noch eine Zugabe gegeben.
Auf der eingezäunten Wiese warteten sie bereits: die Züchterin, neben ihr ein junger Hund mit beeindruckender Ausstrahlung – und davor der kleine Welpe.
Ich öffnete die Autotür und trat hinaus ins Licht, als würde ich in einen Westernfilm spazieren.
Die Szene war perfekt: Sonne, Gras, Weite – und die kleine Hundefamilie.
Die vermeintlich ausgewachsene Cane-Corso-Hündin war eine schwarze Schönheit mit ernstem Blick. Elegant, muskulös, irgendwie furchteinflößend und faszinierend zugleich.Später stellte sich heraus, dass es die einjährige Halbschwester des Welpen war. Na wunderbar – wenn das die Teenagerphase war, wollte ich den Erwachsenen lieber nicht kennenlernen.
Snoopy sprang aus dem Auto. Normalerweise spielte er gern den kleinen Möchtegern-Rambo – immer auf Empfang, immer bereit, sich groß zu machen, wenn andere Hunde in Sichtweite waren. Brust raus, Kopf hoch, wichtig tun – das konnte er perfekt.
Doch diesmal blieb er stehen. Starrte. Machte große Augen. Kein Aufschneiden, kein Imponiergehabe.
Und dann traf er eine ganz klare Entscheidung: Ich bleib lieber höflich.
Die Cane-Corso-Hündin warf ihm nicht einmal einen Blick zu.Sie stand da wie eine Statue – elegant, unerschütterlich, völlig unbeeindruckt von seinem Erscheinen. Snoopy verstand die Botschaft sofort: Kleiner, mach dich nicht lächerlich.Er schnaubte leise, schlug einen halben Bogen um sie herum und tat so, als hätte er am Wegesrand plötzlich sehr wichtige Dinge zu erschnüffeln. Elegant war das nicht, aber immerhin: kein Getue. Ich war ein kleines bisschen stolz.
Und dann sah er den Welpen.
Beige, der Körper noch weich wie Teig, die Pfoten viel zu groß für den Rest, und der Schwanz wedelte wie ein defekter Scheibenwischer.
Der Kleine sah Snoopy – und kam sofort auf ihn zu. Offen, fröhlich, neugierig.
Ohne Zögern, ohne Scheu. Er tappte durchs Gras, als hätte er gerade einen alten Freund entdeckt.
Seine Ohren wippten, das Fell glänzte, und er roch nach diesem unverwechselbaren Welpenduft – eine Mischung aus Milch, Stroh und Abenteuerlust.
Und was soll ich sagen? Snoopy war verliebt. Sofort.Aus dem Möchtegern-Rambo wurde ein Gentleman im Spaziermodus.Er trottete dem Kleinen entgegen, ganz ohne Starallüren, ganz ohne Imponiergehabe – nur ein schlichtes, ehrliches: Hallo, kleiner Freund.
Wir folgten.
Mein Mann strahlte, als hätte er im Lotto gewonnen.Ich dagegen blieb standhaft. Pokerface. Bloß nichts anmerken lassen.
Es war nur ein Welpe. Ich war hier, um vernünftig zu bleiben.
Die Züchterin lächelte uns entgegen, der Welpe trabte fröhlich neben ihr her, als hätte er das alles schon tausendmal gemacht.
Wir begrüßten uns – Menschen und Hunde. Hände und Nasen.
Ich beugte mich hinunter, um den kleinen Racker zu begrüßen.Er blieb vor mir sitzen. Kein Zögern, kein Ausweichen.Er sah mich an. Direkt. Klar. Als hätte er nur auf mich gewartet.Verdammt.
Snoopy war ebenfalls begeistert, denn der Welpe war fast so groß wie er. Noch.
Und ich? Ich war innerlich weich geworden. Nur ein kleines bisschen, aber gefährlich weich.
So weich wie der Welpe selbst.
Dabei war ich vorbereitet gewesen – auf alles: Sabber, Muskelpakete, dieses „Der ist ja sooo besonders“-Gerede, das man bei solchen Rassen fast schon dazudenkt.Ich war gerüstet wie eine Festung der Vernunft.Innerlich hatte ich mir hundertmal gesagt: Wir wollen nur gucken. Höflich nicken, ein paar Fragen stellen, streicheln – und wieder fahren.
Mit einem klaren Nein im Herzen und einem „Hab ich doch gesagt“ auf den Lippen.
Aber dann sah er mich an.
Nicht süß, nicht aufdringlich, nicht mit dieser klebrigen Welpenmasche, die einem sofort die Vernunft aus der Tasche zieht. Er sah mich einfach nur an. Direkt. Ruhig. Ohne Geflatter, ohne Drama.
Seine dunklen Augen trafen meine wie zwei kleine Magnete, die gar nicht anders konnten, als aufeinander zuzulaufen.Kein Flehen, kein „Bitte nimm mich mit“, kein wildes Schwanzwedeln.Er wirkte nicht wie jemand, der etwas wollte – sondern wie jemand, der längst wusste, was passieren würde.
Ich versuchte wegzusehen. Links, rechts, irgendwohin.Vielleicht war da ein Baum, ein Zaun, ein Grashalm, an dem ich meine Konzentration festklammern konnte.Aber nein – mein Blick kehrte zurück. Und er stand noch immer da.
Leicht schräg, ein Ohr halb umgeklappt, die Pfoten zu groß, das Schwänzchen vibrierte wie ein nervöses Metronom.Alles an ihm sagte: Ich bin klein. Noch. Aber der Blick? Der ist schon ganz groß.
Dann setzte er sich in Bewegung. Tapsig, unsortiert, wie Welpen eben sind, wenn ihr Körper schneller wächst als ihr Plan fürs Laufen.
Ich spürte, wie mein innerer Widerstand versuchte, die Mauer hochzuziehen – doch das Fundament war längst brüchig.Ich sagte mir noch: Bleib sachlich. Es ist nur ein Welpe. Ein flauschiger Vorwand.
Und dann stand er direkt vor mir.
Er hob seine kleine, feuchte Schnauze und stupste ganz sanft gegen mein Bein – nur ein Hauch, wie ein leises: Hallo, ich bin übrigens der, auf den du dich angeblich nicht einlassen willst.
Danach setzte er sich. Kein Theater, kein Klammern. Einfach nur sitzen. Gucken. Warten.
Ich stand da, mitten im Hof, umgeben von Sonne, Weite und dem immer lauter werdenden Verdacht, dass ich gerade dabei war, ganz still zu verlieren.
Vom Haus her wehte Kaffeeduft, irgendwo klapperte ein Eimer, die Kinder trippelten ungeduldig im Kies.Mein Mann sagte nichts. Er brauchte nicht. Sein Grinsen reichte vollkommen aus.
Ich redete mir ein, dass das nur ein Augenblick war. Ein niedlicher Welpenmoment. Harmlos. Vorübergehend.Ich dachte: Da ist nichts passiert. Wirklich nicht.Aber innerlich wusste ich: Ich war gefallen.
Der kleine beige Welpe mit der schwarzen Maske saß direkt vor mir, als hätte er genau diesen Platz gewählt – als hätte er darauf gewartet, dass ich endlich begreife, dass jeder Widerstand zwecklos war.
Ich beugte mich hinunter. Nicht stürmisch, nicht verliebt – eher so, wie man eben Kontakt zu einem Tier aufnimmt. Nur mal vorsichtig streicheln, ganz neutral. Keine Bindung. Kein Herz verlieren.
Aber dann berührte ich sein Fell. Weich. Warm. Welpig. Es roch nach Milch, nach frischer Wiese – und ein bisschen zu sehr nach: Ich gehöre zu dir.
Mein Herz machte diesen einen kleinen Hüpfer, den man nicht mehr rückgängig machen kann.
Ich strich über seinen Rücken, seine Schulter, seine dicken kleinen Backen, und er blieb einfach sitzen. Schaute nur. Lehnte sich ganz leicht an meine Hand – zart, fast unmerklich, und doch stark genug, um zu wissen: Das war kein Zufall. Das war Absicht.
Und als hätte er es abgesprochen, ertönte in diesem Moment die Stimme meines Kindes neben mir: „Mama, der kommt mit uns, oder?“
Natürlich. Die Kinder hatten ihn längst adoptiert. Vermutlich schon, als mein Mann ihnen das erste Foto zeigte – spätestens jetzt, als er sich setzte, als wäre das hier sein Bewerbungsgespräch und er sehr sicher war, dass er bestanden hatte.
Ich hätte lügen müssen, um daran etwas nicht gut zu finden.Aber ich suchte noch Gründe gegen diesen Hund – und fand immer weniger.
„Er ist kein Draufgänger“, sagte die Züchterin leise, während wir am Zaun entlangliefen. „Eher einer, der seine Leute genau beobachtet. Und er entscheidet sehr bewusst, wem er folgt.“
Na wunderbar. Ein stiller Denker mit Bindungsbedürfnis.Einer, der sich nicht jedem anschmeißt, sondern wartet, prüft, auswählt.
Ein Charakterhund – mein persönlicher Schwachpunkt, wenn’s um Hunde geht.
Während ich meine Gedanken sortierte, waren die Kinder längst im Vollmodus.
Sie liefen neben dem Welpen her, redeten mit ihm, stritten sich, wer ihn zuerst anfassen durfte, lachten und
diskutierten über Namen.
„Rex!“, schlug einer vor.
„Viel zu langweilig!“, kam es prompt zurück.
Snoopy lief ganz selbstverständlich Schulter an Schulter mit dem Neuen. Kein Brummen, kein Knurren, keine Skepsis.Er wirkte, als sei es sein Job, den Kleinen einzuarbeiten, und hob den Kopf mit der stillen Würde eines Trainers, der seinen besten Nachwuchsspieler entdeckt hat.
Und ich stand da, mitten auf dieser weiten Wiese.
Der Wind strich durchs Gras, die Sonne legte einen warmen Schimmer auf alles, die Stimmen der Kinder wehten durcheinander – und zwischen all dem dieser kleine Hund, der längst in mein Herz geschlichen war.
Zwischen Restzweifeln und Riesenherz schob sich das leise Gefühl nach vorn, dass ich ihn vielleicht nicht mehr loswerden würde.
Natürlich wollten wir noch eine Nacht darüber schlafen.So macht man das als vernünftige Menschen: nicht beim ersten Blick kaufen, erst recht keinen Hund.
Sacken lassen, abwägen, Pro und Contra sortieren – Herz gegen Hirn, das volle Erwachsenenprogramm.
Also verabschiedeten wir uns. Zumindest versuchten wir es.Der Welpe hatte andere Pläne.
Er saß mitten auf der Wiese, als hätte er Wurzeln geschlagen, sah erst die Kinder an, dann mich. Kein Betteln, keine Traurigkeit, nur dieses abwartende, sichere Schauen – wie von jemandem, der weiß, dass der Koffer längst im Auto steht und es nur noch um die Abfahrtszeit geht.Sein Blick sagte: Ich hab gepackt. Wann fahren wir los?
Ich lächelte tapfer, strich ihm über den Kopf, tat so, als hätte ich alles unter Kontrolle.
Er ließ es zu, ganz ruhig, ganz selbstverständlich – und blieb trotzdem sitzen, wie ein kleiner Buddha mit Ohren.In sich ruhend, erwartungsvoll, entschlossen, keinen Schritt zu tun, bis ich endlich begriff, was längst klar war.
Snoopy hatte es sich ein paar Meter weiter im Gras bequem gemacht und sah aus, als hätte er beschlossen, hier ab sofort einen Zweitwohnsitz zu führen.
Der Blick, den er uns zuwarf, als wir uns Richtung Auto bewegten, sprach Bände: Wir nehmen ihn doch mit, oder?Als klar wurde, dass sein neuer bester Freund nicht sofort einstieg, war er ernsthaft irritiert. Fast beleidigt.
Sein ganzer Körper sagte: Ich hab da was angebahnt! Das ist mein Mini-Me! Den lässt man nicht zurück!
Als wir endgültig aufbrachen, erhob sich auch der Welpe.Nicht, um sich zu verabschieden, sondern um einen letzten Punkt zu setzen.
Er kam auf mich zu, setzte sich vor meine Füße – und legte sich dann seelenruhig auf meinen Schuh.
Nicht nur so ein bisschen. Er rollte sich richtig drauf, benutzte ihn als Kopfkissen und blieb liegen.
Ich sah hinab, er sah hinauf, die Sonne wärmte meinen Rücken, irgendwo klapperte ein Eimer, aus dem Haus wehte Kaffeeduft – und in mir schmolz noch ein Stück.Klarer hätte er es nicht sagen können: Ich bin bereit. Was ist mit dir?
Die Rückfahrt verlief ruhig – zumindest von außen.Die Straßen glänzten in spätsommerlicher Oktobersonne, die Felder standen honigfarben, und die Schatten der Alleebäume huschten wie langsame Wellen über die Windschutzscheibe.Die Kinder hinten diskutierten weiter über Namen und stritten, ob „Prinz Eisenpfote“ genial oder peinlich sei.Mein Mann lenkte mit diesem neutralen Gesicht, das er aufsetzt, wenn er innerlich ein kleines Siegeshütchen trägt.Snoopy lag eingeschnappt auf der Rückbank, den Kopf auf den Pfoten, und rührte sich kaum.