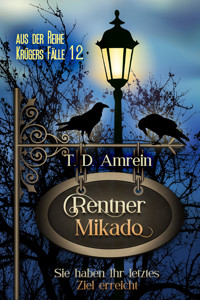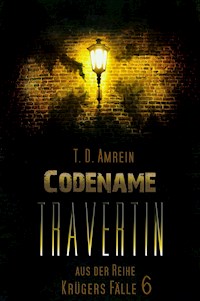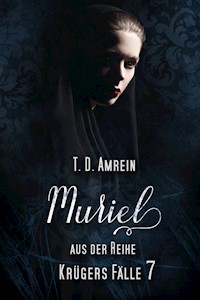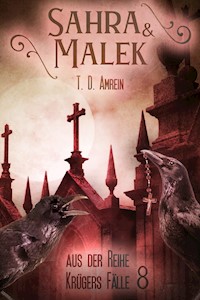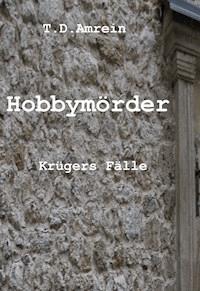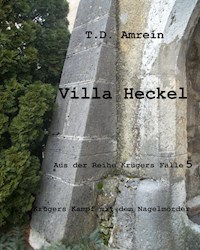
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Heckel hat in den letzten Kriegstagen noch knapp den Sprung nach Amerika geschafft. Grund für die überstürzte Abreise waren nicht nur seine schlechten Berufsaussichten im zerstörten Nazireich. Sondern vor allem die tote Blondine, die er bei einem Streit erwürgt und unbekleidet in den sanften Hügeln des Schwarzwaldes zurückgelassen hat. Als frisch promovierter Physiker findet er jedoch schnell Anschluss als Forscher im US-Raketenprogramm. Fünfzig Jahre später erhält Heckel die Nachricht, in Deutschland geerbt zu haben. Er schickt einen alten Kumpel an seiner Stelle, um die Angelegenheit zu regeln. Der Kumpel meldet sich nicht mehr. Stattdessen schicken die deutschen Behörden einen Totenschein nach Amerika: Der Name des Toten: Wolfgang Heckel. Er arbeitete bis zu seiner Pensionierung für die US-Regierung und bezog danach eine großzügige Rente vom amerikanischen Staat. Natürlich nur bis zu seinem Todestag. Heckel kann das nicht einfach auf sich beruhen lassen. Auch wenn er ohne Rente noch einige Zeit durchhalten könnte, als Toter Mann lebt es sich kompliziert. Deshalb macht er sich auf den Weg nach Deutschland, um die Sache zu klären. Kommissar Krüger bearbeitet zeitgleich einen weiteren Fall, den er von den Kollegen aus der Schweiz geerbt hat. Es geht um eine unbekannte Tote, die man in Basel aus dem Rhein gefischt hatte. Sie trug einen blauen Bikini. Der übliche Badeunfall in einem unberechenbaren Fluss? Bis man feststellt, dass ihr jemand einen 12 Zentimeter langen Nagel direkt ins Herz gestoßen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die wichtigsten Protagonisten der Reihe Krügers Fälle
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Impressum
Die wichtigsten Protagonisten der Reihe Krügers Fälle
Fall Nr. 5 - Villa Heckel
Hauptkommissar Max Krüger, 48, Dienststelle Freiburg im Breisgau.
Seine Lebensgefährtin Elisabeth Graßel, 48.
Kommissar Eric Guerin, 35, Kripo (Police judiciaire) Colmar, Elsass, Frankreich.
Kommissar Kaspar Gruber, 45, Kripo Basel, Schweiz.
Seine Lebensgefährtin Sonja Sperling.
Krügers Team in Freiburg:
Michélle Steinmann, 29, Krügers Liebling und vorgesehene Nachfolgerin. In dieser Folge ersetzt durch Nina Böhringer.
Kriminalrat Peter Vogel, 58, Chef der Dienststelle Freiburg.
Dr. Franz Holoch, Pathologe, unberechenbarer aber sympathischer Egozentriker.
Erwin Rohr, Chef Spuren, und sein besonders begabter Mitarbeiter Helmut Paschke.
Krügers Assistenten Otto Grünwald, 33, Thomas Sieber, 32.
Sekretärin Susanne Trautmann, 43, guter Geist des Reviers.
Grubers Team in Basel:
Sein Assistent Bruno Finger, Adrian Betschart, leitender Staatsanwalt und Grubers Chef.
Pathologe in Basel: Dr. Norbert Diener.
Spuren: Markus Känzig, Sekretariat: Kirsten Hohenauer.
Pathologe in Colmar: Dr. Claude Roulin.
Prolog
Bei Merzhausen, Ende März 1945
Zuerst sah er nur ihr blondes Haar. Sie schlief, lag auf dem Rücken, zwischen zwei kahlen Büschen. Langsam schlich Günther näher, die zarte Haut zog ihn magisch an. Aber er musste vorsichtig sein. Wenn sie aufwachte, würde sie böse werden.
Trotz seiner erst sechs Lebensjahre wusste er schon, dass man Frauen nicht ansehen durfte, wenn sie ohne Kleider waren. Es war ein schöner Nachmittag, die Sonne ließ das helle Haar glänzen, sie hielt die Augen geschlossen. Günther nahm all seinen Mut zusammen, wie gebannt betrachtete er die kleinen Hügel auf ihrer Brust, das blonde Dreieck unten am Bauch, die zierlichen Füße. Ein Geräusch schreckte ihn auf. Rasch duckte er sich, schob sich rückwärts in die Hecke.
Ein Mann tauchte auf. Günther kannte ihn, Wolfgang, der ganz in seiner Nähe wohnte. Er packte die Frau grob an den Fersen, Günther konnte einen Schrei gerade noch unterdrücken, und schleifte sie rückwärtsgehend hinter sich her. Ihr Kopf hüpfte auf und ab wie ein fremdes Teil, das mit dem Rest nichts mehr zu tun haben wollte. Die Haare und die Arme schwangen leblos nach hinten.
Dieses Bild würde er niemals wieder vergessen. Auch wurde ihm sofort klar, dass er etwas beobachtet hatte, das nicht für Kinder bestimmt war. Aber wenn er niemandem davon erzählte, konnte ihn auch keiner bestrafen.
Wolfgang war inzwischen mit seiner Last hinter einem kleinen Abhang verschwunden. Günther kroch aus seinem Versteck und trabte davon. Wenn er rechtzeitig zu Hause war, würde die Mutter nicht schimpfen. Dann würde niemand bemerken, dass er herumgestreunt war. Das war verboten, wie so vieles, das Günther gerne gemacht hätte.
1. Kapitel
Kalifornien, 1996, in der Nähe von Fresno
Nachdenklich betrachtete Wolfgang Heckel den Brief, den er soeben erhalten hatte. Graues Altpapierkuvert, Stempelaufdrucke in Blassblau, Deutsche Post, Stadt Freiburg im Breisgau, Nachlassgericht, daneben mehrere Vermerke, schließlich seine Adresse. Die hatten ihn gefunden, einfach so.
Dabei hatte er doch seit Frühling fünfundvierzig jeden Kontakt in die Heimat vermieden.
Ein Kommilitone jüdischer Abstammung, der noch während des gemeinsamen Studiums in die USA emigrierte, hatte ihm damals geschrieben. Hier suchen sie Physiker, was willst du in deinem zerstörten Land, komm her. Du musst dich zu den amerikanischen Truppen durchschlagen oder ausharren, bis sie eintreffen.
Ein amtliches Dokument, das ihm die Einreise in die USA ermöglichen würde, lag bei. Der Brief kam zur rechten Zeit. Forschung würde es in Deutschland vermutlich nicht so bald wieder geben, seine Ausbildung war dort jetzt völlig nutzlos.
Außerdem war da noch „Die Sache“, wie er es stets in seinen Gedanken nannte.
„Die Sache“ auch deshalb, weil er den Namen, den sie ihm nannte, gleich wieder vergessen hatte. In der Euphorie, die sich verbreitete, als der Krieg fast vorbei war, hatte er einfach eine Fremde zu einem Spaziergang eingeladen. Nie war es so leicht, gewesen, eine willige Frau zu finden, wie in diesen Tagen.
Ohne zu zögern öffnete sie ihre Bluse, als sie ein Stück vom Dorf weg zwischen verstreut stehenden Büschen ankamen.
Eiskalt hatte sie danach ein paar Scheine verlangt, wenn er einer Anzeige entgehen wolle, der Herr Doktor. Er kannte sie nicht. Sie dagegen, schien ihn gezielt ausgesucht zu haben.
Wolfgang besaß kein Geld, was sie ihm jedoch auf keinen Fall abnehmen wollte. Dass sie erst sechzehn Jahre alt sei, wie sie behauptete, glaubte er ihr nicht. Er war sicher nicht der Erste gewesen.
An den genauen Hergang konnte sich Wolfgang kaum erinnern. Plötzlich lag sie still da, er kniete auf ihr, seine Hände an ihrem Hals.
Zuerst rannte er entsetzt weg. Dann siegte die Vernunft. Er kehrte zurück, schleppte sie in einen Graben, bedeckte sie mit trockenem Laub. Ihre Kleider verschwanden in einem Reisighaufen, den irgendjemand in der Nähe aufgeschichtet hatte.
Wolfgang hatte darauf gehofft, dass es einige Zeit dauern würde, bis die Leiche gefunden wurde.
Eine von vielen, die den Besatzern oder versprengten Soldaten in die Hände gefallen war, danach hätte es aussehen sollen.
***
Wolfgang nahm sich die Zeit, ein Messer zu holen, sich hinzusetzen und das Kuvert in Ruhe zu öffnen. „Sehr geehrter Herr Heckel“, stand da. Wolfgang konnte ein Grinsen nicht unterdrücken, die deutschen Behörden mit guten Manieren, das war doch was Neues für ihn.
Erbsache: Frau Ottilie Heckel, Freiburg im Breisgau, Lilienberg 19, ledig. Verstorben 18.07.1996 um 03 Uhr 25 Minuten, in Freiburg im Breisgau, in genannter Wohnung.
Also seine einzige Schwester. Wolfgang rechnete kurz, dann war sie nur 76 Jahre alt geworden.
Das Gericht hatte weiter festgestellt, dass das Testament, das ihn zum Alleinerben bestimmte, gültig war.
Festgestelltes Vermächtnis; ein Grundstück mit Wohnhaus und Inventar, Grundbuch Blatt… Diverse Wertpapiere gemäß separater Liste sowie ein Barvermögen von 528`498,23 DM
Wolfgang ließ den Brief sinken. Und dreiundzwanzig Pfennig, dachte er, da war sie wieder, die deutsche Gründlichkeit.
Das beeindruckte ihn mehr als die Summe selbst. Wolfgang hatte schon lange gelernt, dass ihm mehr Geld, als er brauchte, nichts bringen würde, außer vielleicht die Angst, es wieder zu verlieren.
Er bezog eine absolut ausreichende Pension, das Haus war schon längst bezahlt, und seit seine Frau verstorben war, gab es auch keinen Grund mehr, jemandem etwas zu schenken.
Schließlich las er weiter. Er wurde aufgefordert, binnen sechs Monaten persönlich beim Gericht zu erscheinen, um die Erbschaft gegebenenfalls auszuschlagen. Nach Ablauf dieser Frist würde das Erbe als angenommen gelten.
Persönlich, überlegte er, dachten die wirklich, er würde extra vorbeikommen?
Er las weiter: Aha. Ein mit sämtlichen notariell beglaubigten Vollmachten ausgestatteter Vertreter wäre auch eine Möglichkeit.
Ein weiterer Hinweis, ganz zum Schluss, dass das Erbe im Fall einer Ausschlagung auf vorhandene Erben dritter Ordnung übergehen würde.
Wer sollte das denn sein, überlegte Wolfgang. Offenbar war seine Schwester, genauso wie er, kinderlos geblieben. Sonst konnte das Testament gar nicht zustande kommen. Ihre beiden Brüder waren im Krieg gefallen, ledig, viel zu jung.
Und er selbst war dann wohl amtlich noch am Leben, wenn er das Schreiben richtig interpretierte.
Ob er in Deutschland wegen Mordes gesucht wurde, wie er befürchtete, blieb jedoch im Dunkeln.
Sollte das etwa ein Trick sein, um ihn anzulocken?
***
Zwei Monate später. Wolfgang hatte inzwischen dem einzigen deutschstämmigen Freund, der ihm geblieben war, von der Erbschaft erzählt.
„Du willst dir das entgehen lassen?“, hatte Eugen entgeistert gefragt, als er durchblicken ließ, dass ihn das Vermögen nicht sonderlich interessierte.
Wolfgang hatte mit den Schultern gezuckt. „Was soll ich damit anfangen? Ich habe doch alles, was ich brauche. Und jetzt noch nach Europa reisen, Diskussionen mit Behörden. Der ganze Stress mit den anderen Erben, die sicherlich begeistert sein werden, dass da einer aus Amerika herkommt und ihnen alles wegschnappt.“
Eugen Ulbrich, nicht so gut versorgt wie Wolfgang, der eine großzügige Pension vom Staat bezog, hätte sich keinesfalls vorstellen können, freiwillig auf Geld zu verzichten, das man nur abzuholen brauchte.
Schließlich hatten sie sich darauf geeinigt, dass Eugen als Vertreter nach Deutschland reisen sollte, um das Erbe anzunehmen. Selbstverständlich würde er für seine Mühe eine angemessene Provision erhalten. Auf deren Höhe hatte Wolfgang sich nicht festlegen lassen, er wollte auf jeden Fall einen Teil des Geldes gemeinnützigen Zwecken zuführen. Davon sollte es dann abhängen, wie viel der Freund erhielt. „Außerdem wissen wir noch nicht, wie lange das dauert. Es macht einen Unterschied, ob du nur ein paar Tage bleiben musst oder ob es einige Monate werden“, hatte Wolfgang lächelnd festgestellt.
Eugen hatte eine andere Meinung gehabt, ließ sich jedoch nichts anmerken. Zu groß erschien ihm die Gefahr, dass Wolfgang den Plan im letzten Moment wieder fallenließ, wenn er widersprechen sollte.
Für Eugen war die Provision ohnehin klar. Sie würde genau einhundert Prozent betragen, zuzüglich des Vorschusses, den er für die Reisekosten von Wolfgang erhielt. Wenn der das Geld nicht zu schätzen wusste, dann hatte er es auch nicht verdient. Den größten Teil zu verschenken war für Eugen ein Frevel, dazu durfte es nicht kommen.
***
Sein erster Weg, nachdem er sich am Stadtrand von Freiburg in einer behäbigen Pension einquartiert hatte, führte Eugen nicht zum Nachlassgericht, sondern zur Stadtverwaltung. Zum Einwohnermeldeamt, um mit „seinem“ alten Personalausweis, einer sogenannten Kennkarte, einen neuen, gültigen Ausweis zu erhalten.
Wolfgang hatte ihm das Dokument mitgegeben, „nur für alle Fälle“, wie er betont hatte. Sie sahen sich nicht besonders ähnlich, aber nach fünfzig Jahren war es schwierig, das verblichene und abgeschabte Bild der richtigen Person zuzuordnen.
Von den Fingerabdrücken auf dem Dokument ließen sich nur noch zwei dunkle Flecken erkennen.
Zur Ergänzung besaß Eugen auch noch den Brief des Nachlassgerichts, der den Grund für seinen Aufenthalt und das Anliegen erklärte.
Ohne besonderen Aufwand erhielt Eugen einen vorläufigen Ausweis, den er verwenden konnte, bis das endgültige Dokument fertiggestellt war.
So leicht war aus Eugen Ulbrich Wolfgang Heckel geworden.
Sehr schwer fiel dagegen, sich an den anderen Namen zu gewöhnen, sich überall damit vorzustellen. Ein einziger Versprecher konnte das Ende der Erbschaft bedeuten. Eugen stammte aus Süddeutschland, wie Wolfgang. Seine Aussprache, mit leichtem Akzent, passte. Dass ihn jemand nach fünfzig Jahren als Eugen erkennen könnte, hielt er für unwahrscheinlich.
***
Fast täglich besuchte er das Haus, um den Besitz zu sichten. Einziehen wollte er jedoch nicht, um eine mögliche Begegnung mit alten Bekannten von Wolfgang zu vermeiden.
Vom Bargeld, das auf einer einheimischen Sparkasse lag, hatte er gleich eine halbe Million auf sein Konto in Amerika überwiesen, falls er doch plötzlich verschwinden musste. Den Rest ließ er auf dem Konto, für den täglichen Bedarf, für eine eventuelle Flucht. Die Bankkarte, die er erhalten hatte, ermöglichte ihm, überall in Europa Geld abzuheben.
Sein Ziel blieb jedoch, in Amerika zu leben. Sobald alles geregelt war, konnte er sich dort ein ruhiges Plätzchen suchen. Sich mit dem Bargeld und dem Erlös für das Haus sowie dem Inventar, sich einen schönen Lebensabend gönnen.
Unter seinem eigenen Namen, nur in einer anderen Gegend, in Florida zum Beispiel.
An Wolfgang Heckel schrieb er regelmäßig, berichtete von Schwierigkeiten, dass es möglicherweise ein Jahr dauern würde.
Das Haus, oder besser die Villa, fand er vollgestopft mit antiken Möbeln, die er zuerst sorgfältig durchsuchte. Den Dachboden füllte eine riesige Menge abgestelltes Mobiliar. Dazu die Bilder an den Wänden und der Inhalt der Schubladen und Regale. Bis er alles gemessen, eine Liste mit Einzelheiten geschrieben und jedes Stück grob, im Rahmen seiner Möglichkeiten, bewertet hatte, würden sicher einige Wochen vergehen.
Sobald die Übersicht erstellt war, wollte er damit ein
Angebot von den Antiquitätenhändlern der Gegend einholen. Mit etwas Glück lag eine weitere halbe Million drin, so schätzte er.
***
Es war schon später Nachmittag, Eugen hatte sich einen Kaffee gekocht. Dazu genoss er einen alten Kognak, von dem sich noch eine ganze Menge im Keller fand, als ihn die Hausglocke aufschreckte. Besuch, damit hatte er gar nicht gerechnet. Kam auch sehr ungelegen. Rasch schob er die auf dem Tisch ausgebreiteten Papiere zu einem Haufen zusammen.
Klar würde er abwarten, ob sich der ungebetene Gast von selbst verzog. Die Glocke schlug ein zweites Mal an.
Eugen schob sich ans Fenster. Ein Mann mittleren Alters, die Hände in den Hosentaschen, Filzhut, eher einfach gekleidet. Auf jeden Fall kein Beamter oder sonst eine wichtige Person, das sah Eugen auf den ersten Blick. Er scharrte irgendein Muster in den Kiesweg, während er wartete.
Ein neugieriger Anwohner, der sich nicht schämte, seine schlechte Angewohnheit zur Schau zu stellen.
Eugen zuckte mit den Schultern. Der konnte klingeln, so oft er wollte, sein Ziel würde er damit nicht erreichen.
Kurz entschlossen knautschte er ein Stück Papier zusammen, dass er zwischen Glocke und Hammer der altehrwürdigen Anlage klemmte.
Befriedigt stellte er eine Viertelstunde später fest, dass sich der Besucher verzogen hatte.
Sein Blick fiel auf das Muster, das im Kiesweg zurückgeblieben war.
Undeutlich zwar, aber zu entziffern: Ulrike lässt grüßen.
„Was zum Teufel…“, brummte er, „soll das denn bedeuten?“
Als er am nächsten Morgen zum Haus ging und kurz bei der Schrift stehen blieb, tauchte wie aus dem Nichts der Besucher von gestern neben ihm auf. „Hallo Wolfgang“, begrüßte er ihn grinsend.
„Wer sind Sie?“, fragte Eugen verständnislos.
„Du erkennst mich also nicht, gut, das kann ich verstehen. Ich war damals erst sechs, als ich dich zum letzten Mal gesehen habe!“
Eugen atmete auf. Kein guter Bekannter, der den Schwindel gleich bemerken würde.
„Wer sind Sie?“, wiederholte Eugen die Frage.
„Das spielt eigentlich keine Rolle“, lautete die spöttische Antwort. „Hauptsache, ich weiß, wer du bist. Ich habe dich zwar ebenso wenig erkannt wie du mich, aber du musst ja Wolfgang Heckel sein, sonst wärst du nicht hier“, stellte der Besucher fest.
„Was willst du denn nun von mir?“ Eugen wechselte auch ins Du.
„Ich wollte dich an Ulrike erinnern.“
„Ulrike“, wiederholte Eugen. „Tut mir leid, ich habe keine Ahnung.“
Der Besucher grinste aufs Neue, „die hast du ganz bestimmt nicht vergessen, das kannst du mir nicht weismachen.“
Eugen zuckte mit den Schultern. „Ist aber so“, beharrte er.
„Genaugenommen ist das auch egal“, erwiderte der Besucher, es ändert nichts daran, dass ich dir zugesehen habe, wie du ihre Leiche weggeschleppt hast, damals, da oben in den Büschen.“
Er deutete in Richtung Süden. „Erinnerst du dich jetzt?“
Eugen suchte fieberhaft nach einer Lösung. „Gehen wir ins Haus“, sagte er schließlich.
2. Kapitel
Ein ruhiger Sonntagnachmittag im Elsass. Jemand hatte die Idee gehabt, man könnte Karten spielen.
Kommissar Krüger hatte ein äußerst schlechtes Blatt, das wie erwartet keinen einzigen Stich schaffte. Die Damen, Michélle und Elisabeth, kicherten, als Guerin ihnen erklärte, dass sie schon wieder eine Runde und somit auch das Spiel gewonnen hatten.
Seit Michélle gekündigt hatte, sah er sie nur noch selten. Jetzt war sie nicht mehr seine Untergebene, trotzdem sprach sie ihn manchmal noch mit „Chef“ an. Nur zum Spaß, ihr Verhältnis war jetzt völlig unbefangen.
Die im Frühling geplante Hochzeit von Eric Guerin und Michélle Steinmann war, soweit notwendig, besprochen. Über den größten Teil ließ man das Paar ohnehin im Ungewissen.
Krüger wurde aufgefordert, die Karten auszuteilen. „Ach, mir reicht’s, wir haben ja doch keine Chance gegen das Glück, das die immer haben“, brummte er.
„Glück?“, tadelte Elisabeth. „Könnte ja auch sein, dass wir einfach besser spielen, oder nicht?“
Krüger grunzte irgendwas, stand auf und ging durch die offene Terrassentür in den Garten.
Guerin folgte ihm. Er bewunderte den Gartengrill, den Krüger schon vorbereitet hatte.
„Holzkohle ist immer noch das Beste“, sagte er zu Krüger.
Dieser nickte. „Ja, finde ich auch.“
Michélle rief nach Krüger. „Telefon, Chef!“
***
Ein Leichenfund, männlich, mittleres Alter mit Schussverletzungen. Im Süden Freiburgs, schon in den ersten Abhängen des Kypfelsens. Grünwald erklärte ihm den Weg. Krüger war einmal mit Elisabeth in der Gegend spazieren gegangen, deshalb wusste er ungefähr, wohin er fahren musste. Ein Streifenwagen würde ihn bei der Abzweigung von der Hauptstraße erwarten.
Doktor Holoch saß auf einem Feldstuhl hinter seinem Wagen und füllte offenbar ein Formular aus, als Krüger eintraf.
„Guten Abend, Herr Kommissar“, begrüßte er ihn.
Krüger erwiderte den Gruß und sah ihn fragend an.
Holoch nickte. „Gleich, Herr Kommissar, nur noch ein paar Zahlen.“
Krüger nutzte den Moment, um einen ersten Blick auf den Toten zu werfen. Die Leiche lag auf dem Bauch, an einem sanften Abhang, mit dem Kopf nach unten. Die Hände und die Schuhe steckten bereits in Plastiktüten. Verletzungen oder Blut ließen sich nicht erkennen.
Holoch räusperte sich hinter Krüger. „Wir haben ihn für Sie wieder so hingedreht, wie er aufgefunden wurde.“
Krüger bedankte sich höflich. Diese Weisung hatte er selbst einmal gegeben, obwohl es kaum viel half.
„Zwei Einschüsse in der Brust“, begann Holoch, „eines der Projektile hat das Herz getroffen, der Tod ist vermutlich sofort eingetreten. Ausschusswunden sind nicht vorhanden, die Kugeln sind stecken geblieben, also wahrscheinlich ein kleineres Kaliber.
Hier ist auch nur der Fundort, das kann ich bereits sicher sagen. Die Leiche wurde transportiert und umgelegt, das beweisen die Livores. Verstorben dürfte er gestern Abend sein, das werde ich noch genauer eingrenzen können.“
„Angaben zur Person?“, fragte Krüger nach.
„Männlich, circa fünfzig Jahre alt, die Hände lassen auf körperliche Arbeit schließen. Die Taschen leer, keine Dokumente oder sonstige Hinweise auf die Identität.“
„Danke Herr Doktor. Wann werden Sie die Obduktion vornehmen?“
„Gleich morgen früh, bis zehn können Sie mit Ergebnissen rechnen. Die Projektile kann ich Ihnen noch heute Abend sichern, wenn Sie das möchten?“
Krüger winkte ab. „Lassen Sie nur, auf die paar Stunden kommt es nicht an, ist ja Wochenende.“
Holoch zuckte nur mit den Schultern. Eher ungewöhnlich, aber ihm war es recht.
Krüger hatte absolut keine Lust, sich noch heute Nacht mit dem Fall zu befassen. Wenn die Leiche am Tatort gefunden worden wäre, dann natürlich bliebe keine andere Wahl, als die Spuren so schnell wie möglich zu sichern.
Aber unter diesen Umständen konnte er es bis zum Abendessen zurück ins Elsass schaffen, wie er gehofft hatte.
Der Rest war schnell erledigt. Grünwald hatte die Spaziergänger, die den Toten gefunden hatten, längst befragt und die Personalien aufgenommen. Die Spurensicherung wartete noch darauf, dass die Leiche abtransportiert wurde, um die Liegestelle zu fotografieren und auf liegen gebliebene Gegenstände zu untersuchen. Erwin Rohr war nicht anwesend, wie Krüger festgestellt hatte, aber seine Leute schafften das trotzdem, daran war nicht zu zweifeln.
Um den Schein zu wahren, ließ er sich von ihnen eine erste Einschätzung geben.
„Ein paar Reifenspuren, Herr Kommissar, sonst bisher leider nichts“, sagte der Techniker. „Natürlich haben wir Klebeabzüge der Kleidung gemacht, die Taschen waren jedoch leer. Eine Hoffnung, möglicherweise. Die Schuhe enthalten Erdreste.“
Krüger dankte, und der Techniker beugte sich wieder über die Fundstelle.
***
Eugen Ulbrich saß zur gleichen Zeit in seiner Pension und wartete auf die Abendnachrichten. Inzwischen durfte er damit rechnen, dass der Idiot, der ihn zu erpressen versucht hatte, gefunden worden war.
Zum Glück war im umfangreichen Hausrat auch eine Pistole mit Munition aufgetaucht. Nur so eine Damenwaffe, aber ausreichend. Er hatte ihn zur ausgemachten Zeit erwartet, oben an der Treppe, die zum ersten Stock führte. Den Eingang hatte er mit Plastikfolie ausgekleidet, um Blutspritzer an den Tapeten zu verhindern. Zur Tarnung hatte er bereits eine Wand frisch gestrichen, damit sein Besucher nicht gleich Verdacht schöpfte.
Wie erhofft trat dieser arglos ein. Die Gier ließ ihn alle Vorsicht vergessen. Eine Million Mark, in einem Koffer, wie man es im Film immer sieht, hatte er für sein Schweigen verlangt.
Eugen hatte ihm erklärt, dass nur einige Tausender auf der Bank lagen, er die Summe unmöglich aufbringen konnte.
Der Unbekannte hatte ihn nur ausgelacht. Im Dorf würde von mindestens zehn Millionen gemunkelt. Das sei ein richtiges Schnäppchen für ihn, er solle sich nicht so anstellen. „Bleibt dir noch genug, du bist auch nicht mehr so jung, hast nicht mehr so viel Zeit, um es auszugeben. Ich habe fünfzig Jahre geschwiegen, vergiss das nicht!“
Zwei Kugeln hatten dafür gesorgt, dass der auch keine Gelegenheit mehr haben würde, um Geld auszugeben, dachte Eugen, zufrieden.
Die Meldung blieb aus. Offenbar lag die Stelle einsamer, als er gedacht hatte.
***
Peter Hanke war ab und zu am Nachmittag an der Villa Heckel vorbeigeschlendert. Erst am Freitag fiel ihm auf, dass ein Mietwagen auf der Einfahrt um die Ecke stand.
Das musste er sein. Der verlorene Sohn, der auftauchte, sobald es etwas zu holen gab. All die Jahre, wo hatte er sich herumgetrieben. Eigentlich war es Peter völlig egal, weshalb der nie aufgetaucht war, aber so ließ sich die Empörung besser genießen. Das schon sicher geglaubte Erbe, die Villa, ein Millionenvermögen, alles futsch, nur weil dieser Lump, den niemand kannte, im Testament der Großtante erwähnt wurde.
Wenn der allerdings dachte, ohne Gegenwehr an das Erbe zu kommen, dann hatte er sich gründlich getäuscht. Die legalen Mittel, wie die Anfechtung des Testaments waren inzwischen ausgeschöpft, aber Peter konnte doch auf einige kriminelle Erfahrungen zurückblicken. Deshalb traute er sich den Nerv zu, den Kerl unbemerkt verschwinden zu lassen.
Viel hatte es ihm bisher noch nicht eingebracht, ab und zu ein paar Scheine oder Schmuck, die er bei Gelegenheit aus Häusern mit einfachen Schlössern geklaut hatte.
Was er dabei gelernt hatte, war, sich unauffällig zu verhalten, nicht in Panik zu geraten. Nur deshalb war er noch nie dabei erwischt worden.
Und dieses Mal durfte auch nichts schiefgehen. Logisch, dass der erste Verdacht auf sie fiel, wenn der Ami plötzlich abkratzte.
Sie, das waren er und sein Bruder Harald, die zusammen mit der „kleinen“ Schwester Majke so etwas wie einen gemeinsamen Haushalt führten.
Die kleine Schwester zählte inzwischen auch schon achtundzwanzig Jahre, hatte bereits einige Kerle hinter sich, war aber immer wieder zu ihnen zurückgekehrt, wenn sie wieder mal einer zum Teufel geschickt hatte.
Dass es an ihr lag, daran zweifelte Peter nicht. Sie konnte ein richtiger Satansbraten sein, wenn sie schlechte Laune hatte.
Zuhause bekam sie ab und zu eins aufs Maul, wenn sie es übertrieb. Kein großes Problem für sie, sie war das von klein auf gewöhnt.
Dass die Großtante jetzt ziemlich früh verstarb, war ein Glücksfall, sie hatten sich auf eine viel längere Wartezeit eingestellt.
Deshalb hatten sie die ganze Nacht gefeiert, nachdem sie die Nachricht erhielten, und auch die Tage danach. Sie konnten sich schließlich kaum auf den Beinen halten bei der Beerdigung. Der Pfaffe hatte sich sehr darüber aufgeregt, ihnen damit gedroht, die Zeremonie abzubrechen, wenn sie sich nicht zusammenreißen würden.
Das war ein Fehler gewesen, wie Peter inzwischen zugeben musste. Niemand wusste vorher von einem Testament. Er traute dem Pfaffen durchaus zu, dass der da was gemauschelt hatte, um sie um ihr Geld zu bringen. Mindestens hatte er erreicht, dass nach dem Verschollenen gesucht wurde. Ob er den Wisch auch noch selbst geschrieben hatte? Immerhin möglich. Die Alte hatte schließlich regelmäßig gebeichtet, das hieß, der Pfaffe wusste alles über sie.
Peter hatte schon einen Plan. Bisher hatte er seinen Geschwistern nichts davon gesagt, und dabei sollte es auch bleiben. War doch gut möglich, dass die Alte in der Küche irgendwo ein Rattengift oder sowas ähnliches aufbewahrte, das nicht beschriftet war, soweit die Ausgangslage. Wenn dann der verlorene Sohn in der Villa nach Essbarem stöberte, würde er leider dem unvorsichtigen Umgang der Großtante mit Gift zum Opfer fallen. Und damit die Erbfolge korrigieren.
Jetzt musste Peter nur noch dafür sorgen, dass das Zeug im richtigen Behälter lag. Im Kaffeepulver zum Beispiel. Aber nicht nur dort. Sobald er wusste, was sich der Ami so schmecken ließ, wenn er im Haus aß, wurde auch die Marmelade oder die Butter zur möglichen Variante.
Am späteren Abend des Sonntags erkundete er die Lage. Das Schloss ließ sich mit dem Rüttelgerät leicht öffnen, schon stand er im Eingangsbereich. Es roch nach frischer Farbe. Seltsamerweise war nur eine kleine Wand frisch gestrichen. Sollte wohl ein Muster sein, dachte Peter kopfschüttelnd, während er sich Latexhandschuhe überstreifte.
In der Küche standen neben der Spüle einige Teller und Tassen, offenbar zum Trocknen. So, wie Peter gehofft hatte, war der Ami zu geizig, um im Restaurant zu essen.
Der Kühlschrank sah ordentlich aufgeräumt und gut bestückt aus. Geschnittener Speck in Streifen, das konnte eine Möglichkeit bieten.
Peter wusste nicht, was in dem weißen Pulver enthalten war, dass er schon vor vielen Jahren im Keller seines Elternhauses gefunden hatte. Eine grüne Glasflasche mit Totenkopf, nicht aufgeklebt, sondern direkt im Glas. Damit hatte schon sein Vater schon irgendwelches Ungeziefer bekämpft.
Dass es noch wirkte, hatte der dämliche Kläffer in der Nachbarschaft, der Peter schon jahrelang auf die Nerven ging, bewiesen. Gerade bis zu seiner Hundehütte hatte der es noch geschafft. Danach war Ruhe gewesen, auch in der Nacht. Eine winzige Dosis in einer Scheibe Wurst hatte schon ausgereicht.
Peter untersuchte den Kühlschrank genauer. Eine große Tube Senf, das war das Richtige. Er schraubte den Deckel ab, setzte die Tube an den Mund und presste den Senf ein Stück zurück. Das Gift hatte er in einem kleinen Plastikbehälter dabei, der eigentlich für eine Dosis Ausbesserungslack gedacht, für seinen Zweck jedoch auch bestens geeignet war.
Peter arbeitete in einem Farbenfachgeschäft, da lagen die Dinger in Massen herum.
Sorgfältig füllte er die Tube auf. Deckel drauf, ein wenig geknetet, fertig. Natürlich kontrollierte er seine Arbeit. Der Senf hatte das Pulver völlig zum Verschwinden gebracht. Ausgezeichnet, dachte er, das würde auch den stärksten Ami aus den Socken hauen. Hoffentlich sparte der nicht mit dem Zeug, so dass es womöglich noch reichte, um Hilfe zu rufen.
Das Telefon? Mit seinem Taschenmesser säbelte er solange an dem an der Wand verlegten Kabel herum, bis das Freizeichen verstummte. Zu sehen war das bestimmt nicht, und wenn, konnte es von einem Nager stammen.
Genauso leise, wie er gekommen war, verschwand Peter wieder.
***
Montagmorgen in Basel, Binningerstraße, Kripo Basel. Kommissar Kaspar Gruber blätterte in einer Zeitung, als Staatsanwalt Betschart bei ihm eintrat. „Guten Morgen, Kaspar. Schön, dass Sie schon da sind!“
Gruber legte die Zeitung weg. „Morgen Herr Staatsanwalt. Wie war ihr Wochenende?“
Betschart winkte ab. „Meine Frau hat mich auf eine Kunstausstellung geschleppt. Zu viel Champagner, zu viele Leute, zu wenig gute Bilder.“
Gruber konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Er war froh, dass ihn in seiner Freizeit keine solchen Verpflichtungen plagten. Betschart hatte doch niemals wirklich frei, dachte er.
Der Staatsanwalt legte ihm einen Hefter auf den Tisch. Ganz oben Fotos, auf denen eine Badende im Bikini zu sehen war. Nur auf den ersten Blick schien es, dass sie badete. Die weiteren Bilder zeigten, dass sie leblos im Wasser trieb. Der dunkelblaue Bikini war vorne mit Schlamm bedeckt, vermutlich, weil sie bei der Bergung an Land geschleppt worden war.
„Wurde heute Nacht am Kraftwerk Birsfelden angetrieben“, bemerkte Betschart. „Dürfte ertrunken sein, irgendwann am Sonntag.“
Gruber sah ihn fragend an. Badeunfälle fielen normalerweise nicht in sein Gebiet.
„Unbekannt, wird auch niemand vermisst bisher“, fuhr Betschart fort, „zurzeit liegt sie bei Doktor Diener, er kann Ihnen sicher mit weiteren Details helfen.“
Gruber nickte. „Ich werde mich darum kümmern, Herr Staatsanwalt.“
Betschart zog sich zurück. Gruber las die paar Infos durch, die die Kollegen schon zu Papier gebracht hatten. Viel mehr, als er schon wusste, brachte es nicht. Der Fundort, dazu die Bilder, weibliche Leiche, Alter circa vierzig Jahre, Datum und Uhrzeitangaben.
Gruber machte sich auf den Weg in die Rechtsmedizin zu Doktor Norbert Diener. Ein umgänglicher Typ, der trotz seiner makabren Tätigkeit gern auch mal auf ein Bier mitkam, mit ganz normalen Menschen ohne Hochschulstudium, so wie Gruber.
Die Frau lag auf dem Seziertisch. Den Bikini trug sie immer noch, als Gruber ankam. Sonst war niemand im Raum.
Er betrachtete sie von allen Seiten. Sie konnte auf jeden Fall schon älter sein, als es auf den ersten Blick schien. Das Wasser hatte die Haut aufquellen lassen, was die Falten am Körper zum Teil verschwinden ließ. Wie aufgebahrt lag sie da, die Nackenstütze hielt den Kopf in Position, die Augen waren geschlossen.
Braunes Haar, etwa schulterlang, grüne Ohrstecker, die teuer wirkten, fielen Gruber auf. Der Bikini war jetzt sauber, ohne den Schlamm, den Gruber auf den Fotos gesehen hatte. Der Körper wirkte frisch abgespült, deshalb wohl auch der Glanz der Haare. Am Unterteil des linken Körbchens zeigte sich ein dunkler Fleck. Gruber sah genauer hin. An der Unterkante des Stoffes hatten sich einige Tropfen gebildet, die einen blassen, rötlichen Schimmer erkennen ließen. Blut kann es nicht sein, dachte er, das färbt deutlicher und dunkler.
Das Geräusch der automatischen Schiebetür riss ihn aus den Gedanken. Diener betrat den Raum, einen dampfenden Pappbecher in der Hand.
„Guten Morgen, Norbert“, grüßte Gruber.
„Danke, dir auch. Willst du auch einen?“ Norbert hob den Becher an.
„Nein, danke.“
„Du hast sie genauer betrachtet“, stellte Norbert fest. „Ist dir schon etwas aufgefallen?“
Gruber nickte. „Ja da, was könnte das sein?“
„Der Fleck?“
„Ja, auch, aber diese Flüssigkeit?“
Diener stellte seinen Kaffee ab. „Sie ist frisch gewaschen, möglicherweise färbt der Stoff ab“, sagte er.
„Ein Bikini, der färbt?“, warf Gruber ein.
„Blödsinn, klar!“ Diener schüttelte den Kopf. „Ist schließlich Montag, bin noch nicht ganz in Betrieb.“
Doktor Diener griff nach einem Tupfer, der sich am Fleck schnell vollsaugte. Er hielt ihn in die Höhe, roch daran. „Rost, ganz eindeutig“, stellte er fest.
„Rost“, wiederholte Gruber, „woher sollte der den kommen?“
Diener zuckte mit den Schultern. „Weiß ich auch noch nicht, aber dazu brauche ich keine Analyse, das ist typisch!“
Er streifte sich einen Latexhandschuh über, bevor er das Bikini-Oberteil leicht anhob. Eine runde Scheibe erschien, die direkt auf der Haut auflag, knapp einen Zentimeter im Durchmesser, deutlich angerostet. „Das ist Eisen, beziehungsweise Stahl“, stellte Diener fest. „Seltsam, dass die nicht weggerutscht ist?“
Mit einer Pinzette versuchte er, die Scheibe wegzunehmen. Erfolglos, sie schien zu kleben. „Sitzt fest.“
„Wenn du eine Zange…“, schlug Gruber vor.
„Nein, nein, wir machen ein Röntgenbild“, wehrte Diener ab.
Es dauerte eine Weile, Gruber trank inzwischen auch einen Kaffee, bis das Bild fertig war. Mit einem Siegerlächeln hielt ihm Doktor Diener das Bild vor die Nase. „Was siehst du?“, wollte er wissen.
Gruber stutzte. „Das sieht ja wie ein Nagel aus“, wunderte er sich.
Norbert nickte zustimmend. „Würde ich auch sagen. Ein Nagel, circa zwölf Zentimeter lang, steckt genau im Herzen!“
***
Am Montag nahm Eugen sich „frei“. Er machte einen Ausflug an den Rhein, spazierte, gönnte sich ein schönes Abendessen.
Deshalb lag Peter am Abend vergeblich auf der Lauer. Nichts regte sich. Missmutig zog er schließlich ab. Allzu oft durfte er das nicht machen. Er würde schnell jemandem auffallen. Merzhausen gehörte noch zur Stadt, aber die Leute hier kannten sich, das war schon fast wie im Dorf. Die würden ihn, da er ihnen fremd war, schnell als Spanner oder Einbrecher einstufen.
Deshalb wartete er für die nächste Kontrolle bis Mittwoch.
Diesmal sah es besser aus, der Mietwagen parkte wieder an der gleichen Stelle.
Schon als er durch die Tür der Villa schlüpfte, fiel ihm ein ungewöhnlicher Geruch auf.
Der Ami lag auf dem Küchenboden, zusammengekrümmt. Peter beachtete ihn nicht weiter. Dass er tot war, sah man auch so. Der Senf auf dem Teller zeigte schon erste Risse, also musste es gestern passiert sein. Die Warterei wäre nicht nötig gewesen, dachte er. Aber woher hätte er das wissen sollen.
Peter hatte den Ablauf genau geplant, Handschuhe trug er schon. Zügig presste er eine ordentliche Portion Senf aus der Tube in einen Plastikbeutel, den er mitgebracht hatte. Den Rest Senf auf dem Teller wischte er mit einem Papier auf, ließ ihn auch im Beutel verschwinden.
Einen frischen Klecks Senf auf den Teller. Einen kleinen Teil der Wurst, die der Ami fallen gelassen hatte, brach er ab. Noch kurz die Wurst in den Senf eingetaucht, schon sah der Teller genauso aus wie zuvor.
Er überlegte kurz. Wenn er das Ding wieder fallen ließ, würden Spuren des Senfs an Stellen bleiben, die vielleicht nicht zum Ablauf passten. Also besser nicht. die Wurst landete abgewischt und ohne den Senf auf dem Boden.
Alles bedacht, keine Fehler? Der Geruch. Schon bald würde ein Gestank daraus werden. In dem Haus, dass er erben wollte.
So ganz weg bekam man so etwas nie. Das musste er irgendwie verhindern. Der Tote musste bald gefunden werden. Sonst…
Peter öffnete ein Fenster, das den Blick von außen direkt auf die Leiche ermöglichte. Morgen würde er jemanden unter einem Vorwand zum Haus locken. Wie, war ihm noch nicht ganz klar, aber er hatte ja noch Zeit, um darüber nachzudenken.
3. Kapitel
Am Mittwochnachmittag ergab sich eine erste Spur im Fall des Leichenfundes vom Sonntag. Grünwald und Sieber hatten überall in Freiburg Suchplakate geklebt, jetzt hatte sich jemand gemeldet.
Er würde den Toten nur flüchtig kennen. Könne sein, dass er irgendwo in Merzhausen, ganz am Rand, wohnte. Die Adresse wisse er nicht, aber er war dort in der Gegend kürzlich mit einer Autopanne liegengeblieben. Derjenige, der ihm geholfen hatte, habe genauso ausgesehen, sagte der Mann aus.
Deshalb war am Donnerstag Klinkenputzen angesagt. Sieber mit Grünwald, Krüger nahm das „Küken“, die Nachfolgerin für Michélle Steinmann, mit. Das Küken hieß Nina Böhringer, war sechsundzwanzig, hatte sich schon seit Längerem für den Kriminaldienst beworben. Die letzten Jahre hatte sie bei der uniformierten Truppe verbracht. Trotz der paar Jahre Berufserfahrung war sie natürlich noch kein Ersatz für Michélle.
Grünwald und Sieber tuschelten heimlich, dass sie vermutlich eine Lesbe sei. Das kam jedoch eher daher, dass sie nicht so hübsch war wie Michélle und auf keinen ihrer Annäherungsversuche reagierte. Davon hatte Krüger allerdings noch nichts mitbekommen.
Systematisch suchten sie die Straßen ab, befragten die Anwohner.
Bisher ohne Erfolg. Krüger ließ die neu aussehenden Häuser aus, er ging davon aus, dass in ihnen vor allem kürzlich zugezogene Bewohner wohnten.
Ein leicht heruntergekommenes Haus, das trotzdem immer noch stattlich wirkte, mit offensichtlich großzügigem Grundstück, zog ihn magisch an. Nichts wies darauf hin, dass jemand zuhause war, außer dem Mietwagen, der so parkte, dass man ihn von der Straße aus nicht sehen konnte.
Nina klingelte mehrmals, dann zuckte sie mit den Schultern. „Keiner da, Chef!“
Krüger zog die Brauen hoch. „Der Mietwagen, damit muss doch jemand gekommen sein“, stellte er fest.
Nina schlenderte am Haus entlang und stieß plötzlich einen erstickten Schrei aus. Krüger lief los. Sie stand wie erstarrt vor einem offenen Fenster.
„Da… da drin liegt einer“, stammelte sie.
Vor wenigen Minuten waren sie an einer Arztpraxis vorbeigekommen. Krüger schickte Nina zurück, um den Mediziner zu holen. Sie, etwas blass, versuchte tapfer, sich nichts anmerken zu lassen. Deshalb bestand sie darauf, voll einsatzfähig zu sein. Außerdem sei das nicht ihre erste Leiche, es sei nur völlig unerwartet gekommen, deshalb habe sie geschrien. Behauptete sie zumindest. Krüger ließ sie gewähren. Immerhin war sie nicht zusammengeklappt.
Schon nach fünfzehn Minuten kehrte sie zurück. Mit ihr ein älterer Herr, der sich als Doktor Henschel vorstellte.
Krüger, in der Zwischenzeit durch das Fenster eingestiegen, hatte mit dem Schlüsselbund, das auf dem Tisch lag, die Haustüre aufgeschlossen, so dass der Doktor einfach eintreten konnte.
Der Tote lag auf dem Boden. Er schien keinerlei Verletzungen zu haben. Offenbar hatte ihn der Schlag beim Essen getroffen, die angefangene, einfache Mahlzeit ließ darauf schließen.
Die an einem Stuhl hängende Jacke enthielt eine deutlich herausragende, dicke Brieftasche mit mehreren tausend Mark sowie einen vorläufigen Ausweis auf den Namen Wolfgang Heckel, Jahrgang 1917. Das Bild wirkte neu, es stimmte absolut mit dem Gesicht des Toten überein.
Auf die Frage, ob er die Bewohner kenne, hatte der Arzt geantwortet, dass die letzte Besitzerin kürzlich verstorben sei und das Haus eigentlich leer stehen würde.
Der Doktor kam nach gründlicher Untersuchung zu dem Schluss, dass ein natürliches Ableben anzunehmen sei. Den Todeszeitpunkt konnte er nur schätzen, die Leichenstarre war schon wieder abgeklungen. Etwa drei Tage, so seine Vermutung. „Bewegt wurde die Leiche definitiv nicht, die Flecken sind scharf begrenzt, da bin sicher“, sagte der Doktor.
Krüger hatte seine Beobachtungen bisher nicht erwähnt. Zusammen mit der Leichenschau ergab sich ein schlüssiges Bild.
Wolfgang Heckel, immerhin schon neunundsiebzig, war einem Herzanfall erlegen. Eine Fremdeinwirkung ließ sich nicht feststellen.
Nina kam die auf die Idee, dem Doktor das Bild des Toten zu zeigen, nach dem sie suchten.
„Das ist Günther Zwiesel, einer meiner Patienten“, antwortete der Doktor, ohne zu zögern.
Krüger rief Grünwald und Sieber zurück, während Nina den Arzt zu seiner Praxis begleitete, um die Adresse von Zwiesel zu bekommen.
***
Die Wohnung Zwiesels gab nicht viel an Erkenntnissen her. Außer der Tatsache, dass nicht abgeschlossen war, eigentlich nichts Ungewöhnliches. Zwei Zimmer, eine Kochecke, die übliche Unordnung eines langjährigen Junggesellen. Zwiesel war seit Jahrzehnten geschieden, keine Kinder, das hatte der Arzt noch beitragen können.
Die Identifizierung des Toten war ein wichtiger Schritt. Jetzt konnte seine Vergangenheit durchleuchtet und nach einem Motiv gesucht werden. Auch nach einer ganzen Woche zeichnete sich nichts ab. Günther Zwiesel war ein absolut unauffälliger Mensch gewesen, keine Umtriebe, Ämter oder Mitgliedschaften. War es überhaupt jemandem aufgefallen, dass er nicht mehr lebte?
Ein Einkommen hatte er durch die Herstellung von Werkzeugstielen aus Holz erzielt, die er in einer winzigen Werkstatt im Untergeschoss seines Wohnhauses angefertigt hatte. Kein Job, um reich zu werden, es schien jedoch zum Leben gereicht zu haben.
Eine Beziehung nach der Scheidung ließ sich nicht finden. Ab und zu hatte er eine Eckkneipe besucht, nicht den Stammtisch, den benutzten nur regelmäßig erscheinende Gäste. Gesprochen hatte er höchstens mit der Bedienung, die nicht einmal seinen Namen wusste. Stets war er allein gekommen und auch wieder gegangen.
Und trotzdem: Günther schien jemanden so sehr gestört zu haben, dass er ihn erschossen hatte.
Krüger dachte an eine Verwechslung. Oder hatte Zwiesel irgendwas mitbekommen, das nicht ans Licht dringen durfte? In Merzhausen?
Der direkte Ablauf konnte ein Auftragsmord sein. Einfach erschossen und abgelegt. Dagegen sprach jedoch die verwendete Munition. Ein kleines Kaliber, das seit dem Krieg kaum noch Verwendung fand. Ziemlich unsicher, ob die Patronen überhaupt noch funktionierten. Ein Profi würde sich niemals auf so etwas einlassen.
Andererseits war die Waffe vermutlich nirgends registriert. Es handelte sich schon fast um eine Antiquität, wie Erwin Rohr, der Chef der Spurensicherung in Freiburg, Krüger lächelnd erklärt hatte.
Die sich daraus ergebende Spur in alte Zeiten schien wenig ergiebig, Günther war bei Kriegsende gerade sechs Jahre alt gewesen.
Trotzdem, der Schlüssel musste irgendwo in der Vergangenheit liegen. Krüger konnte sich einfach nichts anderes vorstellen. Nur aus Gefühl, ohne klaren Hinweis, irgendwie musste es mit einer Frau zusammenhängen. Die sich jetzt gerächt hatte?
Elisabeth, der er davon erzählte, hielt das immerhin für möglich. Für Krüger ein ausreichender Grund, in der Sache weiterzusuchen. Wenn Polizeirat Vogel das wüsste, dachte er. Ein Grinsen konnte er sich dabei nicht verkneifen.
***
Auch Kommissar Gruber in Basel kam in seinem neusten Fall nicht weiter. Die Tote war nach der Entdeckung der Todesursache vom Badeunfall zum Mordfall geworden, was natürlich umfangreiche Ermittlungen auslöste. Die Frau war bisher nirgends als vermisst gemeldet, Gruber hatte keinen Namen, keinen Tatort, kein Umfeld.
Sie schien aus besseren Kreisen zu stammen. Die teuren Ohrstecker und die sorgfältig manikürten Fingernägel wiesen darauf hin. Der Pathologe hatte Silikonkissen aus den Brüsten entnommen, die leider keinerlei Beschriftung aufwiesen.
Inzwischen hatten sie sämtliche Schönheitsstudios in Basel und Umgebung abgeklappert, ohne jeden Erfolg.
Die Obduktion hatte diverse Hinweise geliefert, so war der Frau vor längerer Zeit die Gebärmutter entfernt worden. Deshalb ließ sich auch nicht mehr feststellen, ob sie jemals Kinder zur Welt gebracht hatte. Das Alter korrigierte der Pathologe auf knapp fünfzig Jahre. Das Skelett wies keine verheilten Brüche auf, nichts ließ auf irgendwelche Beschwerden wie Gelenkprobleme oder Haltungsschäden schließen. Routinemäßig waren Röntgenbilder des Gebisses verschickt worden, bisher genauso erfolglos wie alles andere.
Die Ohrstecker waren laut einem Experten von ausgezeichneter Qualität, kaum unter zehntausend Franken zu haben, pro Stück. Leider hatte sich der Meister, der sie angefertigt hatte, nicht verewigt. Nur die Materialpunzen waren vorhanden. Dass ihr der Schmuck nicht entwendet wurde, konnte daher rühren, dass der Verschluss sehr kompliziert gestaltet war und sich nicht einfach so öffnen ließ.
Sie schien Ringe oder Armbänder getragen zu haben, entsprechende helle Stellen hatte Doktor Diener festgestellt. Die Schmuckstücke dazu fehlten.
Der Bikini stammte aus England. Eine weit verbreitete Marke, die man fast auf der ganzen Welt kaufen konnte. Dieses Modell war allerdings nicht mehr in Mode. Ein schwaches Indiz, dass sie das Ding nicht selbst oder zumindest nicht freiwillig angezogen hatte.
Der Eisennagel, ein absolut normales Teil, praktisch auf jeder Baustelle zu finden, brachte sie auch nicht wirklich weiter. Es schien bei entsprechendem Zeitaufwand möglich zu sein, den Hersteller zu ermitteln, nach genauer Analyse des Stahls sowie der Pressform. Aber ob das helfen würde? Diese Nägel wurden überall verkauft, ohne dass es jemanden interessierte, woher sie stammten.
Erwin Rohr beschäftigte sich intensiv damit, wie ihr der Nagel ins Herz gestochen worden sein könnte. Einfach aufsetzen und einschlagen, wie bei einem Stück Holz, erschien unwahrscheinlich. Der Hammer hätte Spuren hinterlassen, an den Rippen oder auf der Haut. Trotzdem lag der Nagelkopf vollständig auf der Haut auf, eine leichte Aufschlagstelle darunter konnte Diener nachweisen.
Der Stift, genau zwischen zwei Rippen eingedrungen, hatte die Wunde praktisch abgedichtet. Es dürfte nur wenig oder gar kein Blut geflossen sein, stand dazu in Dieners Bericht.
Nagelpistolen, die mit Druckluft arbeiten, waren frei verkäuflich, erforderten jedoch spezielle Nägel, die sich zu Paketen zusammenfügen ließen. Außerdem war die Länge solcher Nägel auf etwa achtzig Millimeter begrenzt. Einen handelsüblichen hundertzwanziger Nagel konnte man nicht verwenden. Außer, jemand hatte sich so ein Ding umgebaut oder gebastelt, das für Holz nicht funktionierte, jedoch als Mordwaffe geeignet war.
Rohrs Fazit: Eigentlich eine ausgezeichnete Idee. Ein Ding, das beim Opfer kaum Argwohn auslöste, für die Polizei, die jede Art Schusswaffen irgendwie kannte oder zuordnen konnte, jedoch völliges Neuland bedeutete, löste bei allen Beteiligten ein unheimliches Gefühl aus. Das war, als ob jemand, der mit einem scheinbar harmlosen Schirm zum Spaß drohte, dann auch in der Lage war, abzudrücken. Dazu noch der Nagel anstelle der Kugel. Einfach widerlich.
Jetzt war es an der Zeit, die Suche auf das angrenzende Ausland auszudehnen. Die Leiche konnte ohne Weiteres auf der deutschen Seite des Rheins in den Fluss gelegt worden sein. Gruber vermutete, dass es sich beim Täter um jemanden handeln könnte, der nicht über besonders gute Ortskenntnisse verfügte. Im Wehr Birsfelden, dem letzten auf dem Weg, wäre die Tote bestimmt hängen geblieben.
Der Platz musste auf jeden Fall unterhalb des Rheinfalls liegen. Diese Passage hätte deutliche Spuren hinterlassen.
Am wahrscheinlichsten jedoch befand sich die Stelle zwischen Augst und Birsfelden, eine Strecke von gerade mal sechs Kilometern. Theoretisch war es möglich, dass die Leiche eine Schleuse unbemerkt hätte passieren können, praktisch schien es jedoch eher unwahrscheinlich.
Bis das offizielle Rechtshilfegesuch wirksam wurde, beschlossen Gruber und Betschart, die fragliche Strecke durch die Wasserschutzpolizei absuchen zu lassen. Die deutschen Kollegen durften dabei auch ohne Auftrag mithelfen. Das war gegenseitig üblich, vor allem, wenn Personen vermisst wurden.
Nur ein Strohhalm, aber besser als nichts.
***
Nina Böhringer schrak auf, als sich Krüger hinter ihrem Rücken räusperte. „Woran arbeiten Sie zur Zeit?“, wollte er wissen.
„An diesem Fall, Wolfgang Heckel“, antwortete sie treuherzig.
„Fall? Das ist kein Fall, Frau Böhringer, da gibt es nichts zu tun!“
Krüger war ziemlich laut geworden. Dauernd musste er Berichte nachfragen, die noch nicht geschrieben waren, und diese Göre beschäftigte sich mit einem natürlichen Todesfall!
Zu allem Überfluss erschien auch noch Rohr mit den Fotos, die sie zum Entwickeln ins Labor gegeben hatte. Von der Leiche und der Wohnung. Die hatte sie geschossen, während der Arzt die Leichenschau durchgeführt hatte.
„Also wirklich, Frau Böhringer, Sie sind hier zum Arbeiten, nicht um in der Arbeitszeit private Ermittlungen anzustellen. Dass Sie dann auch noch das Labor damit beschäftigen, das geht absolut nicht. Wenn das der Polizeirat erfährt, dann können Sie ihre Sachen gleich wieder packen!“
Erwin Rohr zog sich dezent zurück, ohne etwas zu sagen. Nina zitterte. Gleich würde sie anfangen zu weinen, das war deutlich zu erkennen.
Jetzt wurde Krüger das Ganze doch peinlich. „Ist doch wahr“, brummte er, „haben Sie sonst wirklich nichts zu tun?“
„Nein“, antwortete sie schniefend.
„Wie, nein?“, fragte Krüger, fassungslos.
„Schauen Sie mal“, Krüger bemühte sich um einen väterlichen Ton, „die Stapel da drüben, die müssen bearbeitet werden, zum Teil sind wir Tage im Verzug.“
Krüger stutzte, Grünwald und Sieber schienen sich plötzlich in Luft aufgelöst zu haben. Anfangs waren die beiden noch da gewesen, das hatte er gesehen.
„Die geben mir doch nichts“, schluchzte Nina.
Die darauffolgende Besprechung wurde ziemlich unangenehm. Nicht für Nina, die hatte Krüger in die Kantine geschickt.
***
Zuhause erzählte Krüger Elisabeth davon.
„Ganz typisch, deine Machos“, stellte sie fest, „deshalb sind Frauen oft benachteiligt, weil sie außen vor gelassen werden.“
„Ich war sehr deutlich. Du wärst bestimmt stolz auf mich gewesen, wenn du es gehört hättest“, lobte er sich selbst.
So leicht wollte sie es ihm dann doch nicht machen. „Wenn du das von Anfang an klargestellt hättest, ja, dann…“
„Habe ich“, wehrte sich Krüger, „ich habe sie nett vorgestellt, um eine gute Zusammenarbeit gebeten, was hätte ich denn sonst noch tun sollen?“
„Vielleicht mal nachfragen?“, schlug sie vor.
Klar tappte er in die Falle. „Sie hat natürlich schon wenig Ahnung. Am Anfang ist sie keine große Hilfe, da ist man manchmal schneller, wenn man es selbst macht“, ließ er hören.
Ihre Empörung war auch ein wenig gespielt, aber so eine Gelegenheit konnte sie sich nicht entgehen lassen. „Jetzt verteidigst du schon wieder diese zwei Neandertaler. So ganz richtig für voll könnt ihr eine Frau nicht nehmen, was? Immerhin hat sie die Auswahl gewonnen! Sie war doch nicht die Einzige, die den Job wollte, oder?“
„Nein, sie war die Beste, mit Abstand“, gab Krüger zu.
„Na, also, da hast du es wieder. Nicht die Leistung zählt, es ist nur das Geschlecht!“
„Du meinst also, ich soll sie besonders fördern, so wie Michélle?“
„Ja, warum nicht?“
Krüger versprach es, und sie gab sich damit zufrieden.
***
Die Suchaktion lief seit einigen Stunden. Praktisch zentimeterweise suchten die Beamten von der Wasserseite aus auf beiden Seiten das Rheinufer ab. Eine beachtliche Menge Müll war schon eingesammelt worden, nur ein Nebeneffekt. Das verlieh der Aktion wenigstens einen Sinn, falls sich nichts ergeben sollte.
Gruber fuhr im „Kommandoboot“ der Grenzacher Kollegen mit, zusammen mit dem Chef der dortigen Polizeistation, Meinrad Wappel. Sie wechselten zwischen den Booten hin und her, sichteten die Funde, sortierten aus. „Was meinen Sie, Herr Kollege? Wäre doch geeignet, um eine Leiche zu transportieren“, sagte Wappel zu Gruber, als sie einen noch guterhaltenen Kinderwagen betrachteten, der tropfend vor ihnen stand.
Gruber seufzte. „Sicher nicht auszuschließen, doch eher unwahrscheinlich. Damit eine erwachsene Person vor sich her zu schieben, wäre nicht gerade unauffällig, finden Sie nicht auch?“
Wappel zuckte mit den Schultern. „Im Dunkeln, zum Beispiel“, gab er zurück.
Der nächste größere Fund, ein typischer Fahrradanhänger mit zwei Rädern, der sich ohne weiteres auch als Handwagen verwenden ließ, schien ergiebiger. Er trug ein angenietetes Schild mit der Aufschrift, „Pension zur goldenen Sonne“.
Gruber und Wappel ließen sich die Adresse durchgeben. Das Gasthaus lag fast direkt am Rhein. „Strand fünfhundert Meter“, verhieß ein auffälliges Schild mit Richtungspfeil.
Offenbar stellte man den Gästen diese Handwagen, die in einem offenen Unterstand aufgereiht waren, zur Verfügung, damit sie ihre Grills oder Liegestühle nicht schleppen mussten.
Um möglichst alle zufriedenzustellen, standen die Wagen auch für Radtouren bereit. Ein in Folie eingeschweißtes Blatt wies ausdrücklich darauf hin. Dass ein Wagen fehlte, hatte bisher noch niemand bemerkt, die Badesaison war schließlich noch nicht angelaufen. Strand klang, gelinde gesagt, auch übertrieben, es war einfach eine Stelle am Rhein, wo man sich zwischen Bäumen und Wasser hinlegen konnte.
„Jeder der will, kann sich so ein Ding ausleihen“, stellte Wappel messerscharf fest.
Gruber widersprach nicht. Durchaus möglich, auch wenn er nicht daran glauben mochte, dass sich einer mit einer Leiche im Schlepptau solch einem Risiko aussetzte.
Das Einfachste wäre ein Rollstuhl, den man leicht mitnehmen konnte. Fiel absolut nicht auf, und jeder konnte ihn problemlos in einer Klinik oder einem Altersheim entwenden.
„Wir suchen trotzdem weiter“, sagte er nur.
„Aber natürlich“, gab Wappel zurück, dem die Aktion richtig Spaß zu machen schien. War vermutlich sonst nicht viel los in Grenzach, dachte Gruber, deshalb der Eifer.
Zwei Beamte erhielten den Auftrag, die Besitzer der Pension und die Nachbarn zu befragen, danach kehrten Gruber und Wappel an den Rhein zurück.
Die Sensation fand am nächsten Tag statt. Weil die Polizei in Grenzach kein Labor führte, hatte Wappel den Kinderwagen und den Handwagen „großzügig“ den Basler Kollegen zur Verfügung gestellt.
Der Anhänger bestand aus einem umlaufenden Aluminiumrahmen, genau vierzig Zentimeter hoch, der unten durch einen Boden aus Holzlatten abgeschlossen war. In einer Ritze zwischen den Latten entdeckte Markus Känzig, der Laborleiter der Kripo Basel, einen abgebrochenen Fingernagel. Rot lackiert. Ein erster Vergleich an der Leiche ergab, dass an ihrem linken, kleinen Fingernagel ein Teil fehlte.
„Natürlich werden wir das noch verifizieren“, sagte Känzig zu Gruber, „aber wenn der nicht zu der Frau passt, dann fresse ich einen Besen, zusammen mit der Putzfrau!“
Diener nickte zum ersten Teil des Satzes, beim zweiten Teil zog er die Brauen hoch. „Es heißt jetzt Reinigungskraft“, bemängelte er.
Känzig stutzte. „Zur Not halt auch mit einer solchen, wenn das besser passt“, antwortete er kopfschüttelnd.
Gruber knetete seine Hände, „das ist schon fast ein Wunder“, stellte er fest.
„Aber das bedeutet auch, dass wir den Fall an die deutschen Kollegen abgeben müssen“, ergänzte er nach kurzem Nachdenken.
Känzig und Diener machten lange Gesichter.
„Tut mir leid, meine Herren, aber ist nicht zu ändern“, versuchte Gruber, zu trösten.
***
Gruber fuhr selbst zu Krüger, um ihm die Erkenntnisse, die sie im Fall der „Rheinleiche“ schon gesammelt hatten, zu erläutern.
Wie versprochen ließ Krüger die Neue von Anfang an mitmachen. Schnell versorgten sie Nina mit verschiedenen Aufgaben, so dass die Kommissare noch in Ruhe ein paar private Worte wechseln konnten. Das Thema war wieder die Hochzeit von Guerin und Michélle, für die Sonja, Grubers Freundin, schon eine ganze Menge geplant hatte. Das Ziel, die beiden unvergesslich zu überraschen, lag in Reichweite.
4. Kapitel
Am nächsten Tag fuhren Krüger und Nina nach Grenzach, wo die Kollegen bereits fleißig weiterermittelt hatten. Eine erste Spur führte in ein Pflegeheim, wo die Tote möglicherweise gesehen worden war. Ein Heim für geistig Behinderte, die Betreuung benötigten, keine besonders schweren Fälle. „Sie könnten unsere Patienten als Kinder betrachten“, erläuterte Frau Schultheß, die Leiterin, „einfach Kinder in verschiedenen Lebensaltern, die entsprechend Hilfe brauchen.“
Krüger nickte verständnisvoll, Nina machte sich Notizen, wie er schmunzelnd feststellte.
„Im letzten Monat ist eine Bewohnerin verstorben. Die Schwester, die zur Beerdigung angereist ist, könnte die Tote sein, ich bin mir jedoch nicht sicher“, fuhr sie fort.
„Wie lautete denn der Name der Verstorbenen?“, fragte Nina.
„Linda Schulte. Ich habe ihnen ihre Lebensdaten kopiert.