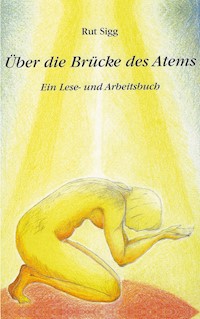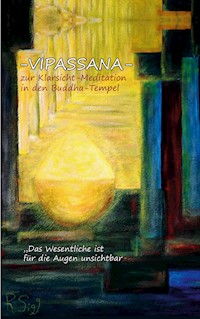
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wer Vipassana Meditation noch nicht kennt oder mehr darüber vernehmen möchte, vertieft sich am besten in diese erbauliche Lektüre von Rut Sigg. In einer einfachen, gut verständlichen, einfühlsamen und genauen Sprache, erklärt sie wesentliche Punkte wie man als gewöhnliche Person zum Meister in dieser Art von Meditation werden kann. Die Verfasserin ist viel gereist, hat allerhand Lebenserfahrung hinter sich, musste viel leiden, war enormen Gefühlsschwankungen ausgesetzt, hat aber auch Erfreuliches zu berichten. Sie zeigt an ihrem eigenen Beispiel, mit all den Höhen und Tiefen in ihrem vielseitigen Leben, wie durch Meditation und Yoga ein Durchbruch im Leben möglich ist und zu einem erfüllten Leben oder zur "Kunst des Lebens" führen kann. Diverse Gefühle z.B. von Angst, Begeisterung, Skepsis, Vertrauen werden angesprochen. Die Entwicklung von der Anfängerin in der Buddha-Nachfolge bis zur erfahrenen Meisterin wird aufgezeigt. Das "Eindringen in die Welt des Spirituellen" ist kein Schleck - Beharrlichkeit und viel Übung sind notwendig auf dieser Reise nach Innen. Die Kraft der Beharrlichkeit ist in jedem Menschen verborgen, schreibt Rut Sigg. Die Verfasserin erwähnt, dass Vipassana Meditation mit einem Stierkampf vergleichbar sei, wobei der Stier das eigene Ego ist und dass aus dem erfolgreichen Kampf innere Klarheit entspringt. Der Mensch muss also an sich selbst arbeiten. Es wird empfohlen, sich einen Meister (in Meditation erfahrene Person) als Berater zu suchen. Die Entscheidung, frei zu werden, muss jeder selbständig leisten. Die Basis der buddhistischen Philosophie liegt im gesunden Menschenverstand - es gibt keine Gebote und Verbote, sondern bloss Empfehlungen. Obwohl der Buddhismus keine Religion ist, sind ethische Grundsätze von Bedeutung (z.B. nicht töten, stehlen, lügen, kein sexueller Missbrauch, keine Rauschmittel..) Neben vielen anderen scheint mir der folgende Satz aus diesem Buch bedeutungsvoll (Zitat): "Leben wird unfassbar spannend und grenzenlos vielfältig, wenn der Mensch nicht mehr in es eingreift". Die Konzentration auf das Heben - Senken der Bauchdecke im Atem. Ohne Druck, ohne Wunsch oder Erwartung wird angestrebt. Zu Beginn ist das fast unmöglich. Emotionen laufen Amok, vertausendfachen sich, lassen keinen klaren Moment zu. Es braucht Zeit, Beharrlichkeit und Geduld mit sich selbst. "Liebe zum Jetzt". Zu genau diesem inneren Tumult. Dann kann es sein, dass sich ein Augenblick von Stille einschleicht, unversehens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Guten Tag Rut,
Seit einigen Tagen habe ich immer wieder in Ihren Büchern gelesen....und gestaunt, wie wunderbar und was Sie schreiben..., wie vielseitig und tiefgründig all dies daherkommt, wie Sie aus Ihrem Innern schreiben und das Geschehen im Innern rüberbringen zu uns Mitmenschen. Chapeau, chapeau, chapeau!!! .... und Danke, danke, danke ...dass Sie schreiben und wir lesen dürfen.
Irgendwie haben sich unsere Wege gekreuzt, ohne dass wir uns begegnet sind, weil meine Gemahlin Supatra, eine Thailänderin, und ich, Vincenz Blum, aus Pfaffnau ebenfalls den Abt in Gretzenbach getroffen haben, weil Supatra früher 5 Jahre buddhistische Nonne war und sich in Meditation auskennt; sie hat die Spuren Buddhas in Indien und Nepal angetroffen; ich habe Varanasi besucht und lebte und arbeitete ein paar Jahre in Bhutan und nun bald 30 Jahre in Thailand. (siehe "Aus meinem Leben" bei meet-my-life)
Gerne lese ich weiter von Ihren Erkenntnissen und erzähle Supatra darüber - hoffentlich schreiben Sie weiter.
Mit lieben Grüssen
Vincenz und Supatra Blum
Inhalt
Vorwort
Kapitel. Einstieg
Kapitel. Das Kloster, der Abt und die Mönche
Kapitel. Vipassana-Meditation
Kapitel. Gar gekocht
Kapitel. Der Meditationsmeister
Kapitel. Die Macht von Karma
Kapitel. Den Stier bei den Hörnern packen
Kapitel. Das Totenbuch
Kapitel. Von der äusseren zur inneren Reinigung
Kapitel. Werdegang
Kapitel. Die beiden Welten sind Eine
Kapitel. Es gibt kein Ausscheren
Kapitel. Der Raum innerhalb meiner Armspanne
Kapitel. Risiken und Nebenwirkungen
Kapitel. Gesunder Menschenverstand
Kapitel. Atem
Kapitel. Freiheit
Kapitel. Eine Entscheidung fällen
Kapitel. Verdrängen ist nicht dasselbe wie Loslassen
Kapitel. Geben und Nehmen
Kapitel. Anhaftung
Kapitel. Leichtigkeit
Kapitel. Schöpfung
Kapitel. Indien
Kapitel. Übergang
Kapital. Seinlassen und mitgehen
Kapitel. Konya
Kapitel. Den Raum umkehren
Vorwort
Wer Vipassana Meditation noch nicht kennt oder mehr darüber vernehmen möchte, vertieft sich am besten in diese erbauliche Lektüre von Rut Sigg.
In einer einfachen, gut verständlichen, einfühlsamen und genauen Sprache, erklärt sie wesentliche Punkte wie man als gewöhnliche Person zum Meister in dieser Art von Meditation werden kann. Die Verfasserin ist viel gereist, hat allerhand Lebenserfahrung hinter sich, musste viel leiden, war enormen Gefühlsschwankungen ausgesetzt, hat aber auch Erfreuliches zu berichten.
Sie zeigt an ihrem eigenen Beispiel, mit all den Höhen und Tiefen in ihrem vielseitigen Leben, wie durch Meditation und Yoga ein Durchbruch im Leben möglich ist und zu einem erfüllten Leben oder zur "Kunst des Lebens" führen kann.
Diverse Gefühle z.B.von Angst, Begeisterung, Skepsis, Vertrauen werden angesprochen. Die Entwicklung von der Anfängerin in der Buddha-Nachfolge bis zur erfahrenen Meisterin wird aufgezeigt. Das "Eindringen in die Welt des Spirituellen" ist kein Schleck - Beharrlichkeit und viel Übung sind notwendig auf dieser Reise nach Innen. Die Kraft der Beharrlichkeit ist in jedem Menschen verborgen, schreibt Rut Sigg.
Die Verfasserin erwähnt, dass Vipassana Meditation mit einem Stierkampf vergleichbar sei, wobei der Stier das eigene Ego ist und dass aus dem erfolgreichen Kampf innere Klarheit entspringt. Der Mensch muss also an sich selbst arbeiten. Es wird empfohlen, sich einen Meister (in Meditation erfahrene Person) als Berater zu suchen. Die Entscheidung, frei zu werden, muss jeder selbständig leisten.
Die Basis der buddhistischen Philosophie liegt im gesunden Menschenverstand - es gibt keine Gebote und Verbote, sondern bloss Empfehlungen. Obwohl der Buddhismus keine Religion ist, sind ethische Grundsätze von Bedeutung (z.B. nicht töten, stehlen, lügen, kein sexueller Missbrauch, keine Rauschmittel..)
Neben vielen anderen scheint mir der folgende Satz aus diesem Buch bedeutungsvoll (Zitat): "Leben wird unfassbar spannend und grenzenlos vielfältig, wenn der Mensch nicht mehr in es eingreift». Die Konzentration auf das Heben – Senken der Bauchdecke im Atem. Ohne Druck, ohne Wunsch oder Erwartung wird angestrebt. Zu Beginn ist das fast unmöglich. Emotionen laufen Amok, vertausendfachen sich, lassen keinen klaren Moment zu. Es braucht Zeit, Beharrlichkeit und Geduld mit sich selbst. "Liebe zum Jetzt". Zu genau diesem inneren Tumult. Dann kann es sein, dass sich ein Augenblick von Stille einschleicht, unversehens. Und wenn der Übende dadurch nicht in Ekstase gerät, sondern unbeirrt weiter übt, können Momente der Stille länger werden, zunehmen und eine Weite, eine Tiefe des inneren Raumes erreichen, die mit der Aussenwelt nichts gemein hat. Ebenen des Seins werden darin erfahrbar, sichtbar, je mehr Stille sich zeigt. Bis zu diesem Punkt braucht es dir «Führung» eines Meisters, der die vollständige Erfahrung kennt. Helfen im Sinne von «etwas tun», kann er nicht, nur, sozusagen wie ein Wegweiser, in die «richtige Richtung» deuten. unermüdlich, was im Sufismus den Satz - sich ans Kreuz von Bruderschaft schlagen zu lassen geprägt hat-. Mit weit ausgebreiteten Armen, Wind, Regen und Hitze nicht fürchtend.
Mensch bleibt Mensch, wie jeder andere. Nur seine Ausdrucksweise wird sich verwandeln. Denn im inneren Raum gibt es keine Wörter, nur direkte Schau. Geschichten, Gleichnisse, erdachte, geben Hinweise. Doch nichts Gesagtes oder Geschriebenes ist, in dem Sinne real.
1. Kapitel. Einstieg
Unter dem abgeschrägten Dach des Meditationsraums lagerte Stille. Nicht einmal die beiden Kerzenflammen rührten sich. Ihr Schein erweckte das goldene Antlitz des Buddhas auf dem kniehohen Altar zum Leben. Seine Augen standen offen. Er lächelte nicht wirklich. Die machtvolle Ausstrahlung, die von ihm ausging, entsprang vielmehr der Präsenz seiner Haltung.
Da ich eher an Buddhas mit geschlossenen Augen gewöhnt war, bereitete mir dieser Buddha Unbehagen. Ich fühlte mich von ihm beobachtet, schutzlos. In seiner Gegenwart fehlte mir die Empfindung von Geborgenheit, die mich üblicherweise an Buddhas anzog. Ich konnte mich nicht unwillkürlich in die Stille fallen lassen, die von diesem Buddha ausstrahlte. Die Stille entsprang nicht Entrücktheit. Der Blick durchdrang mein Sehnen nach emotionaler Preisgabe schonungslos. Er legte es in einem Mass bloss, das mir Angst einflösste. Emotionale Preisgabe war nicht, worum es ging. Ganz offensichtlich nicht. Ich wurde durch und durch geröntgt – und es hätte gnadenlos wirken können, wäre da nicht gleichzeitig diese Haltung bar jeden Urteils gewesen.
Je mehr ich die Scheu überwand, dem vor mir Thronenden ins Angesicht zu schauen, desto mehr strömte der Ausdruck von Güte. Von bedingungslosem Mitgefühl in mich hinein. Ich spürte meinen Körper in jeder Zelle. Ich spürte das Pulsieren. Das Vibrieren meines Lebendigseins in jeder Zelle. Das war nicht neu für mich. Doch dass es durch diese Präsenz geschah, machte es neu. Ich liess es zu. Und je stärker es wurde, desto langsamer und feiner floss mein Atem. Ausatem und Einatem vereinigten sich zu einem Strom. Ich war nicht da: niemand war mehr da, der atmete. Es geschah aus sich selbst. Atem geschah durch mich. Ich war das Instrument dafür. In mir dröhnte es wie in einem Hochleistungstransformer. Die Zeit stand still.
Als mich der Abt später fragte, ob mir der Buddha gefallen habe, teilte ich ihm mein anfängliches Befremden mit. Er kicherte sein zwitscherndes Thai-Lachen, das so ansteckend wirkt, und verlautete gedehnt: „Ja“. Sein Blick durchforschte meinen Blick. Ich hielt stand. Denn ich wollte gesehen werden. Mit jeder Faser meines Seins wollte ich gesehen werden. Ich erkannte den Meister im Blick des Abts. Denn einen solchen brauchte ich nun. Und ich war bereit, ihm vorbehaltlos zu vertrauen.
Nach einer Weile bemerkte der Abt: „Ich sehe, du hast schon viel in dir gearbeitet“. Worte, die einen Feuerstrom durch meinen Körper sandten, Tränen in meine Augen trieben.
Der Abt sass in etwa drei Metern Entfernung im Lotossitz auf einem schwarzen Ledersofa im Eingangsbereich des Mönchshauses. Ich selbst kauerte auf einem Sessel ihm gegenüber - als lautlos ein zweiter Mönch herbei schwebte und mich in gebrochenem Englisch fragte, ob ich Wasser, Tee oder Kaffe möchte. Verwirrt stotterte ich, ich bräuchte nichts von alledem. Doch der Mönch hakte geduldig nach. Und so entschied ich mich für Tee, dankbar für diesen Moment von Alltäglichkeit.
Ich hatte während Jahrzehnten mit Lehrern in verschiedenen Schulen gearbeitet. Es war mir wichtig, Schulen unterschiedlicher Richtungen, unterschiedlicher religiöser Hintergründe kennen zu lernen. Ich scheute mich vor Eingleisigkeit und der oft damit einhergehenden Abhängigkeit. Ich war auf der Suche nach dem, was allen Traditionen innewohnt, was allem Leben zugrunde liegt – jenseits dogmatischer Ansichten und Meinungen. Deshalb wollte ich die Essenz wenigstens der grossen Weltreligionen kennen lernen.
Zum Zeitpunkt meines ersten Besuchs beim Abt des Thaibuddhistischen Klosters in Gretzenbach in der Schweiz, hatte sich mein langjähriger Sufi-Meister aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Schule und die in verschiedenen Ländern existierenden Gruppen bestanden zwar noch. Man arbeitete weiterhin miteinander. Doch mir genügte das nicht. Ich wollte direkt von der Quelle trinken. Also brauchte ich einen Lehrer, mit dem ich in unmittelbaren Kontakt treten konnte. Zudem wünschte ich mir kompetente Führung in Meditation.
Zu diesem Zweck war ich zu verschiedenen Klöstern, die Meditationsmöglichkeiten anboten gefahren, hatte sie besichtigt und mich dort umgehört. Zu Beginn dachte ich an Zen-Meditation. Doch der Weg zum entsprechenden Ort war zu weit.
Ich suchte auch christlich orientierte Orte auf. Doch es zog mich zweifellos in die buddhistische Richtung. Mein grösster Wunsch war es, ein buddhistisches Kloster irgendwelcher Ausrichtung zu finden. Das tibetische Kloster in Rikon bot sich an. Aber auch dorthin war der Weg zu weit. Regelmässige Kursbesuche wären unmöglich gewesen.
Entmutigt durch mein fruchtloses Umherfahren, Nachfragen und Herumtelefonieren warf ich eines Tages beim Mittagessen die Bemerkung auf den Tisch: „Wenn doch nur in unmittelbarer Nähe ein buddhistisches Kloster materialisiert werden könnte.“ Mein Mann schaute mich fragend an, und ich erklärte ihm weshalb. Bis dahin hatte ich das Suchen verheimlicht. Er lachte und entgegnete: „Nichts leichter als das: es gibt doch eines, eine knappe halbe Stunde von hier.“ Ich war platt.
Ich rief umgehend im Kloster an. Die Verständigung gestaltete sich schwierig. Keiner der Mönche sprach Englisch, geschweige denn Deutsch. Man verband mich deshalb mit dem Abt, mit dem Verständigung gelang. Er lud mich zu einem Gespräch für den darauffolgenden Nachmittag ein.
Meine Gedanken liefen Amok. Glühende Angst überfiel mich. Worauf liess ich mich ein? Und was, wenn ich mich daneben benahm, tapsig wie ein Elefant? Einfältig und respektlos – hatte ich doch keine Ahnung von buddhistischen Gepflogenheiten.
Die Neugier auf Neues und Ungewöhnliches überwog zu guter Letzt: aus Panik von der Erde herunterzufallen, ginge sowieso nicht. Also erschien ich zum vereinbarten Zeitpunkt an der Klosterpforte: die gesammelte Überheblichkeit meiner zahllosen spirituellen Lehrjahre im Gepäck.
Zwar wusste ich, es gebe in der spirituellen Arbeit weder etwas zu erreichen noch zu gewinnen. Doch der Wahn, mithilfe von Meditation meinem Schicksal ein Tröpfchen Nektar mehr, ein Quäntchen zusätzlichen Glanzes abzutrotzen, geisterte noch hie und da durch meine Träume. Die Gier schlug im Verborgenen Purzelbäume!
Zudem steckte ich beziehungs- und jobmässig in der Krise, wollte ausbrechen, dachte an Scheidung, an Auswanderung – nach Amerika zu Freunden, bei denen ich nochmals bei null anfangen könnte: ein Irrglaube, klar - den ich dennoch, halb ängstlich, halb stolz dem Abt kichernd mitteilte. Er lachte über den „Scherz“. Ein Stein polterte von meinem Herzen, denn genaugenommen wollte ich gar nicht abhauen. Dafür brauchte ich seine Bestätigung. Das Gefühl, an der Enge meiner Situation zu ersticken werde sich geben, tröstete der Abt. Er lud mich fürs Wochenende ins Kloster: eine befreundeteThailänderin weise mich in die Technik der Sitz-, der Steh-, der Geh- und der Liegemeditation ein.
Besucher umringten den Abt, als ich im Kloster ankam, wollten ihn sprechen, erbaten seinen Rat, den Segen, überreichten Spenden. Doch zuerst warfen sie sich auf Knien dreimal vor dem Buddha, dann vor dem Abt, der im Lotossitz auf einem niedrigen Diwan sass zu Boden, berührten die Erde mit der Stirne, vor die sie die gefalteten Hände führten. Aus Filmen kannte ich solche „Niederwerfungen“. Ich machte sie nach, so gut ich konnte. Und ich konnte sie nicht gut, obwohl ich einen trainierten Körper besass –denn es ging nicht darum, eine Übung zu absolvieren. Die innere Haltung zählte. In sie hinein gebe sich der Mensch, mit seinem ganzen Sinnen und Trachten, in vollendeter Hingabe. Meine Fersen schrien. Und erst meine Knie! Doch galt es auszuharren, bis die Reihe an mir sei vom Abt begrüsst und im Kloster empfangen zu werden. Wie das dauerte! Ich konnte danach kaum noch aufstehen.
Der Teppich in der Empfangshalle, ebenso der Teppich des Meditationsraumes ein Stockwerk höher, waren blutrot. In der Empfangshalle hingen rote Kristalllüster von der Decke herunter. Und im Meditationsraum und in der Empfangshalle standen und sassen goldene Buddhastatuen, einige übermannshoch, darumherum gruppiert auf einem in Stufen ansteigenden Marmoraltar, kleinere Buddhas sowie eine originalgetreue Kopie des legendären Smaragdbuddhas aus Thailand. Blumenvase an Blumenvase reihte sich dazwischen, einige mit wallenden Orchideenzweigen gefüllt, andere mit Lotosknospen oder mit Frühlingsblumen aus schweizerischen Regionen. Die Fülle war massgebend, wie ich später erfuhr. Das üppige Blühen und Verblühen erinnerte – so sagte mir der Abt - an die Vergänglichkeit von Existenz.
Ich bewohnte gemeinsam mit meiner thailändischen Meditationslehrerin einen winzigen Kellerraum, in dem drei eng aneinandergerückte Kajütenbetten sowie ein Einzelbett standen. Schränke gab es keine, Stühle oder einen Tisch ebenso wenig. Sie hätten gar keinen Platz gefunden. Man wohnte im Kloster wie in Thailand: die gesamte Familie in einem Raum. Ich bezog mein Bett und schob meine Reisetasche darunter. Daraufhin stiegen wir zu zweit die drei Stockwerke zum Meditationsraum empor. Die entsprechenden Techniken begriff ich rasch. - Von da an war nur noch Schweigen angesagt.
Ich hatte während Jahren an spirituellen Workshops, Seminaren, längeren und kürzeren, teilgenommen und dachte, der Aufenthalt im Kloster gestalte sich ähnlich. Nach einer halben Stunde des Sitzens und einer halben Stunde des Gehens folge vielleicht eine Stunde Unterweisung, etwas Musik, eine Kontemplation, einige Körperübungen oder sonstige Unterbrechungen. Weit gefehlt! Meine Thailänderin machte keinerlei Anstalten, im Üben zu pausieren. Sie bedeutete mir im Gegenteil, ich solle nun zu einer ganzen Stunde des Sitzens und einer ganzen Stunde des Gehens überwechseln.
Die Stille des Tuns, der spärlich erleuchtete Raum und der blutrote Teppich unter den nackten Sohlen hypnotisierten. Das Blut rauschte in meinen Adern. Das laute Ticken der überdimensionalen Wanduhren wurde unhörbar, ebenso wie das Rattern der Züge und das Hupen der Lastwagen, wenn sie um die Ecke bogen. Die Technik der Meditation hatte ich masslos unterschätzt. Und gekannt hatte ich sie überhaupt nicht. Ich übte „Vipassana“-Meditation, die Methode mit der im „Theravada“-Buddhismus gearbeitet wird. Einer meiner früheren Lehrer nannte sie einmal spasseshalber „Spirituellen Stierkampf“. Staunen und Verblüffung darüber wuchsen in mir von Moment zu Moment..
Um halb zwölf Uhr gingen wir zu zweit zum Mittagessen, um sieben Uhr abends zum Nachtessen. Dazwischen übten wir – übten wir – übten wir. Und ebenso danach. Wenn ich nicht mehr konnte, legte ich mich ausgestreckt auf den Boden, was im gesamten Körper einen Feuersturm auslöste. Ich glaubte zu zerspringen. Es war, als würden meine Knochen zerrieben. Mein Nervensystem schrie wie ein angeschossener Hund.
Nachts sollte ich auf dem Rücken liegen. Meine Lehrerin stand zweimal auf und drehte das Licht an, um es zu kontrollieren. Sie nahm es mit ihrer Unterweisung bitterernst. Auch mit ihrem eigenen Üben. Schon um drei Uhr morgens stieg sie in den Meditationsraum hinauf, obwohl wir erst um elf Uhr zu Bett gegangen waren. Ich folgte ihr um fünf Uhr. Ich fühlte mich gerädert und betäubt von Schlaf - bis um sieben Uhr zum Frühstück gebeten wurde. Hinterher gab‘s eine Stunde lang Gemüseputzen.
Thailändisches Essen kannte ich nicht. Wie sollte ich nur damit eine vierzehntägige Klausur überstehen?!. Dennoch beschloss ich, mich dem „Kampf“ mit dem „Stier“ zu stellen – trotz Reissuppe zum Frühstück und den übrigen fremdländischen Gerichten.
Am zweiten Meditations-Tag gelangen mir Momente innerer Klarheit, die mich in Entzücken versetzten. Gegen Abend war ich so erschöpft, dass ich keiner Kontrolle mehr fähig war und mein Körper von alleine Fuss vor Fuss setzte. Ich schaute ihm dabei zu und gewahrte, wie alle Erdenschwere aus ihm wich und es sich anfühlte, als schwebe er. Die Füsse schienen breit und rund geworden wie Suppenteller. Das Herz hämmerte. Und ich musste mich hinlegen. Zum Glück war ich allein. Meine Lehrerin war vom Abt ins Büro gerufen worden.
Die Glieder schlotterten. Die Gelenke versagten den Dienst. Mehr tot als lebendig, jedoch felsenfest davon überzeugt, diese Weise sei die einzige Art der Arbeit auf meinem zukünftigen Weg - hätte ich nur erst die Einstiegsschwierigkeiten überwunden – setzte ich mich auf und übte – übte – übte….
Nachts lag ich wach, zu zerschlagen, zu aufgelöst, um abzutauchen. Die Thailänderin war nach Hause gefahren. So hatte ich die Kammer für mich allein.
Tags darauf sollte auf der Wiese, die damals noch die leere Mitte der Klosterliegenschaft ausfüllte, eine Zeremonie stattfinden: ein Trommelmeister aus Thailand wurde erwartet. Männer erstellten einen von einem Zelt überdachten Altar. Weder der Abt noch die Mönche beteiligten sich an den Vorbereitungen. Thailändische Musik zirpte zu mir herauf. Ich hatte mich über Nacht etwas erholt und meditierte konzentriert. Dem Wunsch des Abtes entsprechend sollte ich das Üben um neun Uhr morgens beenden. Dann beginne die Zeremonie. Die Menge an Teilnehmern – an Erwachsenen und Kindern - könnten das Üben stören.
Nach einem abschliessenden Gespräch, verabschiedete ich mich vom Abt mit Niederwerfungen, betrat die Wiese vor dem Mönchshaus: - und mich traf beinahe der Schlag: - die Sonne glühte. Ich erkannte fast nichts. Mir wurde schwindlig. Und als ich auf dem Altar die zauberhaft geschnitzten Früchte, die gekochten Schweinsköpfe, die üppige Blumenpracht und die goldenen Masken entdeckte, stürzte ich kopfüber in einen perfekten Kulturschock.
Zuhause angekommen, fragte ich meinen Mann nur: „Bitte, können wir einfach zusammen Motorrad fahren gehen und dabei Elvis-Songs hören?!“
**********************
2. Kapitel. Das Kloster, der Abt und die Mönche
Inzwischen ist die leere Mitte des Areals dem Herzstück des Klosters, dem „Ubosoth“ gewichen. Die Anlage besteht nun aus dem Mönchshaus, aus einem Längsbau, in dem die Bibliothek sowie die Sonntagsschule für Kinder untergebracht ist, dem Ubosoth in der Mitte des Geländes, unter dem sich auch ein Mehrzweckraum mit Bühne befindet, aus zwei kleinen Tempeln, aus dem obligatorischen Fischteich und der alles umgebenden Tempelmauer. Die Gebäude konnten ausschliesslich auf Spendenbasis errichtet werden. Kuanin, die weibliche Verkörperung des Buddha, residiert im einen der beiden kleinen Tempel, eine Statue König Ramas V im zweiten. Seitdem die Figuren ihre provisorischen, Wind und Wetter ausgesetzten Unterstände verlassen konnten, werden sie rege aufgesucht. Kuanin wird von Frauen angerufen, die schwanger sind oder es werden möchten, Rama wird als Erneuerer und Befreier Thailands gefeiert, und da er edles Gebranntes und Zigarren liebte, damit beschenkt. Und niemand stibitzt Flaschen, Schachteln aus seinem Tempelchen oder eine Handvoll Perlenketten, mit denen Kuanin über und über beschenkt wird.
Thais sind in einer Weise selbstlos und spendenfreudig, die den weit verbreiteten westlichen Geiz schonungslos offenlegt. Ich bekam es mit der Angst zu tun, als mir dieser Umstand bewusst wurde, ich meine wirklich bewusst, so dass ich ihn in Haut und Knochen und in jedem Blutstropfen als leibhaftige Bedrohung erlitt. Die Thais spenden, selbst wenn sie nichts zum Spenden erübrigen können. Für den Bau der Klosteranlage wurden keine Bankkredite benötigt. Es gab zwar welche zur Sicherheit, doch sie brauchten nicht angetastet zu werden. Die vielen Millionen, die zum Landkauf sowie zum Erstellen der Anlage benötigt wurden, entsprangen ausschliesslich den Taschen thailändischer Familien, die in der Schweiz leben sowie von deren Angehörigen in Thailand. Oder von Familien, von denen zumindest ein Elternteil thailändisch ist. Weder schweizerische noch thailändische Behörden haben zu den Millionen beigetragen.
Die Mutter des kürzlich verstorbenen Königs spendete allein mehr als eine Million. Nach ihr ist denn auch der Tempel benannt. Als Witwe war sie in die Schweiz übergesiedelt, um ihren Kindern die bestmögliche Erziehung und Schulung angedeihen zu lassen. Sie liebte die Schweiz, den Genfersee, an dem sie wohnte. Und sie wollte diesem Land, das ihr, wie sie sagte, soviel Gutes erwiesen habe etwas zurückgeben. Als dann der Ruf der in der Schweiz residierenden Thailänderinnen und Thailänder nach einem eigenen Kloster, einem eigenen Kulturzentrum stärker und stärker wurde und schliesslich auch an ihr Ohr drang, entschied sie sich, die Schirmherrschaft für das Zentrum zu übernehmen.
Vom königlichen Kloster in Bangkok, an dem er als Professor der angegliederten Universität sowie als rechte Hand des Abts gewirkt hatte, wurde der heutige Abt von Wat Srinagarindravararam, Phratep Kittimoli in die Schweiz entsandt, mit der Aufgabe, die Vipassana-Meditation in den Westen zu bringen. Als erstes musste ein angemessenes Grundstück gefunden werden. Und in Gretzenbach, in der Nähe von Aarau, entdeckte er den richtigen Ort dafür.
Gestartet wurde das Projekt in einem Bauernhaus in Bassersdorf, Zürich. Dort kamen, dank der Initiative des Abts die ersten Hunderttausender zusammen.
Später wohnten der Abt und die Mönche in Containern neben dem zukünftigen Klostergelände, um die beginnenden Bauarbeiten zu begleiten.
Dem Abt fiel der Start in der Schweiz nicht leicht. Das Klima machte ihm zu schaffen: er fror erbärmlich. Und er kam auch mit der schweizerischen Mentalität schlecht zurecht. Er hätte liebend gerne Reissaus genommen - was natürlich nicht ging: die Flinte ins Korn zu werfen entspricht nicht buddhistischer Weltsicht. Er biss sich durch – lernte rasch – wurde gemocht – und fand die notwendige Akzeptanz: das gesamte Vertrauen in den Klosterbau verlagerte sich auf seine Schultern.
Phratep Kittimoli, der Abt, entstammt einem Bauerndorf hunderte von Meilen von Bangkok entfernt. Seine Karriere begann er als Kuhhirt. Ins Kloster zu gehen war keine Option für den aufgeweckten Knaben. Er hatte weltlichere Pläne. Doch das Schicksal nahm darauf keine Rücksicht. Als er zwölf war, schlug es zu: der Knabe wurde Novize – und bereute diese Wendung keinen Augenblick: er wurde zur unentbehrlichen Stütze seines Lehrers, obwohl er um seinen zwanzigsten Geburtstag herum kurz mit dem Gedanken liebäugelte, das Klosterleben hinter sich zu lassen und eine Familie zu gründen. Weder persönliche Wünsche, noch eiserner Wille, noch Ehrgeiz trieben seine Karriere an: sie fiel ihm sozusagen in den Schoss, ohne dass er einen Finger dafür zu krümmen brauchte.
Rasche Auffassungsgabe, Anpassungsfähigkeit, Hilfsbereitschaft und ausnehmende Freundlichkeit zeichneten ihn aus sowie tiefe innere Verpflichtung der Arbeit gegenüber. Zu seiner Überraschung fand er sich plötzlich im königlichen Kloster in Bangkok wieder, unterrichtete an der buddhistischen Universität, hielt Vorträge und Vorlesungen und leitete Meditationskurse an – arbeitete pausenlos, studierte asiatische Sprachen und schrieb zwischendurch an seiner Dissertation.
Der Abt ist eher klein, aber stark und stämmig gebaut, im Gegensatz zu vielen Thais, die für westliche Verhältnisse oft sehr zart und fragil erscheinen. Den Abt und die Mönche gehen zu hören, ist fast unmöglich. Der Schritt ihrer nackten Sohlen ist so leicht, als flögen sie. Ihre Bewegungen sind fein und beseelt, sozusagen „vom Atem getragen“. Nicht nur dem Kloster sondern auch seinen Bewohnern wohnt ein Zauber inne. Nichts Sentimentales, ganz und gar nicht. Viel eher natürliche Konzentriertheit, die jeder Krampfhaftigkeit entbehrt.
Ohne der Pali-Sprache mächtig zu sein und dadurch die Bedeutung seines Mönchsnamens zu verstehen, ist es unmöglich, den Rang zu erkennen, den ein Theravada-Mönch in der klösterlichen Hierarchie einnimmt, denn einer sieht aus wie der andere. Alle sind sie gleich gekleidet. Rangabzeichen gibt es keine. Unterschiede lassen sich nur erspüren, nicht erspähen. So unterscheidet sich etwa der Abt von jungen Mönchen nur durch tiefere Präsenz innerer Stille – so könnte man sagen - durch selbstverständlicheres Da-sein.
Die meisten Mönche, die ins Kloster kommen, für einige Zeit dort bleiben und wieder weiter reisen, sind jung, doch nicht so jung, dass nicht jeder von ihnen einen Universitätsabschluss in der Tasche hätte. Ein Abschluss ist Grundvoraussetzung für eine Arbeitserlaubnis im Wat Srinagarindravararam. Nur die Besten werden zu Botschaftern ihres Landes, ihrer Religion und ihrer Kultur ausgewählt.
Weder das Kloster noch irgendetwas, das sich darin befindet, gehört dem Abt oder den Mönchen. Die Mönche sind besitzlos. Müssen sie verreisen, ist das innerhalb einer Minute möglich. Das für den Alltag Unentbehrliche, wie Zahnbürste, Rasierzeug, Brille oder Uhr tragen sie in einem Beutel, der nicht einmal so gross ist wie die Handtasche der meisten Frauen, am Arm mit sich herum. Das tun sie sogar während den Festtagszeremonien im grossen Tempel, dem Ubosoth, zum Zeichen dafür, dass ihr Leben an keinerlei Bedingungen geknüpft ist und sie ständig abrufbereit sind – auch wenn es ums Sterben gehen sollte.
Das Kloster selbst ist eine Stiftung. Es erwirtschaftet nichts, ist zu hundert Prozent abhängig von Spenden. Die Mönche essen das, was die Menschen ihnen bringen. Würde nichts gebracht, würden die Mönche hungern. Auf Betteltour wie in Thailand, Burma oder Kambodscha gehen die Mönche hier in der Schweiz nicht, denn die Schweiz ist kein buddhistisches Land. Der Buddhismus als solcher geniesst keine behördliche Anerkennung. Und da es für die Mönche selbstverständlich ist, sich den Gepflogenheiten ihres Gastlandes nahtlos anzupassen, verzehren sie dargebotenes Essen von Schweizern mit der gleichen Dankbarkeit wie thailändisches, selbst wenn es sie vielleicht Überwindung kostet.. Sie weisen nichts als unpassend zurück. Sie essen um des Essens, um der Ernährung willen. Dennoch ist der Abt ein Riesenfan von - als Beispiel - Spaghetti an italienischer Sauce geworden! Während des Essens sprechen die Mönche nur das Allernotwendigste. Sie schauen sich nicht um. Auch wenn Kinder an ihrem Tisch vorüber rennen, laut schreien und einander schubsen – was an Sonn- und Feiertagen häufig der Fall ist. Die Mönche bleiben auf sich selbst und ihre Tätigkeit konzentriert. Ich habe nie eine Regung des Unwillens oder der Ungeduld bei irgendeinem von ihnen erlebt. Auch der schrecklichste Lärm scheint sie unberührt zu lassen. Was nicht heisst, dass die Mönche nicht auch von Herzen mit den Besuchern lachen oder mit den Kindern herumalbern mögen.
Den Mönchen gehört auch immer nur gerade das Gewand, das sie am Leib tragen. Es setzt sich aus einer kurzen Tunika zusammen, über die ein weiter Umhang drapiert wird. Der rechte Arm bleibt immer frei. Denn im Buddhismus wird auf das Tun besonderen Wert gelegt. Richtiges Tun erzeugt gutes Karma. Das Tun steuert das Resultat von Ursache und Wirkung.
Über der linken Schulter wird wie eine Art Schärpe, ein zu einer Bahn zusammen gefaltetes zusätzliches Tuch getragen, das auf Wanderschaft als Unterlage oder zum Zudecken dienen kann, und auf dessen unteres, über das Knie des Abts auf den Boden hinaus ragendes Ende auch Gaben – „Dana“ - für das Kloster gelegt werden, die Besucher anbieten. Dieses Tuchende dient als Zwischenstation. Die Mönche nehmen nichts für sich selbst. Alles ist immer „für den Buddha“ bestimmt, für das Wesen des Erleuchteten, das erwachte Eine, das keinen Gegenpol kennt. Die Mönche dürfen davon zehren, geben jedoch sämtliche Gaben für den Unterhalt des Klosters, Schüsseln mit Essen, Getränke immer gleich weiter an die ständig aus- und eingehenden Gäste, sobald sie den von ihnen benötigten Teil davon abgezweigt haben. Persönlich eignen sich die Mönche nichts an, gar nichts.
Oft ist das Wetter bei uns in der Schweiz alles andere als sonnig und warm. Dann empfinde ich es als besonders wohltuend, den Mönchen in ihren leuchtend orangefarbenen Gewändern zu begegnen. Auf mich wirkt die Farbe belebend, erfrischend, Herz und Gemüt erwärmend. Mäntel zu tragen ist den Mönchen nicht erlaubt. Doch im Winter stehen ihnen langärmlige T-Shirts und wollene Socken zur Verfügung - falls sie welche geschenkt bekommen. Ebenso verhält es sich mit dem Schuhwerk. Die Mönche bitten nie um etwas. Es ist dem Gast überlassen herauszufinden und zu erspüren, was sie benötigen könnten.
Das Kloster ist ein ausgesprochen fröhlicher Ort. Ich habe in der Gesellschaft mit den Thais mein Lachen wiedergefunden. Das, was mich am meisten berührt ist ihre Freundlichkeit, ihre Herzlichkeit, ihre selbstverständliche und selbstlose Hilfsbereitschaft und ihr Bemühen, andere - ganz anders geartete Menschen, als sie selbst es sind - als gleichwertig anzunehmen.
Zu Beginn meiner Meditationsarbeit gab es das Kloster erst seit knapp vier Jahren und es hatte sich noch nicht herumgesprochen, dass dort Meditation gelehrt wurde. Demzufolge sass ich manchmal allein im Meditationsraum. Manchmal waren wir zu zweit, selten zu dritt. Und auch heute sind es nur knapp zwei Dutzend Schweizerinnen und Schweizer, die zu den beiden Meditationsklassen erscheinen, die wöchentlich stattfinden.
Bei Baubeginn hatte der Abt befürchtet, es werde nie genügend Besucher für die damals riesig erscheinende Anlage geben. Heute ist sie längst zu klein. Das Kloster hat inzwischen mehr als dreitausend Familien als Mitglieder. Während grossen Festen quillt das Kloster über, schwappt der Strom der Gäste über auf benachbarte Grundstücke, auf denen grosse Zelte errichtet werden. Und inzwischen ist eines dieser Grundstücke zusätzliches Eigentum des Klosters, das wachsen und wachsen will und mittlerweile als Kulturzentrum nicht nur in Europa bekannt geworden ist. Wat Srinagarindravararam, in traditionell thailändischem Stil erbaut, streng nach den Gesetzen heiliger Architektur, ist heute ein ernstzunehmender Faktor im religiösen Leben vieler Menschen. Es ist auch ein Schmuckstück, das unter Heimatschutz steht und als Touristenattraktion gehandelt wird. Seine goldene Kuppel leuchtet weit herum.
Mit dem Abt verband mich von meinem ersten Besuch an tiefe Freundschaft. Ich hatte keinerlei Autoritätsprobleme. Ich wollte von ihm lernen - ohne mir emotional im Weg zu stehen. Auch die Frage des Vertrauens stellte sich mir nicht. Die Fruchtlosigkeit des Zweifelns kannte ich aus Erfahrung. Der Psychospiele war ich überdrüssig. Zudem erschien die spirituelle Vertrautheit zwischen dem Abt und mir so rein und klar, dass es sich erübrigte mich zu verstecken. Wir kannten einander seit unendlich langer Zeit: das spürte ich. Verstellung wäre Zeitvergeudung. Der Abt hätte sie durchschaut. Und meine Dankbarkeit gegenüber dem Kloster und den Mönchen verbot das Mogeln.
Auch meine Verehrung für den Abt erscheint mir als natürlich. Sie hat sich von selbst ergeben. Doch bin ich nicht von seinem Hier-sein abhängig. Ginge der Abt zurück nach Thailand, würde ich das bedauern, könnte aber mit einem eventuellen Nachfolger genauso gut weiterarbeiten. Das Vertrauen der Menschen ruht zu Hundert Prozent auf seinen Schultern. Er wird geschätzt und ist äusserst beliebt. Und es suchen ihn auch immer mehr Menschen auf, die den Buddhismus nur vom Hörensagen her kennen. Auch deshalb, weil sie sich von ihm und im Kloster ernst genommen fühlen.
********************
3. Kapitel. Vipassana-Meditation
„Vipassana“ bedeutet Einsicht, klares Sehen, direkte Schau der wahren Natur der Dinge, das heisst: das Erkennen ihrer Unbeständigkeit, das Erkennen ihrer Unzulänglichkeit sowie das Erkennen ihrer Substanzlosigkeit. „Vipassana-Meditation“ zu üben, bedeutet demnach, an der geistigen Entwicklung zur Erlangung von Einsicht zu arbeiten. Eine Arbeit, die keineswegs so abgehoben ist, wie die Erklärung des Begriffs „Vipassana“ das suggerieren mag.
Es könnte gesagt werden, dass Vipassana-Meditation aus zwei Teilen besteht. Und zwar aus dem vorbereitenden sowie aus dem Teil von Klarsicht. Doch das ist nur bedingt richtig. Denn diese beiden Teile gehen nahtlos ineinander über und bilden zusammen ein untrennbares Ganzes. Zum besseren Verständnis kann der Vergleich mit dem Vorgang der Zubereitung einer Mahlzeit dienen:
Punkt 1: einkaufen. Genau hinzuschauen ist wichtig, die Qualität des Ausgesuchten unter die Lupe zu nehmen, das Gewählte zu erkennen, zu verstehen und auch benennen zu können. Ebenso wichtig ist es, dabei bewusst zu atmen. Wieder zuhause, werden die Zutaten ausgepackt, nach Verunreinigungen untersucht, gewaschen und vorbereitet. Dieser Teil könnte als der Teil der Bestandesaufnahme angesehen werden, indem der Übende sich innerlich klar darüber wird, was es eigentlich ist, das sein Leben ausmacht, das es oft schwierig und unübersichtlich gestaltet, da es in den stets gleichen, diffusen Mustern abläuft.
Erst nach dieser Bestandesaufnahme kann mit der Zubereitung der Mahlzeit begonnen werden, indem die Zutaten erhitzt, also dem Feuer übergeben werden, das sie läutert und verwandelt, sie geniessbar macht und in Nahrung umwandelt, die der Übende für sein äusseres und inneres Wachstum braucht. In der Meditation entsteht die Hitze durch das Mittel der Konzentration, durch exaktes Anschauen dessen, was sich innerlich zeigt, durch das Bewusstmachen und das Benennen.
Beim Essen entsteht durch den Vorgang des Kostens, des Kauens, des Wahrnehmens von dem, was gegessen wird eine zusätzliche Substanz, die nicht nur den Hunger stillt sondern den physischen Körper, die Zellen, aber auch die feinstofflichen, für das ungeübte Auge unsichtbaren „Körper“ des Essenden regeneriert. Ein Vorgang, der Alchimie genannt wird.
Dieser Teil entspricht in der Meditation der subtilen Wandlung, die in Körper und Geist im Laufe des Übens vor sich geht, die sichtbar und spürbar ist und im Übenden die Gewissheit aufkeimen lässt, dass seine Arbeit Früchte trägt.
Werden die Abläufe des Aussuchens der Nahrungsmittel über das Vorbereiten, das Kochen, das Anrichten und das Essen bewusst durchlaufen, gleicht das tatsächlich dem Üben von Vipassana-Meditation. Vipassana-Meditation ist nichts anderes als ein Hilfsmittel, um das Leben durch das Vergrösserungsglas von Achtsamkeit anzuschauen und von den alltäglichen Automatismen zu befreien. Dieser Vorgang verleiht dem Übenden Kraft, Mut und Durchhaltevermögen. Die Essenz, die durch diesen alchimistischen Prozess frei wird, reicht der Übende an alles Lebendige weiter: an sämtliche sichtbaren und unsichtbaren Wesen, sichtbaren und unsichtbaren Welten, und zwar über seinen durch die Konzentration transformierten Atem, seine transformierte Körperhaltung und Sichtweise – also über seine erneuerte Fähigkeit zu Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Genau so funktioniert auch Vipassana-Meditation
.
Indem sich der Übende während der Sitzmeditation bewusst und bewegungslos auf den Atem konzentriert, auf das Heben und Senken der Bauchdecke, Atemzug um Atemzug, entscheidet er sich dafür, die beste Mahlzeit zuzubereiten, die er kann – oder genauer gesagt: zur besten aller Mahlzeiten für das Leben zu werden.
Während des Sitzens bleibt es im Inneren des Übenden natürlich nicht einfach nur angenehm still. Sicher nicht. Gedankenfetzen schwirren umher. Gefühle steigen aus den Tiefen des Unterbewusstseins auf. Erlebnisse aus früheren Zeiten. Oder Schmerzen stellen seine Konzentration auf die Probe. Erscheinungen die als „Grundnahrungsmittel“ menschlicher Existenz bezeichnet werden könnten. Entweder tut er sich an diesen Phänomenen gütlich, hängt sich gierig an Gefühle, Gedanken und Schmerzen und leidet über kurz oder lang an Bauchweh und Verstopfung. Oder er schaut sich bewusst an, was sich zeigt, was hochkommt und was sein Leben in die immer gleichen Irrungen und Wirrungen drängt. Er legt es quasi als Auslage vor sich auf den Tisch. Schon allein die Distanz, die dieser Vorgang bewirkt, verwandelt die Erscheinungen. Schickt er sie nun noch auf dem Ausatem sanft, liebevoll, nicht verärgert und überdrüssig, zurück in die Abgründe menschlichen Unterbewusstseins, entsteht Wärme, nicht als Gefühl, sondern als Wahrnehmung von Hitze – und dadurch kommt eine Art von Kochvorgang zustande.
Übt er das ständig wieder, wird sich allmählich etwas im Leben des Übenden verändern, auf alchimistische Art verwandeln. Anstatt emotionaler Unrat wird sich „Gold“ zeigen. Gold, das stets da war, das er nur, blindgeworden durch die Faszination des an ihm vorüberratternden Lebensfilms nicht erkannte.
Durch das Sitzen, durch die Konzentration auf das Heben und Senken der Bauchdecke, erhalten die physischen, emotionalen und mentalen Muster, die sein Leben wie ein Gerüst aufrechthalten Gelegenheit sich zu zeigen. Und öffnet er sich ihnen liebevoll genug, achtsam genug, werden sie anfangen, in schier endlosem Strom vor seinem inneren Blick vorüberzuziehen. Horden von Tieren gleich, von edlen und struppigen, anschmiegsamen und wilden, bissigen, halb verhungerten und verstümmelten Tieren jeder Sorte, jeder Laune, die froh und dankbar sind für sein Hinschauen. Denn nur das Erkennen kann diese Horden aus ihrem von Leiden geprägten Dasein erlösen. Der Übende muss lernen, die Gesamtheit menschlichen Potenzials anzuschauen, nicht nur sein persönliches Potenzial, heisst es doch: „Dem Erwachten ist nichts Menschliches fremd“.
Dieser Auseinandersetzung muss sich der Übende in der inneren Arbeit stellen wollen. Auch wenn ihm vielleicht ganz und gar nicht gefällt, was sich ihm dadurch in tiefen und tiefsten Tiefen eröffnet. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Sonst kann der Kochvorgang, kann der Vorgang der Transformation, der Alchimie nicht stattfinden.
Das könnte man den ersten Teil des Übens von Vipassana-Meditation nennen. Der zweite Teil beginnt dort, wo der Übende sich dem Gekocht- und dem Garwerden überlässt. Dem Garwerden wohnt auch der Vorgang der Neutralisation inne. Das Kochen löst Giftstoffe aus der Nahrung und macht sie dadurch unschädlich. Es schält Essenz aus ihr heraus, die der Schüler für das Hinüberwechseln in ein neues Stadium des Menschseins braucht, in ein geläutertes, verfeinertes Stadium des Menschseins, das sich nicht mehr über unkontrolliert aufsteigende Gefühle, Gedanken, Wünsche, Hoffnungen oder Ängste definiert. Die ursprünglichen Muster, die die Vorgänge des Menschseins steuern, werden jedoch nicht einfach vernichtet. Sie verschwinden nicht ein für allemal. Der Übende hat lediglich durch die Praxis von Vipassana - der Praxis der geistigen Entwicklung zur Erlangung von Einsicht - einen Schritt in eine neue Richtung getan. Man könnte es „einen Schritt vorwärts“ nennen, hinaus aus unablässiger menschlicher Pein. Nun schaut er sich um und sieht das im Leiden erstarrte Menschsein, das sein eigenes Menschsein miteinschliesst. Er sieht es aus Distanz, losgelöst und unidentifiziert. Er selbst ist momentan davon befreit. Doch um dorthin zu kommen, muss er sich zubereiten und garkochen lassen.
Um Vipassana-Meditation zu üben, sollte der Schüler lernen, sich vollständig still zu halten, alle willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen zu unterlassen. Der Körper soll entspannt aufrecht dasitzen, wenngleich nicht starr und übertrieben gerade. Eine normale, unprätentiöse Haltung ist gefragt. Die Augenlider hängen lose über den Augäpfeln, deren Blick hinter den geschlossenen Lidern leicht schräg gegen den Nasenrücken gerichtet ist.
Die Gefahr besteht bei jeder Form von Übung, dass der Schüler sie dazu verwendet, sein Ego zu spiritualisieren anstatt es aufzulösen. Deshalb ist es für ihn unabdingbar, dass er sich so auf das Aus- und Einatmen konzentriert, dass er dadurch keinen Atemzug aus der inneren Sicht verliert.
Gerade im Westen richten viele Menschen ihr Leben nicht nach religiösen Grundsätzen aus. An die Stelle von Religion ist die Verherrlichung der Psyche, deren Vergöttlichung, das Spiritualisieren des Egos getreten. Deshalb fühlen sich auch so wenige Menschen in sich selbst aufgehoben, beschützt und geborgen. Persönliches Wohlbefinden, persönliche Verwirklichung, das Spasshaben an allem, was sie tun, möglichst ohne sich dabei anstrengen zu müssen, sind die Kriterien, mit denen sie Leben als gut oder, bei Abwesenheit dieser Erfordernisse, als schlecht taxieren. Die Bereitschaft zu Auseinandersetzung und damit die individuelle Belastbarkeit haben stark abgenommen. Scheidung ist angesagt, sobald das Verhalten des Partners nicht mehr befriedigt. Fühlt sich jemand eingeengt, wechselt er seinen Wohnort oder seinen Arbeitsplatz. Das spiritualisierte Ego ist bei einem beträchtlichen Teil der Menschheit an die Stelle innerer spiritueller Ausrichtung getreten.
Doch wenn jede und jeder seine Person in den Vordergrund, möglichst in die erste Reihe zu stellen sucht, herrscht ständige Konkurrenz und fürchterliches Kompetenzgerangel. Die Gefahr, als Person übergangen oder untergebuttert zu werden, ist enorm. Kostbares Potenzial geht verloren aus Egoismus, aus purer Ignoranz. Anstelle einer überpersönlichen, spirituellen Instanz treten Milliarden von Egos, Milliarden von Götzen. Und jeder verteidigt seinen Podestplatz aufs Erbittertste. Das produziert unbändigen Lärm und entsetzlich viele Verletzungen.
Ich habe erfahren, dass es gerade am Anfang des Übens von Vipassana-Meditation vonnöten ist, beharrlich darauf zu achten, nicht der Versuchung zu verfallen, dem unablässigen Geschwätz im eigenen Kopf auf den Leim zu gehen. Sonst fährt der Übende, ohne es zu merken, darauf ab und stellt nach fünf oder zehn Minuten fest, dass der Faden des Übens abgerissen ist und er vergessen hat, dass er eigentlich Meditation praktizieren wollte. Das Abdriften geschieht im Bruchteil einer Sekunde. Das Ego ist beängstigend trickreich. Es ist auch nicht angebracht, auf Gedanken oder Gefühle, die im Übenden hochsteigen in dem Sinne einzugehen, dass er anfängt, sie vor sich selbst zu rechtfertigen, sie schön zu reden oder sich für sie zu entschuldigen, etwa mit dem Einwand: „Ach, ich bin doch auch nur ein Mensch.“
Die Versuchung des Urteilens, des Über- oder Unterbewertens der eigenen Person, des eigenen Erlebens, ist allgegenwärtig. Es sind Vorgänge, die das Ego meisterhaft spiritualisieren, ohne dass sie den Übenden in der Meditation auch nur einen Millimeter weiterbringen. Urteilslosigkeit ist sehr hart zu erlernen. Im alltäglichen Leben wie im Üben von Meditation. Der Schüler darf keine Angst vor Rückschlägen haben, vor persönlichem Versagen. Immer wieder muss er sich aufraffen können, um weiterzuüben.
Die ursächliche Frage im Menschen nach dem Woher und dem Wohin ist der unpersönliche Motor, der das Feuer des Übens am Glühen hält. Wenn der Schüler ihn verliert, verliert er die Motivation. Dann macht es keinen Sinn mehr, die Strapazen des Übens auf sich zu nehmen. In der Stille des Übens entfacht sich die Glut ständig neu, ohne sein Dazutun, ohne dass er darüber nachdenken muss. Es handelt sich dabei nicht um einen persönlichen Wunsch oder um persönliche Begierde. Sondern um den allem Leben zugrunde liegenden, archetypischen Drang nach Öffnung, nach Hingabe, nach Befreiung. Sind diese Kräfte erst freigelegt, entfaltet sich Vipassana von selbst, klärt sich der Blick und offenbart sich, „was ist“.
Hier möchte ich noch einen weiteren Vergleich zu Hilfe nehmen:
Bedeutenden Wallfahrtsorten vorgelagert sind meistens zahllose Läden oder Verkaufsstände, die jede nur denkbare Sorte von Devotionalien feilbieten, angefangen von Kristallen, Duftprodukten, Kerzen jeder Grösse, Kalendern, Astrologiebüchern bis zu Meditationskassetten. Prospekte für Kuren liegen aus. Heiligenbilder. Es gibt Kreuze, Statuetten, Gebetbücher und Rosenkränze zu kaufen. Schlicht alles, was sich an solchen Plätzen vermarkten lässt, ist vorhanden – nebst Gaststätten, die Gerichte nach dem am Wallfahrtsort verehrten Heiligen benannt, auf der Speisekarte stehen haben.
Verschiedene Besucher finden den Weg über diese Geschäfte und Kneipen hinaus nie. Ihr meist unbewusstes, diffuses Sehnen nach Nestwärme und Aufgehobenheit wird bereits durch diese mannigfaltigen Angebote gestillt oder überlagert.
Zwischen der entsprechenden Kultstätte und den Geschäften breitet sich in der Regel ein grosser Platz aus, oft schön gepflastert, der von Autos frei gehalten wird und einzig für Wallfahrer begehbar ist. Diesen Platz kann der Reisende zwar noch mit anderen zusammen als Gruppe überqueren. Es lässt sich noch schwatzen und lachen dabei. Wenngleich die Atmosphäre hier eine ganz andere ist, als sie noch inmitten der Läden und Kneipen herrschte. Weniger Schutz ist da. Weniger Versteckmöglichkeiten bieten sich an. Die Konzentration an Spannung nimmt zu.
Je mehr sich der Reisende der Mitte des Platzes nähert, desto mehr kann ihm bewusst werden, dass das Überschreiten des Platzes dem Wechsel von einer Welt hinüber in eine andere gleicht. Vielleicht empfindet er dieses Hinüberschreiten sogar wie einen Gang durch die Wüste, ein sich gnadenloses Aussetzen. Oder mit dem Überqueren des „Grossen Wassers“, wie es auch heisst. Vom turbulenten, alltäglichen Treiben und Getriebenwerden gelangt er in die Welt der Archetypen, in die Welt, in der das Persönliche, das Individuelle dem Kollektiven Platz macht. Vorgänge wie das Loslassen, wie Hingabe, wie das sich der Angst Stellen, das sich dem Ungewissen gegenüber Öffnen, haben hier das Sagen. Und ist er jenseits der Mitte des Platzes angekommen, zeigt sich ihm ganz langsam, ganz allmählich die Welt des Spirituellen. Inmitten des Platzes ging es noch um Phänomene, um Bilder, um innere Erlebnisse und um Erscheinungen. Doch je weiter er geht, desto mehr verblassen auch die. Das Hoffen, das Wünschen müssen zurückbleiben. Je mehr er sich dem eigentlichen Heiligtum nähert – und das ist kein Ort in der Aussenwelt – desto weniger geschieht etwas, findet noch etwas statt. Im Heiligtum seiner selbst gibt es ihn als Person nicht mehr. Es herrscht dort kein Zustand von Abwesenheit. Es fällt einfach Getrenntheit weg.
Jenseits des Platzes trifft der Pilger auf die schweren Eichen- oder Bronzetüren des Gotteshauses. Durch diese hindurch muss jeder einzeln gehen. Er kann sich nach dem hinter ihm Nachfolgenden höchstens noch kurz umschauen, wenn er ihm die Tür aufhält, der wiederum seinem Nächsten die Tür aufhält und so weiter. Doch einmal drinnen im Gotteshaus ist jeder Mensch nur noch auf sich selbst gestellt. Das Schwatzen und das Lachen verbieten sich hier. Jeden weht die von Gebeten und Fürbitten geschwängerte Atmosphäre im Gotteshaus auf andere Weise an, lässt jeden auf andere Weise still oder auch ängstlich zu sich selbst finden oder sich seines Anliegens, seines Leidens erst richtig bewusstwerden. Auf dem Weg zum Altar wird sich der Übende seiner Alleinheit bewusst, vor allem dann, wenn der Weg hinunter in eine Gruft oder Krypta führt.
Verblasst ist die Erinnerung an Kristalle, Düfte, Sternzeichen, Sahnetorten oder Wurstspezialitäten. Sehr entblösst fühlt sich der Pilger nun, sehr ausgesetzt und verletzlich, auch ratlos, sogar traurig vielleicht – vorausgesetzt, er ist wirklich auf Pilgerfahrt und es treibt ihn nicht nur Neugierde an.