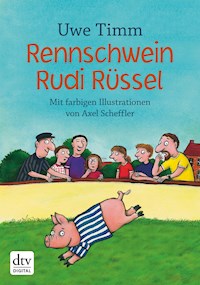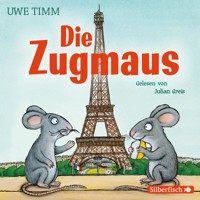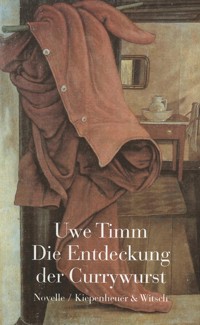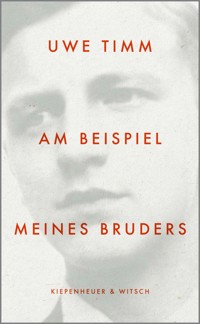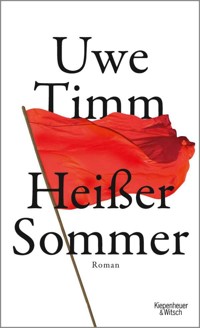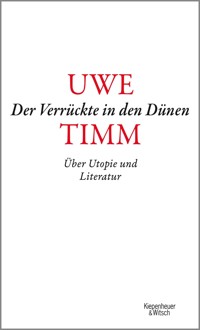9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Anfang der achtziger Jahre hat Uwe Timm seine Zelte in München abgebrochen und ist mit Frau und Kindern nach Rom übergesiedelt. Der Aufenthalt in der von Geschichte und Utopien erfüllten Stadt wird zu einer harten Prüfung – und Rom trotz aller Widrigkeiten zum magischen Ort, der dem »Edelaussteiger« die eigene geschichtliche und literarische Position bewusst macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Uwe Timm
Römische Aufzeichnungen
Vogel, friss die Feige nicht
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Uwe Timm
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Uwe Timm
Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt Vogelweide, 2013, Freitisch, 2011, Am Beispiel eines Lebens, 2010, Am Beispiel meines Bruders, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, Der Freund und der Fremde, 2005, und Halbschatten, Roman, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis und 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Anfang der achtziger Jahre hat Uwe Timm seine Zelte in München abgebrochen und ist mit Frau und Kindern nach Rom übergesiedelt. Der Aufenthalt in der von Geschichte und Utopien erfüllten Stadt wird zu einer harten Prüfung - und Rom trotz aller Widrigkeiten zum magischen Ort, der dem »Edelaussteiger« die eigene geschichtliche und literarische Position bewusst macht.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Vom Autor durchgesehen und um ein Nachwort erweiterte Ausgabe des Buches ›Vogel, friss die Feige nicht. Römische Aufzeichnungen‹
© 1989, 1996, 2000, 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Mendell & Oberer, München
ISBN978-3-462-30874-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Die Vernichtung der Zettelkästen
Archäologie der Wünsche
Erste Einblicke
Die Kontoeröffnung
Erkundungen I
Zum 1. Mal
Erkundungen II
Erkundungen III
Die gnostischen Rindenfelder
Es gibt nur gefährliche Situationen …
Erkundungen IV
Dopo il Brennero
Die Jagd, ach, die wilde Jagd …
Der Gesang aus dem Feuerofen
Ausblick I
Der Trümmermörder
Neros Tod I
Die Ohrdusche
Ausblick II
Versuch über eine Ästhetik …
Die Kunst der Verbindungen
Der fehlende linke Schuh
Das Auge des Ethnologen
Neros Tod II
Ausblick III
Gramscis Traum
Caravaggio …
Die Utopie der Sprache
Das plötzliche Verschwinden der Katzen
Für Diederich Hinrichsen
Die Vernichtung der Zettelkästen
Die letzte Nacht schlief ich in der leeren Wohnung: Der Teppichboden herausgerissen, die Lampen abmontiert, in den Zimmern stand feucht der Geruch von Tünche. Im Schein einer Taschenlampe wühlte ich in dem zusammengekehrten Dreck und sammelte Pfennigstücke, Haarklammern, Briefmarken und Legostücke heraus, wusste dann aber nicht, wohin mit dem Kleinkram, und kippte alles in den Müll.
Einen Tag vor der Abreise hatte ich gemeinsam mit Peter Hubert die Kammer ausgeräumt, die vollgestopft war mit Zeitungen, Illustrierten, Seminararbeiten, Exzerpten, Briefen, Flugblättern, Resolutionen zu Teach-ins, Go-ins und all jenen Manuskripten, die, unaufgefordert zugeschickt, aus irgendwelchen Gründen hier seit Jahren liegen geblieben waren. Diese unfasslich öden, holprigen Schreibereien, die durch alle Verlage gewandert waren und manchmal, trotz Ablehnung, mit dem gleichen Begleitbrief wieder auftauchten.
In den letzten Monaten musste ich mich mit einer immer größeren Kraft zum Lesen der Manuskripte zwingen, bekam immer häufiger Wutanfälle, sprang auf und rannte ins Freie. Beinahe wäre dieser Papierberg, der schon vier Umzüge mitgemacht hatte und weiter angewachsen war, zusammen mit den Möbeln eingelagert worden. Aber dann stand ich in diesem Altpapier, diesem Durcheinander, diesem aus den Borden quellenden Hochglanzpapier, den vergilbten Zeitungen, den eingerissenen, zerfledderten Exzerpten aus Sein und Zeit, De anima, den Seminararbeiten, Reisenotizen, all den Ausschnitten, Zetteln, Karteikarten, und spürte einen körperlichen Ekel, stopfte das Papier in Kartons und schleppte die mit dem Freund hinunter. Die Kammer war noch nicht leer, da quoll im Hof der Müllcontainer über. Ich stieg auf den Papierberg und stampfte ihn mit einer albernen Munterkeit zusammen: keine Manuskripte mehr lesen, keine Gutachten mehr schreiben, keine Bücher mehr an den Wänden, die im Traum auf mich stürzten. Leere, weiße Wände. In der Ferne die Atemsäule des Pottwals.
Lag im Dunkeln in der Badewanne, genoss die Wärme und, wenn ich die Luft anhielt, den leichten Auftrieb. Fast wäre ich im Wasser eingeschlafen.
Ich ging durch die Zimmer. In ihrer Größe und hallenden Leere waren sie mir fremd und vertraut zugleich.
Ich sah in die Straße hinunter. Die einzige Bewegung in der nächtlichen Stille war das leise Schaukeln der Neonlampen, die auch die Schatten der geparkten Autos hin- und herwandern ließen. Die Müdigkeit war wie Fusseln in den Augen.
Es war der 21. September und kurz nach 3 Uhr nachts.
Für den Tag der Abreise – D. war mit den Kindern schon vorausgefahren – hatte ich mir Regen gewünscht, einen grauen regnerischen Himmel. Aber die Sonne schien, und es war für Ende September ungewöhnlich warm.
Beim Einbiegen in die Paradiesstraße sah ich nochmals zurück zum Englischen Garten, in dem sich Spaziergänger, Radfahrer und Köter drängten. An warmen Tagen schob sich das in Massen zum Chinesischen Turm. Über den Tischen und Bänken lag eine Staubwolke und der Gestank von Pisse, Bier und Gebratenem.
Auf der Autobahn, am Inntal-Dreieck, ein Stau. Im Radio sang eine Frauenstimme: The bloody rose. Ein Polizist stand auf der Fahrbahn und winkte die Autos an einem zusammengedrückten Ford vorbei. Zwischen Glasscherben und Sägemehl lag ein Plüschteddy. Am Straßenrand standen zwei längliche Blechwannen mit Stielgriffen.
Der pickelige Zöllner ging um den mit Wäsche, Töpfen, Lampen, Bettzeug vollgeladenen Wagen. Er zeigte auf die mit Kleidungsstücken vollgestopften Plastiksäcke: Cosa è questo? Le mie camicie.
Er lachte und winkte mich durch.
Hinter dem Brenner begann es zu nieseln. Kaum in Italien, hatte ich die quietschenden Scheibenwischer und diese schwarz glänzende Straße vor mir, auf der sich die Scheinwerfer der entgegenkommenden Autos spiegelten. Dicht an dicht kam der deutsche Mittelstand in seinem Daimler und BMW und schleppte seine Segelboote und Surfbretter vom Lago Maggiore zum Überwintern nach Hause. In den Süden fuhren jetzt, Samstagnacht, nur wenige Autos.
Wer da alles runtergezogen war: Henze und Neckermann, Thomas und Heinrich Mann, stigmatisierte Metzgermeister und württembergische Hofmaler, all die Heinrichs, Ottos und Karls, und natürlich die Ost- und Westgoten, die Cimbern und Teutonen, über die Alpen, den Stiefel runter, Richtung Rom.
Kurz vor Bozen hatte es aufgehört zu regnen.
Ein kleiner kropfiger Hoteldiener trug mir den Koffer. Er betonte, dass ich den Wagen ruhig auf der Straße stehen lassen könne, hier werde nichts geklaut, hier habe alles noch seine Ordnung.
Später, nach dem Abendessen, ging ich in die Altstadt, durch die viele Freizeitjacken spazierten, ältere deutsche Ehepaare. Kam in eine Nebengasse, den Bozener Kiez, drei Bars, alle leer, vor einem Eingang eine magere Frau, die mir schon von Weitem zuwinkte, als habe sie dort seit Stunden auf mich gewartet. Sie redete in einem rheinländischen Dialekt auf mich ein, wollte etwas trinken, ich sagte: Qu’est-ce que vous voulez?
Da wechselte sie ins Französische und sprach es weit besser als ich, hakte sich ein, ging nebenher. Erzählte mir von dieser Scheißstadt, den Scheißleuten, versprach eine einmalige Nummer.
Je suis fatigué.
Ich mach dich munter!
In meiner Hilflosigkeit wechselte ich abermals die Nationalität, sagte: I am married.
Da blieb sie stehen. Merde, sagte sie, lachte dann aber: How sweet und lovely dost thou make the shame. Good night, poor little boy.
Archäologie der Wünsche
Nachmittags auf dem Raccordo anulare: ein Stau, der sich mit 130 Stundenkilometern vorwärtsbewegte. Die Hände am Lenkrad verschweißt, raste ich, nach der Ausfahrt Ausschau haltend, auf der mittleren Fahrbahn, hinter mir, Stoßstange an Stoßstange, ein Blitzen, Hupen, wenn ich auch nur etwas Gas wegnahm, von rechts und links überholende, vorn einscherende Autos, die sofort die entstandene Lücke wieder füllten. Ich verfehlte die erste Ausfahrt, wurde unfreiwillig in die zweite hineingeschoben, die sich als richtig erwies, kam auf die Nomentana, die durch eine rötliche Ebene führt, links und rechts Pinien, und in der Ferne in einem braunen, ja goldenen Licht: Rom. Die Farben auf den Postkarten hatten nicht übertrieben.
Dann die ersten Häuser, Neubauten, die Fassaden braun verkachelt, sieben-, achtstöckig. Und wieder bildete sich ein Stau, der diesmal zum Stehen kam. Am Straßenrand das Verkaufsgelände eines Keramikgroßhandels. Dort standen Blumentöpfe in allen Größen und Farben, Statuen aus einem Marmor imitierenden weißen Material, verkleinerte Repliken antiker Skulpturen, die – anders als bei uns die Gartenzwerge, die eine putzige Erinnerung an die Wildnis sind – die klassische Kultur in den Vorgarten bringen sollen.
Kniehoch: Laokoon mit seinen Söhnen in den Kampf mit der Schlange verwickelt, der Apoll von Belvedere in halber Lebensgröße, die kapitolinische Wölfin, variierend von der Größe eines Rehpinschers bis zu der eines ausgewachsenen Wolfs, dann die verbissene Gruppe, die Unauflösbaren: zwei Ringer. Der eine, ein bärtiger, muskulöser Mann, hat seinen Gegner, einen jüngeren Mann, gepackt und in einer Drehung hochgehoben, um ihn mit einem einzigen kraftvollen Schwung, kopfüber, zu Boden zu schleudern, wenn der nicht seinen Hodensack ergriffen hätte und umklammert hielte. So kann der eine wie der andere nicht loslassen, und sie stehen buchstäblich versteinert da.
Nahm mir vor, diese Statue zu kaufen und Heinar Kipphardt für seinen Garten zu schenken, als allegorische Darstellung des Realismus. Man kann sich aussuchen, welcher Ringer die Wirklichkeit und welcher die Literatur darstellt. Kastration oder weiche Birne, das jedenfalls wäre die Folge, würde diese Verschlingung aufgelöst.
Die Via Gradisca, eine schmale Einbahnstraße. Hinter vergitterten Vorgärten zwei- und dreistöckige Häuser aus der Jahrhundertwende. Das Haus Nr. 13: ockerfarben, der Putz fällt von den Fassaden, schiefe Holzjalousien, vor der Haustür ein Haufen Spaghetti, matschig, rotbraun, zwei räudige Katzen fressen davon. Der Geruch nach Katzenpisse. Im Garten eine Fächerpalme, die Farben leuchten im letzten Licht, das Dach, die Gesimse, die Fensterläden, alle Dinge treten aus sich heraus, scharf umrissen, als wollten sie sich nochmals ihrer selbst vergewissern, bevor sie ins Ungefähre, Dunkle fallen. Die Kinder kommen und wollen mir als Erstes den Brunnen zeigen, einen Brunnen direkt am Haus, ein marmorner Löwenkopf, abgestoßen die Schnauze, die Ohren, aus dem Maul fließt Wasser in ein Betonbecken. Ich muss die Arme hineinstecken, ein eiskalter Schock, dann muss ich ihnen die Arme zeigen. Sie streichen mir gegen den Strich über die Armhaare, die sich aufgestellt haben, ein kitzelndes, durchdringendes Schaudern. Das sei Gruseln, behaupten sie und wollen sich ausschütten vor Lachen. D. kommt in ihrem weiten, ehemals schwarzen, von der Sonne ausgebleichten Kleid.
Liegen nachts im Bett ohne Decke, nackt. In München laufen sie jetzt in Mänteln durch die Straßen. Aus dem Garten steigt ein Duft, schwer und süß wie ein Parfum, der Duft von einem blühenden Busch, dessen Namen wir nicht kennen. Das Kreischen der Katzen, Fernsehlärm, jemand singt, Stimmen, Gelächter, von fern der Verkehrslärm, nahe das Schlürfen des Ablaufs am Brunnen, hin und wieder das Aufheulen einer Sirene von einem geparkten Auto.
Vor dem Fenster steht ein Orangenbaum. Im dunkelgrünen Laub leuchten gelb die Früchte. Niemand macht sich die Mühe, sie zu pflücken. Sie fallen auf das Garagendach, auf dem die Katzen dösen.
Die Archäologie der Wünsche. Saß 1946, im Winter, in der Küche, dem einzig beheizbaren Raum in der Wohnung, die wir mit zwei anderen Mietern teilen mussten, und übte schreiben. Die Mutter wusch ab. Fräulein Scholle pütscherte am Herd herum. Da kam der Vater in die Küche, verbarg etwas hinter dem Rücken. Mit einer schnellen Bewegung legte er eine Frucht auf mein Heft, eine nie gesehene Frucht, von der ein nie gerochener Duft ausging, die Schale porig und doch glatt, lag sie mir in der Hand, und nach einem kurzen Zögern biss ich in die Frucht. Eine die Zunge überziehende Bitterkeit. Die Erwachsenen lachten. Fräulein Scholle nahm die Frucht, schnitt sie auf, klappte die Scheiben auseinander, und die Orange lag da wie eine Blüte, eine Seerose, deren Inneres so schmeckte, wie die Schale leuchtete.
Das Haus, zweistöckig, ist Ende des letzten Jahrhunderts erbaut worden und ähnelt im Kleinen dem, was Mussolini später am Corso Trieste monumental hinklotzen ließ: eine antikisierende Architektur. Die Zimmer vier Meter hoch, der Fußboden gekachelt, schwarz-weiß, von stilisierten Weinblättern umrandet. An den Decken, von beängstigender Größe, schwere Stuckrosetten. Eingerichtet hat die Wohnung Frau Bassi vor siebzig Jahren: Kristalllüster, marmorierte Lampenschalen in der Größe von Regenschirmen, klotzige Vertikos, Mahagonischränke in einem Jugendstil, der sich durch Monumentalität auszeichnet. Tapeten, exotische Ornamente. Auf einer Anrichte schreitet eine nackte Bronzefrau aus, den Arm hochgestreckt, als wolle sie zu den Sternen greifen, ein starker Gegenwind drückt ihr ein Bronzetuch auf die Brüste und zwischen die Schenkel.
Dem Haus gegenüber liegt ein kleines Karmeliterinnenkloster mit einer Mädchenschule. Stündlich bimmeln die Glocken – anhaltend lange, zur Vesper. Morgens geht die Äbtissin auf der Veranda auf und ab und liest im Brevier. Die Mädchen sitzen in Hollywoodschaukeln. Ein ständiges Gegacker und Gekicher. Später die Stimme einer Nonne, die einen englischen Text vorliest, aber wie gesungen und kaum verständlich. Die Mädchen sitzen über die Tische gebeugt und schreiben. Vermutlich ein Diktat. Einmal schaut ein Mädchen auf und blickt herüber, wie ertappt beugt es sich schnell wieder über das Heft. Im Garten jätet eine Schwester Unkraut. Ein massiver schwarzberockter Hintern.
Der Salon ist vollgestellt mit Vertikos, Schränken und verschnörkelten Lehnstühlen. Von diesem Zimmer blickt man auf einen massiven Rundbau. Das Ocker der Fassade hat der Regen in langen Streifen vom grauen Beton abgewaschen. Es ist das staatliche Heim für die Kriegsblinden. Im Hof steht ein kleiner Kuppelbau, in den Arm- und Beinprothesen hinein- und hinausgetragen werden. Dort ist eine Werkstatt, in der die Blinden Prothesen herstellen und reparieren.
Nach vorn schiebt sich eine hochgemauerte halbrunde Terrasse wie eine Bastion auf die Straße, die sich an dieser Stelle zu einem kleinen Platz weitet. Morgens und am späten Nachmittag marschieren auf der Terrasse vier ältere Männer im Gleichschritt nebeneinander an der Balustrade entlang, von Hausmauer zu Hausmauer, gute 70 Meter. Wenige Zentimeter vor der Hausmauer bleiben sie stehen, machen eine militärische Kehrtwendung und marschieren den Halbkreis wieder zurück, bis zur gegenüberliegenden Mauer. Kehrtwendung. Rückmarsch. Hin und her. Wahrscheinlich marschieren sie dort schon seit Kriegsende. Sie tragen dunkle Brillen, haben sich untergehakt, werfen die Beine und brüllen sich an. Einem fehlen beide Hände. Wahrscheinlich ist der eine oder andere taub, vielleicht sind es auch alle vier.
Träumte von meinem Bruder, der – meine einzige Erinnerung an ihn – sich hinter einem Besenschrank versteckt hält. Er will mich, seinen kleinen Bruder, überraschen. Aber ich sehe seinen Kopf, sein blondes Haar. Er war damals, wie man mir später erzählte, auf der Durchreise von Frankreich nach Russland, wohin seine Division verlegt worden war. Einige Monate später schrieb er meinem Vater aus Charkow einen Brief: Mein lieber Papi! Leider bin ich am 19. schwer verwundet worden. Ich bekam einen Panzerbüchsenschuß durch beide Beine, die sie mir nun abgenommen haben. Das rechte Bein haben sie unterm Knie abgenommen und das linke wurde am Oberschenkel abgenommen. Sehr große Schmerzen hab ich nicht mehr.
Das steht da in einer durch das Morphium verzerrten Schrift.
Tröste die Mutti, es geht alles vorbei.
Damals war er 19 Jahre alt.
Er war an einem Abend im Winter 1942 losgegangen, zu dem Meldebüro der SS-Kasernen in Ochsenzoll. Es war schon dunkel, und er hatte sich aus dem Villenvorort hinaus ins offene Land verlaufen. Es war eine mondhelle Nacht, und dennoch konnte er weder einen Wegweiser noch sonst ein Zeichen finden, das ihn hätte zur Kaserne führen können. Schließlich sah er auf der Landstraße einen Mann stehen. Der Mann stand da und blickte über die Felder, in deren Ackerfurchen feine Streifen Schnee lagen. Er sprach den Mann an und fragte nach den Kasernen. Der Mann aber starrte in den aufgehenden Mond und sagte: Der Mond lacht. Und als mein Bruder nochmals nachfragte, sagte der Mann, er solle ihm folgen. Der Mann ging voran, schnell, fast lief er, ohne sich umzudrehen, ohne Rast gingen sie durch die Nacht. Sie gingen an dunklen Bauernhäusern vorbei. Das heisere Muhen der Kühe aus den Ställen, das splitternde Eis in den Radspuren. Mein Bruder fragte, ob sie denn auf dem richtigen Weg seien. Da drehte sich der Mann um und sagte: Ja, wir gehen zum Mond, da, der Mond lacht, er lacht, weil die Toten so steif liegen.
Zu Hause erzählte mein Bruder, wie er sich einen Moment gegraust habe, und dass er später, als er sich zum Bahnhof durchgefragt hatte, zwei Polizisten traf, die nach einem Verrückten suchten, der aus der Alsterdorfer Anstalt ausgebrochen war.
Am nächsten Tag war mein Bruder abermals losgefahren, hatte das Musterungsbüro gefunden, wurde auch sofort genommen: 1,85 m groß, blond, blauäugig.
Meine Mutter verwahrt die kleine Pappschachtel, die ihr später aus dem Lazarett zugeschickt worden war: sein Tagebuch, seine Orden, ein paar Briefe von meiner Mutter und meinem Vater, zwei Fotografien, die eine zeigt einen unbekannten Kameraden, die andere den Vater, unten in der Schachtel liegen ein kleiner schwarzer Taschenkamm und eine Tube Zahnpasta. In ihrer verdrückten Aluminiumhülle ist sie zu Stein geworden.
Erste Einblicke
Morgens im Deutschen Archäologischen Institut. Dorthin hat uns Herr Milite bestellt. Er ist der Neffe von Frau Bassi, der Besitzerin der Wohnung, die, 92 Jahre alt, vor Jahren zu ihrer Familie aufs Dorf gezogen ist. Herr Milite tritt als Vermieter der Wohnung auf. Ein alter Mann mit einem misstrauischen Zug im Gesicht. Er war beim militärischen Geheimdienst und ist seit zehn Jahren pensioniert. Er hat Arthrose in den Hüftgelenken, geht am Stock und ist ein Opfer seines Berufs. Das Mietgeld wollte er nicht in der Wohnung, sondern, wie auf einem konspirativen Treff, im Deutschen Archäologischen Institut entgegennehmen. Wahrscheinlich will er eine Zeugin haben, eine deutsche Sekretärin, die uns die Wohnung vermittelt hat und immer wieder betont, Herr Milite sei einer der ehrlichsten Männer, die sie kenne. Der Ehrenmann scheint aber auch noch seine Familie zu betrügen, denn als er sich nach langem Gerede bereit erklärt, eine Quittung zu geben für die deutsche Steuerbehörde, schreibt er einen geringeren Betrag auf. Weigert sich auch, den Betrag als Mietgeld auszuweisen, weil damit das Mietverhältnis anerkannt wäre. Denn es ist, seit die Kommunisten die stärkste Partei im Stadtrat sind und den Bürgermeister stellen, ein neuer Mieterschutz eingeführt worden. Kündigungen und Mieterhöhungen sind nur schwer oder gar nicht durchsetzbar. Die Wohnung hatte er an Dagmar vermietet, die vorausgefahren war. Ein alter geiler Bock, der Dagmar, obwohl sie schwanger ist, mit Leckaugen ansieht. Von mir verlangt er, dass ich mich bei dem zuständigen Kommissariat anmelden müsse. Sofort. Die Roten Brigaden, die sich überall einnisten, überall wühlen, entführen, überfallen, morden. Neulich war ein Mitglied der Roten Brigaden verhaftet worden. Der Mann hatte zur Tarnung eine hübsche junge Ehefrau, zwei nette Kinder. Die Fotos konnte man in der Zeitung sehen. Herr Milite sieht mich misstrauisch an. Dann geht er weg, auf den Stock gestützt.
Die Kinder wurden frühmorgens mit einem Bus zum deutschen Kindergarten gebracht, der weit draußen, an der Via Aurelia liegt.
Ich fuhr mit dem 36er zum Bahnhof Termini, dessen Eingangshalle sich einem wie eine Brandungswelle entgegenwirft. Ich wollte einen Scheck einwechseln. Vor dem Bankschalter stand eine Schlange Touristen bis weit in die Ankunftshalle hinein. Die Einlösung eines Euroschecks ist wahrscheinlich sogar in Burundi einfacher als hier in Rom. Nach zwei Stunden Warten schloss der Bankangestellte plötzlich den Schalter, dafür wurde ein anderer geöffnet. Alle stürzten dahin, eine drängende, stoßende Menschenmenge, die sich unter den beruhigenden Zurufen eines Engländers langsam in die Länge zog und eine neue Schlange bildete. Ich kam wieder ans Ende zu stehen, da gab ich auf und ging hinaus. Eine niederdrückende Hitze, ein milchiger Dunst.
Vor dem Bahnhof, auf der Piazza dei Cinquecento, verkaufen fliegende Händler Uhren, Transistorgeräte, Schuhe, tunesische Lederpuffs, gepunzte marokkanische Taschen. Daneben ein Stand mit alten abgegrabbelten Zeitschriften: Playboy, Penthouse, Lui, in verschiedenen Sprachen und Ausgaben, in denen ein paar Nordafrikaner blätterten. Auffallend, wie die Nationalitäten die Nacktheit anders präsentieren, mit einer anderen optischen Beschreibung der zur Schau gestellten Körper, mal betatschend, mal kühl distanziert: Für die amerikanischen Ausgaben von Penthouse und Playboy werden die Mädchen »scharf« fotografiert, ähnlich auch die deutschen Ausgaben, eine sterile, makellose Nacktheit von der technischen Kühle einer Sportwagenkarosserie. Die französischen Fotografen arbeiten mit Weichzeichnern. Die italienischen Magazine zeigen die Frauen noch mit Resten des Alltäglichen, der gewöhnlichen Normalität, nicht retuschierte Muttermale, Falten, eine kleine Laufmasche am Strumpf, auch scheinen viele der dargestellten Mädchen spontan zu lächeln. Aber vielleicht ist auch das nicht zufällig, sondern noch raffinierter inszeniert, weil diese Pornographie in ihrer Alltäglichkeit leichter »begreifbar« ist.
Die Luft ist wie Schleim. Der Himmel hat sich bezogen, grau, mit orangen Schlieren, vom Süden ziehen schwarze Wolken auf, auch von Nordwesten schiebt sich eine Wolkenbank hoch.
Gehe in das dem Bahnhof gegenüberliegende Thermenmuseum, laufe in einer inneren Unruhe, mit einer flusigen Wahrnehmung durch den mit antiken Plastiken, Sarkophagen und Kapitellen vollgestellten Kreuzgang. Am Boden liegen wie amputiert Marmorfüße, Arme, Hände.
Meine Beine sind wie mit Blei ausgegossen. Ich setze mich in den Kreuzgang des ehemaligen Kartäuserklosters und beobachte die beiden aufeinander zutreibenden, blauschwarzen Wolkenbänke am Himmel, bis der erste Blitz aufzuckt, eine Sturmböe durch die drei mächtigen Palmen fährt, ein ferner Donnerschlag, Blitze, ganz nahe, mehrere heftige Donnerschläge, mit einer Wucht, die sich als Druck auf die Brust legt. Der Himmel reißt auf, Wasser stürzt heraus. Ein paar Touristen haben sich mit mir in die Ecke des Kreuzganges geflüchtet. Zwei Japanerinnen klammern sich aneinander, ihr Haar knistert, sträubt sich, sie stehen da in ihren ärmellosen weißen Blusen, frieren und starren in den tobenden Himmel.
Doomsday, sagt ein Ami und putzt sich die Nickelbrille. Plötzlich versteht man, warum die antiken Chroniken voll von diesen Katastrophenmeldungen sind, all die dramatischen Blitzschläge, Brände, Kugelblitze, die Paläste verwüsten, die Statuen zertrümmern, Kupferdächer glühen lassen, wie auch jener Blitz, der in die kapitolinische Wölfin einschlägt, ihr den Hinterlauf und Romulus und Remus unter den Zitzen wegschmilzt. Es riecht nach feuchter Erde, und hin und wieder drückt ein Windstoß eine feine Regengischt in den Kreuzgang.
Eine halbe Stunde später: Ein kühler blauer Himmel, das Grün der Bäume und Büsche leuchtet, und die Autodächer auf der Piazza della Repubblica glänzen in der Sonne.